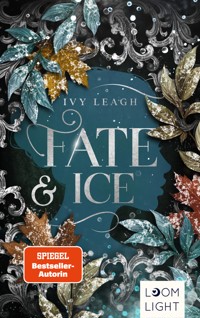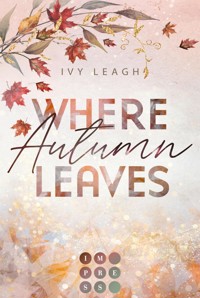6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Ein einziger Herzschlag verändert das Schicksal für immer**
Emmas neuer Mitschüler ist schlimmer als jedes Klischee ihrer heiß geliebten Fantasyromane: Marc sieht unverschämt gut aus, seine Aura strotzt nur so vor Geheimnissen und seinem Charme kann niemand widerstehen, auch Emma nicht. Genau aus diesem Grund hat sie so gar keine Lust auf ihn und das ganze Drama, das sein Auftauchen mit sich bringt – bis plötzlich am helllichten Tag Nordlichter gesichtet werden und Emma sich fragen muss, ob Marc tiefer mit einer alten Legende verbunden ist, als ihr lieb ist …
Mit dem gefühlvollen wie mitreißenden Auftakt ihrer Romantasy-Dilogie »Die Nordlicht-Saga« enführt Debütautorin Ivy Leagh in eine Welt voller Bücherliebe und alter Mythen vor der beeindruckenden Naturkulisse der White Mountains in den USA. Sie zählt mit über 10.000 Followern ihres Instagram-Accounts @ivyleagh.books zu den erfolgreichsten Buchbloggerinnen Deutschlands.
Das sagt SPIEGEL-Bestsellerautorin Beril Kehribar über »Fate and Fire«:
»Ein atmosphärisches Setting, ein heißer Book-Boyfriend und eine kleine Prise Humor: Ivy Leagh hat hier ein absolutes Lese-Highlight mit Suchtpotenzial geschaffen!«
//Dies ist der erste Band der Reihe »Die Nordlicht-Saga«. Alle Romane der magisch-romantischen Liebesgeschichte im Loomlight-Verlag:
-- Band 1: Fate and Fire
-- Band 2: Fate and Ice (Herbst 2022)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Emma ist ein leidenschaftlicher Bücherwurm und träumt davon, den Outdoor-Laden ihres Vaters nach dem Schulabschluss um ein Büchercafé zu erweitern. Als dieser allerdings vor der Pleite steht und obendrein ein neuer Mitschüler auftaucht, wird Emmas Gefühlswelt schlimmer durcheinandergewirbelt als die bunten Blätter im Herbst. Denn Marc versprüht eine Aura, der scheinbar niemand entfliehen kann, auch Emma nicht – obwohl sein sonderbares Verhalten sie viel zu sehr an die unfassbar gut aussehenden, aber nun mal unerträglich launischen Wesen ihrer geliebten Fantasy-Romane erinnert. Ein Spiel, das Emma nicht bereit ist, mitzuspielen. Bis plötzlich am helllichten Tag Nordlichter gesichtet werden und Emma sich fragen muss, ob genau der Junge, dem sie sich einfach nicht entziehen kann, tiefer mit einer alten Legende verbunden ist, als ihr lieb ist ...
Die Autorin
© privat
Ivy Leagh, geboren 1992, braucht bloß drei Dinge: Reisen, Koffein und das Schreiben. Nachdem sie eine Weile als freie Journalistin in Berlin und London kostenlos Konzerte besuchen und Stars interviewen durfte, verbringt sie mittlerweile ihre freie Zeit neben dem Literaturstudium lieber damit, an ihren Geschichten zu feilen. Ihrer Liebe zu Großstädten gibt sie inzwischen nur noch während ihrer Reisen nach; sie lebt wieder in ihrer Heimatstadt Würzburg.
Ivy Leagh auf Instagram: https://www.instagram.com/ivyleagh.books/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer*in erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen auf: www.loomlight-books.de
Loomlight auf Instagram: https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Ivy Leagh
Die Nordlicht-SagaFate and Fire
Für Mama: Weil du mir immer zeigst, woher ich komme, und nie verbietest, zu träumen.
Für Oma Betty: Weil du es zwar nie erfahren wirst, aber ich dir diese Träume widme.
Für Papa: Wegen dem ich in Fußballstadien gröle und Bücher liebe.
Und für alle Bücherwürmer: Ohne euch würde ich immer noch denken, dass die Kombination in Punkt 3 unmöglich ist.
Gibt’s dich auch in weniger Schicksal?
Marc
Neben mir kauert Tay in Angriffshaltung. Sein hochkonzentrierter Blick verlangt heftig nach dem, was unser aller Ziel ist. Ein winziger Moment wird es sein, der das Schicksal des Mädchens besiegelt.
Tays Muskeln spannen sich zum Sprung.
Drei Sekunden sind vergangen, seit das Mädchen aus dem Flughafengebäude gestolpert ist. Sie ist noch immer in Bewegung, als Tay aufhört zu atmen. Unsicher schaut sie sich um, Tay lächelt und tritt ohne Eile einen Schritt auf sie zu.
Es ist so weit.
Ihr Blick trifft meinen.
»Jetzt«, knurrt Tay.
Nicht sie, denke ich.
Britisches Mistwetter zu vermissen, macht die Sache echt kritisch
Mit heruntergelassenen Scheiben stehen wir am Flughafen in Boston. Ich denke an die unbezahlte Krankenhausrechnung auf dem Küchentisch und unseren kleinen Outdoor-Laden Smith Pro Shop inmitten des White-Mountains-Nationalparks, meinem Zuhause. Dann atme ich tief durch. Wenn ich Dads kryptische Andeutungen richtig interpretiere, steht meine Rückkehr nach Lincoln unter keinem guten Stern. Und der Laden noch weniger.
Das letzte Jahr war wie in einem schrecklichen Albtraum, in dem man rennt und rennt, bis irgendwann die Luft knapp wird und ein dicker Kloß im Hals anschwillt, der die Lunge zu zerbersten droht. Doch egal, wie ich es anstellte, die Dinge wurden schlimmer und ich lief immer langsamer, bis ich nur noch auf der Stelle trat. Meine Träume begrub ich unter der schrecklichen Sorge um meinen Vater und ich hatte panische Angst, den Laden – unsere Existenz und Zukunft – zu verlieren. Aber aufgeben kam nicht infrage. Ich kämpfte, um das Wertvollste in meinem Leben zu retten. Mit Erfolg.
Doch vorhin hat sich irgendetwas in Dads Stimme einmal mehr nach Veränderung angehört. Keine wirklich rosige Vorstellung; jetzt, wo gerade alles endlich wieder besser ist.
»Bist du sicher, dass du fahren kannst?« Dads Blick wandert unsicher vom Knopf des Radios unseres uralten Pick-ups zu mir. Gerade ist er noch willkürlich die Sender durchgegangen, bis er einen gefunden hat, der das Spiel der Pats überträgt. Dad ist ein richtiger Football-Freak. Trotzdem ruhen seine dunkelgrünen Augen jetzt auf meinen Händen, die das zerschlissene Lenkrad viel zu fest umklammern.
»Besser als du auf jeden Fall!«, ärgere ich ihn grinsend, schlucke meine Sorgen fürs Erste hinunter, schnalle mich an, drehe den Schlüssel im Zündschloss und warte, bis der Motor anspringt. Der Lärmpegel, den der Wagen schon im Leerlauf erzeugt, lässt die umstehenden Menschen irritiert aufblicken. Aber das rostige Ding ist nun mal das einzige Auto, das wir uns leisten können und das diese Bezeichnung zumindest annähernd verdient. Zerknirscht kurble ich das Fenster hoch, ignoriere die Leute dabei genauso konsequent wie das Lachen meines Vaters.
»Ich hatte kaum Probleme, Ems.« Er zuckt mit den Achseln. »Nicht einmal die Arme sind müde.« Demonstrativ lockert er die Schultern; ich glaube ihm kein Wort.
»Wieso hat Tom dich denn nicht gefahren?« Vorsichtig parke ich rückwärts aus und versuche nicht allzu angestrengt darüber nachzudenken, was in den zwei Stunden Fahrt von Lincoln hierher hätte alles passieren können. Dad hat sich von seinem kleinen Herzinfarkt im letzten Sommer gut erholt. Doch seit er den Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat, wird er zu oft übermütig. Im Leben würde ich ihn gerade nicht ans Steuer lassen. Daran ändert auch der lange Flug aus England zurück nach Hause nichts.
»Tom ist beim Polizeichef«, beginnt Dad zögernd, kaum habe ich es aus der Parklücke rausgeschafft. »Ich dachte, er hätte es dir gesagt.«
Hat er nicht. Sofort schaue ich zu Dad. Ich kenne diese Tonlage. Kenne sie zu gut, weil das, was jetzt folgt, schon viel zu oft passiert ist. Und erklärt, weshalb Tom nicht mit zum Flughafen gekommen ist, um mich abzuholen. Was er – bis auf eine bestimmte Ausnahme – nie versäumen würde. Außer ... »Es geht um Leah.« Seine Schwester. Dad räuspert sich leise.
Ich schlucke und stoppe gerade noch so hinter einem pechschwarzen Sportwagen, der elegant vor mir in die Spur geglitten ist und jetzt die einzig mögliche Ausfahrt blockiert. Genervt lasse ich den Motor aufheulen.
Ist das sein Ernst?
»Steckt sie schon wieder in Schwierigkeiten?«, frage ich das Offensichtliche, weil Dad nicht sofort weiterspricht.
Tom ist wie ein Bruder für mich, mein bester Freund aus Kindertagen. Im Gegensatz zu ihm, der den plötzlichen Unfalltod seiner Eltern vor einigen Jahren überwunden hat, macht seine Schwester seitdem nur Probleme. Solange beide nicht volljährig gewesen sind, hat sich ihr Onkel eher widerwillig um die Geschwister gekümmert. Da war es etwas besser. Mittlerweile leben Tom und Leah alleine im Haus ihrer Eltern, und Leah hat komplett den Boden unter den Füßen verloren. Tom ist unser einziger Mitarbeiter im Outdoor-Laden und fühlt sich für seine jüngere Schwester verantwortlich, Leah hat die Schule geschmissen und ›Verantwortung‹ komplett aus ihrem Wortschatz gestrichen.
Dad dreht das Radio leiser. »Leah ist von einem Ausflug zu den Franconia Falls nicht zurückgekehrt.« Er ist nervös, schon seit er mich vor dem Flughafengebäude ungelenk in seine Arme geschlossen hat. Kein gutes Omen. Manchmal ist Dad vielleicht etwas unbeholfen, ziemlich oft schnell verlegen, aber Angst hat er selten.
»Wann ist sie denn losgegangen?« Ich bemühe mich um einen lockeren Tonfall, während ich so nah an die Stoßstange der Protzkarre vor uns heranrolle, dass nur ein kleiner Stupser ausreicht und der Glanzlack hätte eine ordentliche Delle. Ernsthaft, auf was wartet der? Irritiert schaue ich nach rechts, dann nach links. Nichts. Er blockiert einfach die Ausfahrt. »War sie alleine unterwegs? Hat sie irgendjemand gesehen?« Es sind die üblichen Fragen.
»Vorgestern«, antwortet Dad ruhig. »Zwei Wanderer haben sie zuletzt in der Nähe unseres Ladens in Begleitung von zwei Männern beobachtet.« Und das nicht die übliche Antwort.
»Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie ein paar Tage untertaucht«, sage ich schnell, doch gegen das dunkle Gefühl, das sich in mir ausbreitet, helfen keine Beschwichtigungen. »Leah lässt sich nichts vorschreiben. Wie geht’s Tom damit?« Meine Frage hallt im Wageninneren nach, während mein Blick wie von selbst zurück zum verführerischen Metall vor uns wandert. Bedrohlich schwebt mein Fuß über dem Gas.
»Wie gesagt, er ist seit heute Morgen beim Chief«, sagt Dad nach einer halben Ewigkeit. Keine Antwort auf meine Frage. Sofort werde ich hellhörig.
»Das ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Das heißt, dass es Neuigkeiten gibt.« Gute oder ...
Wie wild beginnt Dad plötzlich damit, seinen Zeigefinger in einem mir unbekannten Takt auf das Armaturenbrett zu schlagen.
Schlechte.
Es dauert einen unbehaglich langen Moment, bis er weiterspricht. »Die Wanderer wollen einen Schrei gehört haben. Unweit der Stelle, von der aus Leah kurz davor mit den Männern in den Wald aufgebrochen ist. Sie sind wohl sofort hinterher; allerdings konnten sie nichts Auffälliges entdecken. Der Chief hat natürlich Untersuchungen eingeleitet, um zu schauen, ob es ...«
»Einen Zusammenhang gibt«, beende ich den Satz, nicke mechanisch, obwohl Dads Worte bloß zäh zu mir durchdringen und das dunkle Gefühl in mir zum Brodeln bringen. Mir wird speiübel. »Ob diese Männer Leah etwas angetan haben.«
»Es muss ja nichts miteinander zu tun haben«, beschwichtigt Dad unbeholfen. »Die Ranger durchforsten bereits großräumig das Waldstück; einige Jäger lassen sich nicht abhalten, sie dabei zu unterstützen. Bisher ohne Erfolg.« Seufzend greift er sich in den Nacken. »Der Chief hat eindringlich davor gewarnt, auf eigene Faust in die Wälder zu gehen.« Dad schluckt, dann schüttelt er den Kopf. »Du kennst doch die Unerfahrenheit einiger Wanderer. Wahrscheinlich haben sie irgendein Tier schreien hören.« Was eine Aufmunterung sein soll, klingt trotzdem mutlos.
Ich halte die Luft an und will sie nie wieder ausatmen. »Ein Tier?«, flüstere ich und schlucke den Rest der aufgestauten Luft hinunter. Die meisten der Wandertouristen in den White Mountains sind ziemlich planlos, da hat Dad recht, aber einen menschlichen Schrei von dem eines Tiers zu unterscheiden ... das ist keine besonders große Herausforderung.
Hinter uns hupt jemand.
Blitzartig reiße ich die Hände vom Lenkrad, spüre das Kribbeln im Mittelfinger, recke sie dann aber doch nur beschwichtigend in die Höhe. Realisiere erst jetzt, dass ich nach wie vor auf dem Flughafenparkplatz in Boston darauf warte, dass die Arroganz auf vier Rädern vor mir sich ein Stück bewegt.
Dad räuspert sich leise und lenkt damit meine Aufmerksamkeit erneut auf unser Gespräch. Den Sportwagen scheint er gar nicht wahrzunehmen.
»Lass uns erst einmal nach Hause fahren. Wir wissen ja gar nicht, weshalb der Chief Tom zur Wache gebeten hat. Womöglich ist Leah längst wieder aufgetaucht.«
Er blinzelt angestrengt, einmal, zweimal, dreht dann das Radio lauter. Wütend schalte ich das Ding aus. Dann warten wir stillschweigend, und gerade als selbst die Stille zu dröhnend wird und ich ernsthaft überlege, auszusteigen, um den Fahrer vor uns zurechtzuweisen, wirft Dad mir einen nervösen Seitenblick zu. Mein Vater kennt mich, er weiß, dass ich gerade dabei bin, einen einzigen Gedanken mit aller Kraft zu verdrängen: den Outdoor-Laden und meinen größten Wunsch, diesen nach dem Abschluss um ein kleines Büchercafé zu erweitern. Ohne meine Bücher wäre ich das vergangene Jahr über aufgeschmissen gewesen. Und Leahs Verschwinden, so nah an unserem Shop, bringt ihn und meinen Traum erneut in Gefahr.
Dad atmet tief durch, streicht dann seine braunblonden Haare zurück. »Ich weiß, worüber du nachdenkst, Ems. Es wird dir jetzt nicht gefallen, aber ich überlege, den Shop fürs Erste zu schließen.« Als er meinen Blick sieht, redet er sofort weiter. »Wenn ein Mädchen in deinem Alter mit zwei Typen spurlos verschwindet, dann will ich nicht, dass du allein in unserem Laden stehst.«
Der Laden. Jetzt hat er es ausgesprochen. Wir haben eine gute Saison bitter nötig, um nicht nur laufende Kosten decken, sondern auch Dads Krankenhausrechnung bezahlen zu können. Alles andere ist keine Option. Ich weiß, dass er gerade nicht an erster Stelle steht, dass er eigentlich überhaupt an gar keiner Stelle stehen sollte. Nicht, wenn Leah wirklich ... Ich zwinge mich dazu, nicht darüber nachzudenken. An diesem Laden hängt mein Herz, meine ganze Zukunft. Ich kann nicht anders.
Beschämt sehe ich zu Dad. Ich muss einfach wissen, dass er mich nicht verurteilt. »Tut mir leid ... ich sollte nicht ...«
»Ist in Ordnung, Emma«, sagt er. »Du bist nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Aber wir müssen abwarten.« Damit beendet er das Gespräch, und als ich wieder nach vorne schaue, fallen mir zum ersten Mal im Rückspiegel des Autos vor uns die Augen des Fahrers auf. Sie sind direkt auf mich gerichtet, unangenehm frustriert, fast schon wütend – beobachtet der mich?
Ich möchte mich wegdrehen, wie ich es immer tue, wenn ich in eine unangenehme Situation gerate, meine chaotischen dunklen Locken wie einen schützenden Vorhang vor mein Gesicht werfen. Aber ich kann nicht. Irgendetwas an seinem Blick verwirrt mich. Als würde er für einen winzigen Moment in mein Beinah-Zuhause eindringen und Dad unsichtbar werden lassen. Mein Herz pocht, ich schlucke. Dad muss das Radio wieder angeschaltet haben, denn ganz weit weg höre ich, wie die Pats einen Touchdown erzielen.
Im selben Moment huscht der Blick des Typen zu seinem Beifahrer. Als hätte er jedes angespannte Wort zwischen Dad und mir mit angehört und als wäre unser Gespräch der einzige Grund des unnötigen Staus gewesen, redet er nun wild auf ihn ein, gestikuliert. Die Umrisse des Beifahrers liegen im Schatten, aber er scheint vor Zorn zu beben. Einen Augenblick glaube ich sogar, dass der Wagen mitwackelt. Keine Minute später brausen sie endlich lautlos davon. Und ich schüttle ungläubig den Kopf. Hab ich in dem ganzen Durcheinander verpasst, dass jemand eingestiegen ist?
»Ist frei«, bringt Dad meine Gedanken wieder in die Spur. Schiebt, nachdem ich nicht sofort antworte, hinterher: »Emma? Bist du sicher, dass ich nicht fahren soll? Geht’s dir gut?«
Nein, will ich antworten. Am besten, du setzt mich wieder in einen Flieger – zurück nach England. Dort gibt’s nur dunkle, explodierende Regenwolken, kein bodenloses Chaos.
Stattdessen: »Alles gut.«
Die ganze Heimfahrt über schweigt Dad – von den ein, zwei Kommentaren zu meinem unsicheren Fahrstil einmal abgesehen. Die Farbenpracht der Laubbäume, eine Wand aus buntem Graffiti, kann mich nicht von meinen Sorgen ablenken. Obwohl ich niemanden kenne, den Lincoln zu dieser Jahreszeit nicht umhaut. Jeder einzelne Baum sieht aus, als hätte ein ziemlich ungeschickter Künstler beim Malen immer wieder seinen Farbkasten fallen lassen, sodass sich Rot, Gelb, Orange und Lila geradewegs über die Baumkronen verteilt haben; bis das perfekt orchestrierte Durcheinander an Herbstfarben ein Bild ergeben hat, das wir hier in Neuengland den ›Indian Summer‹ nennen.
Erst als ich in die schmale, bekannte Seitenstraße biege, vorbei am alten Friedhof und zerbrochenen Ahornblättern auf dem Gehweg fahre, schafft Dad es, den Mund wieder zu öffnen. »Mach dir keine Sorgen«, sagt er merkwürdig tonlos. »Wir kriegen das alles hin, versprochen.«
Nur ein paar Worte. Die meinen Verstand völlig überfordern. Ich will nichts mehr hinkriegen müssen. Ich will, dass alles einfach gut ist.
Gegen meinen Willen sammeln sich Tränen in meinen Augenwinkeln, wütend schlucke ich sie hinunter. Ignoriere den Kloß, der erneut in meinem Hals anzuschwellen droht, und schweige die wenigen Meilen bis zu unserem Haus. Obwohl es gerade einmal Anfang September ist, bedecken einige bunte Blätter auch hier schon das dichte Gras in unserem Vorgarten.
Ich parke den Wagen und wir steigen aus. Noch während der Duft des Zuckerahorns zumindest ein paar der komplizierten Gedanken aus meinem Kopf vertreibt, hat Dad mein einziges Gepäckstück geschultert und geht mir voraus in Richtung Haustür. Ich folge ihm die knarzenden Holzstufen der Verandatreppe nach oben, schalte das Außenlicht an und schließe die Tür hinter mir, kaum habe ich unser kleines Haus betreten. Ich atme den Staub ein, der durch unsere Ankunft aufgewirbelt wird, und vermeide konsequent den Gedanken daran, dass während meiner zweimonatigen Abwesenheit scheinbar alles ins Chaos gestürzt ist. Und wie einsam Dad gewesen sein muss.
Im Gegensatz zu Mum kommt er mit der Trennung immer noch nicht gut klar, obwohl er seinen Schmerz die meiste Zeit über sorgfältig hinter einer Maske verbirgt. Leider hat die ein transparentes Sichtfenster – so wie Homer Simpson sie im Kernkraftwerk trägt.
»Na gut, Ems.« Dad legt meine Tasche ächzend auf der untersten Treppenstufe ab. »Willkommen daheim.« Lehnt sich anschließend gegen das dunkle Geländer. Nur sein Blick verrät ihn, der einmal zu viel zum Sofa wandert.
»Schon okay, Dad.« Ich greife nach meinem Rucksack, dann grinse ich. »Ich glaub, ich kenne den Weg zu meinem Zimmer noch ganz gut. Schau dir ruhig das Spiel zu Ende an. Ich spring schnell unter die Dusche und danach sofort ins Bett.« Demonstrativ gähne ich und Dad nickt zufrieden. Es gibt genug Informationen, die ich erst einmal verdauen muss. Und das geht am besten alleine, mit einem Buch und meiner liebsten britischen Cadbury-Schokolade, aus der mein halbes Handgepäck besteht.
Dad ist schon ein paar Schritte bis ins Wohnzimmer gelaufen, als er sich abermals umdreht. »Bis Morgen, Schatz. Und ...«, verlegen schaut er auf seine dunkelgrauen Socken, die mit den Löchern, »schön, dass du wieder da bist.«
»Ich bin auch froh, Dad.« Meine Augen brennen verräterisch.
»Fahren wir morgen in den Laden?« Dads Kopf hebt sich, ein Lächeln breitet sich über seine angespannten Gesichtszüge aus. »Ich hab die Wanderstiefel sicher ganz falsch angeordnet. Von den Leichtrucksäcken fangen wir gar nicht erst an.«
»Nichts lieber als das.« Und das erste Mal, seit ich vor zwei Monaten in den Flieger nach London gestiegen bin, ist mein Lächeln wieder ehrlich.
Mein Zimmer liegt im ersten Stock, am Ende des Flurs. Schnell packe ich die wenigen Sachen aus, die ich aus Großbritannien mitgebracht habe, und schmeiße sie achtlos auf mein Bett. Ein Blick auf mein Handy verrät mir, dass es trotz der unnötigen Verzögerung am Flughafen erst früher Abend ist. Dank der Zeitverschiebung fallen mir dennoch beinahe die Augen zu, als ich mich auf die ausgeblichene Tagesdecke hocke.
Es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Mum lebt einfach in einer völlig fremden Welt, nicht nur geografisch gesehen. Nach der Trennung von Dad vor zehn Jahren und unserer überstürzten Flucht nach England hat sie mehr und mehr zu arbeiten begonnen. Um ehrlich zu sein, hat sie angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört. Schließlich hat sie beschlossen, dass das so auch keine Lösung – dass ich keine Lösung bin –, und mich nach zwei Jahren England-Hölle zurück zu Dad nach Lincoln geschickt.
Immerhin war sie wild entschlossen gewesen, mich jeden Sommer zu sich zu holen, auch wenn mein Kinderzimmer augenblicklich ihrem Arbeitszimmer weichen musste. Bis Mum Steve kennenlernte und mit ihm einen Hang zu spontanen, völlig verrückten Dingen. Sie erwartet mich jeden Sommer in ihrem schicken Vorort-Häuschen, aber anstatt spannende Mythen und Legenden in uralten Bibliotheken zu durchstöbern, gehen wir jetzt Bungeespringen.
Mit erschöpften Armen stemme ich mich von der weichen Matratze ab und schleiche in das kleine Badezimmer, das ich mir mit Dad teile. Dort stelle ich mich kurz unter die heiße Dusche, kämme mir anschließend meine Locken und ziehe mir eine Jogginghose und Dads übergroßen Collegepullover an. Er hat ein einziges Semester auf einem vielversprechenden College in Boston verbracht, bevor er Mum traf, sie schwanger wurde und meine Geburt alles veränderte.
Ehe ich weiter drüber nachdenken kann, werfe ich hastig einen Blick in den Spiegel, auf dem erstaunlicherweise kaum Zahnpastaspuren zu entdecken sind. Mein blasses Gesicht mit den lilafarbenen Schatten unter den übermüdeten Augen wirkt nach der langen Reise richtig ungesund. Der tiefbraun gesprenkelte Ring, der meine dunkelgrüne Pupille sonst umrahmt, ist beinahe verschwunden, das Weiß in den Augen gerötet. Sorge liegt darin. Darüber, was mit Leah passiert ist. Ob Tom damit irgendwie klarkommen wird. Und was das alles für unseren Laden bedeutet.
Mit klopfendem Herzen creme ich mein Gesicht ein, wische trotzdem mit einer schnellen Bewegung über den Spiegel und atme tief durch, als mein Handy vibriert.
Mum. Wer sonst.
Setz nicht deine ganze Zukunft auf diesen Laden ... geh lieber studieren, komm raus aus deiner Schutzhülle ... sei mutig!
Weiter lese ich gar nicht erst. Als könnte Mum meine Gedanken bis nach London hören. Im Grunde geht das aber die letzten beiden Monate schon so: Tu alles das, auf was ich verzichten musste, weil ich dich bekommen habe, mach bloß nicht denselben Fehler ...
Meine Finger schweben über dem Display, während die Gedanken unkontrolliert durch meinen Kopf wirbeln. Sich mit den Fragezeichen und den Sorgen vermischen und ja doch keine Antwort zustande bringen, die nicht nach überreiztem Teenager klingt und die ich ihr die letzten beiden Monate über nicht bereits tausend Mal gegeben habe. Ich bin glücklich in Lincoln. Dads Outdoor-Laden ist meine Zukunft, auch wenn es seit einem Jahr echt hart ist. Ich bleibe bei meiner Entscheidung, den Laden nach meinem Schulabschluss Stück für Stück zu übernehmen, ihn um ein schickes Büchercafé zu erweitern und Dad damit nicht nur zu entlasten, sondern auch stolz zu machen.
Bloß Mum will das ganz und gar nicht verstehen.
Ich seufze und schmeiße das Smartphone genervt zu den anderen Sachen auf meine Bettdecke. Mums Worte haben mich die letzten Monate über verunsichert. Tatsächlich frage ich mich seit Wochen, ob das alles, ob ich richtig bin, ob Immer-das-Gleiche-Tun überhaupt als Charaktereinstellung durchgeht.
Wieder öffne ich die App, ignoriere Mums Nachricht und scrolle stattdessen zu Toms Namen. Es gibt Wichtigeres als die für mich unpassenden Vorstellungen eines Lebenskonzepts meiner Mutter.
Tom braucht mich. Und weil er nach dem tödlichen Unfall seiner Eltern vor ein paar Jahren immer gesagt hat, dass ein »Wie geht’s dir« nur dem Fragenden selbst Erleichterung verschafft, schicke ich ihm ein Damon-Salvatore-GIF und schreibe:
Eine gute Dosis Magie ist das Beste, wenn’s in der Realität hart wird …
Die beiden Häkchen färben sich nicht sofort blau und mich überrollt eine neue Welle der Erschöpfung. Mittlerweile ist die Müdigkeit echt überwältigend, es fühlt sich beinahe so an, als würde mein Kopf nicht mehr zu meinem Körper gehören. Und bevor ich wieder damit anfange, komische Typen in bebenden Sportwägen zu sehen, lasse ich erst den Kopf nach rechts und links wandern und husche schließlich ein weiteres Mal ins Badezimmer, um mir dort noch schnell die Zähne zu putzen.
Erst als die immer gleichen Kreisbewegungen die Gedanken in meinem Kopf beruhigt haben, schleiche ich über den Flur zurück in mein Zimmer und dort direkt unter die Bettdecke. Die Schokolade fällt mit den anderen Dingen auf den Boden. Lediglich mein Handy fische ich aus dem unordentlichen Haufen heraus und lese die Nachricht auf dem Display, die Tom mir geschrieben hat:
Wer braucht denn Magier, wenn er Damon haben kann?
Schön, dass du wieder zu Hause bist.
Ich fall um vor Erschöpfung … Wir reden morgen!
Alles gut.
Im Wettlauf gegen meine schweren Lider tippe ich gerade so erleichtert eine Antwort. Dann falle ich in einen traumlosen Schlaf.
Danke, dass du dich für Smith entschieden hast. Kannst du jetzt bitte wieder gehen?
Schwaches Tageslicht fällt durch die halb geschlossenen Jalousien und kitzelt mich im Gesicht. Es ist sechs Uhr morgens. Und dank des Jetlags liege ich seit zwei Stunden wach. Die Bettdecke bis zur Nase gezogen, wechsle ich zwischen An-die-Decke-Starren und Lesen hin und her, lausche dabei Dads gleichmäßigem Schnarchen. Irgendwann seinen polternden Schritten, die ungewöhnlich früh das Holz der Treppenstufen zum Knarzen bringen. Ich warte noch einen Moment, bis ich das vertraute Gluckern der Kaffeemaschine höre, klebe dann vorsichtig einen rechteckigen Post-it an eine meiner liebsten Stellen in Sturmhöhe und bette das Buch zugeklappt auf meinen Nachttisch.
An Schlaf ist nicht mehr zu denken, also drehe ich mich stöhnend um und ignoriere dabei den lauten Protest der Matratze. Ich fühle mich alles andere als ausgeruht, nur ein einziger Gedanke bringt mich überhaupt dazu, das warme Bett freiwillig zu verlassen: Nach zwei Monaten schmerzhafter Abstinenz fahren wir heute endlich wieder in den Laden.
Kaum bin ich aufgestanden, löst hektische Aufregung die Müdigkeit ab. Ich greife nach den erstbesten Sachen in meinem Schrank, ohne darauf zu achten, ob sie überhaupt zusammenpassen, laufe nach dem Zähneputzen eilig die Treppe hinunter, drehe mir gleichzeitig die Haare zu einem unordentlichen Dutt und überspringe die letzten beiden Stufen. Anschließend werfe ich einen flüchtigen Blick in die Küche und kann mich gerade noch bremsen, bevor ich beinahe mit Dad im Flur zusammenstoße.
»Du bist schon wach?« Er stellt seine Lieblingstasse mit unterschiedlichen London-Motiven fahrig auf der Garderobe ab, sieht genauso erschrocken aus wie ich. »Hast du was vor?«
»Wir wollten in den Laden fahren«, erwidere ich irritiert. »Ich dachte nur, je früher, umso besser?«
Dad runzelt die Stirn, als ich keine Miene verziehe. »Möchtest du nicht zuerst frühstücken? Es ist nicht mal halb sieben.«
»Keinen Hunger.« Ich schlüpfe in meine Wanderschuhe, reiße meine Jacke vom Kleiderhaken und werfe sie mir über.
»Ems.« Dad versperrt mir den Weg zur Haustür. »Mach mal langsam. Wär mir recht, wenn wir bisschen später fahren. Und du erst mal hierbleibst, bis ich zurück bin.«
Ich höre gar nicht richtig zu, versuche immer noch, mich an ihm vorbeizudrängeln, als mein Blick erst auf Dads Wanderstiefel fällt, dann auf den Gürtel, den er sich um die Hüften geschnallt hat: Bärenabwehrspray, ein Messer; fehlt bloß noch die Waffe und seine Jagdausrüstung wäre vollständig ... Erschrocken blicke ich auf und entdecke in seinem angespannten Gesicht den Grund, weshalb er so früh auf den Beinen ist.
»Dad?! Was hast du vor?«
»Ich unterstütze die Ranger bei der Suche nach Leah.«
»Ich dachte, der Chief hat eindringlich davor gewarnt? Außerdem warst du seit einem Jahr nicht mehr im Wald!« Meine Stimme schießt mehrere Oktaven höher, überschlägt sich vor Panik. Um genau zu sein, ist es vierhundertvierundfünfzig Tage her, seit Dad das letzte Mal seine Wanderstiefel angezogen und die Jagdwaffe geschultert hat. Der Tag seines Herzinfarkts.
»Stell dir vor, du wärst da draußen. Ich bin das Leahs Vater schuldig. Er war Familie.« Dad streicht sich über die müden Augen. »Ich kann nicht einfach hier rumsitzen und warten, ob das Mädchen wieder auftaucht.« Als sein Blick erneut auf mich fällt, ist er wachsam. Die verräterische Falte auf seiner Stirn ist mir mehr als vertraut. »Ich kenn mich in den Wäldern aus, Ems. Versprich mir einfach, dass du im Haus bleibst.«
Ich kann ihm nicht antworten. Denke an Leah. Dann an Tom. An Dad.
»Warte bitte, bis Tom dich abholt, bevor du in die Berge gehst«, mahnt er weiter. »Wir sehen uns in ein paar Stunden im Laden, okay?«
»Okay«, erwidere ich schwach. Der Kloß in meinem Hals verhindert beinahe das Atmen. Ich will Dad aufhalten, aber mir ist so übel, dass mir nichts einfällt. »Pass bitte auf dich auf, Dad«, füge ich daher nur flüsternd hinzu.
»Immer.« Er geht hinaus in den anbrechenden Morgen und schließt die Tür hinter sich.
Sobald er außer Sicht ist, ziehe ich mein Handy aus der Jeanstasche. Am liebsten hätte ich mir den Kopf zwischen die Knie gesteckt und meine Arme fest um die Hüften geschlungen. Stattdessen beschließe ich, auf Dad zu hören, und lenke mich ab. Ziellos scrolle ich durch Instagram und bleibe bei einem Bild von Leah hängen, das sie am Tag ihres Verschwindens hochgeladen hat. Es ist drei Jahre alt. Ich kenne die Aufnahme, weil ich sie von ihr gemacht habe. Damals ging Leah noch in meine Klasse; wir waren gut befreundet. Auf dem Bild trägt sie ein strahlendes Lächeln im Gesicht und einen glänzenden Ring in ihrem linken Nasenflügel, frisch gestochen. Die Hände hat sie in die schmalen Hüften gestemmt, den Kopf leicht schief gelegt. Die schwarzen samtenen Haare hatte sie sich damals selbst mit der Küchenschere bis auf Höhe der Ohren abgeschnitten. Ich bin dabei gewesen, als sie Tom beides beichtete. Er ist ausgerastet vor Wut, aber letztendlich hat er ihr verziehen. Wie er ihr jeden Mist durchgehen lässt, den sie seitdem gebaut hat.
Unter dem Bild stehen lediglich zwei Worte, keine Hashtags: Live Free. Das passt zu Leah; ihre Freiheit ist ihr im Moment wichtiger als die Gefühle der Menschen, die sich um sie sorgen.
Es darf einfach keinen Zusammenhang zwischen dem Schrei und Leahs Verschwinden geben. Sie hat sich sicher einmal mehr dazu entschieden, den Kopf freizukriegen. Tom nennt es immer so; in Wirklichkeit nimmt sie hin und wieder Drogen und hängt ausnahmslos mit den falschen Leuten herum. Vielleicht ist es diesmal genauso; und die zwei Typen, mit denen sie gesehen wurde, sind Freunde.
Automatisch springen meine Gedanken zu Dad. Der jetzt auch dort im Wald ist, geschwächt von seinem Herzinfarkt. Ich zucke zusammen und fühle mich nicht mehr wohl in dem plötzlich viel zu engen Haus. Alleine und hilflos.
Als der Drang, hinaus an die frische Luft zu flüchten, nach einer Weile beinahe übermächtig wird, renne ich in die Küche, reiße den fast leeren Kühlschrank auf und krame so lange darin herum, bis ich die Zutaten für ein Omelette zusammenhabe. Dann schmeiße ich alles in eine Pfanne und ignoriere meine zitternden Finger. Vor allem jetzt, wo sich die Sonne allmählich vor die düsteren Nachtwolken schiebt, Schatten auf der Arbeitsfläche umhertanzen, wächst mein Unbehagen zunehmend. Und die Angst gewinnt mehr und mehr die Oberhand über die Hoffnung.
Wem mache ich etwas vor? Leah ist im Wald verschwunden, ob sie die Typen nun kennt oder nicht, der Schrei, den die Wanderer gehört haben wollen ... Ich schlucke und schaue aus dem Fenster in den perlgrauen Morgen, als würde dort draußen auf den laubbedeckten Gehwegen irgendjemand stehen und mich beobachten.
Fahrig schiebe ich die Pfanne auf der zerkratzten Herdplatte hin und her, ziehe gleichzeitig das Handy aus der Hosentasche und lege es auf der Arbeitsfläche ab. In Rekordzeit schnipple ich den Käse und werfe ihn unbedacht zu den Eiern.
»Reiß dich mal zusammen«, beruhige ich mich selbst.
Ehe die Eier fertig gebraten sind, schiebe ich die Pfanne auf die Anrichte und esse die Ei-Käse-Matsche direkt daraus. Kein Wunder, dass ich mir prompt den Mund verbrenne. Obwohl ich übertrieben gleichmäßig kaue, mit den Fingern immer wieder gegen die Schläfen presse, löst sich die Anspannung nicht, wird nur noch schlimmer.
Ich zwinge mich dazu, tief durchzuatmen, während ich mich auf der Anrichte abstütze und meinen Blick die in die Jahre gekommenen Holzschränke entlanggleiten lasse. Als ich gerade den letzten Bissen nehme, leuchtet mein Handybildschirm hell auf:
Schon wach, Miss Salvatore?
Steh vor Ihrer Tür und warte.
Hektisch räume ich das Geschirr in die Spüle, und während ich noch dabei bin, das Haarchaos auf meinem Kopf unter Kontrolle zu bekommen, verdrängt Erleichterung allmählich die düsteren Gedanken. Meine Lieblingsserie ist Vampire Diaries, Tom vergöttert Das Reich der Sieben Höfe; beide wünschen wir uns manchmal, dass die jeweiligen gut aussehenden Typen in der Realität existieren könnten. Schnelle tippe ich:
Mr Rhysand, ich bin unterwegs.
Im Rauslaufen stecke ich mein abgegriffenes Portemonnaie und die Haustürschlüssel in meinen Outdoor-Rucksack und streife mir meine Jacke über. Als ich Toms weißen Prius auf dem Gehweg parken sehe, steigt meine Vorfreude sprunghaft an. Fast schon muss ich über mein paranoides Verhalten im Haus lachen.
Ich habe das Auto noch nicht erreicht, als Tom bereits den Wagen verlässt. Seine dunklen Haare stehen in alle Richtungen ab, die markanten Wangenknochen, die Reihe blendend weißer Zähne – es erscheint mir, als wäre ich nie weg gewesen. Tom wirkt völlig erschöpft, trotzdem breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Ihn nach so langer Zeit zu sehen, ist, als würde die Sonne die dunklen Wolken in meinem Kopf durchbrechen. Toms verstorbene Mutter war Kolumbianerin, und die Sonne in ihrem Herzen strahlt bis heute nicht nur auf seiner und Leahs Haut, sondern auch in Toms Gemüt. Er schnappt hörbar nach Luft, dann verzieht sich sein Lächeln zu einem herausfordernden Grinsen.
»Emma!«, brüllt er. »Du bist zurückgekehrt!«
Wäre das nicht Tom, meine Antwort wäre »Nicht so laut, du Spinner« gewesen. Aber vor mir steht mein bester Freund, mit dem die Welt sofort viel bunter ist. Also hole ich tief Luft. »Du hast also die ganze Zeit auf mich gewartet?« Ich kriege die Worte kaum ausgesprochen vor Lachen. Tom stimmt sofort mit ein. Ich weiß nicht, wieso, aber jedes Jahr, wenn ich aus London zurückkomme, begrüßen Tom und ich uns auf diese Weise. Als wäre das die wichtigste Szene eines kitschigen Liebesfilms. Trotz seiner Sorgen hat Tom das nicht vergessen.
Er antwortet gar nicht erst, sondern rennt auf mich zu, reißt mich vom Boden und wirbelt mich im Kreis herum, bis wir beinahe umfallen. Als er mich abstellt, hüpfen wir auf und ab, wie damals, als wir noch Kinder gewesen sind und unsere Eltern uns verkündet haben, dass wir die Ben&Jerrys-Eismanufaktur besichtigen. Tom gibt mir einen Kuss auf die Stirn, dann stemmt er die Hände locker in die Hüften. Er legt den Kopf schief, genau wie Leah auf dem Foto. Ich schlucke.
»Lass uns fahren«, antworte ich, als ich endlich wieder genug Luft zum Reden in der Lunge habe. »Und während der Fahrt erzählst du mir alles!«
Es sind fünfzehn Meilen von Dads Haus bis zum Laden inmitten der entlegenen Bergkette; ein großer Teil der Strecke wird von dichten Wäldern gesäumt. Die letzten Minuten über hat Tom die Ereignisse zusammengefasst, ich mich dabei aufs Zuhören beschränkt. Der Chief hat ihn gestern auf die Wache gebeten, da sich eine Kundin aus Dads Laden gemeldet hat, die beim Verlassen ebenfalls einen Schrei gehört haben will. Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass das alles tatsächlich ganz in der Nähe unseres Ladens stattgefunden hat. Gerade passieren wir das Eingangsschild mit der Aufschrift »White-Mountains-Nationalpark«, eine Weile ist es still im Auto geworden. Dann seufzt Tom laut.
»Weißt du, was mich am allermeisten fertigmacht?«
Ich schüttle stumm den Kopf.
»Dass Leah am Geburtstag unserer Mutter abgehauen ist.« Toms Griff ums Lenkrad wird fester. »Sie baut viel Mist, aber an Mums Geburtstag legen wir immer Blumen aufs Grab.«
»Und kocht gemeinsam Tamales.«
Er nickt. »Diesmal waren ihre ach so tollen Freunde wichtiger.«
»Leah kennt sie?« Trotz der Tatsache, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte, bin ich überrascht.
Tom schnaubt verächtlich. »Kann sein.« Frustriert schüttelt er den Kopf. »Letztes Wochenende haben zwei Typen Leah von irgendeiner Party nach Hause gebracht. Große Kerle, beide mit schwarzen Hoodies und der Kapuze im Gesicht. Es war so dunkel, dass ich sie nicht richtig erkennen konnte. Unter anderen Umständen hätte ich ihr Auftreten einfach nur peinlich gefunden. Wie Bodyguards. Aber irgendwas hatten die an sich ...« Während Tom erzählt, verharrt sein Blick konzentriert auf der Straße. »Leah war natürlich richtig begeistert. Sie hat die ganze Woche geschwärmt. Du weißt ja, sie zieht Ärger automatisch an.« Toms angespannte Körperhaltung verrät noch deutlicher als seine Worte, was er von diesen Typen hält.
»Und die beiden machen eindeutig Ärger?« Ich stoße die angestaute Luft aus. »Hast du das dem Chief erzählt?«
Einen Moment schaut Tom zu mir, dann wieder zurück auf die Straße. »Na ja, sie haben nicht so ausgesehen, als würden sie zum Ballett gehen.« Er lacht, kurz und trocken. »Der Chief nimmt meine Sorgen, dass die Typen Leah Drogen verticken könnten, jedenfalls ernst. Ich bin froh, dass er mich nicht gleich weggeschickt hat. Eine Drogen-Gang in Lincoln – das klingt total bekloppt.«
»Haben die beiden Wanderer etwas über das Aussehen der beiden gesagt?«
»Deren Beschreibung passt.« Tom ballt eine Hand zur Faust, wirkt so, als würde er sie am liebsten direkt durch die Windschutzscheibe rammen. »Ich hab ein paarmal versucht, mit Leah über diese Leute zu reden, aber sie hat immer nur behauptet, sie würde schon auf sich aufpassen.« Er stöhnt leise. »Leah kennt diese Kerle eine Woche, und zack, sieht sie sie als Vorbilder oder Ersatzfamilie, was weiß ich.« Selbstzweifel spiegeln sich in seinem Gesicht. Tom ist ein Jahr älter als Leah, seit wir klein sind, passt er auf uns beide auf. »Wieso vertraut sie lieber irgendwelchen Fremden, anstatt einfach mit mir zu reden?« Er schluckt geräuschvoll. »Rennt denen in den Wald hinterher, wo die sie dann ...« Ihm bricht die Stimme weg.
»Ich weiß, ich hab dir das schon mal gesagt, aber du darfst Leahs Entscheidungen nicht zu deinen eigenen machen«, beeile ich mich sanft zu antworten. »Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es muss ja wirklich keinen Zusammenhang zwischen dem Schrei und Leahs Verschwinden geben.« Vorsichtig schaue ich Tom an, hoffe, dass die Wut auf sich selbst sich legt und er sich nicht angegriffen fühlt. Doch Toms Blick ruht bloß auf der Straße, seine Lippen öffnen sich, schließen sich wieder. Verziehen sich irgendwann zu einem halbherzigen Lächeln, ohne dass ein Ton seine Lippen verlässt. Ich versuche seine Miene zu deuten. Da ist noch mehr, das ihn bedrückt, aber Tom ist niemand, der Dinge verschweigt. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Sobald er so weit ist, wird er mit mir reden.
Eine Weile bleibt es still. Ich schaue aus dem Fenster, beobachte den Pemmigewasset River, der sich entlang der Fahrbahn schlängelt. Der Anblick des Nationalparks ist atemberaubend. Vor allem an einem sonnigen Tag wie heute, wenn sich die bunt gefärbten Baumspitzen ganz sanft im Wind wiegen und Steinmassive steil und kantig aus dem undurchdringlichen schroffen Wald erheben. Ich bin mir sicher, dass der Wind ein wenig salzig schmeckt.
Als könnte Tom meine Gedanken lesen, höre ich keine Sekunde später das Summen des elektrischen Fensterhebers. Mit einem Lächeln lege ich meinen Arm auf dem Rand meines Fensters ab, atme die angenehm kühle Luft ein. Tausend Gerüche und Farben begleiten uns.
Am Horizont türmen sich bereits dunkel die ersten Wolken, vermutlich wird es ein Unwetter geben, daher versuche ich, mein Gesicht so häufig wie möglich in die warmen Sonnenstrahlen zu halten.
»Emma?«
»Was?« Erschrocken fahre ich zusammen. »Sorry, ich war grad in Gedanken.« Im Herbst ist Lincoln besonders, einmalig. Ich kann gar nicht anders, als mich von der Schönheit um uns herum fesseln zu lassen. In ein paar Wochen, wenn der Indian Summer seinen Höhepunkt erreicht, wird man immer nur ein paar Meter weit sehen können, inmitten unzähliger Farbexplosionen ins Ungewisse abbiegen. Bereits jetzt liegt so viel Laub auf dem im Herbst dauerfeuchten Beton, dass die Seitenmarkierungen kaum noch sichtbar sind.
»Vergiss es.« Tom lacht leise. »Wie war England?«
»Schrecklich.«
Er steuert den Wagen sicher die kurvige Straße entlang. Rechts und links gleiten die bunten Bäume an uns vorbei, ein nicht enden wollender Regenbogen.
Tom kommt nicht mehr dazu, mir zu antworten, denn endlich lichtet sich der Wald und Dads Laden gerät am Straßenrand in Sichtweite. Wie immer werde ich total hippelig.
Er ist nicht groß. Das Holzhäuschen mit einem Dach, das an den Seiten herunterzufließen scheint, liegt versteckt im Schatten dicht gewachsener Bäume. Etwas abseits steht ein winziger Metallschuppen, der nicht nur Dad und Tom als Hobby-Werkstatt dient, sondern vor allem Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege ist. Auch der, den Leah und diese Typen vermutlich genommen haben ...
So lange war ich nicht hier gewesen, viel zu lange. Die einzelnen Holzpaneele hatte Dad vor ein paar Jahren rotbraun angestrichen, in den kleinen Fenstern hängen die aktuellen Angebote. Ein roter Wanderrucksack, ein paar windfeste Jacken, Wurfzelte, Bärenabwehrspray. Über der schlichten Tür prangt der Name des Ladens: Smith Pro Shop.
Die morschen Bäume wollte Dad den Sommer über eigentlich stutzen, ihre Äste langen aber nach wie vor gleich Fangarme bis hin zum Wellblechdach des verwitterten Schuppens. Das Gefühl, für den Laden und Dad verantwortlich zu sein, überwältigt mich aus dem Nichts. Bald würde es in meinem Hals so schlimm anschwellen, dass ich es nicht mehr herunterschlucken kann. Aber fürs Erste klappt das noch.
»Hier wären wir.« Tom hat den Prius auf dem menschenleeren Parkplatz abgestellt, schaltet gerade den Motor aus.
Wir steigen beide aus, und Tom geht sofort in Richtung des Ladens. Kurz vor der Eingangstür dreht er sich zu mir herum.
»Willkommen.« Mein bester Freund lächelt liebevoll und alles an ihm und diesem Ort fühlt sich an wie Willkommen zu Hause.
Wir machen einen kleinen Spaziergang um das Gebäude herum, fürs Arbeiten bin ich viel zu aufgedreht, außerdem ist sowieso kein Kunde in Sicht. Ich versuche Tom von den dunklen Leah-Gedanken abzulenken, er erwähnt die Tatsache, dass an einem Herbst-Sonntag kein einziger Tourist vor dem Laden wartet, mit keinem Wort. Das Verschwinden eines Mädchens in Begleitung zweier Männer wühlt nicht nur Dad auf.
Doch dann, als wir uns nach ein paar Runden um den Laden wieder an zwei hochgewachsenen Tannen vorbeizwängen, wird es schwieriger. Wir können die Probleme nicht ewig ignorieren. Sie sind zu allgegenwärtig.
»Lass uns erst mal reingehen«, schlägt Tom gerade vor, als ich mit zu viel Kraft gegen einen Stein trete, der mir im Weg liegt. Wenn es doch nur so einfach wäre mit den Veränderungen und Hindernissen. Ich atme tief durch, nicke und folge ihm zum Laden. Das erste Mal nach zwei Monaten dringt der silbrige Klang des Windspiels an mein Ohr, als Tom die Tür vor mir mit Schwung aufstößt.
Ein paar Dinge stechen mir sofort ins Auge. Die sorgfältig aufgereihten Wanderschuhe im Regal – plötzlich wirkt es so, als wären es viel zu viele –, die verschiedenfarbigen Leichtrucksäcke, die völlig durcheinander direkt darüber hängen. Daneben die bärensicheren Behälter und davor der Verkaufstresen, unter dem wir Mitarbeiter unsere Westen aufbewahren. Umgehend stelle ich mich dahinter, schließe meine Schublade auf und ziehe die Weste daraus hervor. Mit einem Arm verharre ich in ihr, als Toms Handy klingelt. Die Titelmusik von Sherlock Holmes hallt durch den schmerzhaft leeren Laden.
»Ja?« Noch während Tom dem Anrufer zuhört, läuft er in Richtung Lagerraum, sodass ich seine Stimme nur noch gedämpft vernehme.
Es ist angenehm, wieder im Laden zu sein, zu arbeiten, ein Gefühl von Normalität zu spüren – trotz der Tatsache, dass mir Dads Worte durch den Verstand schießen. Wenn niemand hier auftaucht, ist es besser, den Laden vorerst zu schließen.
Im Herbst. Hauptsaison. Keine Umsätze. Krankenhausrechnung. Kloß im Hals.
Sofort wirke ich der aufkommenden Panik entgegen und mache mich daran, alte Wanderkarten durch neue zu ersetzen. Schließlich inspiziere ich die Einnahmen der letzten Tage, lasse es aber sofort wieder sein. Es gibt kaum welche.
»Das war der Chief, er möchte noch mal mit mir reden.« Fast geräuschlos ist Tom hinter mir aufgetaucht, stützt sich jetzt mit beiden Händen neben mir am Tresen ab. Die Unsicherheit in seinem Gesicht begleitet jede seiner Bewegungen. »Ich soll da jetzt hinfahren. Aber Oli wird es sicher nicht gut finden, wenn ich dich hier alleine lasse.«
»Hallo? Ich habe die letzten zwei Monate in einer verregneten Großstadt überlebt, und das zusammen mit meiner Mutter.« Ich lächle Tom aufmunternd zu. »Ich komm schon klar. Du kannst dich auf mich verlassen. Hat der Chief gesagt, was er von dir will?«
»Nicht so wirklich.« Tom denkt eine Weile nach, schaut mich schließlich entschuldigend an. »Emma, ich bin vorhin im Auto nicht ganz ehrlich gewesen. Ich weiß ja, was du von dem ganzen Nordlicht-Quatsch hältst ...«
Ich runzle die Stirn, bis Toms Lächeln meine angespannten Gesichtszüge wieder lockert.
»Aber der Frau, die sich gestern beim Chief gemeldet hat, der will noch etwas anderes als der Schrei aufgefallen sein.«
»Oh nein.« Bei Toms Blick verdrehe ich die Augen. »Ist es wieder so weit?«
Tom lacht. »Bis zum Nordlichtfest sind es keine drei Monate mehr.« Dann zuckt er mit den Schultern. »Ich glaube, der Chief will nicht, dass irgendwer von den Nordlichtern Wind bekommt. In den letzten Jahren gab’s ja immer mal wieder Probleme damit. Ich hab unfreiwillig ein Gespräch zwischen ihm und dem Bürgermeister mit angehört. Auch nur deshalb, weil Leah sich neuerdings für den Mist interessiert.«
»Wenn ich der Chief wäre, hätte ich auch keine große Lust auf irgendwelche albernen Märchen.« Ich seufze. »Bestimmt bereut er es, dass er von Los Angeles ausgerechnet hierher versetzt wurde. Kleinstädter sind schlimmer als irgendwelche Psychokiller.«
Tom boxt mir sanft in die Seite. »Ich lass ihn besser nicht warten; er meinte, er hat noch einen anderen Termin.« Er zögert kurz, dann wendet er sich zum Gehen. »Pass auf dich auf.«
»Hör schon auf damit.« Ich schubse ihn in Richtung Ladentür. »Wenn ein Alien hier auftaucht, sobald du den Laden verlassen hast, ruf ich dich an.«
»Nur wenn er gut aussieht.« Ohne ein weiteres Wort verlässt Tom den Laden.
Und ich brauche ganz dringend Kaffee.
Gerade als ich dabei bin, die heiße Flüssigkeit aus der Kaffeepresse in meinen Thermobecher zu kippen, lässt mich der subtile Klang des Windspiels, sacht und leise, mit meinem freundlichsten Verkäuferinnen-Lächeln aufblicken. Endlich.
Keine Sekunde später muss ich aufpassen, dass mein Lächeln zu keiner Grimasse wird.
Der Junge in meinem Alter, der den Laden betreten hat, zieht entspannt seine Kapuze vom Kopf, das dichte schwarze Haar darunter zerzaust, als wäre er mitten durch einen Regenschauer gelaufen. Mit der schwachen Andeutung eines Lächelns um seine geschwungenen Lippen steuert er in langen eleganten Schritten auf den Tresen zu, nicht den Hauch einer Unsicherheit in seinem Gang. Alles an seiner Erscheinung ist so unwirklich; hätte man mich darum gebeten, sich ihn mir in unserem neben ihm ziemlich unscheinbar wirkenden Laden vorzustellen, ich hätte es nicht gekonnt. Interessiert wandert sein Blick durch den Raum. Irgendwie wachsam.
Als im Hintergrund das Windspiel ausklingt, zwingt mich die Vehemenz in seinen Schritten dazu, verlegen wegzuschauen. Ich bin mir sicher, dass meine Wangen vor Hitze glühen. Aus den Augenwinkeln beobachte ich ihn heimlich, bemerke, dass er sich versteift, als sein Blick das erste Mal auf mich fällt. Viel Unwillkürliches liegt darin, und etwas Fremdes, das mich erschrocken zusammenzucken lässt und Adrenalin durch meine Adern pumpt. Ein paar Schritte noch, dann würde er am Tresen ankommen und ich etwas sagen müssen.
Ein Schritt: Levis-Jeans, marinefarbener Kapuzenhoodie, weiße Sneaker. Mein verräterisches Herz schlägt schneller.
Zwei Schritte: Überlässiges Haareraufen, lichtblaue Augen, unfassbar hell. Schlägt noch viel, viel schneller.
Drei Schritte: Starbucks-Plastikbecher. Ein verdammter Plastikbecher. Mein Verstand tritt mein Herz für einen Moment hart zur Seite. Entscheidet den Kampf trotzdem nicht wirklich für sich.
»Hey«, sagt er in diesem Augenblick. »Kannst du mir einen Rucksack für einen Trip in die Berge empfehlen?« Seine Stimme ist melodisch und sanft.
Angespannt blicke ich auf und bin mir ziemlich sicher, dass ich einfältig blinzle. Mehrmals. Denn seine Augenbrauen wandern umgehend skeptisch in Richtung Haaransatz. Verengen sich dort, als ich nicht sofort antworte.
»Einen Wanderrucksack?«, murmle ich. Eine dumme Frage, wir verkaufen nichts anderes. Aber etwas Besseres will mir gerade nicht einfallen.
Ich erkenne, dass er lächelt. Offen, freundlich. Ein makelloses Herz-Aussetz-Lächeln.
»Du weißt schon, diese Dinger, die man sich auf den Rücken schnallt.« Eine schnelle Handbewegung über seine Schulter hinweg, als würde er sich tatsächlich einen imaginären Rucksack aufziehen. »Den ich dann am Bauch verschließe. Ungefähr so.« Seine beiden Hände schießen nach vorne, ahmen die passende Bewegung zu seinen Worten nach. »Ihr habt ein Angebot im Fenster hängen.« Jetzt zwinkert er mir zu, nickt mit dem Kopf hinüber zum Ladenfenster. Dazu ein Lächeln, das noch breiter wird. Schelmischer. »Du musst dich nur umdrehen, hinter dir an der Wand hängen ziemlich viele davon.«
Irgendwo zwischen seinem Augenzwinkern und diesem schiefen Lächeln habe ich die üblichen Verkaufsfloskeln vergessen. Beides trifft mich völlig unerwartet und sorgt dafür, dass ich mich wie ein unzurechnungsfähiger Vollidiot fühle. Und ihn schon wieder anstarre.
Er wartet. Doch meinem Verstand fällt immer noch nichts Besseres ein als: Hmm, lecker.
»Ja«, sage ich endlich und deute in die Richtung der verschiedenen Modelle, die Dad hinter mir unordentlich untereinander an den dunklen Holzpaneelen aufgehängt hat. »Es gibt verschiedene Größen und Farben. Der rote hier links ist im Angebot, genau«, stammle ich. Verziehe augenblicklich mein Gesicht, als mir klar wird, was ich da gerade von mir gebe. Wie gerne würde ich mir meine Locken über meine Schultern fallen lassen, eine dunkle Begrenzung zwischen seinem eindringlichen Blick und meinem Herz schaffen. Doch dafür müsste ich unauffällig meinen Dutt lösen, während seine Augen nach wie vor jede meiner Bewegungen verfolgen. Ich schaue weg.
»Oh, ich wusste nicht, dass es sie mittlerweile in unterschiedlichen Farben gibt«, sagt er amüsiert und lockert seine steif gewordene Position. »Empfiehlst du mir nicht eher den blauen Rucksack?« Vielleicht irre ich mich, aber für einen Sekundenbruchteil flackert in seiner Lockerheit wieder so etwas wie Anspannung auf.
»Was?« Ich hebe irritiert den Kopf und halte die Luft an. Reiße im selben Moment vor Schreck die Augen auf.
Wie ein Raubtier seine Beute fixiert er mich. Anders kann ich es nicht beschreiben. Überraschend wilde Entschlossenheit funkelt in seinen hellen Augen. Als wäre ihm irgendetwas an seiner Aussage unglaublich wichtig. Dann aus dem Nichts ein völlig unergründlicher Ausdruck, der sich wie ein Nebel über das Funkeln legt. So richtig kann ich beides nicht deuten, mich davon losreißen noch weniger.
»Empfiehlst du mir nicht lieber den blauen Rucksack«, wiederholt er seine Frage, ohne dass sie nach einer klingt. Und ich habe das Gefühl, auf der Stelle festzufrieren, während der Typ darauf wartet, dass ich reagiere.
Seine Anwesenheit, dieser Blick, beides macht etwas mit mir. Als würde er eine eigenartige Kälte in mir heraufbeschwören. Nur ein Frösteln, aber es durchzieht meinen Körper und legt sich dort wie winzige Eiskristalle über mein Inneres. Ich rege mich nicht und beobachte, wie sich Unzufriedenheit in seine Miene mischt, meine wird dabei zusehends unsicherer. Überfordert wende ich mich ab und konzentriere mich lieber auf den bebenden Becher in seiner Hand.
»N-nein, eigentlich nicht.«
Der Griff um seinen Becher wird fester. Blitzschnell krempelt er den Ärmel seines Pullovers ein Stück nach oben, sodass ich die Sehnen erkennen kann, die dort unter seiner Haut deutlich hervortreten. Hart und unnachgiebig.
Er scheint verwirrt, beugt sich ein Stück in meine Richtung. »Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass du mir den blauen Rucksack empfehlen möchtest, Emma.«
Erstaunt darüber, dass er meinen Namen kennt, blicke ich doch wieder auf. Und bereue es sofort. Erneut trifft mich sein matter Blick, ein auffälliger Kontrast zu dem Funkeln, das zu Beginn darin gelegen hat.
»Woher weißt du, wie ich heiße?«
»Steht auf deinem Namensschild«, sagt er schlicht, aber charmant. »Also, was ist? Der blaue Rucksack?« Ich kann es mir nicht erklären, doch mittlerweile klingt er richtig frustriert.
Ich senke erneut den Kopf und frage mich, wie oft das noch so gehen soll. Der Kunde ist König, erinnere ich mich. Ich sollte jetzt einfach nachgeben und ihm diesen verdammten blauen Rucksack geben. Das würde ich zumindest tun, wenn ich nicht seit zwei Monaten eingetrichtert bekommen hätte, dass ich lauter sein soll. Mutiger. Dass ich mich etwas trauen soll. Mums dämlichen Ratschlag genau jetzt umsetzen zu wollen, ist vermutlich nicht die intelligenteste Entscheidung meines Lebens, trotzdem recke ich das Kinn nach vorne.
»Nein«, antworte ich bissig. »Ich würde dir den roten empfehlen. Nach dem hast du doch schließlich auch gefragt.« Und mal ehrlich: Ich verstehe wirklich nicht, worauf er hinauswill. Ist das irgendein Test? Zumindest kann es nicht sein normales Verhalten sein.
»Na dann«, lässt er das Thema einfach fallen und rückt ein Stück vom Tresen ab. Unerklärliche Wut mischt sich in seinen Tonfall. Er seufzt leise. Dann schweigt er.
Ein paar Mal schaue ich noch irritiert auf, immer nur so lange, dass er sich in keiner Google-Bewertung über meine Unhöflichkeit und damit über den Laden beschweren kann. Er sagt nichts, also zwinge ich mich nach einem Moment unangenehmer Stille dazu, ihn nicht einfach bloß dämlich anzustarren, sondern weiterzureden. »Ich komm ehrlich gesagt nicht ganz mit«, gebe ich zu. Aber komplett kann ich meine Gereiztheit nicht unterdrücken.
Sein Lächeln verschwindet. Mist, ganz bestimmt hat er sie auch gehört. »Der rote wird schon passen.«
Erleichtert drehe ich ihm den Rücken zu, atme tief durch, schließe die Augen, zähle in Gedanken bis fünf. »Gut, ich hol ihn dir«, sage ich anschließend. »Dann kannst du ihn erst einmal anprobieren.«
Ich atme tief ein. Und so langsam beruhigt sich auch mein Polter-Herz. Ich ziehe den Rucksack rasch vom Haken und beginne damit, die Träger umzustellen, um sie auf seine Größe abzustimmen. Etwas unbeholfener als sonst.
»Wie groß bist du?«, frage ich betont beiläufig, während ich den Gurt erst im zweiten Versuch durch die Lasche pfriemle, dann auf beiden Seiten nacheinander straffziehe. Als er nicht sofort antwortet, schaue ich kurz zu ihm auf.
»Einen Meter fünfundsiebzig.« Wieder dieser eindringlich matte Blick. Ich erinnere mich lebhaft an das eisige Gefühl, das er eben erst in mir ausgelöst hat. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, obwohl diese Kälte gerade schon wieder dabei ist, meinen Körper einzunehmen. Sich dort mit der Hitze vermischt, mit der der Junge die Distanz zwischen uns füllt.
Wie Feuer und Eis.
»Sicher?«, zwinge ich mich diesmal schneller zu antworten. »Du wirkst größer.« Ich hätte es wie jeder normale Mensch einfach bei seiner Aussage belassen können, doch ich bin nach wie vor dabei, diese lähmende Kälte abzuschütteln, die mich vom Denken abhält. Außerdem weiß ich, dass ich recht habe. Er ist definitiv größer, überragt meine ein Meter achtundsechzig deutlich. Seltsam benommen sehe ich ihm dabei zu, wie er die wenigen Schritte bis zum Tresen erneut überbrückt, mich dabei keine Sekunde aus den Augen verliert. Entweder meine Mum hat es geschafft und ich habe endgültig den Verstand verloren, oder der Typ lügt, was seine Größe betrifft. Ersteres klingt logischer.
»Ich bin mir ziemlich sicher, ja.« Er lacht leise, als hätte ich einen Witz gemacht, den ich nicht verstehe.
Ich ignoriere ihn, belasse die Einstellung so, wie ich es für richtig halte, und strecke ihm den Rucksack daraufhin entgegen. »Probier mal«, bemühe ich mich, weiterhin unbeeindruckt zu klingen. »Ich denke, das müsste passen.«
In einer schnellen Bewegung reißt er mir den Rucksack aus den Händen. Fast erscheint es, als würde er ihn sich noch in derselben über die Schultern werfen.
»Passt«, murmelt er, streift sich den Rucksack nach ein paar Sekunden schon wieder ab und legt ihn gleich einer Barriere auf den Tresen zwischen uns.
»Siehst du.« Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen. »Sag ich doch.«
Seine vollen Lippen öffnen sich, als wolle er etwas erwidern, verziehen sich dann jedoch bloß zu einem Grinsen. »Vielleicht sollte ich doch den blauen probieren, was denkst du ...«, beginnt er überraschend sanft, weniger eindringlich, überhaupt nicht mehr wütend, als ich gerade nach dem roten Rucksack auf dem Tresen greifen will, mein kleiner Finger dabei beinahe seinen berührt.
Ruckartig schnellt seine Hand zurück, sodass ihre Umrisse kurz vor meinen Augen verschwimmen. Dass ich gar nicht erst reagieren kann und in meiner Bewegung erstarre. Überrascht zu ihm aufblicke. Ich habe ihn noch nicht einmal berührt, und doch weicht er ein paar Schritte vor mir zurück. Sein Blick ist wie versteinert. Als wäre ein plötzlicher Adrenalinstoß durch seinen Körper gezuckt, wie ein elektrischer Schlag. Irgendetwas huscht über sein Gesicht, schnell senkt er den Kopf.
»Den blauen ... okay, ja«, versuche ich sein Verhalten irgendwie einzuordnen. Mechanisch drehe ich mich erneut um, als das Läuten des Windspiels mich erschrocken zusammenfahren lässt.
»Emma ... Oh, guten Tag, willkommen bei Smith Pro Shop. Ich sehe, Ihnen wird bereits geholfen.« Dads raue Stimme mischt sich unter den hellen Klang des Windspiels.
»Lass gut sein«, presst der Typ zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich nehm den roten.«
Ohne ein weiteres Wort zieht er erst den Rucksack über den Tresen, stellt den noch vollen Plastikbecher darauf ab, holt dann ein paar Dollarnoten aus seiner Jeanstasche und legt sie neben den Becher. Vorsichtiger diesmal. Als hätte er Sorge, dass wir uns noch einmal zu nahe kommen. Zumindest fühlt sich seine körperliche Anspannung, die in der Luft beinahe greifbar wird, danach an.
»Danke, dass du dich für Smith entschieden hast«, flüstere ich die Standardverabschiedung, während er sich längst umgedreht hat und in Richtung Tür läuft. Im Weggehen nuschelt er etwas, das ich nicht verstehe. Schneller, als ich mich wieder fangen kann, ist er durch die Ladentür nach draußen verschwunden.
Verdattert stehe ich am Tresen, meine Hand liegt neben dem kleinen Berg Geldscheine. Erst jetzt sehe ich, dass es allesamt Einhundert-Dollar-Noten sind. Mit leerem Blick schaue ich zu Dad, der deutlich länger braucht, um die wenigen Meter bis zum Tresen zu überbrücken als der Junge, der mir gerade ernsthaft das Dreifache des eigentlichen Preises gezahlt hat.
»Was hat den denn gebissen?« Keuchend kommt Dad am Tresen an. Als ich ihm nicht sofort antworte, zuckt er mit den Schultern. »Na ja ... Bis auf ein paar Rehe war’s im Wald ruhiger als an einem Sonntagmorgen am See.« Er atmet tief durch. »War das der erste Kunde für heute?«, höre ich ihn in mein Gedankenwirrwarr hinein fragen.
Ich nicke mechanisch, bemühe mich, meine Verblüffung abzuschütteln. Meine Aufmerksamkeit ruht nach wie vor auf dem eingedellten Plastikbecher, der unschuldig neben dem Geld steht. »Ja.«
»Und das nach zehn Uhr.« Dad seufzt laut. »Solange überall in den Nachrichten von einem Besuch des Nationalparks abgeraten wird, sollten wir den Laden für heute schließen.« Endlich reiße ich mich los. Sie bringen es schon in den Nachrichten? Die Vorstellung vertreibt meine Verblüffung.
»Für heute?«, stelle ich mich dumm.
»Ein paar Tage länger vielleicht«, gibt Dad zu.
Ich schlucke, beiße mir auf die Lippen, um nicht in Tränen auszubrechen. »Aber ...«
»Ich weiß, Schatz.« Dad schließt die wenigen Meter zwischen uns und legt mir jetzt seine Hand beschützend auf die Schultern. »Ich hab vorhin kurz mit dem Chief gesprochen. Er bemüht sich, Leahs Verschwinden so schnell wie möglich aufzuklären. Er ist allerdings auch der Meinung, dass es besser ist, wenn du nicht alleine hier mitten in den Bergen bist. Solange hält auch er es für die beste Idee, den Laden zu schließen.«
»Ich kann auf mich aufpassen.« Mit einer schnellen Handbewegung wische ich mir über die feuchten Augen.
Dad stützt sich am Tresen ab. »Ich weiß, ich weiß. Aber wenn keine Kunden kommen ...«
»Wieso kümmert sich der Bürgermeister nicht um die Angelegenheit?«, frage ich schnell. »Wir könnten ihn fragen, ob er eine Sonderge-«
»Jansen hat zu tun.«
»Er ... also. Dad, er ist der Bürgermeister. Seine Aufgabe sollte es sein, sich um die Belange der Stadt zu kümmern.«
Dad überrascht mich mit einem verärgerten Blick.
»Jansen«, murmelte er, »schert sich lieber um seinen eigenen Dreck. Passt ihm sicher gut in den Kram, dass in Lincoln grad die Hölle los ist.« Während er fortfährt, wird seine Stimme zunehmend lauter. »Stammt aus einer Bürgermeister-Familie, der Junge. Seit Jahrzehnten nur hohe Tiere über die ganze Ostküste verteilt. Und Jansen, was macht Jansen? Verstrickt sich in eine Affäre nach der anderen. Dem ist es doch bloß recht, wenn sich die Presse mit Leah oder irgendwelchem Nordlicht-Quatsch beschäftigt, statt mit seinen Intrigen. Hat keinen Sinn für Lincoln, wenn du mich fragst. Ich kann nicht behaupten, dass Jansen jemals irgendeine Hilfe für diesen Laden gewesen ist. Legt ständig Steine in den Weg, vor zwei Wochen erst wieder neue Auflagen. Er identifiziert sich nicht mit Lincoln, das ist das Problem.«
Es ist offensichtlich, dass Dad sich über den Bürgermeister ärgert. Aber so eine lange Ansprache hab ich noch nie aus seinem Mund gehört.
»Ist mir auch schon aufgefallen«, füge ich schnell hinzu, »dass er unseren Laden irgendwie nicht leiden kann.«
Eine Weile schweigen wir, hängen beide unseren Gedanken nach, dann unterbricht Dad die Stille. »Der Chief ist manchmal ein wenig seltsam, findest du nicht?» Überrascht über den abrupten Themenwechsel schaue ich auf. »Während unseres Gesprächs heute Morgen musste er unbedingt loswerden, dass er Familie in Großbritannien hat. Keinen blassen Schimmer, warum. Dachte, er hätte gar keine. Ich meine, er ist erst zwei Jahre in Lincoln, aber Familie hat er nie erwähnt.«
Ich lächle und weiß, dass Dad nur versucht, mich abzulenken. Doch sein Geplauder kann meine schlechte Stimmung nicht lösen. »Keine Ahnung, Dad. Wir haben noch nicht sonderlich viel miteinander zu tun gehabt. Vielleicht hast du es nur nicht mitgekriegt?«
»Hm.« Er blickt auf den Berg Geldscheine. »Der Chief hat Witze darüber gemacht, dass gerade jetzt, wo sein Neffe vermutlich eine Zeitlang bei ihm einziehen wird, Chaos in Lincoln ausgebrochen ist. Das würde kein gutes Licht auf seine Arbeit werfen, meinte er.« Dad lacht. »Wo der Junge scheinbar froh ist, aus England wegzukönnen.«
Letzteres kann ich ihm nicht einmal verdenken. »Solange er nicht auf meine Schule geht – nichts ist schlimmer, als Verwandtschaft des örtlichen Polizeichefs in der Klasse sitzen zu haben.« Demonstrativ verdrehe ich die Augen und hoffe auf die richtige Wirkung.
Dad lacht. »Lehrer- und Polizistenkinder sind die schlimmsten«, sagt er, bevor sich seine Augenbrauen skeptisch zusammenziehen. »Wieso liegen da dreihundert Dollar, Ems?«
»Der Typ hat viel zu viel bezahlt.«
»Wieso das denn?«
»Ich weiß es nicht, Dad. Vielleicht hat er Mitleid?« Ich bemühe mich, die Wut zu unterdrücken, die beim Gedanken an diesen Typen in mir aufsteigt. »Oder zu viel Geld? Ich hab ihn nicht dazu gezwungen.« Ein Überschuss an normalem Verhalten ist es ja schon mal nicht.
»Das ist außerordentlich nett. Hast du dich bedankt?«
Ich schüttle den Kopf und ernte sofort einen tadelnden Blick von Dad.