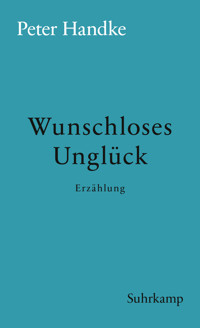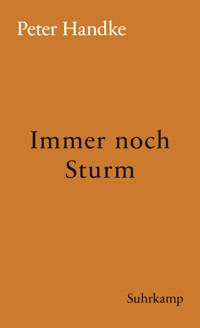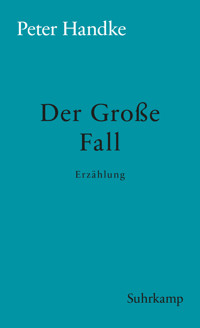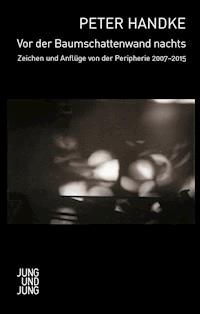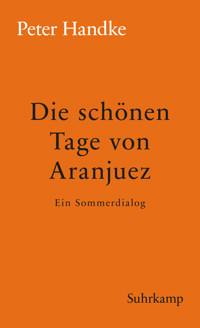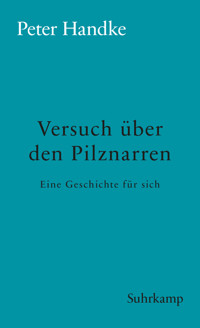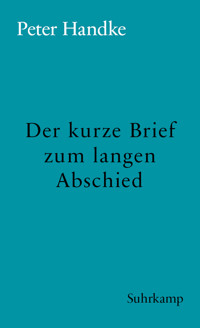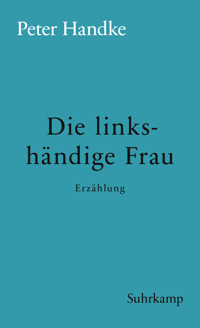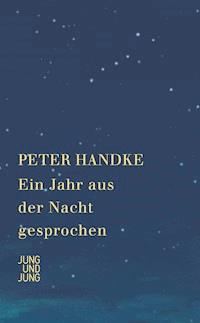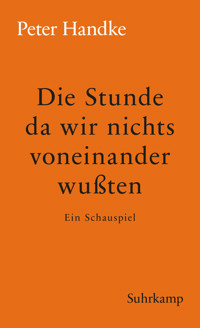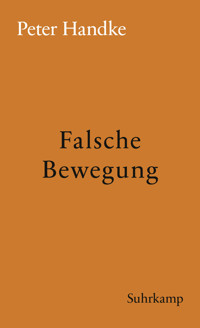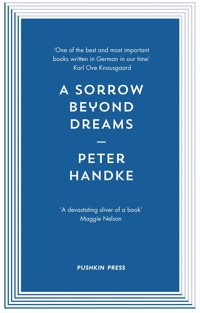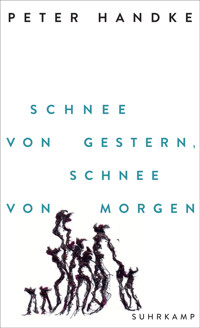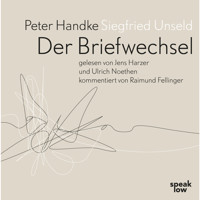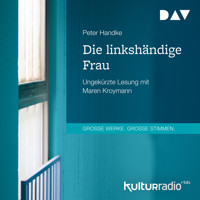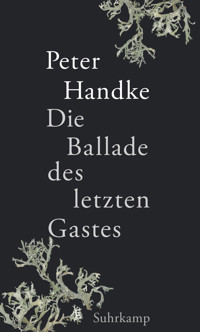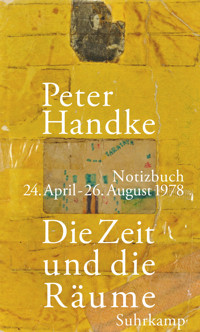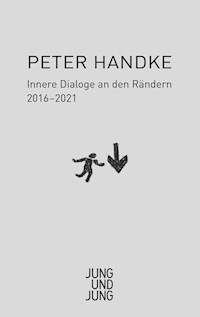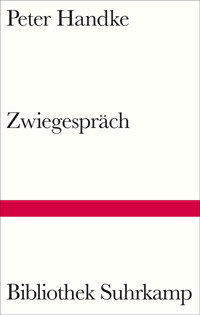14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als das »Letzte Epos« (mit großem »L«) hat Peter Handke seinen neuen Roman bezeichnet. Mit der Niederschrift begann er am 1. August 2016: »Diese Geschichte hat begonnen seinerzeit an einem jener Mittsommertage, da man beim Barfußgehen im Gras wie eh und je zum ersten Mal im Jahr von einer Biene gestochen wird.« Dieser Stich wird, wie der Autor am 2. August festhält, zum »Zeichen«. »Ein gutes oder ein schlechtes? Weder als gutes noch als ein schlechtes, gar böses – einfach als ein Zeichen. Der Stich jetzt gab das Zeichen, aufzubrechen. Zeit, daß du dich auf den Weg machst. Reiß dich los von Garten und Gegend. Fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs, sie ist gekommen.«
Die Reise führt aus der Niemandsbucht, Umwegen folgend, sie suchend, in das Landesinnere, wo die Obstdiebin, »einfache Fahrt«, keine Rückfahrt, bleiben wird, oder auch nicht? Am 30. November 2016, dem letzten Tag der Niederschrift des Epos, resümiert Peter Handke die ungeheuerlichen und bisher nie gekannten Gefahren auf ihrem Weg dorthin: »Was sie doch in den drei Tagen ihrer Fahrt ins Landesinnere alles erlebt hatte: seltsam. Oder auch nicht? Nein, seltsam. Bleibend seltsam. Ewig seltsam.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
PETER HANDKE
DIE OBSTDIEBIN
ODEREINFACHE FAHRT INSLANDESINNERE
SUHRKAMP
Man gesach den liehten summer
in sô maniger varwe nie
Wolfram von Eschenbach, Willehalm
(Man sah den lichten Sommer
in so mannigfacher Farbe nie)
Wenn einer dich zwingt,
mit ihm eine Meile zu gehn,
geh mit ihm zwei.
Matthäus, 5,41
Keiner am Weg gab Feuer
und am Stelldichein Licht
Fritz Schwegler von Breech
Diese Geschichte hat begonnen an einem jener Mittsommertage, da man beim Barfußgehen im Gras zum ersten Mal im Jahr von einer Biene gestochen wird. Zumindest mir ist das seit jeher zugestoßen. Und inzwischen weiß ich, daß diese Tage des ersten und oft einzigen jährlichen Bienenstichs in der Regel zusammenfallen mit dem Sichauftun der weißen Kleeblüten, der erdbodennahen, worin sich die Bienen halbversteckt tummeln.
Es war, auch das wie immer, ein, jedenfalls am späten Morgen, sonniger, aber noch nicht heißer Tag Anfang August, mit einem beständigen Blauen, hoch und immer höher, im Himmel. Kaum eine Wolke – und wenn eine: schon wieder aufgelöst. Ein leichter, beflügelnder Wind wehte, wie meist im Sommer vom Westen her, in der Einbildung vom Atlantik in die Niemandsbucht fächernd. Kein Tau zum Trocknen. Wie schon seit einer guten Woche beim frühmorgendlichen Durchstreifen des Gartens auch nicht eine Ahnung von Feuchtigkeit an den bloßen Sohlen, geschweige denn zwischen den Zehen.
Es heißt, daß die Bienen, indem sie, anders als die Wespen, beim Stechen ihren Stachel verlieren, an ihrem Stich sterben müssen. In all den Jahren zuvor, sooft ich gestochen worden war – fast immer in den nackten Fuß –, hatte ich das nicht selten auch selber mitbekommen, wenigstens angesichts der wie aus dem innersten Fleisch der Biene gerissenen, so kleinwinzigen wie urgewaltigen, dreigezackten Harpune, an der etwas Flockig-Gallertiges, als das Innerste des Tiers, sich bauschte, vor Augen dazu ein Einkrümmen, Zittern, Bibbern, Flügellahmwerden des Wesens.
Doch an dem Stich-Tag damals, da die Geschichte von der Obstdiebin Gestalt annahm, ging die Biene, die mich Barfüßigen stach, daran nicht zugrunde. Obwohl es sich um eine erbsenkleine handelte, pelzig, wollig, in den altbekannten Bienenfarben und -streifen, verlor sie im Stechen keinerlei Stachel und entschwirrte nach dem Stich, einem Bienenstich wie nur je einem – jäh wie heftig –, in einem Schwung, so als sei nicht bloß nichts gewesen, sondern sie sei darüber hinaus kraft ihrer Aktion auch noch zu zusätzlichen Kräften gekommen.
Mir kam das Gestochenwerden recht, und nicht nur wegen der überlebenden Biene. Es gab noch andere Gründe. Erst einmal, sagte man, seien Bienenstiche, angeblich wieder zum Unterschied von denen der Wespen oder Hornissen, gut für die Gesundheit, gegen Rheumabeschwerden, zur Stärkung des Blutkreislaufs, oder wozu auch immer – und so ein Stich jetzt würde, wieder eine meiner Einbildungen, die von Jahr zu Jahr schwächer durchbluteten, empfindungsloser, gar taub gewordenen Zehen wenigstens eine Zeitlang wiederbeleben; in einer ähnlichen Einbildung oder Phantasie riß ich ja jedesmal, ob im Garten der Niemandsbucht oder auf den Terrassen des Anwesens fern in der Picardie, die Brennesseln oft büschelweise mit den bloßen Händen aus dem hier Löß-, dort Kalkboden.
Aus einem zweiten Grund war mir der Stich willkommen. Ich nahm ihn als ein Zeichen. Ein gutes oder ein schlechtes? Weder als ein gutes noch als ein schlechtes, gar böses – schlicht als ein Zeichen. Der Stich gab das Zeichen, aufzubrechen. Zeit, daß du dich auf den Weg machst. Reiß dich los von Garten und Gegend. Fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs, sie ist gekommen.
Brauchte ich denn solcherart Zeichen? An dem Tag damals: ja, und sei es wiederum nur eingebildet oder sommertaggeträumt.
Ich räumte in Haus und Garten auf, was aufzuräumen war, ließ dies und das auch eigens, wo es stand oder lag, bügelte die zwei, drei alten Hemden – kaum im Gras getrocknet –, an denen mir besonders gelegen war, packte, steckte die Schlüssel für das Land ein, die so viel schwereren als die für das Vorstadthaus. Und nicht zum ersten Mal kurz vor einem Aufbruch riß mir beim Knüpfen der knöchelhohen Schuhe ein Schnürband, fand ich nicht und nicht die Socken, die zueinanderpaßten, gerieten mir drei Dutzend von Detaillandkarten zwischen die Finger, bis auf die eine, auf die ich aus war, mit dem Unterschied dieses Mal, daß mir alle zwei Schuhbänder rissen – bei deren viertelstündigem Aufknoten vorher mir ein Daumennagel abbrach –, daß ich zuletzt die unzugehörigen Socken paarweise zusammenstülpte – fast einzig solche –, und daß es mir auf einmal recht war, ohne jede Landkarte unterwegs zu sein.
Auf einmal auch kam ich frei von der Zeitnot, in der ich mich verfangen hatte, eine grundlose Zeitnot, die mich immer wieder befiel, nicht allein in den Aufbruchsstunden, da in der Regel besonders atemabschnürend, und in der Stunde vor dem Aufbrechen geradezu mörderisch. Keine Stunde darüber hinaus. Buch des Lebens? Blindband. Aus der Traum. Aus das Spiel.
Unverhofft jetzt aber: Zeitnot verflogen, und gegenstandslos geworden. Alle Zeit auf Erden hatte ich plötzlich. Alt wie ich war: Mehr Zeit denn je. Und das Buch des Lebens: Offen und dabei dingfest, die Seiten, besonders die unbeschriebenen, aufleuchtend im Wind der Welt, der Erde hier, der Hiesigkeit. Ja, ich würde meine Obstdiebin endlich, nicht heute, nicht morgen, doch bald, sehr bald zu Gesicht bekommen, als Person, als ganze, und nicht bloß in den Teilen, den phantomatischen, wie sie mir in all den Jahren zuvor, meist in der Menge, und da immer nur von weitem, unter die altgewordenen Augen gekommen sind und mich noch einmal auf die Sprünge gebracht haben. Ein letztes Mal?
Ja, hast du denn vergessen, daß es sich nicht gehört, von einem »letzten Mal« zu reden, ebensowenig wie von einem »letzten Glas Wein«? Oder wenn, dann so wie jenes Kind, das, nachdem ihm sein Spiel »ein letztes Mal!« (sagen wir, auf einer Schaukel oder einer Wippe) zugestanden worden war, ruft: »Noch ein letztes Mal!«, und danach: »Und noch ein letztes Mal!« Ruft? Jauchzt! – Aber hast du das nicht schon öfter verlauten lassen? – Ja, aber in einem anderen Land. Und wenn –
Kein Buch packte ich an jenem Sommertag mit ein, räumte sogar das eine vom Tisch, in dem ich noch am Morgen gelesen hatte, die mittelalterliche Geschichte von einer jungen Frau, die, um sich zu entstellen und so für die sie verfolgenden Männer nicht in Frage zu kommen, sich beide Hände abgehackt hatte. (Sich selber die beiden Hände abhacken? Nur in Mittelaltergeschichten war so etwas möglich?) Auch meine Notizbücher und -hefte ließ ich im Haus, sperrte sie weg, versteckte sie wie vor mir selber, es auch in Kauf nehmend, sie nicht mehr zu finden, wenigstens nicht für die kommende Zeit, mir verbietend, mich ihrer zu bedienen.
Bevor ich mich auf den Weg machte, setzte ich mich, das Bündel zu Füßen, in den Garten, mitten da hinein, auf einen einzelnen Stuhl, eher einen Hocker, im Abstand zu den Bäumen, und vor allem weg von den Tischen, dem unterm Holunder, dem unter der Linde, dem unter den Apfelbäumen, dem größten, oder jedenfalls ausladendsten. In meiner Vorstellung verkörperte ich so, untätig dasitzend, in Maßen aufrecht, ein Bein übers andere geschlagen, den Reisestrohhut über den Schädel gestülpt, jenen Gärtner namens »Vallier« (oder wie auch), den Paul Cézanne gegen Ende seines Lebens immer wieder gemalt und gezeichnet hat, besonders 1906, in des Malers Sterbejahr. »Der Gärtner Vaillier« zeigt auf all diesen Bildern, und nicht nur wegen des die Stirn beschattenden Huts, kaum ein Gesicht, oder eins, bilde ich mir ein, ohne Augen, auch Nase und Mund wie weggewischt. Nichts als den Umriß habe ich von dem Gesicht des da Hockenden jetzt im Sinn. Doch was für einen Umriß. Eine Kontur, kraft deren die von ihr umgebene Fastleerfläche des Gesichts etwas verkörpert, ausdrückt und aussendet, was über das hinausgeht, was je eine detailtreu gezeichnete Physiognomie vermitteln könnte – oder zumindest etwas anderes ist und übermittelt, etwas vom Grunde auf anderes – eine grundandere Spielart. Wäre eine mögliche Übersetzung des von mir umgemodelten Namens jenes Gärtners von »Vallier« zu »Vaillant« nicht »Aufpasser«, nein, »Achtgeber«, »Wachender«, oder, kurz, »Wacher«, und das würde, mitsamt den halb verschwundenen Sinnesorganen, Ohren, Nase, Mund und vor allem die Augen wie weggewischt, auf sämtliche Konterfeis des Gärtners Vaillier passen?
So sitzend, wachend, zugleich wie in einem Schlaf, einem anderen Schlaf, bin ich auf einmal angeflogen worden von einer Stimme, nah – näher nicht möglich – am Ohr. Das war die Stimme der Obstdiebin, eine fragende, so zarte wie bestimmte – zarter und bestimmender nicht möglich. Und was fragte sie mich? Wenn ich mich recht erinnere (unsere Geschichte ist ja schon wieder lang her), nichts irgendwie Besonderes; etwas zum Beispiel wie »Wie geht’s dir?«, »Wann fährst du?« (oder nein, jetzt kommt es mir, das Gedächtnis). Sie hat mich gefragt: »Was fehlt Ihnen, mein Herr? Worüber sorgen Sie sich denn so? Qu’est-ce qu’il vous manque, monsieur? C’est quoi, souci?« Und das ist dann auch in der Geschichte das einzige Mal geblieben, daß die Obstdiebin mich in Person angeredet hat. (Wie konnte ich übrigens meinen, sie habe mich dieses erste und einzige Mal geduzt?) Das Besondere dabei war allein ihre Stimme, eine Stimme, wie sie heute gar selten geworden ist, oder vielleicht seit jeher eine Seltenheit war, eine Stimme voll der Sorgsamkeit, ohne einen Tonfall von Extra-Besorgtheit, und vor allem eine, die, Stimme der Geduld, der Geduld sowohl als einer Eigenschaft als auch, stärker noch, als einer Tätigkeit, eines beständigen Tätigwerdens, im Sinne von »Gedulden«, auch »Dulden«: »Ich gedulde mich und ich dulde dich, ihn, sie – ich dulde wen oder was auch immer, ohne Unterschied und, ja doch, ohne Unterlaß.« Nie im Leben würde solch eine Stimme anders modulieren, geschweige denn umspringen in eine erschreckend andere – wie mir das bei den meisten Menschenstimmen (auch der eigenen), akzentuiert noch bei Frauenstimmen, der Fall scheint. Wohl aber war diese Stimme ständig in Gefahr, zu verstummen, womöglich – bewahre! springt bei meiner Obstdiebin, ihr Mächte! – für immer. Die Stimme nach Jahren weiterhin im Ohr, denke ich, es passe zu ihr, was ein Schauspieler, gefragt in einem Interview, wie seine Stimme ihm helfe, in einem Film die jeweilige Geschichte zu spielen, geantwortet hat: Er spüre, nicht bloß bei sich selber, wenn eine Szene, oder auch die ganze Geschichte, »die rechte Tonalität« habe, und es passiere ihm, daß er die Wahrhaftigkeit einer Szene, ja, des Films, einschätze nicht nach dem, was er sehe, sondern nach dem, was er höre. Worauf der Schauspieler, mit einem Lachen, anfügte, was mich für einen Moment an seine Stelle rücken ließ: »Und im übrigen höre ich sehr gut, das habe ich von meiner Mutter.«
Es war hoher Mittag, der Hohe Mittag wie vielleicht nur in der ersten Woche des August. Alle die Nachbarn im Umkreis schienen verschwunden, nicht erst seit gestern. Es war, als seien sie nicht nur den Sommer über umgezogen in ihre Zweitwohnungen oder Chalets in den französischen Provinzen oder sonstwo. Sie waren, stellte ich mir vor, überhaupt ausgezogen, ferner als fern, weit weg von Frankreich, zurückgekehrt in die Heimat ihrer Vorfahren, nach Griechenland, ins portugiesische Hinterbergland, in die argentinische Pampa, an das japanische Ostmeer, die spanische Meseta, und, vor allem, in die russischen Steppen. Ihre Häuser und Hütten an der Niemandsbucht standen sämtlich leer, und anders als in den Sommern zuvor war in den Tagen und Nächten vor meinem Aufbruch nirgendwo eine Alarmanlage angesprungen, auch nicht in den wenigen, seit langem geparkten, motorlos liegengebliebenen Autos.
Schon den ganzen Morgen hatte, wie an den Vormorgen, eine Stille geherrscht, die sich im Lauf der Stunden noch ausbreitete, über die Grenzen oder Ränder der Buchtgegend hinaus, von den episodischen, in der Regel dreitaktigen Rabenrufen weniger unterbrochen als vielmehr womöglich noch weitergetragen. Jetzt aber, mit der Mittagsstunde, umfangen von einem unhörbaren, an dem Sommerlaub auch nicht sichtbaren, windlosen Wehen, eher einem zusätzlichen Luftstrom ohne eigens eine Strömung, einer nach außenhin, auf der Haut, weder an den Armen noch an den Schläfen, unspürbaren Luftzufuhr – kein einziges Blatt, auch nicht das leichteste, das der Linde, regte sich mehr –, senkte sich die über die Gegend gebreitete Stille, und zwar mit einem Mal, mit einem so sanften wie machtvollen Ruck herab auf die Erdlandschaft, und, einzigartiger Vorgang, allsommerlich nur momentlang sich ereignend: die Landschaft, schon vorher umfaßt von Stille, senkte sich oder sank ein mit Hilfe der aus den Himmelhöhen sich urplötzlich herabsenkenden Stillezufuhr und blieb dabei weiterhin die vertraute gebuckelte, aufgewölbte, tragende Erdoberfläche. Jenseits des Hörbaren, Sichtbaren, Spürbaren geschah das. Und doch war es offenbar.
Einsinken ins Land, das war seit jeher einer meiner Tagträume gewesen. Und der hatte sich bisher, noch ein jedes Mal, den einen, einen einzigen Sommermoment lang, erfüllt, zumindest während der mehr als fünfundzwanzig Jahre meines Daseins an ein und demselben Ort.
Auch an jenem Tag, in der Stunde vor dem Aufbruch in das Departement der Oise, hatte sich also für den einen, langerwarteten Moment in der allgemeinen Stille noch die zusätzliche herabgesenkt. Es war gekommen wie immer. Und doch war einiges nicht wie immer, ganz und gar.
Wie immer sah ich, als ich danach den Kopf hob, im Himmel über mir mit ausgebreiteten, sichelförmig gekurvten Schwingen den Adler heraufkreisen, der bis jetzt noch ein jedes Mal verläßlich zum lebenden Bild des einen Moments geworden war, still daherkurvend als dessen Folgemoment. In meiner Vorstellung war es Jahr für Jahr derselbe Raubvogel, der sich aufgeschwungen hatte aus seinem mit Falken, Bussarden, auch Geiern und Eulen geteilten Gehege westwärts im Wald von Rambouillet und eben, nun, auf dem Luftweg ostwärts zu den Rändern von Paris und zurück, über der Stillebucht spiralisierte. Wie immer sah ich auch in dem zu meinen Häupten gleichsam eigens für diese bestimmte Gegend seine Sphären ziehenden Vogel einen Adler, obwohl es vielleicht nur – warum »nur«? – ein Bussard oder ein Milan war – wie immer bestimmte ich: Adler. »Hallo, Adler! He, du! Wie geht’s? Que-ce-que tu deviens?«
Nicht wie immer war, daß der Adler so niedrig flog. So nah den Baumwipfeln und Hausdächern hatte ich ihn nie kreisen sehen. Alle die Jahre waren selbst die Schwalben, so hoch oben im Blau, um einige Raumeinheiten unterhalb des Adlers gesegelt. Diesmal aber zogen die Schwalben ihre Bahnen über ihm, und ich sah sie dabei – auch das nicht wie immer – weniger ihre Bahnen ziehen als, weniger hoch im Blau als sonst, knapp über dem Adler, hin und her schießen, in die Kreuz und in die Quer zucken.
Zwar sank das Umland ein wie noch ein jedes Mal in den vielen Jahren hier. Aber der Boden samt Untergrund blieb diesmal nicht fest und aufgewölbt. Für Augenblicke erlebte ich an der Gegend, statt die vertraute schöne Senke oder Wanne und mein Versinken darin, ein Zusammensinken, nicht bloß mir allein drohendes Zusammenschlagen.
An jenem Tag fiel die erträumte Stille dann tatsächlich, wenn auch bloß für die eine Sekunde, über mich her als die Druckwelle einer weltweiten Katastrophe. Und für einen Augenblick wurden mir auch die Gründe klar, keine eingebildeten – habhafte, handfeste, unabweisliche: solch Versinken des Umlandes, die Stille jetzt, die, statt auf die Sprünge zu bringen, bedrohte und betrauerte, eine Droh-, zugleich Schreckens-und-Sterbensstille: schreckstill wie schreckstarr.
Diese Stille, sie drückte aus, was die Geschichte der letzten Monate und Jahre, mörderisch zugeschärft, jetzt, im zweiten Jahrzehnt des meinetwegen dritten Jahrtausends, den Menschen, nicht nur in Frankreich, da freilich geballt, angetan hatte, und auch das in jenem einen Moment weder hörbar noch sichtbar, noch ertastbar. Dafür aber offenbar – anders offenbar. Alle die weißen Falter, die quer durch den stillen Garten, jeder für sich allein, zickzackten, sie schienen mir zugleich abzustürzen. Und dann: Hinter der Ligusterhecke, im Nachbargarten, ein Aufschreien, das bei mir einschlug als ein Todesschrei.
Aber nein: Weg mit dem Tod. Nichts hier von Tod: der Schrei war gekommen von der jungen Nachbarin, die sich, mucksmäuschenstill mit ihrem Stickzeug in einem Korbsessel, in den Finger gestochen hatte. Vor ein paar Wochen – der Liguster blühte da noch und duftete wie nur Liguster – hatte ich sie durch das Blattwerk ebenso sitzen sehen, mehr eine Ahnung als ein klar umrissener Anblick, in einem knöchellangen hellen Kleid, welches spannte über dem aufgewölbten Bauch der Hochschwangeren. Seitdem keine Spur mehr von ihr, bis auf den Aufschrei gerade, gefolgt von einem Lachen, so als lache die junge Frau über ihr bißchen Schmerz sich selber aus.
Und jetzt folgte auf den Schrei ein Plärren, mehr ein Quäken, wie nur das Quäken eines frisch Geborenen, geweckt aus seinem Säuglingsschlaf durch den mütterlichen Schmerzensschrei. Gute Nachricht! Das Gequäke gefiel mir. Leider dauerte es kaum. Die junge Mutter gab ihm die Brust, oder sonstwas. Stille hinter der Hecke. Ich hätte dem Greinen, so schwach es auch tönte, wie aus einer Grotte, noch lange lauschen mögen. Auf zum nächsten Stich in den Finger, jeune brodeuse, morgen zur selben Zeit! – Nur würde ich da ja schon ganz woanders sein.
Nichts war wie immer an jenem Sommertag? Unsinn: Es war wie immer. Alles? Alles. Alles war wie immer! Wer sagte das? Ich. Ich beschloß es. Ich setzte es so fest. Ich erklärte: Es war wie immer. Rufzeichen? Punkt. Als ich dann durch die Hecke spähte, traf mein Blick auf ein großes, ein einziges Auge, das des Säuglings, welches, ohne zu blinzeln, zurückschaute, und ich versuchte, ihm gleichzutun.
So, wie mich immer an solch einem Tag erstmals im Jahr eine Biene stach, so, in ähnlicher Weise, simili modo, erschien verläßlich wie immer an der Stelle der vereinzelten, wie hoch aus dem Luftraum abstürzenden großen weißlichen Falter das Schmetterlingspärchen, welches bei mir »die Balkanfalter« hieß. Diesen Namen hatten die beiden bekommen, weil die Besonderheit, das Phänomen, das ihr Paarflug zeigte, mir seinerzeit, lang ist’s wieder her, erstmals bei einer Wanderung durch die Gefilde des Balkans vor Augen gekommen war. Aber vielleicht hat auch die Unscheinbarkeit der Tierchen, wenn sie dahinschaukelten oder bloß still im verstruppten Gras hockten, kaum da auszumachen, beigetragen, daß sich der Name bei mir einbürgerte.
Ja, wie immer umtanzte jetzt einander erstmals hier im Jahr solch ein Pärchen von Balkanschmetterlingen. Und wie immer ließ es bei seinem Tanz jene Besonderheit sehen, die zumindest mir noch an keinem einzigen anderen Falterpaar auffällig geworden ist. Es war das ein Tanz, auf und ab, kreuz und quer, dabei jeweils eine Zeitlang so ziemlich an Ort und Stelle (bis dann an anderer Stelle ebenso weitergetanzt wurde), bei dem die zwei, in einem fort durcheinanderwirbelnd, eine Dreigestalt bildeten. Man konnte sich die Augen aus dem Kopf schauen, um diese Dreiheit auseinanderzuhalten und in ihr, was man ja wußte, die tatsächlichen zwei da einander umtanzen zu sehen: unmöglich; es blieb bei den untrennbaren drei. Und daran änderte auch nichts, daß ich, wie jetzt, von meinem Hocker aufstand, um, gleich auf gleich mit dem Tanzpaar, in Augenhöhe, dem Phänomen auf die Schliche zu kommen: Geradewegs vor mir, kaum eine Spanne weg vor den Augen, spielten die zwei um- und ineinander, nicht und nicht zu entwirren, als drei, ließen sich zwar mit einem Handstreich vielleicht augenblicks trennen als eindeutig bloß zwei, gar entzweien, gar vereinzeln, wirbelten aber schon einen Augenblick später durch die Lüfte wieder zu dritt.
Doch warum sie trennen, warum sie sehen wollen, wie sie in Wirklichkeit waren, als bloße zwei? Ach, Zeit. Zeit in Fülle.
Ich setzte mich und schaute dem Falterpaar weiter zu. Ah, wie das Dreiwerden der beiden im Tanzen jeweils aufleuchtete. Dobar dan, balkanci. He, ihr. Was wird aus euch? Srećan put. – Wozu mir dann erstmals auffiel, wie ähnlich das Pärchen, in seinem blitzschnellen ständigen Platzwechsel beim Tanz, jenem Hütchenspiel war, beliebt auf sämtlichen balkanesischen Trottoirs. Betrug? Trug? – Dazu wieder: Und wenn. Sve dobro. Alles Gute.
Auf jetzt! Vorher noch die übliche Abschiedsrunde um das Haus, durch den Garten, mitunter auch rückwärts gehend. Üblich? Diesmal war an meinem Rundgang nichts wie üblich. Oder: Ich umrundete das Haus wie schon so oft für eine länger gedachte Abwesenheit. Doch war mein Gefühl dabei ein anderes, noch nie derart sich mir aufdrängendes: ein Abschiedsschmerz, zwar wie wiederum schon oft, aber gesteigert zu einem: Für immer.
Kein Baum, zumindest Fruchtbaum, der nicht von mir eigenhändig gepflanzt worden war. (Eher stümperhaft – und wenn: »Stümper!« war die am häufigsten mir in den Sinn kommende Selbstanrede, so ziemlich seit meinem Menschengedenken, und bezog sich nicht bloß auf meine Handwerksversuche.) An dem schief gewachsenen Nußbaum zählte ich gewohnheitsmäßig die wenigen Nüsse, in der nicht auszurottenden Hoffnung, es werde zu den vieren zwischen den Blättern ausgeforschten endlich sich doch noch die eine, bis heute versteckte fünfte Nuß zeigen. Nichts da. Sogar die vierte blieb unauffindbar. Wenigstens das Birnbäumchen, auch dank seines schütteren, vorzeitig eingerollten Laubs, prangte vollzählig mit seinen ursprünglichen sechs Birnen – sie schienen gar über Nacht spürbar ausgewachsen und ausgedickt zu den handelsüblichen Birnenformen, während dagegen die Quitte, le cognassier, dunja, im Jahr zuvor noch der Früchterekordbaum, mit rostfleckigen Blättern vollkommen leer stand. Nichts zu holen da für die Obstdiebin, auch wenn ich jetzt wieder, wie an fast jedem Morgen nach dem so weißweißen Blütenfall, mich vor dem Quittenbaum aufpflanzte mit etwas anderem als bloß einer Hoffnung: mit dem Vorsatz, augenblicklich doch noch, verborgen im innersten Laubwerk, eine, und sei es nur eine einzige der so anders birnenförmigen, so anders gelben Quitten, die allereinzigste Dunja ausfindig zu machen.
An dem fraglichen Tag geschah in dem Vorsatz – »Jetzt werde ich sie entdecken, die eine, bisher übersehene Frucht im scheinbar fruchtleeren Baum!« – noch eine Steigerung. Schritt für Schritt um den Quittenbaum herumgehend, innehaltend, den Kopf hebend, äugend, vor und zurück gehend, und so fort, steigerte sich mein Vorsatz, zu erblicken, zu einem wilden Willen, mit nichts als den eigenen Augen die fehlende Frucht in die Leere über mir hineinzuschauen, allein kraft meines Blicks dort oben aus all den zugespitzten Blätterlanzetten in einem, und wenn auch noch so winzigen Zwischenräumchen »diejenige welche« hervor ans Licht treten, sich jetzt, jetzt vorwölben und runden zu machen. Und für den Bruchteil eines Augenblicks schien der Zauber zu gelingen: Da hing sie, die Frucht, so schwer wie duftig. Dann freilich … Doch immerhin – ich zu mir selber – habe ich mir so, Aufblick um Aufblick, den Nacken gestärkt, und das werde ich für das Folgende noch brauchen. Und weiter: zu zählen aufhören. »Der Zähler«, »der Zählende«: einer der neunundneunzig Beinamen eures Gottes? Den »Zähler« streichen, wie überhaupt sämtliche neunundneunzig Namen, insbesondere den »Barmherzigen« und den angeblich noch umfassenderen »Allerbarmer«. Weg mit dem »Allmächtigen«! Oder dem Gott doch einen Namen lassen: »der Erzähler«. Und vielleicht noch den einen: »der Zeuge«, »der Bezeuger«. Und vielleicht noch jenen andern, der in eurer Reihe der neunundneunzig der neunundneunzigste ist: »der Geduldige«. Also gleichwohl die Zahlen? Nicht doch: Ein Name, und noch einer, und wieder einer. Waren nicht die Äpfel in den einen wie den anderen Bäumen des Gartens zahllos gewesen – unzählbar?
Im Gehen, auf dem Weg zum Gartentor, kehrte ich um und stieg hinab in den Keller. Lange stand ich dort vor den Kartoffelsäcken, vor den Baumsägen, den Schaufeln und Harken – im Gedächtnis Funkensprühen von den Kieseln seinerzeit –, dem wacklig gewordenen Tischfußballgestell, dem matratzenlosen Kinderbett, der Kiste mit den Papieren und Photos der Vorfahren, und es fiel mir nicht mehr ein, was mich denn bloß in den Keller geführt hatte. Klar war nur: Ich hatte da etwas tun, verrichten, besorgen, holen wollen, etwas, das ich brauchte, oder das überhaupt gebraucht wurde, und zwar dringend. Nicht zum ersten Mal fand ich mich so vor etwas stehen, ob in Küchen, Fluren, ganzen Häusern, und mich fragen, was es denn war, das ich da in der Räumlichkeit, um alles in der Welt, zu suchen oder zu erledigen hatte. Und zum soundsovielten Mal stand und stand ich im Leeren, und das Ding, die benötigte Aktion, das zu Tuende ging und ging mir nicht und nicht auf. Andererseits: Es wollte, es sollte etwas getan werden. Da, im Keller, hatte ich zu handeln – nur was und wie? Und zugleich, vor all den Sachen, kam mir, daß es sich mit meinem Aufbruch von den Pariser Rändern in die Picardie, in ein Landesinnere wie nur je eines, ähnlich verhielt: Es sei dort etwas Bestimmtes zu tun, zu verrichten, zu holen, zu besorgen. Ich hatte, auf dem Weg zum Gartentor, noch gewußt, was. Nur: im Augenblick war es mir entfallen. Und zugleich hing etwas davon ab – wenn nicht alles, so doch einiges. Das eben noch bestimmt Gewesene war auf einmal unbestimmt – was aber nicht hieß, daß es sich weniger aufdrängte. Es drängte sich umso mehr auf. Und insbesondere beunruhigte es, so wie auch das Stehen im Hauskeller hier mich beunruhigte. Willkommen, Unbestimmtes!? Willkommen, Unruhe!?
Ein letzter Blick, über die Schulter, zum schon weit offenen Gartentor, auf das Anwesen, das meine. Mein? Ekel, im Verein mit Müdigkeit, packte mich angesichts all des Eigentums. Eigentum, das war was grundanderes als mein Eigen. Oder so: Mein Eigen hatte nichts zu schaffen mit dem Zeug – so dachte ich da –, das mir gehörte; auf das ich einen Besitzanspruch hatte. Mein Eigen, es stand mir weder zu, noch konnte ich auf es setzen und mich darauf verlassen. Und trotzdem war es, von Fall zu Fall, wenngleich verschieden vom Besitz, zu ersitzen, und ebenso zu erstehen, zu ergehen, zu umzirkeln.
In ähnlicher Weise hatte mich ja auch seither abgestoßen jeder meiner Blicke auf das, was gemeinhin »Werk« hieß, wenigstens auf das sogenannt »meine«. Allein schon Wörter wie »Arbeitszimmer« oder gar »Werkraum« waren mir zuwider. In einem jeden Zimmer im Haus, in der Küche, auch draußen im Garten, hatte ich im Lauf der Jahrzehnte das Meine getan. Aber ich vermied selbst den flüchtigsten Blick da hin, wo die Gefahr bestand, es würde nur eine Spur oder, bewahre, das Ergebnis meines Tätiggewesenseins in die Augen springen. Trotzdem kam es vor, daß es mich dann und wann unwillkürlich und gegen mein besseres Wissen hinzog zu dem »Werkstück« und ich es, kurz!, in Augenschein nahm, in der Hand wog, und dergleichen mehr. Zwar war das noch erträglich, verlief ohne Nachwirkungen, und an dem Ding zu schnüffeln konnte mich sogar erheitern, wenn nicht zugleich rühren, ja, ergreifen, und bestärken. Doch sowie ich mich einmal in das Getane vertiefte und darin buchstäblich versank, verlor es dann, und nicht bloß momentan, seinen Wert und vor allem sein Parfüm. Das Geleistete verduftet, und ich in seinem staubtrockenen Sog geschwächt, schwächer nicht möglich. So war es eine Gewohnheit, um diese früheren Werk-Stätten in Haus und Garten – selbst um die, in den Wäldern am »Namenlosen Weiher«, in der »Neuen Lichtung«, am »Abwesenheitsweg« – einen Bogen zu machen, oder mich an ihnen, als an Stätten eines möglichen Lasters, vorbeizustehlen. Nur wenn ich diese Räume und Örtlichkeiten leer wußte, ohne Spur und Ergebnis meines einstigen Tuns, war, an ihnen vorbeizugehen, kein Vorbeistehlen mehr. Mit dem Blick hin zu ihnen verlangsamte ich mich im Gegenteil. Zwar wurde ich auch dabei überwältigt von Schwäche. Aber solch ein Schwachwerden erlebte ich nicht als das böse, das entkernende Geschwächtwerden. Es flog mich an als eine Weise der Sehnsucht, und das war von den sämtlichen so unterschiedlichen und einander widerstreitenden Sehnsüchten im Altern die letzte und, das spürte ich, dauerhafte Sehnsucht, die mir geblieben war, und sie war verknüpft, und manchmal auch verknotet mit Angst. Sehnsucht und Beklommenheit.
Wie erleichternd dagegen statt »Werk« und »Eigentum« das, was »das Werk der Natur« hieß. Überall in der Gegend war in dem vergangenen Vierteljahrhundert der Grund und Boden aufgegraben, aufgeschüttet, eingeebnet, planiert worden. Einzig ich hatte, so jedenfalls wieder meine Einbildung, den Boden, das Gartenland, in Ruhe gelassen, dank meiner Trägheit oder dank sonst etwas. Und siehe da: in diesen wenigen Jahrzehnten war der bei meiner Inbesitznahme noch vollkommen planplane Grasgrund dank Wasser- und Wetterkraft (wieder »dank«) umgemodelt worden zu einem grundanders ebenmäßigen Buckelland, einer im Gleichmaß mit Höhen wie Tiefen, geradezu Miniaturtälern und -hügelzügen bis zu allen Horizonten (denen der Nachbarhecken) in einem herzerfrischenden Muster zugleich wie im Passiv hingestreckten und dabei wie aktiv hinstreichenden Buckligen Welt. Das Land da hatte sich gewellt, auf und ab, in von Jahr zu Jahr kräftigeren Wellen, in einem nicht nur augenfälligen, sondern beim Gehen, Durchstreifen, Durchwandern auch, unter den Sohlen, in den Knien und bis hinauf in die Schultern sich einschreibenden Rhythmus. Ja, siehe: die Natur, die Große, hatte das Planierte frisch rhythmisiert, das Land da strahlte jetzt Rhythmen aus, und ich stellte mir dazu vor, die Obstdiebin, darin über Berg und Tal unterwegs, hielte gerade auf einer der Kuppen und beschirmte sich vor einer weiten Aussicht die Augen, oder sie legte sich eben ins Gras und ließ sich, wie damals wir Kinder, an der Flanke hinunterrollen. Ja, das da war mein Eigen. Und tief im Innern zuckte zugleich, still, schon wieder vorbei, das Bild eines bestimmten Dorfs im Karst auf, eine Hauswand nur, die mir im Gehen dort vorzeiten, erst jetzt erfuhr ich’s, erst jetzt belebte es sich, das Bild, das seitdem irgendwo in mir, in den Zellen? in welchen? zum Auf- und Anflattern bereit gewesen war. Immer wieder zucken und flammen sie auf, auch heute noch, unerklärlich, rätselhaft, diese stummen, jeweils menschenleere Bildmomente aus der Vergangenheit, in der Regel einer Längstvergangenheit, ohne einen Zusammenhang mit gleichwelchem Tagesgeschehen, von keinem Gedächtnis und keiner vorsätzlichen Erinnerung herbeirufbar, flattern und flittern auf, blitzen auf, schon wieder entschwunden, mit keiner Zeiteinheit meßbar, wochenlang ausbleibend, dann einen einzigen Tag lang mich durchfahrend als Bildschnuppenschwärme, frei von jedweder Bedeutung oder von gleichwelchem Bedeuten, und doch erlebe und begrüße ich sie jeweils, vor allem nach einem längeren Ausbleiben und an Tagen der Bedrängnis, selbst wenn sie nicht flammen, sondern bloß so aufflackern, blaken, funzeln, mit einem: »Noch ist also nicht alles verloren!«
Drei Briefe aus dem Torbriefkasten geklaubt und sie vorderhand ungeöffnet zu mir gesteckt, zum Lesen auf der Fahrt. Gleich zu erkennen, daß es, wie beinahe die Regel im Hochsommer, Briefe waren, die den Namen verdienten, die Adresse nicht vorgedruckt, sondern in echter Handschrift (auch keiner von einer Maschine vorgetäuschten). Die ersten beiden Augustwochen waren die Zeit, da man damit rechnen konnte, endlich einmal vom Staat verschont zu werden – auch wenn selbst darauf kein rechter Verlaß war. Es handelte sich aber eindeutig um Sommerbriefe, wie sie im Buch standen, und falls bisher noch nicht, so jetzt hier. Allein schon die Kuverts waren nicht die üblichen, das Papier, gefüttert, fühlte sich anders an, knisterte, roch nach etwas, hatte ein Relief, das einiges versprach. Zwei, drei der Handschriften auf den Umschlägen erkannte ich als die von Freunden, und zugleich erschienen sie verschieden von denen in den sonstigen Monaten, größer, mit weiteren Zwischenräumen. Wie auch: Es gab ihn also noch, den und den Freund. Der dritte Brief, ohne Absender, als meine Adresse nur »Niemandsbucht«, zeigte eine unbekannte, in meiner Vorstellung nicht eigens sommerliche Handschrift. Doch auch er knisterte vielversprechend, war schwerer als die beiden andern. Ihn würde ich als letzten öffnen. Und nebenbei machte ich mir fast ein Gewissen daraus, und das nicht zum ersten Mal, schon seit Jahren nun, daß die Briefträgerin, inzwischen mit vielen weißen Haaren und bald Großmutter, auf ihrem Rad von der Departementalstraße wieder hatte abbiegen müssen zu dem Tor am Ende der Allee, einem der wenigen Orte, so dachte ich, auf ihrer täglichen Route, denen die übliche Briefpost, zumindest dann und wann, noch zugestellt wurde.
Kein Auto fuhr mehr auf der Departementale (die bei mir sonst »Carretera«, »Magistrale« und »Tariq Hamm« hieß), und zwar wie für immer. Desgleichen war auch der letzte Hund im Umkreis verstummt, nicht allein wegen der Spätmittagshitze. Über den einen Tag, gar Monat hinaus das Schrillen der Schwalben verstummt, und ebenso der Adler verschwunden, bis zum nächsten Sommer – wenn. Und andrerseits – warum »andrerseits«? – war diese Stille nicht stumm. Die Stille, die jetzt herrschte, vollkommen lautlos, ging auf mich über als Schweigen – ein Stillschweigen. Es war nicht jenes Schweigen der unendlichen Räume, welches den Blaise Pascal hat schaudern machen, sondern eines, das allein der Raum hier und jetzt, ja, ausstrahlte, ein allgemeines Stillschweigen, welches keineswegs aus irgendwelcher angemaßter Zeitlosigkeit kam, sondern aus einem Innehalten wie Innewerden der Zeit, das auch sonst Sekunde um Sekunde wirksam war, als Materie, nicht als Hirngespinst, als eben eine andere reale Zeit in der sogenannten Realzeit, in solch Momenten des horizontweiten Stillschweigens nur spürbarer, oder übergänglicher, als üblich, eines Stillschweigens, das beredt war, strahlte, und schaudern ließ in dem Sinn des Satzes, wonach der Schauder »der Menschheit bester Teil« sei. Ja doch: dieses Stillschweigen jetzt zwischen Erde und Himmel war ein geballtes, es ballte sich, und ballte sich, aber auch das ein Ballen wie das jener Faust, an der, als sie sich öffnete, klar wurde: das Ballen war bloßer Schein gewesen, der Moment vor dem allersanftesten Sichentfalten. Solch eines Stillschweigens, dachte ich, noch immer an dem offenen Gartentor, würde ich in der Picardie, auf dem kaum besiedelten Land, unmöglich mehr innewerden, auch nicht für eine zitternde Sekunde und nicht nur, weil dort in diesen Wochen auf allen Feldern, am Tag und auch nachts, die Erntemaschinen dröhnten, und mein Blick ging durch den Garten zur Haustürschwelle aus Emaille, die ich mir seinerzeit beim Einzug hatte machen lassen, samt der Inschrift, einem Halbsatz, glaube ich, aus der Offenbarung des Johannes, in griechischen Buchstaben: Ho hios menei en ta oikia, eis ton aiona. Der Sohn bleibt im Haus bis in die Äonen. – Bleiben? Zurück ins Haus? Ich bin vor das Tor getreten und habe es hinter mir zugezogen. Ich wollte es dann sogar, anders als sonst, da ich es, auch bei einem Aufbruch für länger, nur zufallen ließ, absperren, gar zweimal. Aber bei der zweiten Drehung brach mir der ziemlich verrostete Torschlüssel ab, und ich erinnerte mich an den Sommertag vorzeiten, da man mich Halbwüchsigen mit einem Schlüssel, um etwas zu holen, zu einem Auto geschickt hatte, mir dabei der Schlüssel abbrach, und meine Mutter, als ich mit leeren Händen beschämt zurückkam, stolz zu den andern im Umkreis sagte: »Da sieht man, was für eine Kraft er hat in den Händen, mein Sohn!« Und was dachte ich vor dem gebrochenen Torschlüssel jetzt? »Der Obstdiebin würde so etwas nicht passieren.«
Hinauf zur Landstraße durch die Zypressenallee. In Wirklichkeit war es ja weder eine Landstraße, noch war die Allee eine Zypressenallee. Aber ich bestimmte es so, für diese Geschichte und, in meinem Selbstbewußtsein episodisch nach dem eines Wolfram von Eschenbach, über die Geschichte hinaus. Was sozusagen »zutraf«: Es ging durch die Allee zu der Straße tatsächlich sachte bergauf. Sonst hatte mir beim Verlassen des Hauses das Bergaufgehen gutgetan, indem es mich den Boden unter den Füßen spüren ließ und die Knie stärkte. An dem fraglichen Tag freilich blieb die Wohltat der Steigung aus, und das lag nicht allein an dem Schuhwerk, dem, fiel mir jetzt erst auf, für die bevorstehenden weiten und wohl auch beschwerlichen Wege – recht so! – viel zu leichten. Umkehren für das Paar Stiefel oder die überknöchelhohen, dicksohligen, jahrzehntlang bewährten John-Lobb-Schuhe? Umkehr ausgeschlossen, wer weiß warum – wegen des im Tor steckengebliebenen Schlüssels? Nein: Ich hätte auch durch das eine versteckte, nur mir bekannte Loch in der Gartenmauer zurückkönnen. Kein Warum. Und das bestimmte jetzt nicht ich, sondern die Geschichte.
Am Ausgang der Allee stand ein Auto, leer. »In meiner Allee!« Plötzlich wurde ich der Eigentümer, der das fremde Ding von seinem Grund und Boden weghaben, mit einem Stein dem Eindringling die Scheibe einschlagen wollte. Freilich gab es da nur kleine Kiesel, und die waren zudem im Alleenboden festgestampft. Herrje: War das nicht das Auto eines Arztes, siehe die Rundscheibe mit der Äskulapnatter am Scheibenwischer? War der Arztwagen etwa meinetwegen da? War es soweit? Und unwillkürlich äugte ich, ob in dem Hinterteil des Gefährts nicht eine Liege eingebaut war, mit Gurten noch und noch, um mich für den Transport festzubinden.
Erst da ging mir auf, daß es das Auto der Krankenschwester oder Therapeutin war, welche seit Jahren, einmal in der Woche, den kranken Nachbarn in dessen Haus an der Ecke Allee/Departementale pflegte. An der Überlandstraße war kein Abstellplatz, und so war es abgemacht, daß die Frau »in meiner Allee« parkte. Das schmeichelte mir sogar. Ich konnte so dem Nachbarn, der, als er noch fest, vielleicht gar zu fest, auf beiden Beinen gestanden hatte, das Böse – im übrigen, wie heutzutags üblich, ohne jeden bösen Willen – mit Gutem vergelten.
Schon vor seinem Krankwerden waren wir einander nähergekommen. Seine Frau war gestorben, eine wie seit jeher runzlige Person, die als die einzige der Familie – es gab auch noch Kinder, gar früh rein nichts mehr von einem Kindsein ausstrahlend – ab und zu sich anders sehen ließ als beim Ausdemhaustreten, Autostarten, Losfahren, Zurückkommen, Haustüraufsperren, Fensterlädenschließen – die sich überhaupt sehen ließ, bei einem Kaffee oder Glas vor der Bahnhofsbar, gehend in einer Seitenstraße, oder allein, ohne den Mann und die Kinder, in den Buchtwäldern, im Sommer, wie jetzt gerade, da die Brombeeren reifen, diese, mit ein paar geübten Schritten zwischen die Dornen, in eine wie im Gewand versteckte Blechkanne pflückend, verstohlen, als ob sich so ein Beerensammeln für sie, die Frau des speziellen Mannes und die Mutter seiner so früh erwachsenen Kinder, nicht gehöre, und ebenso verstohlen ein oder das andere Mal auch zu mir herüberschauend, der im Abstand, noch tiefer im Dorngestrüpp, dasselbe tat, was eigentlich unter meiner wie ihrer Würde war, und zugleich mit etwas wie einer Komplizenschaft, momenthaft gar Freude, diebische, in den Augenwinkeln.
Die Allee endete zwar vor meinem Anwesen, aber daran vorbei setzte sie sich fort als ein Fahrweg, der in eine der Überlandstraße parallele kleine Straße mündete, und der Nachbar benützte Allee wie Weiterweg mit seinem Auto, um dann in der Seitenstraße schneller voranzukommen als auf der oft verkehrsgestauten Departementale. Er hatte dazu kein Recht, es war meine!, von mir, eigenhändig! gepflegte! von mir geschotterte! geharkte!, geschnittene! Allee! (Rufzeichen von mir.) Er nahm sich das Recht heraus, ohne sich dessen bewußt zu sein, unvorsätzlich. Und so, vor allem in der Kurve zwischen Allee und Weiterweg, wo mein Nachbar, mit Karacho jeweils daherbrauste, kurz bremste, waren in der Allee Kiesel und Schotter weggespritzt und hatten Platz gemacht mehr oder weniger tiefen Schlaglöchern, eine ganz anders Bucklige Welt als dahinter das Werk der Natur, die des Gartens, und angesichts dieser Löcherserien wurde auch ich, rechend, harkend, fluchend, allwöchentlich zum Einebner und Planierer, nur daß im Lauf der Folgewoche die Fluchten der Schotterhügel und -mulden bis hinauf zur regulären Fahrstraße, anders rhythmisch, bei Regen blinkend als Serie kleiner Schotterteiche und -seen, mir in alter Frische in die Augen sprangen.
Nach dem Tod seiner Frau fuhr, geschweige denn preschte tagelang kein Auto durch die Allee. Nichts als das entfernte Brausen der Überlandstraße, das mir seit jeher zugesagt hatte, auch das gelegentliche Tosen, selbst das Geheul. Und eines Morgens dann vor dem Gartentor ein Scharren im Kies, das nicht aufhörte. Es setzte sich, nach einer Pause, und noch einer, fort, gleichmäßig, jetzt da, jetzt dort in der Allee. Was geschah da? Was war da im Gang? Und plötzlich wußte ich es, auch ohne zu sehen. Ich zog das Tor auf, hinter welchem mein Nachbar, mit einem Rechen, an Effizienz dem meinen weit überlegen, mit einem Arm- und Beinspiel ungleich professioneller als dem meinigen, die Fahrrinnen und -löcher füllte, auf der gesamten Allee. Er weinte dabei, still. Er schaute mich an und weinte weiter, rechend, harkend. Als ich auf ihn zuging und ihn umarmte, ein Aufschluchzen, wie ich noch nie eines gehörte habe.
Eine Zeitlang verschonte mein Nachbar mit seinem Auto die Allee. Wenn, durchquerte er sie zu Fuß, klopfte zum Gruß im Vorbeigehen an das Tor, und ich grüßte zurück. Ich sah ihn dann sogar zum ersten Mal, unerhörte Begebenheit, in der Bucht zu Fuß unterwegs, während er sonst, ob zum Supermarkt kaum ein paar Häuser weiter, zum Gartenmaschinen- und Heimbastlerladen, kaum einen Steinwurf weg, zum Immobilienbüro, wo er tagaus, tagein die Bewegungen der örtlichen Grundstücks- und Häuserpreise studierte und wohin es kaum ein Sprung war, in seinen Kraftwagen stieg; auch zur Begräbnismesse für seine Frau in der gerade einen Bogenschuß entfernten Buchtkirche donnerte er mitsamt den erwachsenen Kindern und noch ein paar anderen, so alt wie er, hinten im Auto, die allesamt ihm aus dem Gesicht geschnitten wirkten, durch die Allee.
Seltsamer Anblick er danach zu Fuß, wie nackt, ohne Hülle, geradezu ungeschickt, sich selber fremd, am Rand der Straße gehend, eine Baguette oder reparierte Schuhe in der Hand, die Gehsteige benutzend, einmal gar im Wald, unweit der Brombeerlichtung.
Wieder eine Zeitlang danach hörte ich ihn freilich von neuem durch die Allee rollen, wenn auch langsam, wie Schritt für Schritt, leise, behutsam. Und wiederum eine Zeit später teufelte er frischauf, in einem womöglich noch schwereren Fahrgestell, Herr eines speziell für ihn aufgezäumten, gleich beim Anlassen aufröhrenden Motors, durch Kies und Schotter, daß die Steine nur so aus dem Alleengrund spritzten und an die Zypressenstämme schossen – bis er krank wurde, und zwar so, daß ich, der ihm, fast im Ernst, momentweise den Tod gewünscht hatte (»krepier!«), handkehrum mit ihm mitfühlte.
Von einem dritten Nachbarn kam mir dann zu, der andere habe sich beklagt über mich: er fühle sich belästigt, wenn nicht bedroht von der Stille, die ihm entgegenkomme aus meinem Haus und Garten, eine Art Stillebelästigung, Stilletortur.
Lang ist sie her, die Umarmung der zwei Nachbarn im wellenförmig gerechten Schotter – der Rechende ein japanischer Tempelgärtner – vor dem Tor. Und nichts ist mir von dieser Umarmung geblieben. Dauerhaft war etwas anderes, und das ist gültig bis auf den heutigen Tag, und soll, so sei es wieder bestimmt, gelten darüber hinaus: das Geräusch des Rechens (oder Eisenbesens) im Unsichtbaren, und ebenso das fortgesetzte Rechen des Schotters nach der Umarmung, nachdem ich, zurück im Garten, den Torflügel hinter mir zugezogen hatte.
Ein anderes, und doch dasselbe Rechen- oder Besenkratzen kommt mir dazu jetzt in den Sinn. Ich erzähle es hier wohl nicht zum ersten Mal weiter – sei’s drum. Dieses Geräusch habe ich nicht selber gehört, weiß von ihm nur vom Hörensagen, in der Überlieferung, als eine Familiengeschichte. Und die handelt von einem Halbwüchsigen, fast noch einem Kind, dem jüngsten der drei Großelternsöhne. Der war in der Zwischenkriegszeit, ein besonders guter Schüler, mit Anfang des neuen Schuljahrs in ein fernes Internat gebracht worden und sollte, als der erste in der Sippe, studieren. Ein paar Wochen danach wurden die im Dorfhaus Zurückgebliebenen, Vater, Mutter, Brüder, Schwestern – in meiner Vorstellung diese zuerst – nachts, noch lang vor dem ersten Morgengrauen (so übermittelte es mir in der Kindheit die Erzählung) geweckt von dem Geräusch eines Besens unten im Hof, und das war der aus dem Internat geflüchtete Sohn und Bruder, der in seinem Heimweh, domotožje, mal du pays, nachtlang auf der damals wohl, insbesondere in solchen Stunden, kaum befahrenen Straße die vierzig Kilometer, soundsoviel Meilen, soundsoviel Werste ins Dorf zurückgewandert war und nun, in der stockdunklen Nacht, die Hofstatt kehrte, zum Zeichen, daß er hierher gehörte, und nirgends sonst – ohne eine auferzwungene »Weiterbildung«, was dann ja auch sein Los wurde, mitsamt dem Grab eines gemeinen Soldaten in der Tundra.
Das sei hier erzählt, wiederholt und verknüpft mit der Geschichte des auf meinem Grund und Boden kehrenden, rechenden, schaufelnden Nachbarn, weil mir, dessen Kehrgeräusche dauerhaft im Ohr, gerade aufgegangen ist, wie doch, was im Gedächtnis bleibt, wie doch die Begebenheiten, die nicht bloß überliefernswert sind, sondern nach Weitererzählen und Weitergeben förmlich rufen und schreien, über gleichwelche Völker-, Landes- wie Kontinentalgrenzen hinausgehen; wie solche in der Regel minimalen Begebenheiten überall auf Erden ganz andere und zugleich – in aller Herren Länder? nein, in den Ländern ohne welche Herren – dieselben sind.
Noch etwas ist mir dabei aufgegangen: daß ich solche, wenigstens in meinen Augen, weltumspannenden, angeblich kleinen Geschehnisse, bis auf wenige Ausnahmen, nicht selber erlebt habe, sie mir vielmehr, wie die Geschichte vom hofkehrenden Bruder, wenn nicht eben an der Wiege gesungen, so doch sehr früh im Leben vorerzählt worden sind, etwa die mir beständig nachgehende wie vorleuchtende von der Schwachsinnigen Magd, die, vom Bauern geschwängert, ein Kind gebiert. Dieses wächst an dem Hof auf, ohne zu wissen, daß die Idiotin seine Mutter ist. Und eines Tages, als es sich in einem Heckenzaun verfängt und die Magd gerannt kommt und es aus der Verstrickung löst, fragt das Kind dann die Frau des Hauses, die vermeintliche Mutter: »Mutter, warum hat die Dumme solche weiche Hände?« – Und auch dieses nicht selbst Erlebte, diese Hörensagensgeschichte habe ich vor langem schon weitererzählt, ohne besonderes Zutun, wie von allein, jenseits der europäischen Grenzen verwandelt in eine Bluesballade, sagen wir, im innersten Georgia oder jenseits des Jenissej.
Das Selbsterlebte und gleichzeitig zum Weitererzählen Aufrufende ist dagegen die seltene Ausnahme geblieben, und womöglich noch seltener das mir selbst, am eigenen Leib, Erfahrene. Was aber ist jetzt mit der Geschichte zu erfahren, an Hand der Obstdiebin? Diese Geschichte, sie ruft doch nach Überliefern? So eine ist doch noch keinmal erzählt worden? Und ist sie denn nicht eine von heute, wenn je eine? Oder? Oder auch nicht? Laßt uns sehen.
Ich hatte mir Zeit gelassen, und als ich am Ausgang der Zypressenallee ankam, war die Krankenschwester schon abgefahren. Der sieche Nachbar hatte nach der Therapie, oder was es war, zumindest die Kraft, oder den Schwung, sie bis zur Tür zu bringen, und stand nun davor, auf der obersten Stufe, sich beidhändig an dem Geländer festhaltend. Es war ihm ein Glasauge eingesetzt worden, aber auch das natürliche andere, sehr tief in der Höhle, wirkte gläsern, die Farbe ausgebleicht, und wie angepaßt an die des künstlichen Auges, statt umgekehrt. Verwunderlich, daß er etwas sah, und doch hatte er in dem einen Auge spürbar die Überlandstraße und zugleich mich, der in sie einbog. Er grüßte mich, von der Haustürschwelle herab, und trotzdem hörte sein Grüßen sich an, als komme es von unten herauf, aus einem Kellerloch, aus einer Grube. Es war seine Stimme, die mir das vormachte. Vor seiner Krankheit war diese eine Befehlsstimme gewesen, auch wenn er nur so redete und gar nichts befahl, zudem wohl nie, jedenfalls in seinem Berufsleben, zu befehlen gehabt hatte. Sie ertönte (ertönte?) jeweils so harsch wie automatenhaft, ohne je eine Nuance. Seit seinem Siechtum jedoch hatte er eine andere Stimme bekommen, gar mehrere andere Stimmen, viele, vielfältiger, mit jedem Schub im Dahinsiechen womöglich eine zusätzliche. Und als er mich damals am Tag meines Aufbruchs grüßte, war mir, als hätte ich eine Stimme wie diese bisher nur im Traum gehört, eine Stimme insbesondere wie jenes eine Mal, als sie mitten im Herzen des Träumenden ertönte, der davon erwachte: ebenso geschah auch jetzt, am hellichten Tag, in mir eine Art Aufwachens, in Form eines Aufschreckens. Wahr: Es war eine Sterbensstimme, schwach, matt, matter nicht möglich, und doch: springlebendig war solch eine Stimme, und wie bohrte sie sich ein, ohne dabei, wie früher zur Zeit der Gesundheit, zu schmerzen; oder wenn sie schmerzte, so anders.
Der Gruß war im übrigen nicht alles. Denn der kranke Nachbar, nachdem ich ihn gefragt hatte, wie es ihm gehe, fügte dann hinzu, und zwar in der Wir-Form, als gelte, was er sagte, ebenso mir: »Eine Zeitlang werden wir doch noch leben dürfen, nicht wahr?!«, dabei in dem einen wie weit aufgerissenen Auge fortwährend die sommerstille Departementale.
Dabei, von meiner Seite, ein Doppelbild; ein dazugehöriges, überlagert von einem unzugehörigen, wieder rätselhaften. Das eine war die Erinnerung, wie wir, nicht bloß wir zwei hier, sondern viele, wenn nicht sämtliche Anrainer der Straße vor vielen Jahren da die Gehsteige gesäumt hatten, zum ersten und bisher letzten Mal daselbst versammelt, weil in dem Jahr die Tour de France diesen Weg genommen hatte, auf der letzten Etappe vor dem Ziel an den Champs-Elysées. Und das zweite Bild, das unerklärlich mitmischende? Ein anderer Nachbar, einer aus dem Dorf damals, der ortsbekannte Bösewicht und Ungute, hob da einen mitten auf die Fahrstraße verirrten Igel auf, indem er ihn mit beiden Händen von links und von rechts unter den Stacheln an den Weichteilen faßte, eine Bewegung von einer Behutsamkeit, die allem widersprach, was in unseren Dorfkinderaugen diesen verhaßten Menschen, dieses Biest ausmachte, und setzte das Tier ein paar Schritte weiter ebenso achtsam ab ins Kuhweidengras.
Die sonst jahrüber sehr befahrene Überlandstraße, zugleich Straße zum Bahnhof, war so leer, daß ich, statt auf dem gar schmalen Fußgängerstreifen, mitten auf ihr ging – dahinzog. An dem Mittsommertag stellte sie tatsächlich, bel et bien, die Landstraße dar, als die sie sich sonst höchstens in der Stunde lang nach Mitternacht und lang vor dem Morgendämmern erstreckte und als die ich sie tagsüber nur zeitweise imaginierte. Diese weite Landstraße, sie führte, in meinem Rücken, leicht bergauf, auf wie endlose, bewaldete Hügelzüge zu, mit einem jahrhundertalten, längst aufgelassenen, von Wildwuchs befallenen, dabei immer noch quasi staatlichen Forsthausanwesen an deren Fuß. Dahinwandernd auf dem Mittelstreifen, der sich in beide Richtungen, auch hin zum nahen Buchtbahnhof, verlängerte in ungeahnte Fernen, spürte ich den anscheinend flachen Asphaltkörper, mit dem Abglanz des blauen Himmels darauf, unter den Sohlen als eine steife Wölbung, auf der ich Schritt für Schritt, mit dem Mittelstreifen als Richtschnur, dahinbalancierte. Zugleich trat ich so fest auf wie nur möglich, stampfte gar auf, wie auf einem hochgelegenen Trampelpfad, und brachte den Asphalt – auch das, wie das ansonsten nur in der tiefen Nacht vonstatten gehen konnte – zum Schallen. Fürwahr: die leere Überlandstraße hallte von meinen Schritten, und aus den Buchtwäldern kam, in meiner Einbildung?, ein Echo.
»Illegal!«, so kam es mir dazwischen. Grundsätzlicher noch: »Illegaler!«
Daß ich mich als jemand Illegalen sah, geschah mir da freilich nicht zum ersten Mal. Das Bewußtsein meiner Illegalität kam auch von meinem Tun und Lassen, doch nur unter anderem. Jemand »Ungesetzlicher«, ein Verbotener zu sein bestimmt meine gesamte Existenz. Warum? Kein Warum. Nur das: An den Tagen wie dem jetzt, kurz vor dem Versuch, der Verwirklichung eines lang schon insgeheim – zu niemandem ein Sterbenswörtchen davon! – geplanten Vorhabens, wurde davon mein Sinn, ein Illegaler zu sein und etwas Unerlaubtes zu tun, noch geschärft. Übertreibe ich da nicht, und was mir als etwas Verbotenes erschien, war in Wahrheit bloß etwas Ungehöriges, etwas meine Person betreffend Unstatthaftes? Ja, das war es – für jemand wie mich jedenfalls ungehörig und unstatthaft. Aber ich übertrieb nicht: das für mich sich nicht Ziemende fiel mit dem Verbotenen zusammen, war, in meinem Fall, ein und dasselbe. Und das war es, was mir, aufgebrochen, endlich, und hellentschlossen zum Drehen des Dings, unversehens wieder zusetzte – und nicht etwa die mitspielende Vorstellung, mein Unternehmen wäre für kaum was von Nutzen, wäre »für die Fische«, wie mein Bruder das genannt hat, in der Dorfredensart: sollte es doch für die Fische sein!
Mein illegales Treiben, es würde mich, wie noch ein jedes Mal, ausschließen aus der Menschheit. Wenn ich mich bisher, oft mitten im Treiben, wer weiß wie, in die Menschenwelt, eine allerdings andere als die altvertraute, wiederaufgenommen sah, so fürchtete ich jetzt, unterwegs auf der leeren Vorortstraße zur Abfahrt ins Landesinnere, den endgültigen Ausschluß. Und gleichzeitig verstärkte das meine Lust auf die Illegalitätstour. In Gedanken an das, was die große Mehrheit der Legalen tat und trieb, in aller Legalität, von früh bis spät, vom Morgen bis Mitternacht, jahrein, jahraus, ein Menschenjahrhundert jagend das eine das andere, bis auf die speziell dahinjagende Zeit jetzt, ergriff mich, nicht etwa mein dummartiger, kindischer, ja, sündhafter Hochmut, vielmehr etwas, das in einem vergangenen Jahrhundert Hochgemutheit geheißen hat (und, wer weiß, in einem kommenden neu so heißen wird).
Diese Hochgemutheit kam als ein Schub. Obwohl ich, und nicht bloß wegen des vom Stich der Biene geschwollenen Fußes, hinkte, wurde aus meinem Gehen ein Ausschreiten. Epische Schritte waren das jetzt. Und das hieß: Schritte, die einbezogen. Ich ging nicht allein unterm Himmel. Ich ging mit. Mit wem? Mit was? Ich ging mit. Ich war so frei, war im Recht. Und sah ich die Obstdiebin nicht als jemand Vergleichbaren?
Noch und noch Busse kamen auf einmal gefahren, einer hinter dem andern. Ich zog mich zurück auf den Gehsteig und schaute dem Konvoi nach. Alle die Busse waren leer, auf dem Weg ins nahe Versailles, wo an der Esplanade vor dem ehemaligen Königsschloß die Touristen, neuerlich viele aus China, aufs Abgeholtwerden warteten. So im Nachschauen – seit Jahren eine mir ans Herz gewachsene Beschäftigung, nachschauen gleichwas – stellte ich mir vor, statt nordwärts in das, wenigstens auf den ersten Blick, so ungastliche, auch wie geschichts-, nein, zeichenlose Hochland des picardischen Vexin zu fahren, die zwei, drei Kilometer westwärts nach Versailles zu gehen und dort für das Kommende ein Hotelzimmer zu nehmen, nah am Carré St. Louis und dem Platz vor der Kathedrale, mit den Bars mit Namen »Espérance« und »Providence«. Wenigstens diese Namen waren es, was mich jetzt in die ehemalige Königsstadt zog. Oft und oft, und in den letzten Jahren von Mal zu Mal stärker, hatte ich beim Gehen dort, dem mir so nötigen Streunen und Stromern, besonders in den woanders eher widrigen streng geometrisch verlaufenden Straßen, mehr oder weniger alle auf das Schloß zu (in dem ich bis heute nicht war), bemerkt, wie mich das, mitsamt der Empfindung, mich in einer versunkenen und in alle Windrichtungen verwehten Weltgegend, in etwas »Ehemaligem« zu bewegen, momentweise und über den Moment hinaus verjüngte, Kraft in den Beinen, Licht in den Augen, und an den Schläfen: Sausen – Herz, was willst du mehr? Dabei wünschte ich mir keinerlei König oder Königtum – zumindest kein äußeres – zurück; die Wiederkehr gleichwelcher Monarchie war mir schlicht undenkbar. Sooft ich auf der riesigen Esplanade vor dem dabei eher zierlichen Schloß die Statue, hoch zu Roß, des sogenannten Sonnenkönigs sehe, samt dem Schwert und den morgensternscharfen Sporen, die dieser Ludwig der Vierzehnte (nicht ich zähle) dem Pferd gibt auf zum Sprung in noch einen mörderischen Krieg, und dann noch einen, und so weiter der Sonne entgegen, ist mein Gedanke: Nie wieder ein König! Nie wieder einen König sehen! Aber, absehend davon: Ah, Verjüngung. Ah, junge Welt.
Und jetzt genug von Verjüngung, von jung Werden, von Jungtun. Jung war allein die, um die es sich hier dreht, die Obstdiebin, blutjung. Und das, obwohl und ebenso weil sie für ihr Alter schon viel geblutet hat, und schon sehr früh. Ich sah sie vor mir, als ich im Gehen, ohne stehenzubleiben, durch einen Zaun griff und von einem der die Straße säumenden Obstbäume einen Apfel abriß, einen, der in Frankreich, dem Land der mannigfaltigsten Apfelsorten, so seltenen Frühäpfel, reinweiß und, wie der Name besagt, schon seit Juli gereift. Ich sah die Obstdiebin vor mir? Ja, aber ohne Gesicht, überhaupt ohne Bild, nichts als eine Bewegung: wie sie, anders als ich gerade, vor dem Griff durch den Zaun sich dafür in der Luft die Finger lockerte. Auch ihre Finger sah ich nicht, einzig deren Tanz im Leeren, ein Strecken, ein Spreizen, ein Krümmen, ein Auseinanderfalten, Sichverschlingen – wenn ein Bild, so ein Schriftbild, wie das einer Notenschrift. Und sie hätte den Frühapfel, wieder im Gegensatz zu mir, auch nicht im Gehen an sich genommen, sondern sie wäre dazu stehengeblieben. Der Griff durch den Zaun wäre nicht verstohlen geschehen, hätte nichts Diebisches, nichts – Langfingriges gehabt. Anders als ich hätte sie den Apfel nicht gleich irgendwo verschwinden lassen. Anders als ich wäre diese Obstdiebin nach vollbrachter Tat nicht schneller weitergegangen. Sondern? Laßt uns sehen. Ich für meine Person wechselte jedenfalls die Straßenseite.
Ich blickte dort in die Läden, die sich in Bahnhofsnähe jetzt häuften, oder tat auch nur so. Da war nämlich kaum was zu erblicken, entweder, weil die Geschäfte und die Werkstätten in den ersten beiden Augustwochen fast allesamt die eisernen Rolläden heruntergelassen hatten, oder das eine mit den unverdeckten Schaufenstern war überhaupt endgültig aufgelassen, unnötig, davor irgendwelche Schutzgitter aufzuziehen. Diese von oben bis unten wie von einem Flugsand verklebten und mit dem Landstraßenkot bespritzten nackten Glasgroßflächen – alle heil, keine auch nur leicht angesprungen – waren für mich »Schaufenster« in einem besonderen Sinn. Speziell vor einem hatte ich es mir, auf dem Weg zum Bahnhof für eine längere Abwesenheit, angewöhnt, innezuhalten und kurz da hineinzuschauen. In der Werkstatt des seit mehr als einem Jahrzehnt, wohin wohl?, verschwundenen armenischen Schusters und Schlüsselmachers war das schöne Durcheinander des Schuhaufbockkarussells (oder wie das nennen?), der Schlüssel mit den Sohlenteilstückchen (oder so), der Metallschleifmaschine (?) usw. nicht nur unangerührt, sondern auch betriebsbereit geblieben, hinter dem sand- und dreckverschlierten Glas weniger gesehen als erahnt, das freilich zünftig: Auf dem Tisch mit der Schleifmaschine häuften sich zu deren Füßen hügelweise die von den Schlüsselbärten (oder von wo auch) abgeschilferten und weggefeilten Eisen- und Messingteilchen, ein rundliches Hügelland aus winzigen Metallkörnern und -spänen, welches auch ohne Sonnenschein dort in der verlassenen Werkstatt weiter und weiter glitzerte. Und ein paar Schritte danach waren an der Eckbar seit mehr als einem Jahr zwar endgültig die Rolläden heruntergelassen, der alte Berberwirt heimgekehrt, Insch’Allah, in die Kabylen, aber auch da hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, innezuhalten, und wozu? – mit der Faust einmal kurz, einmal lang, auf die Stahljalousie zu schlagen und auf das Echo im leeren, oder vielleicht nicht ganz so leeren Barinnern zu horchen. Echo? Wenigstens bildete ich mir eines ein, als ein Klingen von noch zu füllenden Gläsern, ein Scheppern des Kühlschranks mit ein, zwei immer noch halbvollen Flaschen des einzig in der Berberbar da ausgeschenkten, markenlosen, im übrigen – sei’s drum – schauderhaften Weins; Echo, verstärkt durch das eine, ebenfalls seit einem guten Jahr verwaiste Katzenloch in der Mauer, seltsam auf Schulterhöhe, so daß die vielen Katzen des verwitweten Wirts da jeweils hatten sehr hoch hinaufhechten müssen.
Wieder ein paar Schritte weiter, an der Schwelle zum Platz vor dem Bahnhof, einbezogen ins Geschehen, der Idiot der Niemandsbucht. (Es gab noch den und jenen anderen, und es hätten gut und gerne noch mehr sein können.) Seit geraumer Zeit war er mir nicht begegnet, und auch ihn hatte ich verschwunden geglaubt, so oder so. Wie seit je kurvte er mit Tempo daher, nur sang er diesmal nicht und bückte sich auch nicht nach den sich nach der Station häufenden Abfällen, für deren Beseitigung er, wenn sonst niemand es tat, sich zuständig hielt. Er erkannte mich nicht, oder wollte mich nicht erkennen. Ich schaute ihm nach. Alt war er geworden seit dem letzten Mal, als ich ihm in der Berberbar einen Kaffee spendierte und er schrie – wenn er den Mund auftat, war das jeweils ein Schreien, und selbst wenn er sang, schrie er –, wie ich doch immer so freundlich sei (was beileibe nicht der Fall war). Alt, und dabei in einer schicken Windjacke und wie neuen schwarzledernen Hose, wie sie sich sonst nur der alte Johnny Halliday, und auch der wohl nur, wenn er auf der Bühne den Rockstar gab, erlauben konnte. Stumm kreuzte der greise Idiot quer über den Platz, mit sehr weißen, nach hinten gekehrten Handflächen maulwurfshaft durch die Luft schaufelnd, der riesige Schädel vornübergefallen, die schwarze Lederhose halb herabgerutscht über den gleichfalls sehr weißen Hintern.
Schwelle zum Platz? Es gab buchstäblich eine, in Gestalt des weitverzweigten Wurzelwerks der am Ende der Bahnunterführung aufragenden großen Buche. Die einzelnen Wurzelteile wölbten sich, im Kreis um den Stamm, in verschieden hohen Knicken und Gupfen aus dem Untergrund und bildeten so etwas wie ein Gebirgsrelief en miniature, das Modell einer Berglandschaft. Über diese Schwelle war einst, vor mehr als anderthalb Jahrzehnten, die Mutter der Obstdiebin, von Wurzel zu Wurzel federnd wie von einer Startlinie, aufgebrochen zur Suche ihres verschollenen Kindes in die spanische Sierra de Gredos, während jetzt umgekehrt das Kind die nordfranzösische Hochebene nördlich der Oise durchstreifte auf den Spuren, oder Spurlosigkeiten, seiner lang schon verschwundenen Mutter, wobei es der Obstdiebin freilich noch um dies und das andere zu tun war. Auch ich, der ich sonst, wie die übrigen Fußgänger, um die lang und breit in den Asphalt auslaufenden Wurzeln einen Bogen machte, benützte sie an jenem Augusttag als Startschwelle, indem ich schnurstracks darüberkletterte, in der Vorstellung, jetzt links, jetzt rechts, höher und höher hinauf, von Bergspitz zu Bergspitz, die Knie hebend, auch mit Grätschschritten, zuletzt wieder talab, wo ich, im Queren des Platzes auf den Bahnhof zu, für ein paar Augenblicke den Rhythmus spürte, welcher von den Wurzeln unter den Sohlen auf mich als Ganzen übergegangen war. Auch wenn mir gleichwelches Wünschen seit langem eher sinnlos vorkam und ich es mir abgewöhnt hatte: da hätte ich gewünscht, der Rhythmus möge in mir andauern.
Ein Mann und eine Frau gingen an mir vorbei. Obwohl die zwei hintereinander gingen, in einigem Abstand, sah ich sie als Paar, und sie waren das auch. Und ebenso war es der Fall, daß sie mir nicht entgegenkamen, sondern in der Gegenrichtung unterwegs waren, einer Gegenrichtung nicht allein zu der meini