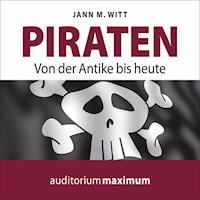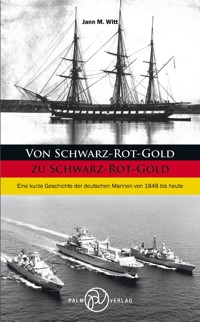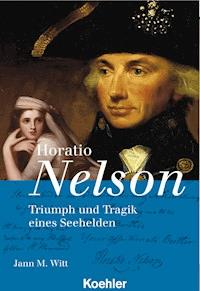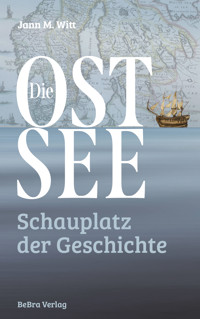
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Ostsee prägte seit jeher die europäische Geschichte: Von hier aus hielten die Wikinger Europa in Atem, an ihren Küsten stieg die Hanse zur herrschenden Handelsmacht auf und im Zweiten Weltkrieg wurde sie zum Schauplatz der Flucht unzähliger Menschen vor der Roten Armee. Jann M. Witt beschreibt die faszinierende Geschichte der Ostsee und ihrer Anrainer von der Völkerwanderung bis in die Gegenwart. Dabei schildert er auch die Konfrontation der Blöcke im Kalten Krieg und die weltpolitischen Spannungen, durch die das Baltische Meer heute wieder einmal in den Fokus der Weltgeschichte gerückt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ostsee – Schauplatz der Geschichte
Jann M. Witt
Die OSTSEE
Schauplatz der Geschichte
BeBra Verlag
Inhalt
Vorwort
Entstehung der Ostsee und erste Besiedlung
Das Mittelalter: Kriege, Christianisierung, Kolonisation
Die Frühe Neuzeit: Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum
Die französische Revolution, Napoleon und die deutsche Einigung
Das 20. Jahrhundert: Weltkriege und Revolutionen
Die Ostsee nach 1945
Krisen, Konflikte und Umweltprobleme im 21. Jahrhundert
Die Staaten rund um die Ostsee
Anhang
Vorwort
Die Ostsee verbindet. Bereits früh haben die Menschen im Norden Europas erkannt, dass das Wasser kein Verkehrshindernis, sondern ein Kommunikationsweg ist. Vom ersten Einbaum bis zum modernen Containerfrachter hat die Schifffahrt die Geschichte des Ostseeraums entscheidend mitbestimmt.
Auch wenn die Ostsee im Gegensatz zum Mittelmeer meist am Rande des wirtschaftlichen und politischen Geschehens lag, wurde hier europäische Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal geriet die Ostsee in den Fokus, als die skandinavischen Wikinger zwischen 800 und 1050 n. Chr. Europa in Atem hielten. Später bestimmten die Hansestädte das wirtschaftliche und politische Geschehen im Ostseeraum. Im 17. Jahrhundert wurde der Kampf zwischen Dänemark und Schweden um die Ostseeherrschaft zum dominierenden Konflikt in Nordeuropa. Das 18. Jahrhundert war vom Aufstieg Russlands und Preußens zu Großmächten geprägt. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde die Ostsee zum Schauplatz der verzweifelten Flucht der Deutschen vor der Roten Armee. Später, während des Kalten Kriegs, standen sich in der Ostsee die Flotten der NATO und des Warschauer Pakts gegenüber.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks führten die wachsenden wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen zur Bildung eines neuen Großraums. Die Ostsee war zu einem »Meer des Friedens« geworden. Heute, mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, hat sich die politische Lage wiederum völlig verändert. Die Ostsee ist wieder einmal zu einer Konfliktregion geworden, in der sich die westlichen Staaten einmal mehr von einem aggressiv-expansionistischen Russland bedroht sehen. Doch im Gegensatz zum Kalten Krieg stehen sich heute nicht zwei Bündnisse gegenüber: Seit 2024 sind alle Ostseeanrainerstaaten Mitglied der NATO – mit alleiniger Ausnahme Russlands.
Dieses Buch will einen Überblick geben über die wechselvolle Geschichte der Ostsee und der Völker, die an ihren Küsten leben. Der kompakten Darstellung ist es geschuldet, dass vieles nicht erwähnt und anderes nur angerissen werden kann. Vielleicht ist dieses Buch aber ein Anreiz, sich intensiver mit der faszinierenden Geschichte dieses Meeres am nördlichen Rande Europas zu beschäftigen.
Kiel, im Februar 2025
Jann M. Witt
Das Mittelalter: Kriege, Christianisierung, Kolonisation
Die Wikinger – gefürchtete Seeräuber
Um das Jahr 800 hielten die Vorfahren der heutigen Dänen, Schweden und Norweger ihren dramatischen Einzug in die europäische Arena. Diese Völker hatten viel gemein: neben der Sprache, dem Altnordischen (aus dem sich später die heutigen skandinavischen Sprachen entwickelten), vor allem die Religion. Sie alle verehrten die Götter des nordischen Pantheons, wie Odin und Thor. Wie die Waffen bezeugen, die in fast allen Männergräbern gefunden wurden, war das Leben im damaligen Skandinavien alles andere als friedlich.
Die skandinavische Bevölkerung gliederte sich in der Wikingerzeit in Freie und Unfreie, wobei die Unfreien, wie diese Bezeichnung bereits vermuten lässt, weitgehend rechtlos waren. Grundlage der Gesellschaft war die Sippe, die ihren Mitgliedern Schutz und Hilfe bot. Obgleich jeder Freie das Recht hatte, an den Thing, d. h. den Volks- und Gerichtsversammlungen, teilzunehmen, gab es auch soziale und damit politische Unterschiede; der Status war an den Besitz gebunden. Einige Geschlechter überragten die übrigen Bauernfamilien an Ansehen, Einfluss und Besitz. Aus dieser kleinen, reichen Oberschicht stammten auch die Häuptlinge oder Jarle, ebenso wie später die Könige.
Raubzüge für schnellen Reichtum
Während des 8. Jahrhunderts hatten sich die Handelskontakte der Skandinavier nach Mittel- und Westeuropa intensiviert. Dadurch gelangten nicht nur Waren, sondern auch Nachrichten über lohnende Ziele für Beutezüge, wie wohlhabende Klöster und reiche Handelsplätze, in den Norden.
Den nordischen Händlern folgten Seeräuber, die bald als »Wikinger« berüchtigt wurden. Das nordische Wort »vikingr« benennt jedoch keine Volkszugehörigkeit, sondern einen Zustand. Es bedeutet »Seekrieger« oder auch »Heerfahrt zur See«. Früher nahm man an, dass die Überbevölkerung Skandinaviens der Grund für die Wikingerzüge gewesen sei, doch gilt diese Theorie inzwischen als widerlegt. Heute geht man davon aus, dass das wichtigste Motiv für eine Wikingfahrt die Hoffnung auf schnellen Reichtum war. Oft waren es wohl die jüngeren Söhne ohne Aussicht auf ein Erbe, die in der Ferne ihr Glück suchten.
Von den mittelalterlichen Chronisten wurden die Wikinger als grausame Seekrieger geschildert, die auf ihren schnellen Schiffen gleichsam aus dem Nichts kamen und ebenso schnell wieder verschwanden. Erschüttert beschrieb ein Mönch aus der nordfranzösischen Stadt Arras um 980 den schrecklichen Anblick, der sich ihm nach einem solchen Angriff bot: »Auf allen Straßen lagen die Leichen von Geistlichen, von adligen und anderen Laien, von Weibern, Jugendlichen und Säuglingen; es gab keinen Weg und Ort, wo nicht Tote lagen; und es war für jedermann eine Qual und ein Schmerz zu sehen, wie das christliche Volk bis zur Ausrottung der Verheerung preisgegeben war.«
Die skandinavischen Seekrieger terrorisierten eine Welt, die zwar an Krieg gewöhnt war, nicht aber an die Guerillataktik der Wikinger. Das Überraschungsmoment spielte bei ihren Überfällen eine große Rolle. Einem raschen Angriff vom Meer her mit Schiffen, die ohne Hafen auskamen und sich deshalb dort der Küste nähern konnten, wo man sie am wenigsten erwartete, folgte ein ebenso rascher Rückzug, bevor es zur Gegenoffensive kommen konnte.
Frühmittelalterliche Hochtechnologie
Ermöglicht wurden die Raub- und Handelsfahrten der Wikinger durch ihr nautisches Können und ihre überlegene Schiffbautechnik. Bis zum Ende des 8. Jahrhunderts hatten die Skandinavier mehrere Schiffstypen für unterschiedliche Verwendungszwecke entwickelt. Neben den schnellen, schlanken Kriegsschiffen, den Lang- oder Drachenschiffen, die gesegelt und gerudert werden konnten, gab es spezielle Fracht- und Handelsschiffstypen. Diese als Knorr bezeichneten Boote waren zwar langsamer, aber auch viel geräumiger und seetüchtiger als die Langschiffe. Ein breites Rahsegel sorgte für den Antrieb.
Das Osebergschiff, ein Langschiff aus dem 9. Jahrhundert, Viking Ship Museum, Oslo
Charakteristisch für den skandinavischen Schiffbau waren die Klinkerbauweise sowie die symmetrischen Vorder- und Achtersteven. Im Gegensatz zu heutigen Schiffen waren die Wikingerschiffe nicht als starre Körper konstruiert, sondern passten sich durch eine elastische Bauweise den Wellenbewegungen an, sodass sie gleichsam auf den Wellen ritten, statt sie zu durchpflügen. Mit Fug und Recht kann man diese eleganten Schiffe als frühmittelalterliche Hochtechnologie bezeichnen.
Von Raubzügen zu Eroberungen
Die innere Schwäche des Frankenreichs nach dem Tod Karls des Großen im Jahre 814 bot den Wikingern beste Voraussetzungen für ihre Raubzüge. 845 zerstörten sie Hamburg und belagerten zwischen 880 und 890 mehrere Jahre lang die Stadt Paris. Auch England und Irland wurden häufig von Wikingern heimgesucht.
Anfänglich beschränkten sich die Wikinger auf reine Plünderungszüge, später ließen sie sich auch dauerhaft in den eroberten Gebieten nieder. Zugleich entwickelten sich ihre Raubzüge von lokalen Überfällen weniger Schiffe über gezielte Vorstöße größerer Flottenverbände hin zu großen, sorgfältig geplanten Kriegsunternehmungen dänischer, schwedischer und norwegischer Könige. In England gelang es skandinavischen Heeren zwischen 865 und 880, drei der vier angelsächsischen Königreiche zu erobern. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts setzten sich die Wikinger auch an der Seinemündung dauerhaft fest; als Normandie wurde dieses Gebiet 912 zum fränkischen Herzogtum erhoben. So wurden aus Wikingern Franzosen.
Die christlichen Moralvorstellungen hatten für die heidnischen Wikinger keine Bedeutung. Ein Raubzug war in ihren Augen keine Sünde, sondern eine ehrenvolle Beschäftigung für einen Krieger. Ebenso galt Reichtum als sichtbares Zeichen göttlicher Gunst. Zudem konnte die Beute als Mittel der politischen Auseinandersetzung genutzt werden, etwa um sich eine große Gefolgschaft zu sichern. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die Wikingerzüge oft von nicht erbberechtigten oder bei Thronstreitigkeiten unterlegenen Mitgliedern skandinavischer Königsfamilien angeführt.
Krieger, Künstler, Handwerker und wagemutige Kaufleute
Doch die Wikinger waren nicht nur furchtlose Totschläger, sondern auch begabte Künstler und Handwerker, wovon bis heute die oft mit kompliziert verschlungenen Tierornamenten geschmückten Holz- und Metallgegenstände zeugen. Die Werkstücke der wikingerzeitlichen Künstler sind handwerklich hervorragend gearbeitet und beweisen einen hoch entwickelten Sinn für Ästhetik.
Die Wikinger waren auch wagemutige Kaufleute, die mit Süd- und Westeuropa Handel trieben und Eisen, Wetzsteine und Kochgerät aus Speckstein gegen Luxusartikel aus dem südlicheren Europa, wie Wein oder Glasgefäße, eintauschten. Ein Beleg für den Aufschwung des Handels seit dem 8. Jahrhundert ist die Entstehung einer ganzen Reihe von Handelsniederlassungen rund um die Ostsee.
Der wichtigste Handelsplatz im Norden Europas war Haithabu. Bereits im Jahre 804 wurde der in der Nähe des heutigen Schleswigs gelegene Ort als »Sliesthorp« in den fränkischen Reichsannalen erwähnt. Vom 9. bis zum 11. Jahrhundert war der »Heideort«, was Haithabu übersetzt bedeutet, die Drehscheibe des Warenaustauschs zwischen Ost und West, Nord und Süd. Der westliche Gegenhafen Haithabus lag vermutlich bei Hollingstedt an der Treene. Der Transit der Waren über die 15 Kilometer breite Landenge erfolgte mit Fuhrwerken.
Haithabu (altnordisch Heiðabýr, dänisch Hedeby) bei Schleswig. Rekonstruktion auf der Basis der Grabungsbefunde
In Haithabu trafen sich Wikinger, Slawen, Sachsen, Friesen und Angehörige vieler anderer Völker, um mit allen nur denkbaren Waren zu handeln – von Pelzen über Trockenfisch, Gewürzen, Wein, Waffen, Schmuck bis hin zu Sklaven, denn der Ort gehörte auch zu den größten Sklavenmärkten Nordeuropas. Zumeist stammten die Gefangenen wohl aus den slawischen Siedlungsgebieten – das Wort »Sklave« leitet sich von »Slawe« ab.
Ein weiterer bedeutender internationaler Handelsort der Wikingerzeit war das mittelschwedische Birka auf der Insel Björkö im Mälarsee. Hier wurden vor allem russische, byzantinische und arabische Waren umgeschlagen. Die Funde großer Mengen arabischer Silbermünzen zeugen von lebhaften Geschäftsbeziehungen mit dem islamischen Raum. Nachdem der orientalische Silberstrom um die Mitte des 11. Jahrhunderts versiegt war, wurde der Ort aufgegeben. An seine Stelle traten nun der gleichfalls am Mälarsee gelegene Ort Sigtuna sowie die Insel Gotland.
Der Beginn der Christianisierung
Von Haithabu aus nahm der erste Versuch der Christianisierung des Nordens seinen Ausgang. Im Jahre 822 betraute Erzbischof Ebo von Reims im Auftrag des Papstes den Mönch Ansgar mit der Aufgabe, den Heiden des Nordens die christliche Botschaft zu bringen. Wiederholt besuchte Ansgar Haithabu und reiste auch mehrfach nach Schweden. 831 wurde er zum Erzbischof von Hamburg und Bremen ernannt. Um 850 gestattete ihm der dänische König Horik sogar den Bau einer Kirche in Haithabu. Doch nach Ansgars Tod im Jahre 865 geriet die christliche Missionierung des europäischen Nordens ins Stocken und musste später fast völlig neu begonnen werden.
In seiner Blütezeit war der Ort am Haddebyer Noor ein wichtiges politisches und militärisches Zentrum. Doch gegen Ende des 10. Jahrhunderts begann der Niedergang Haithabus. Wiederholt wurde der Ort angegriffen und verwüstet. Nach der endgültigen Zerstörung Haithabus im großen Slawenaufstand des Jahres 1066 wurde die Siedlung an den Ort des heutigen Schleswig am Nordufer der Schlei verlegt, büßte seine Bedeutung als Handelsort aber ab Mitte des 12. Jahrhunderts zugunsten von Lübeck ein.
Die Erschließung der Handelswege nach Osten
Während sich die Dänen und Norweger nach Westen orientierten, zogen die »Waräger« genannten schwedischen Wikinger vorwiegend in Richtung Osten. Bereits im 7. Jahrhundert hatten die Schweden begonnen, sich an der südlichen Ostseeküste festzusetzen. Über die russischen Seen und Flüsse erschlossen sie neue Handelswege von der Ostsee bis nach Byzanz und Bagdad. 860 und 907 versuchten die Waräger sogar Konstantinopel zu erobern, allerdings ohne Erfolg. Stattdessen warb der oströmische Kaiser die kriegstüchtigen Skandinavier für seine »Warägergarde« an.
In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstand unter dem Warägerfürsten Rurik (862–879) und seinen Nachfolgern die Keimzelle des späteren russischen Reiches. 862 gründete Rurik das Fürstentum Nowgorod, sein Nachfolger Oleg (882–912) verlegte den Fürstensitz nach Kiew. Der Dynastie der Rurikiden, die bis 1598 herrschte, gelang es, durch den Zusammenschluss mehrerer Fürstentümer ein mächtiges Reich, die »Kiewer Rus«, aufzubauen, das zeitweilig die Hegemonie über einen großen Teil Osteuropas erlangte. 988/89 trat Fürst Wladimir I. (980–1015) zum orthodoxen Christentum über. Auch kulturell begann das byzantinische Vorbild nun allmählich den skandinavischen Einfluss zu verdrängen.
Um 1200 zerfiel das Kiewer Reich in mehrere Teilfürstentümer und konnte somit dem Ansturm der Mongolen unter Dschingis Khan nicht mehr erfolgreich Widerstand leisten. Im Jahr 1237 fiel Kiew und bis 1240 eroberten die Mongolen die meisten Fürstentümer mit Ausnahme von Nowgorod.
Politische und religiöse Umwälzungen im Ostseeraum
Bald nach dem Tod Karls des Großen im Jahre 814 war das Frankenreich in ein west- und ein ostfränkisches Reich zerfallen. Aus dem westfränkischen Reich wurde das heutige Frankreich, während aus dem ostfränkischen Reich das Deutsche Reich hervorging. Letzteres zerfiel jedoch im Laufe des 9./10. Jahrhunderts in weitgehend selbstständige Stammesherzogtümer. Erst König Otto I., genannt »der Große« (936–973, seit 962 Kaiser), gelang es, sich gegen die mächtigen Stammesherzöge und für die Unteilbarkeit des Königstums durchzusetzen. Die Verbreitung des Christentums in den Ostgebieten war eine der Prioritäten in der Politik von Otto I. Er gründete Bistümer zur Slawenmission, wie Magdeburg, Brandenburg und Havelberg. Nach dem Tod seines Sohnes Ottos II. (973–983) im Jahre 983 kam es zu einem großen Aufstand der Slawen, der das Scheitern des ersten Versuchs zur Eingliederung der slawischen Gebiete östlich der Elbe in das Deutsche Reich markierte.
Die dänische Reichsbildung
Auch im Norden Europas kam es in diesen Jahrzehnten zu tiefgreifenden politischen Veränderungen. Beginnend mit Dänemark setzte um die Mitte des 10. Jahrhunderts ein Prozess der Verdichtung staatlicher Strukturen ein. In langwierigen Kämpfen wurden die Territorien der zahlreichen Kleinkönige und Häuptlinge unterworfen. König Gorm dem Alten (900–940) gelang es schließlich, große Teile des heutigen Dänemarks unter seiner Herrschaft zu vereinen. Bis heute gilt er daher als der Staatsgründer Dänemarks. In dem kleinen jütländischen Ort Jellinge ließ Gorm der Alte eine aus zwei Erdhügeln bestehende Anlage errichten, vermutlich als Grabstätte für sich und seine Frau Thyra, und setzte sich und seiner Dynastie damit ein Denkmal. Sein Sohn und Nachfolger Harald Blauzahn (940–987) ließ hier später eine Kirche und einen Runenstein errichten, auf dem er sich rühmt, ganz Dänemark und Norwegen für sich gewonnen und die Dänen christianisiert zu haben.
Der berühmte Runenstein von Jelling (Jütland, Dänemark) mit der ältesten Christusdarstellung Dänemarks. Er wurde von König Harald Blauzahn errichtet, der sich 965 taufen ließ und damit das Christentum in Dänemark einführte.
Um das Jahr 965 hatte Harald Blauzahn den christlichen Glauben angenommen. Angeblich hatte der Missionar Poppo den dänischen König Harald durch eine Feuerprobe von der Überlegenheit des christlichen Glaubens überzeugt. Doch der Grund für seine Bekehrung war vermutlich weniger religiöse Erweckung als vielmehr politische Klugheit. Bereits 948 hatte Otto I. Bischöfe für Schleswig, Ribe und Århus ernannt. Um einem möglichen Ausgreifen des mächtigen südlichen Nachbarn auf sein Reich unter dem Vorwand der Missionierung vorzubeugen, entschloss sich Harald zum Übertritt zum Christentum. Allerdings brauchte er für diesen Schritt die Zustimmung seiner Gefolgsleute. Obgleich viele einflussreiche Persönlichkeiten den neuen Glauben annahmen, gab es Rückschläge: Um 987 wurde Harald Blauzahn von seinem heidnischen Sohn Sven Gabelbart (987–1014) gestürzt, der nun dessen Nachfolge in Dänemark und Norwegen antrat. Später ließ sich auch König Sven taufen und führte die von seinem Vater begonnene, planmäßige Christianisierung der Dänen fort. 1013 eroberte König Sven England, starb aber schon im Jahr darauf.
Sein Sohn Knut der Große (1014–1035) herrschte als König über Dänemark und England und konnte 1028 auch noch die norwegische Krone erringen. Damit wurde Knut zum wohl mächtigsten skandinavischen König in der Geschichte. Er führte Dänemark endgültig in den Kreis der christlichen Nationen. Eine seiner Töchter heiratete sogar den späteren deutschen König Heinrich III. Doch Knuts Reich fehlten die einigenden Strukturen, sodass es nach seinem Tod im Jahre 1035 rasch zerfiel. Gleichwohl blieb Dänemark noch lange das führende Reich im Norden.
Die Einigung Norwegens
Auch in Norwegen hatten sich seit dem 9. Jahrhundert zahlreiche Kleinkönigtümer gebildet, die in jahrzehntelangen, blutigen Auseinandersetzungen von den Königen der ursprünglich schwedischen Ynglingar-Dynastie, die ihre Herkunft vom Gott Yngvi oder Freyr herleiteten, zu einem Reich vereinigt wurden. Der erste namentlich bekannte Norwegerkönig war Harald Schönhaar (ca. 860–930), dessen Sohn und Nachfolger Erik Blutaxt (930–934) im Jahre 934 von seinem jüngeren Bruder Hakon (934–961) vertrieben wurde. Dieser erhielt später den Beinamen »der Gute«, weil er als Erster versucht hatte, die Norweger zum Christentum zu bekehren.
Um die Jahrtausendwende unternahm Olaf Tryggvason (995–1000), ebenfalls ein Ynglingar und ein Urenkel von Harald Schönhaar, den nächsten Versuch, Norwegen unter einer Herrschaft zu einen. Zugleich machte er sich daran, das Land mithilfe des Schwertes zu christianisieren. Doch König Olaf starb, bevor er sein Ziel erreicht hatte. Er wurde im Jahre 1000 von Sven Gabelbart besiegt, der damit seine Oberherrschaft in Norwegen konsolidierte.
Erst König Olaf II. Haraldsson (1015–1028) gelang es, die Norweger zum Christentum zu bekehren. Auf seine Veranlassung fasste das norwegische Thing den förmlichen Beschluss zur Christianisierung Norwegens. Als Olaf II. im Jahre 1028 von Knud dem Großen vertrieben wurde, waren bereits die ersten Bistümer gegründet worden. Bei dem Versuch, die Macht zurückzuerobern, kam er 1030 in der Schlacht bei Sticklestad ums Leben. Später wurde Olaf II. heiliggesprochen. Sein Sohn Magnus, genannt »der Gute« (1035–1047), konnte nach dem Tod König Knuds den norwegischen Thron besteigen und wurde 1042 aufgrund eines Erbvertrags sogar König von Dänemark, doch endete die kurzlebige Personalunion mit seinem Tod. Unter König Harald Hårdråde (»der Harte«, 1047–1066) wurde die Einigung Norwegens um das Jahr 1060 vollendet. Harald der Harte fiel 1066 im Kampf gegen König Harald II. von England, der jedoch selbst kurz darauf bei Hastings einem normannische Invasionsheer unter Wilhelm dem Eroberer unterlag.
Die Anfänge der schwedischen Staatsbildung
Als letztes der nordischen Völker trat Schweden aus dem Dunkel der Geschichte heraus. Anscheinend ging die schwedische Reichsbildung um das Jahr 1000 von dem mittelschwedischen Kerngebiet der Svear rund um den Mälarsee aus. Mit Ansgar hatte im 9. Jahrhundert auch in Schweden die christliche Mission von Westen her begonnen. Als erster christlicher König Schwedens gilt Olaf Skötkonung (ca. 995–1022). Allerdings konnte sich der alte Glaube in einigen Teilen des Landes noch lange halten. Obgleich König Inge Stenkilsson (ca. 1080–1105) die heidnischen Kultstätten in Uppsala um das Jahr 1087 zerstörte, wurde das Heidentum erst unter König Erik IX. dem Heiligen (1156–1160) endgültig besiegt und das Christentum unwiderruflich als offizielle Religion etabliert. Mit der Errichtung des Erzbistums Uppsala im Jahre 1164 war die Christianisierung Schwedens im Wesentlichen abgeschlossen.
Lange Zeit blieb das Königtum in Schweden eine Wahlmonarchie. Der schwedische König wurde auf der Thingversammlung in Uppland durch Akklamation, also durch Beifall oder Handzeichen, gewählt und musste anschließend auf einem großen Umritt die Gefolgschaftstreue derjenigen Untertanen einholen, die bei seiner Wahl nicht zugegen gewesen waren.
Die Einbindung des Ostseeraums in das christliche Europa