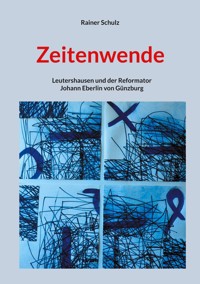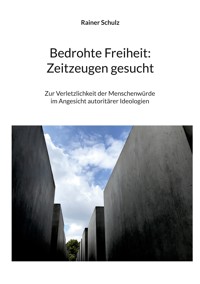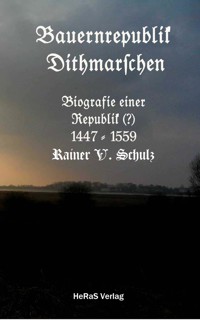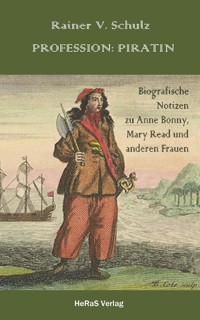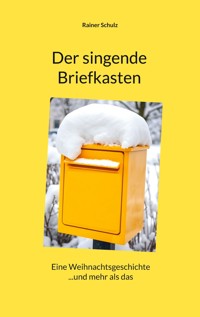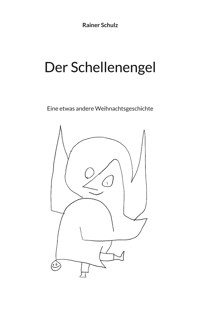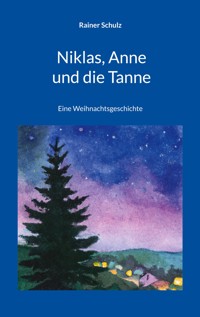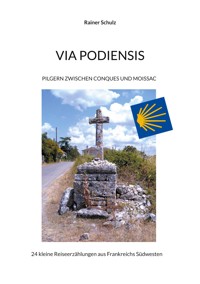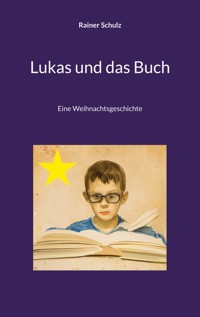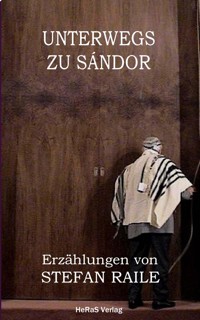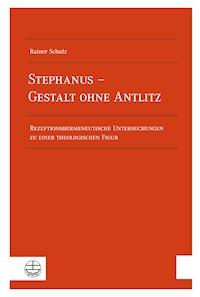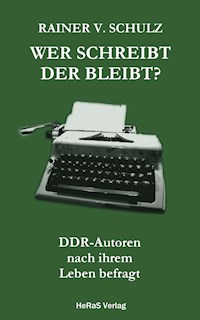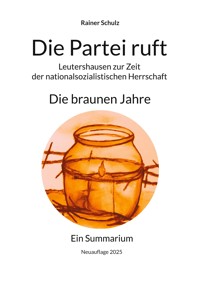
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch präsentiert eine kompakte Zusammenfassung der preisgekrönten, im Team entwickelten sechsbändigen Archiv-Dokumentation "Die Partei ruft". Im Fokus steht exemplarisch das Alltagsleben im mittelfränkischen Leutershausen während der NS-Zeit. Die Studie beleuchtet u.a.: die Durchsetzung der NS-Ideologie in allen Lebensbereichen, die Rolle von Organisationen wie HJ, BDM, SA und NS-Frauenschaft, die Verfolgung der jüdischen Gemeinde, Rechtsprechung, wirtschaftliche Verhältnisse und Kriegsauswirkungen, den Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945. Basierend auf umfangreichem Quellenmaterial aus dem Stadtarchiv Leutershausen und der Fränkischen Zeitung, zielt die Studie auf eine kritische Aufarbeitung der lokalen NS-Geschichte ab. Im November 2024 wurde die Dokumentation mit dem renommierten Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis der Evang.-Luth. Kirche in Bayern ausgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Abb. 1: Rainer Schulz (Autor)
Rainer Schulz, geboren 1954, Dr. theol., war evang. Gemeindepfarrer in Bayern und Chile (Punta Arenas, 1986– 1995). Für seinen Einsatz für Frieden und Gewissensfreiheit in Chile erhielt er die Friedensmedaille der röm.-kath. Kirche. Er promovierte an der AHS Neuendettelsau mit einer Dissertation über den biblischen Märtyrer Stephanus. Die mehrbändige Dokumentation „Die Partei ruft“ wurde von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern im November 2024 mit dem Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis gewürdigt.
INHALT
Einführung
1. Die Macht der Partei
1.1. NS-Ideologie: Verbreitung und Durchsetzung
1.2. Der Aufstieg der nationalsozialistischen Partei
1.3. Einfluss von NSDAP-Vertretern von aussen
1.4. Der Einfluss der NSDAP auf die Kommunalpolitik
1.5. Die Rolle der Bürgermeister
1.6. NS-Ämter und Amtsträger in Leutershausen
1.7. NSDAP-Amtsträger, -mitglieder, -Gliederungen
1.8. Aufforderung zur NS-Loyalität
1.9. Widerstand gegen den Nationalsozialismus?
1.10. Adolf Hitler
2. Symbole der Macht
2.1. Fahnen
2.2. Hakenkreuz
2.3. Die Rolle von Uniformen
2.4. Visuelle Repräsentation der Diktatur
3. Zielgruppen der NS -Indoktrination – Beispiele
3.1. Kinder
3.2. Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel
3.3. Frauen und Frauenverbände
3.4. Arbeitsmaiden und Reichsarbeitsdienst (FAD / RAD)
4. Rechtsprechung
4.1. Rechtsprechung bzw. -beugung
4.2. Bedrohte „Volksgemeinschaft“
4.3. Todesstrafe
5. Juden
5.1. Kurzer historischer Rückblick
5.2. Antisemitische Kontrolle und Unterdrückung
5.3. Die Rolle des Stadtrats im Umgang mit Juden
5.4. Im Widerstand: Martin Ansons Erfahrungen
6. Kirche
6.1. Anpassung und Unterstützung des NS-Regimes
6.2. Widerstand und Kritik
6.3. CVJM
7. Wohnen, Ernährung. Gesundheit
7.1. Wohnungsbau während der NS-Zeit
7.2. Gesundheit und Ernährung
7.3. NS-Volkswohlfahrt (NSV)
7.4. Umgang mit Krankheit und Behinderung
8. Broterwerb
8.1. Das landwirtschaftliche Leben
8.2. Märkte
8.3. Handel und Ladengeschäfte
9. Kultur, Bildung, Erziehung
9.1. Theater- und Musikveranstaltungen
9.2. Lieder
9.3. Sport
9.4. Fahrten und Ausflüge
9.5. Der Einfluss der NS-Ideologie auf den Schulalltag
10. Krieg
10.1. Relevanz und Auswirkungen des 1. Weltkrieges
10.2. Vom 1. Weltkrieg zum Aufstieg der NSDAP
10.3. Militärische Präsenz
10.4. Kriegsvorbereitungen und Auswirkungen
10.5. Auswirkungen des Krieges auf das Stadtleben
10.6. Sammlungen zur Unterstützung des Kriegs
10.7. Die Bombardierung von Leutershausen
10.8. Wiederaufbau und pragmatische Notwendigkeiten
10.9. Kriegsopfer
11. Umsiedlungen
11.1. Wolhynien-Deutsche
11.2. Bessarabien-Deutsche
11.3. Bukowina-Deutsche
12. Kriegsgefangene und Fremdarbeiter
12.1. Kriegsgefangene
12.2. Fremdarbeiter / Ostarbeiter
13. Flüchtlinge, Evakuierte, Heimkehrer
13.1. Flüchtlinge und Evakuierte
13.2. Heimkehrer und Vermisste
14. Aufarbeitung: Umgang mit der NS-Vergangenheit
14.1. Nachkriegszeit: Herausforderungen und Massnahmen
14.2. Wie „braun“ war Leutershausen?
14.3. Gedenken und Erinnerungskultur
15. Zeitleiste: Politische Ereignisse − eine Auswahl
Übergabe der NS-Doku an die Stadt Leutershausen
Preisverleihung für die Doku „Die Partei ruft“
Abbildungen
Register: Personennamen
Nachwort: Jede Diktatur stirbt an sich selbst
EINFÜHRUNG
■ Zur Archiv-Dokumentation „Die Partei ruft“
Diesem Buch liegt eine 1200 Seiten umfassende, aus Datenschutzgründen nichtöffentliche Archiv-Dokumentation zugrunde. Deren Titel lautet: „Die Partei ruft − Leutershausen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft“.
Im Februar 2024 wurde diese Dokumentation nach zweijähriger Arbeit im Team mit Karlheinz Seyerlein (Leutershausen) und Stefan Diezinger (Jochsberg) fertiggestellt. Im November 2024 wurde sie in München mit dem Wilhelm-Freiherr-von-Pechmann-Preis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in der Kategorie „Wissenschaft“ ausgezeichnet.
Der Dokumentationstitel „Die Partei ruft“ greift einen am 31. Oktober 1941 in der Fränkischen Zeitung (FZ) erschienen Artikel auf, der mit der Losung „Die Partei ruft“ beginnt und mit „Führer befiehl, wir folgen!“ endet.
Erklärtes Ziel der Archiv-Dokumentation war und ist es, Material für eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Lebens in Leutershausen zur Zeit der NS-Diktatur bereitzustellen. Sie entstand aus dem langjährigen Bestreben des Stadtrates Leutershausen und seines Arbeitskreises „Gedenken“, eine solche Aufarbeitung zu ermöglichen.
Die Bände der Dokumentation setzen die folgenden Schwerpunkte:
Band 1
dokumentiert die kommunale Politik und Verwaltung Leutershausens anhand der städtischen Bekanntmachungen während der Jahre 1932 bis 1949.
Band 2
(wegen seines Material-Umfangs in
2 Teilbänden
auftretend) bietet durch einen Pressespiegel (v. a.: Fränkische Zeitung, 1930 bis 1948) umfassende Einblicke in das alltägliche Leben der Leutershausener Stadt- und Landbevölkerung sowie die örtliche Propaganda der NSDAP.
Band 3
untersucht den kommunalen Bedeutungszuwachs der NSDAP und die Mechanismen ihrer Machtergreifung im Alltag der Menschen.
Band 4
dokumentiert die Geschichte der jüdischen Gemeinde, ihre Demütigung, Entrechtung, Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung.
Band 5
beleuchtet den demokratischen Neuaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die späteren Formen eines Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.
■ Die befragten Quellen
Die Archiv-Dokumentation „Die Partei ruft“, nun zusammengefasst im vorliegenden „Summarium“, verdankt ihren Inhalt wesentlich Dokumenten aus dem Stadtarchiv Leutershausen. Beispiele dafür sind städtische Bekanntmachungen, Korrespondenzen, Protokolle, Statistiken, Dokumente zur Entnazifizierung wie Meldebögen oder Spruchkammerakten.
Darüber hinaus gibt ein „Pressespiegel“ Auskunft über Alltag und NS-Propaganda in Leutershausen (Teilbände 2-1 und 2-2). Er bezieht sich vor allem auf Artikel der „Fränkischen Zeitung“.
Darüber hinaus verweist die Dokumentation auf zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, die sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus befassen. Gelegentlich wurden auch Internetquellen herangezogen, etwa um bestimmte Begriffe oder Ereignisse zu erläutern. Visuelle Elemente wie Fotografien von Dokumenten ergänzen den Text.
Die Zusammenführung all dieser Archivalien in der Archiv-Dokumentation „Die Partei ruft“ schafft eine konkrete Grundlage für weitere Forschungsarbeiten. Sofern ein direkter Zugang zu den Originalquellen für wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist, besteht die Möglichkeit, die Dokumentation nach Genehmigung durch die Archivleitung im Stadtarchiv Leutershausen persönlich einzusehen. Eine Ausleihe ist nicht möglich.
■ Zu diesem Buch
Das Buch ist so konzipiert, dass seine einzelnen Kapitel je nach Interesse hintereinander oder in loser Reihenfolge aufgerufen und gelesen werden können.
Jedes Kapitel greift ausgewählte Themenbereiche der „großen“ Dokumentation heraus und fasst sie handlich zusammen. Aus Tausenden von ursprünglich befragten Quellen wurden dafür nun etwa 300 ausgewählt und zitiert.
Das Summarium richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich über die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Leutershausen informieren möchten, aber nicht die Möglichkeit haben, sich im Detail mit den mehr als zahlreichen, oft in Sütterlin oder Fraktur geschrieben Archivalien zu befassen, die der „großen“, nichtöffentlichen Archiv-Dokumentation zugrunde liegen.
Hinweis für Eilige:
Vor jedem Kapitel steht eine kurze Zusammenfassung seines Inhalts. Für einen allerersten Überblick hilft die rasche Lektüre dieser Absätze.
Umrahmte Abschnitte, die mit „Näheres dazu“ überschrieben sind, lassen sich zunächst überspringen. Allerdings enthalten gerade sie wichtige Erläuterungen von Begriffen, Beispielen aus dem Alltagsleben der Stadt- und Landbevölkerung und Originalzitate aus Presse und städtischen Archivalien.
Zur vorliegenden überarbeiten Auflage
Die vorliegende Auflage unterscheidet sich von der ursprünglichen aus dem Jahr 2024 vor allem durch die Beseitigung von Druckfehlern. Abgesehen von kleineren orthographischen Unebenheiten betrifft dies einige wenige sachliche Korrekturen, vertippte Kalenderdaten und Fehleinordnungen in der „Zeitleiste“ am Ende des Buches.
Rainer Schulz
„Die Partei ruft“ Leutershausen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft
1. DIE MACHT DER PARTEI
Darum geht es in diesem Kapitel:
Wie überall erlangte die NSDAP auch in Leutershausen ihre Macht durch die effektive Verbreitung und Durchsetzung ihrer Ideologie. Eine zentrale Rolle spielten dabei die Vielzahl nationalsozialistischer Organisationen sowie der gezielte Einsatz bestimmter Symbole und Rituale, um die NS-Ideologie im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Die lokale Presse, insbesondere die Fränkische Zeitung (FZ), diente als Propagandainstrument, um über Veranstaltungen und Ziele der Partei zu informieren und die nationalsozialistische Weltanschauung zu verbreiten. Parteiveranstaltungen demonstrierten Macht und Stärke. Der Einfluss auf die Kommunalpolitik zeigte sich in der Kontrolle der Gemeinderäte und der Gleichschaltung aller Lebensbereiche. Widerstand regte sich kaum, abgesehen von vereinzelten kritischen Oppositionsäußerungen.
1.1. NS-IDEOLOGIE: VERBREITUNG UND DURCHSETZUNG
Die befragten Quellen zeigen, wie die NS-Ideologie in Leutershausen wirksam propagiert und durchgesetzt wurde. Dazu dienten verschiedene Maßnahmen wie die Beeinflussung der Jugend oder die Einbindung der Bevölkerung in nationalsozialistische Organisationen. Bestimmte Symbole und Rituale spielten dabei eine eigene propagandistische Rolle.
■ Die Rolle der Medien
Die damals lokal viel gelesene „Fränkische Zeitung“ (FZ) wurde zunehmend zum Sprachrohr der NSDAP. Ihre Berichterstattung war einseitig auf die Erfolge des Regimes ausgerichtet.
Besonders auffällig sind beispielsweise Zitate aus Artikeln des von Julius Streicher herausgegebenen antisemitischen Blattes „Der Stürmer“. Dessen Publikationen trugen wesentlich zur Verbreitung des Judenhasses bei.
1. Näheres dazu:
Julius Streicher (1885–1946) war ein einflussreicher Gauleiter der NSDAP in Franken und der Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“. Seine aggressive Verbreitung von rassistischer und antisemitischer Propaganda war ein zentraler Bestandteil seiner politischen „Karriere“.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchte Streicher, sich als „Kunstmaler Seiler“ zu tarnen, wurde jedoch in Tirol verhaftet.
Im Nürnberger Prozess wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 hingerichtet.
Der Rundfunk wurde als wichtiges Propagandainstrument eingesetzt, um insbesondere die kommunikationstechnisch oft vom Weltgeschehen abgeschnittene Landbevölkerung direkt zu erreichen und ideologisch zu beeinflussen.
2. Näheres dazu:
Die Übertragung von Reden, insbesondere von Adolf Hitler, spielte eine zentrale Rolle in der nationalsozialistischen Propaganda. Ein Beispiel unter mehreren ähnlichen ist die Übertragung einer „Führerrede“ am 1. Mai 1935. (FZ 3. Mai 1935)
Auch die städtischen Bekanntmachungen der Stadt Leutershausen, die traditionell mit einer Handglocke „ausgeschellt“ wurden, dienten der Verbreitung von Anweisungen und Verordnungen des NS-Regimes.
3. Näheres dazu:
Bereits im Jahr 1933 enthalten die amtlichen Bekanntmachungen Aufrufe zu Wahlversammlungen (städtisch Bekanntmachung 26. Oktober 1933) oder zu Werbeabenden der nationalsozialistischen Jugendverbände. (Städtische Bekanntmachungen 30. November 1933).
Reichszuschüsse für landwirtschaftliche Instandsetzungsarbeiten werden angeboten (städtische Bekanntmachung 1. April 1934) oder verbilligte Fahrten zu Ausstellungen des Reichsnährstandes nach Hamburg (städtische Bekanntmachung 6. Mai 1935). Gleichzeitig werden Musterungstermine und Gestellungsaufrufe für den Arbeits- und Wehrdienst prominent verkündet (städtische Bekanntmachung 1, Juni 1935)
Mit dem Beginn des Krieges dominieren kriegsbedingte Themen die städtischen Bekanntmachungen. Meldungen über die Einquartierung von Soldaten (städtische Bekanntmachung 7. Juli 1940) und die Sammlung von Kleidern für die Front (städtische Bekanntmachung 21. Juni 1942) spiegeln die Herausforderungen der Kriegswirtschaft wider.
Nach dem Krieg beschäftigen sich die städtischen Bekanntmachungen u. a. mit den Herausforderungen des Wiederaufbaus, der Ausgabe von Lebensmittelkarten (städtische Bekanntmachung 6. Dezember 1945) oder der Ausgabe von Saatkartoffeln (städtische Bekanntmachung 18. Februar 1946).
Regelmäßige Kundgebungen und Versammlungen der NSDAP waren ein weiteres Mittel zur Propagierung der Ideologie. Redner wie der berüchtigte „Frankenführer“ Julius Streicher oder Karl Holz trugen dazu bei, antisemitische Hetze zu verbreiten und die Bevölkerung für die Ziele des Regimes zu mobilisieren.
In den FZ-Berichten wurde – vermutlich eher realitätsfern – immer wieder geschildert, dass die Auftritte von Streicher und Holz stets und überall mit „brausenden Heilrufen“, „gewaltigem Jubel“, „starkem“, „reichem“, „lang anhaltendem“ Beifall“ und „stürmischer Zustimmung“ beantwortet worden seien.
4. Näheres dazu:
Karl Holz (1895-1945) war der Stellvertreter von Julius Streicher. Er reiste unermüdlich durch die Region und hielt zahlreiche Reden und Versammlungen ab, um die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten und die Bevölkerung für die Ziele des Regimes zu mobilisieren.
Wie Streicher war Holz ein fanatischer Antisemit und nutzte seine Plattform, um gegen „das Weltjudentum“ zu hetzen und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung voranzutreiben.
Holz war lange Zeit Schriftleiter des „Stürmer“, des berüchtigten antisemitischen Hetzblatts von Julius Streicher. Holz bereicherte sich wie Streicher im 1938er-Pogrom persönlich.
Im Jahr 1934 wurde die Schillingsfürster Straße in „Karl-Holz-Straße“ umbenannt. Holz starb 1945 als Führer von Stoßtrupps der Wehrmacht und des Volkssturms in Nürnberg.
■ Bevölkerung und NS-Organisationen
Die Hitlerjugend (HJ) und der Bund Deutscher Mädel (BDM) spielten eine entscheidende Rolle bei der Indoktrinierung der Jugend. Durch regelmäßige Versammlungen, Appelle, Sportwettkämpfe und paramilitärische Übungen wurden die Jugendlichen auf die Ziele des Regimes eingeschworen und zum Gehorsam erzogen.
5. Näheres dazu:
Ein Bericht über die Gründung einer Hitler-Jungvolk-Abteilung in Frommetsfelden im Jahr 1933 unterstrich die Bedeutung des „nationalen und kameradschaftlichen Geistes“ und stellte den „unverbrüchlichen Gottesglauben“ als „heiligstes Gut“ über alles. (FZ 12. Mai 1933)
Im Lauf der Jahre wurde die HJ immer präsenter im öffentlichen Leben. Sie nahm an Festen und Veranstaltungen teil, wie dem „Fest der deutschen Jugend“ im Jahr 1934 (städtische Bekanntmachung 22. Juni 1934) oder der Sonnwendfeier mit Kriegstotengedenken im Jahr 1936 (FZ 30. Juni 1936).
Zur „Eingliederung“ der evangelischen Jugend berichtet die FZ im März 1934:
„Am Sonntag zogen die Hitlerjugend und evangelische Jugend unter Vorantritt der hiesigen Sturmkapelle zur Kirche, wo die Eingliederung der evangelischen Jugend ihre Weihe fand.Pfarrer Fries wies in seiner Predigt auf die große Bedeutung der Eingliederung hin und ermahnte die Jugend zu treuester Pflichterfüllung und Hingabe für Volk und Vaterland. Der Posaunenchor wirkte bei der erhebenden Feier mit. Anschließend an den Gottesdienst durchzogen die gesamten Jugendverbände unter klingendem Spiel die Straßen unserer Stadt.“Das Schulwesen wurde auf die NS-Ideologie ausgerichtet; Lehrer waren verpflichtet, ihre Schüler im Sinne des Regimes zu erziehen.
Die NSDAP und ihre zahlreichen Gliederungen wie die SA (Sturmabteilung), die NS-Frauenschaft und der Reichsarbeitsdienst (RAD) drängten die Bürger, sich aktiv am Aufbau des nationalsozialistischen Staates zu beteiligen.
6. Näheres dazu:
Die Hitlerjugend (HJ) war eine zentrale Organisation im nationalsozialistischen System, die junge Menschen im Sinne der NS-Ideologie erziehen wollte. Sie bot Aktivitäten wie Sport, Geländespiele, Märsche und politische Schulungen an, um die Jugendlichen auf ihren Einsatz für das Regime vorzubereiten.
Die HJ Leutershausen war in verschiedene Altersgruppen unterteilt und gehörte zum „Bann 319“ der Region Ansbach/Franken. Sie nahm aktiv am öffentlichen Leben teil, organisierte Veranstaltungen und war in die Kriegswirtschaft eingebunden.
Die „Motor-HJ“ und Elternabende verdeutlichen ihre vielfältigen Aktivitäten. Obwohl die Mitgliedschaft offiziell freiwillig war, übte die HJ großen sozialen Druck aus. Sie bot den Jugendlichen Gemeinschaft und Abenteuer, diente aber in Wirklichkeit der Indoktrination und Kriegsvorbereitung.
Die Anwesenheit von HJ-Gruppen aus anderen Regionen, wie z. B. 80 Hitlerjungen aus dem Saargebiet (FZ 7. September 1935), zeigt die überregionale Vernetzung.
Bund Deutscher Mädel (BDM): Die befragten Quellen bieten umfassende Informationen über den Bund Deutscher Mädel (BDM) in Leutershausen und dessen Einfluss auf das Leben von Mädchen und jungen Frauen. Der BDM war die weibliche Jugendorganisation der NSDAP, die Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erziehen und auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereiten sollte. Die Organisation bot Aktivitäten wie Hauswirtschaft, Handarbeit, Sport, Singen und politische Schulungen an, um die Mädchen auf ihre Rolle in der „Volksgemeinschaft“ vorzubereiten.
Der BDM nahm aktiv an Veranstaltungen wie dem 1. Mai, Helden-Gedenkfeiern oder z. B. einem „Werbeabend“ der NS-Frauenschaft 1934 (FZ 17. März 1934). Der BDM nahm zudem an „Reichsberufswettkämpfen“ teil, um Mädchen beruflich zu fördern; 1935 nahmen 66 Mädchen aus Leutershausen daran teil (FZ 22. März 1935). Die Organisation arbeitete eng mit anderen nationalsozialistischen Gruppen wie der NS-Frauenschaft zusammen.
Die SA war eine paramilitärische Organisation der NSDAP und spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten. Sie sorgte bei Versammlungen für Ordnung und propagierte die Ideologie durch Aufmärsche und Kundgebungen. In Leutershausen war die SA in verschiedene Stürme unterteilt, die jeweils für bestimmte Gebiete zuständig waren.
Die NS-Frauenschaft (NSF) hatte die Aufgabe, Frauen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu mobilisieren. In Leutershausen wurde sie 1933 gegründet und umfasste zahlreiche Mitglieder. Ihre Aktivitäten reichten von Schulungsabenden über Handarbeiten bis hin zu Muttertagsfeiern und Nähkursen.
Der Reichsarbeitsdienst (RAD), gegründet 1935, verpflichtete junge Männer und Frauen zu einem sechsmonatigen Arbeitsdienst. Ziel war es, sie zu „Volksgenossen“ zu erziehen und sie auf den Kriegseinsatz vorzubereiten. In Leutershausen wurde ein RAD-Lager für weibliche Jugendliche eingerichtet, das im ehemaligen Landgerichtsgebäude untergebracht war. Die „Arbeitsmaiden“, wie die weiblichen RAD-Angehörigen genannt wurden, arbeiteten vor allem in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft.
Der Reichsnährstand unter Richard Walther Darré spielte eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung der Ideologie auf dem Land, indem er Bauern als „Fundament des Volkes“ idealisierte und sie auf den Krieg vorbereitete.
Zahlreiche Feiern wie der Tag der nationalen Solidarität oder Heldengedenkfeiern dienten der Propagierung der NS-Ideologie und der Mobilisierung der Bevölkerung. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, ihre Häuser zu bestimmten Anlässen mit Hakenkreuzfahnen zu beflaggen, um die Allgegenwart des Regimes zu demonstrieren.
1.2. DER AUFSTIEG DER NATIONALSOZIALISTISCHEN PARTEI
Die befragten Quellen zeichnen ein detailliertes Bild davon, wie sich die NSDAP zwischen 1933 und 1945 in Leutershausen etablierte und die Kontrolle über das gesellschaftliche und politische Leben der Stadt erlangte.
■ Vor 1933: Ein fruchtbarer Boden für die NSDAP
Bereits vor 1933 stieß die NSDAP in Leutershausen auf breite Zustimmung in der Bevölkerung. Bei der Reichstagswahl 1932 erhielt die NSDAP in Leutershausen laut städtischer Bekanntmachung 86% der Stimmen, was der Stadt schon früh den zweifelhaften Ruf einer „Parteihochburg“ einbrachte.
7. Näheres dazu:
Die Reichstagswahl vom Juli 1932 führte zu einem Patt im Parlament, da die NSDAP zwar die meisten Stimmen erhielt, aber nicht genügend, um eine Regierung zu bilden. Da keine Partei eine parlamentarische Mehrheit erreichen konnte, wurden für November 1932 Neuwahlen ausgerufen. Die beiden Reichstagswahlen waren entscheidend für den Aufstieg der NSDAP. Die folgenden stichpunktartigen Hinweise spiegeln die Vielfalt und zugleich Uneinigkeit bzw. Kleinteiligkeit der Parteienlandschaft wider:
Im März 1932 sprach Oberleutnant a.D. Dechant vom paramilitärischen „Stahlhelm“ in Ansbach auf einer Wahlkampfveranstaltung des Kampfblocks Schwarz-Weiß-Rot zur Reichspräsidentenwahl. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Bund der Frontsoldaten, der Deutsch-Nationalen Volkspartei und dem Bayerischen Landbund organisiert. Es musizierte die Stahlhelm-Kapelle Ansbach. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde der Stahlhelm in die SA eingegliedert. (FZ 5. März 1932) Im April 1932 hielt der Landwirt (Johann?) Arnold aus Deßmannsdorf (Sachsen bei Ansbach) eine Rede im Müllerschen Gasthaus in Jochsberg, in der er sich gegen das „schwarz-rote System“ positionierte, d. h. sich gegen eine demokratisch orientierte Koalition der sozialistischen SPD („rot“) und die katholische geprägte Zentrumspartei („schwarz“) aussprach. Der anwesende Leutershausener NSDAP-Ortsgruppenführer Wilhelm Bächner kritisierte seinerseits den Landbund für dessen wechselnden politischen Kurs. (21. April 1932). Im November 1932 hielt Dr. Fischer, ein Redner aus Nürnberg, eine Versammlung des Bayerischen Landbunds in Petersaurach ab. Er forderte die Anwesenden auf, am 6. November für die Liste der Deutschnationalen zu stimmen. (FZ 4. November 1932) Eine für den 6. September 1930 geplante Wahlversammlung der 1930 gegründeten mittelständischen Wirtschaftspartei in Leutershausen musste aufgrund zu geringer Beteiligung abgesagt werden. (FZ 3.9.1940) Die NSDAP führte kurz vor der Reichstagswahl im November 1932 mehrere Wahlversammlungen durch, z. B. in Winden, Oberramstadt, Röthenbach, Auerbach, Meuchlein, Höchstetten usw.: „Ueberall zeigte sich sehr guter Besuch und reges Interesse für die die Idee Adolf Hitlers.“ (FZ 1932-11-04)■ Die „Machtergreifung“ und die Konsolidierung der Macht:
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 festigte die NSDAP rasch ihre Macht im ganzen Land, so auch in Leutershausen. Der Stadtrat, der Hitler bereits 1932 die Ehrenbürgerwürde verliehen hatte, unterstützte die neue Regierung aktiv.
Der Marktplatz wurde 1934 in Adolf-Hitler-Platz und die Schillingsfürster Straße vom Schlumpfschen Anwesen bis zur Hohen Brücke in Karl-Holz-Straße umbenannt.
8. Näheres dazu:
Der Gauleiter Julius Streicher und nationalsozialistische Politiker wie Wilhelm Stegmann verbreiteten die nationalsozialistische Ideologie in der Region – und das mit Nachdruck.
9. Näheres dazu:
Wilhelm Stegmann (1899-1944) war SA-Führer und von 1930 bis 1933 Reichstagsabgeordneter der NSDAP. In den frühen Jahren des Nationalsozialismus wirkte er aktiv an der Parteiorganisation mit. 1932 hielt Stegmann bei einer NSDAP-Kundgebung in Leutershausen eine Rede über „Zweck und Ziel der SA“. (FZ 6. Juni 1932), Im April 1932 (FZ 20. April 1932) sprach Stegmann bei der Beerdigung eines „Hitlerjungen“ in Leutershausen. Ebenfalls 1932 begrüßte er den aus der Haft entlassenen SA-Führer von Leutershausen, Michael Fleischmann, bei einer Versammlung und sprach über die Rolle der SA im „kommenden Dritten Reich“. (FZ 6.Juni 1932)
Stegmann war bekannt für seine aggressiven SA-Ausschreitungen, die sich auch gegen die Landpolizei richteten. Die Polizei sah sich überfordert und konnte sich gegen die Übergriffe nicht durchsetzen.
Als einige SA-Randalierer verhaftet werden sollten, reagierten Teile der Bevölkerung in Leutershausen mit einer drohenden Haltung gegenüber der Polizei. (Rainer Hambrecht, Die braune Bastion, 2017, 210f.)
Die NSDAP-Ortsgruppe unter der Leitung von Personen wie Wilhelm Bächner und später Joseph Rattler spielte eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der nationalsozialistischen Politik auf lokaler Ebene.
10. Näheres dazu:
Wilhelm Bächner war Ortsgruppenführer der NSDAP in Leutershausen.
Im Jahr 1932 leitete er eine NSDAP-Versammlung in Jochsberg. (FZ 28. Januar 1932)
Im Jahr 1933 veröffentlichte Bächner Erklärungen in der Fränkischen Zeitung zu den Vorgängen in der NSDAP in Franken im Zusammenhang mit dem „Fall Stegmann“. Er hob die Wichtigkeit der Treue zu Adolf Hitler hervor und warnte vor parteischädigenden Handlungen. (FZ 2. April 1933)
Bächner organisierte auch einen Vortrag des Reichstagsabgeordneten Schemm aus Bayreuth zum Thema „Der Kampf um die Deutsche Freiheit und Kultur“. (FZ 6. Juni 1932)
Oberförster Joseph Rattler war Mitbegründer der NSDAP-Ortsgruppe Leutershausen und bis 1942 leidenschaftlicher Ortsgruppenleiter.
Sein Engagement zeigte sich z. B. in der Teilnahme an Schulungsabenden, bei denen er Veranstaltungen eröffnete und die Ideologie der NSDAP propagierte. Er starb im März 1944 im Alter von 66 Jahren. (FZ 3. September 1944)
In den befragten Quellen werden verschiedene Maßnahmen der NSDAP beschrieben, die dazu dienten, die Kontrolle der Partei zu festigen und die Bevölkerung zu mobilisieren.
Dazu gehörten
regelmäßige Versammlungen und Appelle,
die Verbreitung von Propaganda durch Zeitungen und Flugblätter
sowie die Einrichtung von NS-Organisationen wie der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel.
Die NSDAP nutzte auch die wirtschaftliche Notlage der Zeit, um Unterstützung zu gewinnen. Dies erfolgte beispielsweise durch die Organisation von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Arbeitseinsätzen sowie die Verteilung von Hilfsgütern im Rahmen des Winterhilfswerks.
11. Näheres dazu:
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Arbeitseinsätze waren u. a. der „Freiwillige“ Arbeitsdienst (FAD. Beispiele: Instandsetzung des Luitpoldhains und des Sportplatzes, Regulierung der Altmühl und Ausbau von Verbindungswegen), Pflichtarbeitseinsätze für Arbeitslose, Krisen- und Wohlfahrtsunterstützungsempfänger (Beispiel: die Instandsetzung des Fußweges entlang der Bezirksstraße nach Wiedersbach), Bauprojekte (Beispiele: Umbau des Rathauses und der Ausbau der städtischen Badeanstalt), Reichsarbeitsdienst (RAD) für die weibliche Jugend („Arbeitsmaiden“).
Das Winterhilfswerk (WHW) war eine nationalsozialistische Wohlfahrtsorganisation, die bedürftigen „Volksgenossen“ Unterstützung bot. Diese Aktion diente nicht nur der materiellen Hilfe, sondern auch der ideologischen Festigung des Regimes, indem sie das Bild einer fürsorglichen Gemeinschaft propagierte.
■ Die Gleichschaltung der Gesellschaft:
Der Begriff der „Gleichschaltung“ bezeichnet den Prozess der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933, welcher eine umfassende Kontrolle aller Bereiche des öffentlichen Lebens zur Folge hatte. Dieser Prozess umfasste
die Abschaffung demokratischer Institutionen,
die Auflösung oder Übernahme von Parteien, Verbänden und Vereinen
sowie die Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Dies betraf z. B. den Stadtrat Leutershausen, der auf Grundlage des „Gleichschaltungsgesetzes“ unter der Aufsicht des zum Wahlleiter ernannten Bürgermeisters Faatz neu zu bilden war und nun von der NSDAP kontrolliert wurde („Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 31. März 1933).
12. Näheres dazu:
Beispiele gleichschaltender Maßnahmen, um eine durchgehende NS-Ideologisierung der Gesellschaft zu erreichen:
Gleichschaltung der Arbeitswelt: Die Deutsche Arbeitsfront (DAF) organisierte Schulungen (z. B. für Handwerker und Gewerbetreibende, Buchführungskurse zur Anwendung der „Einheitsbuchführung“, Abschlüsse, Abzüge für Steuerberechnungen und das Waren-Eingangsbuch, usw., oder Schnellkurse zur Führerscheinprüfung für Kleinkrafträder) und kontrollierte das Versicherungs- und Unterstützungswesen (die befragten Quellen erwähnen Krankenversicherung, Erwerbslosen-, Unfall-, Heirats-, Arbeitsopfer-, Invaliden- und Notfallunterstützung).
Kontrolle der Freizeitgestaltung: Kraft durch Freude (KdF) organisierte Reisen und kulturelle Angebote, um die Freizeit im Sinne der NS-Ideologie zu gestalten und den „Frohsinn“ des deutschen Arbeiters zu fördern. Ausflüge führten Leutershausener Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel nach Norwegen (1936), zum Fasching nach Rothenburg (1937) oder in die Fränkische Schweiz (1937). KdF lud ein zu Weinfesten und anderen Treffen, oft verbunden mit Tanz – Meldung 1937: „Wer wollte auch nicht fröhlich sein? Im Kaffee Dürnhöfer traf man sich und wer nicht rechtzeitig kam, fand keinen Platz mehr. Lachen und Frohsein war die Parole des Abends. Eine feine Musik paßte sich der Fröhlichkeit an.“ (FZ 8. November 1937).
Propaganda und Mobilisierung: NSDAP-Redner auf Versammlungen und Kundgebungen behandelten politische Themen, während Schulungsabende für Parteimitglieder die ideologische Schulung intensivierten.
Ideologisierung der Jugend: Die Hitlerjugend (HJ) und der Bund Deutscher Mädel (BDM) indoktrinierten Kinder und Jugendliche durch Veranstaltungen und Schulungen, z. B.:
Wochenendschulungen für die HJ-Führerschaft (z. B. 1939 in Leutershausen, 1941 in Colmberg und Lehrberg), Ausbildungskurse für Unterführer und Führer (Antritt in Uniform; mitzubringen waren Bücher wie Hitlers „Mein Kampf“ u.a.m.), Schulungen in Lagern Arbeitslager (z. B. Pfingstlager 1942 in Eyb; 1942 Arbeitslager für alle Jungen und Mädchen, „gleichgültig ob sie der Hitlerjugend angehören oder nicht“), Schulung durch praktische Tätigkeiten, spezifische Schulungen (Schießübungen, Geländedienst und Sport; technische Schulungen der Motor-HJ).Abb. 3: „Hoheitszeichen“ am Rathaus Leutershausen (FZ 1934)
■ Aufforderung zur Unterstützung von Kriegsanstrengungen
Die kriegerische Überfallpolitik Hitlers, welche im September 1939 den Zweiten Weltkrieg auslöste, führte zu einer Verstärkung des Einflusses der NSDAP in Leutershausen. Die Partei nutzte die patriotische Stimmung, um ihre Macht weiter zu festigen.
Der Appell an Patriotismus, Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaft stellte ein zentrales Element dieser Propaganda dar.
Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, die Kriegsanstrengungen zu unterstützen.
13. Näheres dazu:
Die befragten Quellen erwähnen z. B.
Finanzielle Unterstützung: Sammlungen für das Winterhilfswerk u. a. m.Materielle Unterstützung: Abgabe von Materialien, die für die Kriegsführung benötigt wurden (z. B. Sammlungen von Altmaterial und Spinnstoffen).Moralische Unterstützung: Häuserbeflaggung 1939 anläßlich der Annexion (bzw. „Rückkehr zum Reich“) des Memellandes oder Empfang von Truppen (vgl. z. B. eine städtische Bekanntmachung vom 20. Juli 1940: „Voraussichtlich am kommenden Montag trifft ein Bataillon Infanterie ein, um hier Quartier zu nehmen. Die Soldaten haben die schweren Kämpfe und gewaltige Märsche in Frankreich hinter sich. Sie kehren als Sieger in die Heimat zurück und sollen sich nun von den überstandenen Strapazen und dem Schweren, das sie erlebten, erholen.“)Aktive Teilnahme: Im Jahr 1940 wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, „Opfer für Deutschlands Sieg“ zu bringen und „aus Vaterlandsgefühl und anständiger Gesinnung“ Quartiere für Rückwanderer bereitzustellen. Im Jahr 1943 wurden „Säumige“ zum Arbeiten aufgefordert, um „die kämpfenden Soldaten an der Front“ nicht „im Stich zu lassen“.■ Antisemitismus
Antisemitismus, eines der zentralen Element der nationalsozialistischen Ideologie, gab es auch in Leutershausen (vgl. dazu besonders den Abschnitt „Juden„, Seite →):
Bereits vor 1933 kam es zu antisemitischen Ausschreitungen und Hetzkampagnen gegen die jüdische Gemeinde der Stadt.
Nach der sogenannten „Machtergreifung“ verschärfte sich die gezielte Diffamierung der Juden dramatisch.
Jüdische Geschäfte wurden boykottiert, jüdische Bürger aus Vereinen und öffentlichen Ämtern ausgeschlossen und jüdisches Eigentum arisiert.
Die Pogromnacht am 16. Oktober (!) 1938 markierte einen Höhepunkt der Gewalt gegen Juden in Leutershausen.
1.3. EINFLUSS VON NSDAP-VERTRETERN VON AUßEN
Die Auswertung der befragten Quellen lässt den Schluss zu, dass Vertreter der NSDAP von außen einen maßgeblichen Einfluss auf das politische und gesellschaftliche Leben in Leutershausen ausübten.
Dies erfolgte durch verschiedene Kanäle, welche eine umfassende Kontrolle und Mobilisierung der Bevölkerung ermöglichten.
■ Redner bei Versammlungen und Kundgebungen
NSDAP-Funktionäre reisten wiederholt an, um bei Versammlungen und Kundgebungen zu sprechen. Diese Gelegenheiten dienten nicht nur der Verbreitung der Ideologie der Partei und der Mobilisierung der Bevölkerung für die Ziele der NSDAP, sondern auch der offenen Agitation gegen politische Gegner.
Beispiele für solche Veranstaltungen sind:
Julius Streicher, Gauleiter von Franken, sprach 1932 bei einer Massenversammlung in Leutershausen.
Pfarrer Sauerteig aus Ansbach referierte 1932 in Binzwangen über das Thema „Das deutsche Volk wählt Adolf Hitler„.
Kreisleiter Hänel aus Ansbach sprach 1939 bei einer Versammlung in Leutershausen über die Herausforderungen, die die Kriegszeit an die Bevölkerung stellte.
Diese Redner waren maßgeblich daran beteiligt, nationalsozialistische Ideen zu verbreiten und das Regime zu festigen.
14. Näheres dazu:
Der Ansbacher Pfarrer Max Sauerteig (1867-1963) trat 1925 mit seiner Familie der NSDAP bei und erhielt den Spitznamen „Hakenkreuzapostel“. Er unterstützte die Partei offen, indem er die Hakenkreuzfahne an seinem Pfarrhaus hisste und als Parteiredner auftrat. (wikipdia.de Max Sauerteig)
In einer Rede 1931 setzte Sauerteig das christliche Kreuz mit dem Hakenkreuz gleich. So versuchte er, christlich-religiöse Inhalte mit nationalsozialistischen Idealen zu verbinden.
Ein weiteres Beispiel seiner Redetätigkeit fand am 4. März 1932 in Binzwangen statt, wo er über „Das deutsche Volk wählt Adolf Hitler„ sprach. (FZ 3, Juli 1932)
Richard Hänel war von 1929 bis 1945 Kreisleiter der NSDAP in Ansbach und gleichzeitig Oberbürgermeister. In dieser Funktion hielt er z. B. bei Vereidigungen von Bürgermeistern in Leutershausen, Petersaurach und Wiedersbach Reden, in denen er die Pflichten der Bürgermeister im „Dritten Reich“ betonte und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen NSDAP, Staat und Gemeinden hervorhob. Er hielt Vorträge über Themen wie die „Neuordnung in Europa und Ostasien“ (FZ 14. April 1942).
■ Schulungen und Schulungsfahrten
Überregionale Schulungen und Schulungsfahrten waren unverzichtbare Instrumente, um die Mitglieder der NSDAP in Leutershausen mit der Ideologie und den Zielen der Partei vertraut zu machen.
Ein Beispiel hierfür ist Kreisschulungsleiter Parteigenosse Böhm. aus Ansbach, der 1936 in Leutershausen über den „Bolschewismus“ referierte.
15. Näheres dazu:
Parteigenosse (Pg.) Böhm war ein Kreisredner in Ansbach. Er hielt eine Rede in Lichtenau im Rahmen einer Reihe von Versammlungen, die im Kreis Ansbach am 7. Oktober 1939 stattfanden.
Zusätzlich war er Kreisschulungsleiter in Ansbach. Am 17. April 1937 hielt er in Leutershausen einen Vortrag über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage mit Schwerpunkt auf dem Thema „Freimaurertum“. (FZ 17. April 1937)
Bolschewismus: Der Begriff „Bolschewismus“ leitet sich von den „Bolschewiki“ ab, was wörtlich übersetzt „die Mehrheitler“ bedeutet und sich darauf bezieht, dass Lenins Anhänger auf dem 2. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands im Jahr 1903 eine knappe Mehrheit erreicht hatten. Sie entwickelten eine eigene Interpretation des Marxismus, die später als Marxismus-Leninismus bekannt wurde.
Der Nationalsozialismus stellte den Bolschewismus als vom Judentum gesteuerte Bewegung dar, die angeblich auf die Zerstörung Deutschlands abzielte.
■ Anweisungen und Richtlinien
Die NSDAP-Kreisleitung in Ansbach gab klare Anweisungen und Richtlinien an die Ortsgruppe in Leutershausen weiter, beispielsweise zur Durchführung von Aktivitäten für das Winterhilfswerk.
Diese Vorgaben garantierten eine einheitliche Umsetzung nationalsozialistischer Programme auf lokaler Ebene.
1.4. DER EINFLUSS DER NSDAP AUF DIE KOMMUNALPOLITIK
Die NSDAP hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Kommunalpolitik in Leutershausen. Sie kontrollierte politische Ämter und setzte nationalsozialistische Ideologie in der Stadtverwaltung durch. Diese Entwicklungen prägten das gesellschaftliche Leben und die politische Agenda der Gemeinde erheblich.
■ Kontrolle über Bürgermeister und Stadtrat
So nahm die NSDAP auch Einfluss auf die Besetzung von Bürgermeister- und Stadtratsposten. Ein prägnantes Beispiel ist die Ernennung von Georg Schiller. Im Jahr 1937 wurde er zum ehrenamtlichen Bürgermeister ernannt, auf Vorschlag des Beauftragten der NSDAP.
16. Näheres dazu:
Georg Schiller