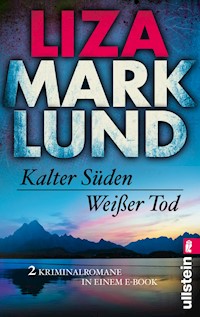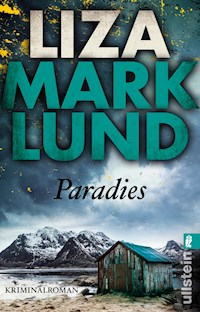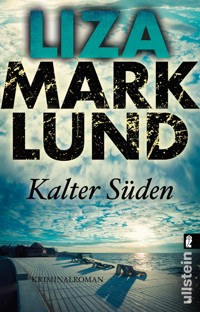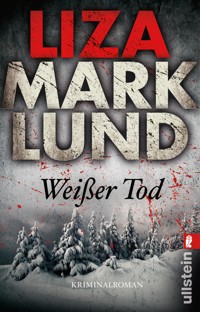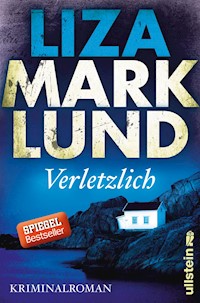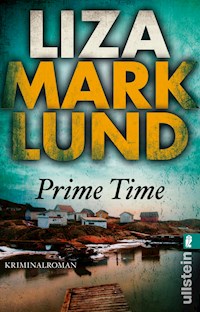10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Nummer 1-Bestsellererfolg aus Schweden Die junge Kiona lebt im Paradies, sie taucht in den tropischen Gewässern der Südsee nach Perlen. Dabei kann sie alles andere um sich herum vergessen. Doch eines Tages zieht ein Zyklon über die Insel und zwingt sie, den harten Realitäten der westlichen Welt ins Auge zu sehen. Vor der Perlenfarm ihrer Eltern strandet ein Segelboot. An Bord ein verletzter Mann, der sich Erik nennt und behauptet, ein Banker aus London zu sein. Kiona pflegt ihn gesund und verliebt sich unsterblich in ihn. Als Erik die Insel fluchtartig verlässt, kommen Kiona Zweifel. Ist Erik gar nicht der, für den er sich ausgegeben hat? Sie beschließt, ihn zu suchen, und bricht auf in ein Abenteuer, das sie quer durch Amerika, Europa und Afrika führt und bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Perlenfarm
Der Autor
LIZA MARKLUND, geboren 1962 in Piteå, arbeitete als Journalistin für verschiedene Zeitungen und Fernsehsender, bevor sie mit der Krimiserie um Annika Bengtzon international eine gefeierte Bestsellerautorin wurde.
Das Buch
Die Presse über Die Perlenfarm, in Schweden ein Nummer-eins-Bestseller: »Ein unglaublich packender Roman über Liebe, Schuld und unsere Träume. Er nimmt uns mit auf eine Reise um die ganze Welt (…) und ist Thriller und Liebesgeschichte zugleich (…) Fast 500 Seiten, die man nicht aus der Hand legen kann und die viel zu schnell enden.« TARA
»Liza Marklund erzählt uns Kionas Geschichte mit großer Souveränität (…) das Leben auf der Insel, die Genesung des Schweden, von Trennungen, Todesfällen und anderen Schicksalsschlägen. Tiefe Traurigkeit und Alltägliches, die Euphorie des Verliebtseins und Gleichgültigkeit sind nur einen Wimpernschlag voneinander entfernt. All das ist sensationell genau gezeichnet, der Schmerz des Verlustes immer unterschwellig da.« DAGENS NYHETER
Liza Marklund
Die Perlenfarm
Roman
Aus dem Schwedischen von Katrin Frey
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Pärlfarmen bei Piratförlaget, Stockholm
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-8437-2240-7
© 2019 by Liza Marklund© der deutschsprachigen Ausgabe2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einer Vorlage von Lonnie Hamborg & SimonUmschlagmotiv: © Imperiet.dkAutorenfoto: © Stine HeilmannPublished by agreement with Salomonsson AgencyE-Book Konvertierung powered by Pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Manihiki
Rarotonga
Los Angeles
London
Daressalam
Hades
Epilog
Die Autorin dankt
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Manihiki
Als die Jacht auf das Riff krachte, herrschte bereits seit sechs Monaten Verdunkelung.
Es war gegen Ende der Orkansaison 1990, wir hatten gerade mit der Perlenernte begonnen.
Papa Tane hatte zwei Männer von Tauhunu angeheuert, die mit uns tauchen sollten (Riki und Panako Brown, sie waren auf der väterlichen Seite mit Oma Vaine verwandt, der Mutter meines Vaters), und wir fuhren vor Morgengrauen mit dem großen Kanu raus. Es lag gespannte Erwartung in der feuchten Morgenluft, ich glaube, die Brüder Brown empfanden es genauso. Wir hatten eine endlose Zeit damit verbracht, die Ankerleinen und die aneinandergeknoteten Taue zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu justieren, jahrelang hatten wir regelmäßig die Perlmuscheln, die Strömung und den Sauerstoffgehalt, die Ablagerungen und die Bojen kontrolliert: Alles war auf die Ernte ausgerichtet.
In der Nacht hatte es kräftig geweht, es war vor einem Zyklon gewarnt worden, aber Manihiki lag so nah am Äquator, dass wir meistens ungeschoren davonkamen. Die Lagune war noch aufgewühlt, die Sicht nicht optimal, aber das machte nichts, die Magie war da. Die Welt unter der Oberfläche war anders, das Licht durchflutete andere Wirklichkeiten und zog in die Tiefe und in die Ferne.
Wir tauchten mit Lampen und Körben und sammelten je zehn, zwölf Taue ein, insgesamt an die fünfhundert Perlmuscheln, sodass Papa Tane mit der Ernte beginnen konnte, das dauerte nicht lange. Unsere Familie hüllte die Muscheln nicht, wie viele andere, in schützende Netze, die zwar das teure Kernmaterial auffingen, falls die Muscheln es abstießen, aber es kostete zu viel Zeit, fand Papa Tane.
Die Männer paddelten, ich saß ganz vorne und brauchte nichts zu tun. Die schimmernden Muscheln lagen schwer im Bug und Heck des großen Kanus, in meinem Bauch kribbelte es vor Aufregung. Von außen konnte man nicht erkennen, in welcher Muschel eine pinctada margaritifera gewachsen war. Wenn wir Glück hatten, enthielten siebzig Prozent von ihnen eine Perle. Die Schalen sahen so schön aus, jede war einzigartig. Im Moment konnten wir nichts tun. Ich streifte die Schwimmflossen ab, hielt die geschlossenen Augen in den Wind und spürte, wie meine salzgetränkte Kleidung am Körper antrocknete.
Wir hatten schon fast den Strand erreicht, als die Sonne über den Horizont stieg und mein Bruder Nikau als Erster die Rufe von tua, der Riffseite, bemerkte.
»Erwarten wir heute ein Boot aus Rakahanga?«, fragte er.
Jetzt hörten wir die Rufe auch. Nicht die einzelnen Worte, sondern nur einen Chor aufgeregter Stimmen. Alle reckten wir den Hals, als könnten wir über die Palmen hinweg zur anderen Seite schauen. Als wir den Strand erreichten, machten wir uns nicht die Mühe, das Kanu raufzuziehen.
»Was ist da los?«, rief Nikau in die Perlenwerkstatt.
Papa Tane, der das Mantelgewebe für die Operation der Muscheln vorbereitete, blickte verwundert von seiner Arbeit auf. Mir fiel wieder ein, dass Mama Evelyn gesagt hatte, Papa Tane werde langsam schwerhörig.
Riki und Panako Brown waren bereits auf dem Weg zur Kirche, und ich folgte ihnen. Sogar Papa Tane riss sich von der Arbeit los und rannte schwerfällig hinterher. Die Rufe wurden immer lauter, ich konnte jetzt einzelne Worte verstehen.
»Los, in die Boote, die Jacht zerbricht!«
Zuerst sah ich nur die Wellen, die mit der Wucht des sterbenden Zyklons weiß und schäumend ans Riff schlugen. Vom Rennen über die Insel war ich außer Atem. Ich hielt mir die Hand an die Stirn, weil das Licht mich blendete, und blinzelte angestrengt ins Glitzern der Wellen, konnte aber trotzdem nichts erkennen.
»Es ist eine 35-Fuß-Santana.« Tanga zeigte in die Richtung, in die ich gucken sollte.
Und jetzt sah ich sie.
Sie war lang und schmal und schneeweiß, eine große Jacht mit zerrissenen Segeln und gebrochenem Mast. Der Rumpf hatte sich im Riff verkeilt, der Bug war auf die Insel gerichtet, das Boot war frontal auf das Korallenriff gekracht und steckte fest, das Meer rüttelte mit zunehmender Kraft am Heck.
»Beeilt euch!«, rief jemand hinter mir.
»Wo bleibt Police Officer Everest? Jetzt holt ihn doch!«
»Der Rumpf bricht hinten durch!«
Die Stimmen wurden lauter und wieder leiser. Tanga hielt sich erneut sein großes Fernglas vors Gesicht. Er kannte sich mit Segeljachten aus und träumte davon, selbst eine zu besitzen.
»Ein amerikanisches Boot«, sagte er, ohne das Fernglas abzusetzen. »Einrumpfer. Nicht übermäßig teuer, ziemlich schnell. Der niedrige Baum könnte ein Problem sein.«
Mehrere kleine Boote waren bereits unterwegs zum Wrack. Zum Glück war Captain Mareko darunter, er hatte als Einziger auf der Insel noch Diesel im Tank.
»Sie werden es nicht schaffen«, sagte Nikau zu mir.
Ich betrachtete das Boot, während meine Augen von der glitzernden Sonne tränten, nein, wahrscheinlich hatte Nikau recht, der Rumpf war zu lang und zu schmal, um noch eine Minute den Wellen standzuhalten. Mitten im Getöse des Meers meinte ich das Knirschen von berstenden Glasfasern zu hören, aber das musste ich mir eingebildet haben.
»Haben wir Taue und Leinen?«
»Wozu?«
»Es ist aus!«
»Jetzt hol sie schon, los!«
Captain Mareko und seine beiden Söhne hatten die Jacht erreicht, die Jungs kletterten rasch auf das schaukelnde Deck, ich hörte, wie sie sich gegenseitig etwas zuriefen, konnte aber nichts verstehen.
»Da ist jemand! Da liegt einer im Cockpit.«
Ich ging einen Schritt näher ans Wasser heran, blinzelte ins Licht. Marekos Jungs hoben etwas Farbloses und Unförmiges an; was es war, konnte ich nicht erkennen, aber Tanga hatte vermutlich recht, es war anscheinend ein menschlicher Körper. Sie hievten die Person über die Reling und ins Boot des Captains. Einer der Jungs stieg zurück unter Deck, eine siebte Welle schlug ans Riff und kippte die Jacht vornüber. Captain Mareko schrie, weitere Boote kamen dazu, aber Captain Mareko scheuchte sie weg, die Jacht war kurz davor auseinanderzubrechen. Der Junge erschien mit einer Tasche wieder an Deck, sprang über die Reling und ins Boot, und dann bretterte der Captain mit Vollgas an Land. Sie hatten noch nicht den Strand erreicht, als der weiße Schiffsrumpf mit einem letzten Knirschen barst und langsam und unausweichlich hinter dem Riff in der Tiefe versank.
»Kiona«, sagte Papa Tane, der sich unbemerkt hinter mich gestellt hatte. »Hol Mama Evelyn.«
Ich drehte mich um und rannte nach Hause, wo Amiria in ihrer Schuluniform am Tisch saß und mit Kopfhörern eine Kassette hörte.
»Wo ist Mama?«
Sie zuckte mit den Schultern, während sie weiter mit dem Kopf zur Musik wippte, aus den Kopfhörern drang leise »Es gibt keine Katzen in Amerika«, der Titelsong aus »Feivel der Mauswanderer«.
Ich raste zur Klinik. Mama Evelyn war mit der Inventur der Bestände beschäftigt, als ich hereinstürmte.
»Wir haben kaum noch Mullbinden«, sagte sie. »Kannst du heute Nachmittag nach Tauhunu rüberfahren und …?«
Als ich angehetzt kam, ließ sie das Verbandszeug fallen.
»Unfall?«
»Schiffbruch«, sagte ich. »Jacht auf dem Riff, eine Person geborgen.«
Schnell ging sie ins Behandlungszimmer.
»Lebend?«
»Weiß nicht.«
Sie schnappte sich Stethoskop und Blutdruckmesser, dann rannten wir los.
Es war ein Mann. Sie hatten ihn auf den Rücken gelegt. Ein Bein stand in einem unnatürlichen Winkel vom Körper ab, und an der Stirn hatte er eine große Wunde. Die Lippen waren weiß und rissig, das Gesicht von der Sonne verbrannt. Mama Evelyn stieß die Kerle zur Seite, steckte sich das Stethoskop in die Ohren und beugte sich über den Mann. Nachdem sie kurz den Herzschlag und den Atem des Mannes geprüft hatte, rief sie hinter sich: »Haben wir eine Art Trage?«
Ewan Jensen, der Neffe von Fete, holte ein Bodyboard, von dem die Beine des Mannes runterhingen, weil es etwas zu kurz war, das aber seinen Zweck erfüllte. Vier Männer trugen ihn mit vereinten Kräften in die Klinik, die übrige Menschenmenge folgte wie eine rauschende Flutwelle.
In der Klinik legten wir ihn ins Zimmer Nummer eins, Mama Evelyn wies alle knapp an, den Raum zu verlassen, während sie arbeitete. Rasch füllten sich Fenster und Türöffnung mit neugierigen Gesichtern.
»Mach die Wunde sauber, damit ich sehen kann, wie tief sie ist«, sagte sie zu mir. Ich wusch mir die Hände, holte Jod und Kompressen und reinigte zuerst die Haut um die Wunde und dann die Platzwunde selbst. Die halbe Stirn war angeschwollen und blau, sie hatte einen kräftigen Schlag abbekommen, aber so tief war die Wunde nun auch wieder nicht.
»Schädelfraktur?«, fragte ich.
»Läuft eine klare Flüssigkeit aus Nase oder Ohren?«, fragte sie, während sie versuchte, dem Mann eine Infusion zu legen, aber die Venen des Mannes fielen in sich zusammen, er war dehydriert.
Ich leuchtete mit einer kleinen Lampe in seine Ohren und in sein Gesicht.
»Nein.«
Schließlich fand sie am gesunden Bein des Mannes ein geeignetes Blutgefäß.
»Chirurgietape«, sagte sie, und ich holte es rasch.
Nachdem sie den Tropf gelegt hatte, ging sie ans Kopfende des Betts und leuchtete um seine Augen herum.
Alle Kinder in Tukao schienen die Schule verlassen zu haben und sich die Nase am Fenster platt zu drücken.
»Wonach suchst du?«, rief eine Kinderstimme.
»Brillenhämatom«, sagte Mama Evelyn.
»Was ist das?«
»Falls er einen Schädelbruch hat, ist dieser linear und möglicherweise verunreinigt«, erklärte sie, und daraufhin fragte das Kind nicht weiter.
Ich maß den kaum vorhandenen Blutdruck des Mannes.
»Er muss schon eine ganze Weile im Boot gelegen haben«, sagte ich.
Mama Evelyn antwortete nicht, hörte sein Herz erneut ab und schrieb »Puls 140«, »Acidos« und »Organversagen« in die Akte.
Ich vernähte die Wunde an der Stirn mit groben Stichen und versuchte dann, das getrocknete Blut aus dem Haar auszuwaschen, bevor ich seinen Kopf mit der letzten Mullbinde der Klinik verband.
»Wird er es schaffen?«, fragte Tanga.
»Hol Papa Tane«, erwiderte Mama Evelyn.
Tanga schickte eins der Kinder zu ihm.
Das rechte Bein war an mindestens zwei Stellen gebrochen, Papa Tane wurde gebraucht, um den Knochen zu richten, bevor Mama Evelyn das Bein eingipsen konnte. Da der Mann bewusstlos war, machten wir uns nicht die Mühe, ihm ein Schmerzmittel zu geben. Mit vereinten Kräften zogen wir am Knochen, bis Mama Evelyn der Meinung war, dass der Bruch einigermaßen gut lag. Das rechte Handgelenk war dick und vermutlich schwer beschädigt. Mama Evelyn drückte so fest, wie sie konnte, darauf herum, um die einzelnen Teile im Innern an der richtigen Stelle zu platzieren, ich half ihr, den Arm einzugipsen, und anschließend legten wir einen Katheter.
Dann lag er da, mit Schläuchen an mehreren Stellen seines Körpers und einem bandagierten Kopf, das eingegipste Bein mit einem Gurt in Richtung Zimmerdecke gezogen. Allmählich trollten sich die Leute, die Aufregung hatte sie hungrig gemacht. Nikau und Papa Tane kehrten zur Perlenernte zurück, sie mussten sich um die Muscheln kümmern.
Mama Evelyn und ich setzten uns an sein Bett, teilten uns ein Glas Wasser und betrachteten den Mann. Er lag mit geöffnetem Mund und geschlossenen Augen still da, unter dem dünnen Laken hob und senkte sich kaum merklich der Brustkorb. Die Wangen waren schuppig und rot, seine ungleichmäßig verteilten Bartstoppeln einen halben Zentimeter lang.
»Wer mag das sein?«, fragte ich.
»Er ist jünger, als er aussieht«, sagte Mama Evelyn. »Vierzig vielleicht. Amerikaner. Europäer. Oder ein Kiwi. Jedenfalls kein besonders erfahrener Segler.«
»Wie kommst du darauf?«
Sie stand auf.
»Er ist trotz Zyklonwarnung allein aufs Meer rausgefahren. Da kann man nicht segeln.«
Als Mama Evelyn nach Oma Metua schauen ging, die hinter dem Flugfeld wohnte, blieb ich mit dem Patienten allein zurück. Ich befeuchtete seine Lippen mit Süßwasser, maß alle dreißig Minuten seinen Blutdruck, der von Mal zu Mal ein wenig stieg. Als die Nährlösung im Tropf verbraucht war, wechselte ich den Infusionsbeutel.
Ich fragte mich, woher er kam und wohin er unterwegs gewesen war. Erinnerte mich an das flaumige und farblose Kinderhaar unter meinen Fingern, als ich die Kopfwunde nähte. Die Frage, die ich Mama Evelyn gestellt hatte, stand noch immer unbeantwortet im Raum: »Warum ist er während eines Zyklons auf den Stillen Ozean rausgefahren?«
Bevor Mama Evelyn zurückkehrte, war es dunkel geworden.
»Ich bleibe heute Nacht hier«, sagte sie. »Ich habe mit Papa Tane gesprochen, du löst mich morgen früh ab.«
Der bandagierte Patient lag reglos da und erinnerte an eine Mumie.
»Glaubst du, er wird überleben?«
Mama Evelyn kontrollierte den Katheter, antwortete aber nicht.
Ich ging durch die Dunkelheit nach Hause. Der Wind strich mir über Arme und Beine, das Salz vom morgendlichen Tauchgang war in meine Haut eingezogen. Ich roch nach Meer.
Die Luft war gesättigt von den vielen kleinen Feuern, die in der Dunkelheit leuchteten wie Glühwürmchen.
Dass das Schiff aus Rarotonga seit zwei Jahren nicht gekommen war, brachte Unannehmlichkeiten mit sich, richtete aber keinen unmittelbaren Schaden an. Der Diesel für den Generator, der die Insel mit Strom versorgte, war längst verbraucht. Meer und Land ernährten uns Menschen auf die gleiche Weise wie seit Jahrtausenden, wir hatten den Fisch, die Kokosnüsse und nachts das Sternenlicht. (Eigentlich waren wir neumodischem Kram wie Konservendosen, Spülmittel und Kühltruhen gegenüber immer argwöhnisch gewesen.) Unter meinen Füßen knirschte der Korallensand, es war nicht leicht, hier etwas anzubauen. Unmengen von glücklichen Hühnern und Wildschweinen rannten auf der Insel herum und fraßen das bisschen, was wuchs, ich hörte die Schweine im Gebüsch quieken. Einige Familien, darunter unsere, hatten Limettenbäume dazu gebracht, hier Wurzeln zu schlagen, und wir teilten die Früchte, so wie wir von alters her alles geteilt hatten. Der Fisch wurde getrocknet und nicht eingefroren, das Rascheln der Schnüre, die sich im Wind bewegten, vermischte sich mit dem Zirpen der Grillen. Wir putzten uns die Zähne auf herkömmliche Weise im Meer und nicht mit Zahnpasta. Als wir keine Tampons und Binden mehr hatten, benutzten wir Streifen alter pareus (dieser Tücher, die uns als Röcke, Kleider, Umhänge und Universalwerkzeuge dienten). Anfangs warfen wir sie weg, aber nach einiger Zeit mussten wir sie waschen und wiederverwenden. In einer Nacht, nachdem der Dieselkraftstoff im Generator aufgebraucht war, entband Mama Evelyn unter einem Mahagonibaum eine Frau im Schein einer Öllampe. Die Entbindung verlief gut, aber das Baby wurde nach einiger Zeit krank und starb, bevor es ein Jahr alt wurde.
In der Dunkelheit wirbelten meine Gedanken durcheinander, kehrten aber immer wieder zum Patienten in der Klinik zurück. Die Dehydrierung war vermutlich verringert, die Nieren des Mannes produzierten wieder Urin. Die Frage war, wie schwer seine Kopfverletzung war. Bei einer linearen Schädelfraktur bestand die Chance, dass sie ohne bleibende Schäden verheilte, aber wenn er im Inneren des Schädels eine Blutung hatte, stieg eventuell der Druck im Gehirn, und wir hatten in der Klinik keine Möglichkeit zu operieren. Wie lange er bewusstlos gewesen war, spielte auch eine Rolle. Wahrscheinlich würde er hinken, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir das verletzte Bein in die gleiche Länge wie das andere gezogen hatten. Außerdem war er hoffentlich kein Rechtshänder, denn es war höchst fraglich, ob seine Hand wieder voll funktionstüchtig werden würde.
Die Männer hatten sich vor unserer Perlenwerkstatt am Strand versammelt und ein großes Lagerfeuer entzündet. Tanga saß mit einer Flasche Selbstgebranntem in der Mitte der Gruppe und hatte eine leere Sporttasche vor sich, die ähnlich wie die aussah, in der Nikau seine Tennissachen aufbewahrte. Der Inhalt der Tasche lag ringsherum verstreut: Kleidungsstücke, Bücher, ein Paar Turnschuhe, einige Hygieneartikel. Neben Tanga stand ein geschlossener Aktenkoffer aus Metall. Als ich Ngaru entdeckte, spürte ich ein Ziehen im Unterleib, das dramatische Ereignis heute hatte ihn von Tauhunu herübergelockt. Die Stimmen der Männer klangen aufgeregt.
»Erik Bergman.« Barbie blätterte in einem Büchlein, das vermutlich ein Pass war, seine langen lackierten Nägel blitzten im Schein des Feuers auf. »Wo liegt Schweden?«
»Was für ein Stümper«, sagte Ewan Jensen. »Die Jacht auf das Riff zu setzen.«
»Der Wind frischte auf, und er hat den Baum an den Kopf bekommen«, sagte Tanga. »Dieser Bootstyp hat niedrige Bäume. Er muss völlig vom Kurs abgekommen sein.«
Ich setzte mich zu den Leuten am Feuer und merkte plötzlich, wie müde ich war. Ngarus Anwesenheit flößte mir Lust und Unbehagen zugleich ein, aber niemand schenkte mir viel Beachtung. Ich nahm mir einen gegrillten Papageienfisch und eine nimata (Kokoswasser), schaute mir die Bücher aus der Reisetasche des Mannes an. Sie waren in einer Sprache geschrieben, die ich nicht verstand, sie hatte sogar Buchstaben, die ich nicht kannte.
»Was macht ihr denn da?«, brüllte Papa Tane, der in diesem Augenblick aus der Perlenwerkstatt kam. »Packt sofort seine Sachen wieder ein, wie alt seid ihr eigentlich?«
Lachend untersuchten und kommentierten die Männer ein letztes Mal die persönlichen Gegenstände des Mannes, bevor Papa Tane die Kleider einsammelte und den Reißverschluss der Sporttasche zuzog. Dann trug er sie und den merkwürdigen Aktenkoffer ins Große Haus.
Police Officer Everest kam von der Funkstation herüber.
»Was hat Rarotonga gesagt?«, rief Tanga.
Police Officer Everest hatte der Verwaltung auf der Hauptinsel die Havarie gemeldet.
»Er hatte keine Genehmigung.« Police Officer Everest setzte sich neben Barbie und trank einen Schluck nimata.
Wer Manihiki anlaufen wollte, musste vorher eine Erlaubnis bei der Zoll- und Immigrationsbehörde in Avarua beantragen, aber das war offenbar nicht passiert.
Ich schaute ins Feuer, während die Männer eine ganze Weile die Konsequenzen des Vorfalls diskutierten (mit dem Ergebnis, dass er keine haben würde, da die Jacht den Hafen ja nicht erreicht hatte, sondern gesunken war und somit kein Problem mehr darstellte).
Ngaru setzte sich neben mich. Ich wollte mich zurückziehen, blieb aber.
Man kam überein, dass es keinen Sinn hatte, das Schiff zu bergen. Der Rumpf war in mindestens zwei Teile zerbrochen und hinter dem Riff in die Tiefe gestürzt. Jedenfalls hatte Police Officer Everest, wie es sich gehörte, dem Mann (oder besser gesagt seinem Pass) ein Touristenvisum für einunddreißig Tage ausgestellt, und somit waren die Formalitäten erledigt.
Man sprach über Segelboote und über das, was dem Mann auf See zugestoßen sein mochte (der Wind hatte aus Südost geweht, dieser Dummkopf musste also von Tahiti gekommen und geradewegs in den Wirbelsturm gefahren sein), erörterte, welche Jachten stabil und welche schnell waren, und verstrickte sich schließlich (wie üblich) in eine Diskussion über verschiedene Fische und ihre Vorzüge, die Frage, in welcher Jahreszeit sie am fettesten waren, und ob sie besser schmeckten, wenn man sie grillte oder roh als ika mata aß.
Ich ging, ohne dass jemand Notiz davon nahm.
Als ich über der Werkstatt eingeschlafen war, kam Ngaru zu mir. Zum ersten Mal drehte ich mich weg, als er die Hand zwischen meine Beine schob.
Am nächsten Tag vertrat mich Ngaru bei der Perlenernte, damit ich Mama Evelyn in der Klinik helfen konnte. Als ich zum Krankenzimmer rüberging, nahm ich die beiden Gepäckstücke mit, die Marekos Jungs von der Jacht gerettet hatten, die Sporttasche und den glänzenden Aktenkoffer.
Verwirrt und mit starken Kopfschmerzen war der Patient im Morgengrauen aufgewacht. Er hatte nichts Sinnvolles von sich gegeben, hatte in der Nacht aber auch nicht gekrampft. Das war ein gutes Zeichen und deutete darauf hin, dass die Kopfverletzung nicht schwer war. Jetzt schlief er mit geschlossenem Mund. Seine Lippen sahen nicht mehr ganz so aufgesprungen aus, die Haut im Gesicht war weniger rot. Den Katheter hatten wir ausgewechselt, und der Tropf war nicht mehr am Bein, sondern in der Armbeuge befestigt.
»Ich komme nach dem Mittagessen zurück.« Mama Evelyn ging mit roten Augen nach Hause.
Ich setzte mich neben den schlafenden Patienten, sah mich im Zimmer um. Eigentlich fehlte mir nichts. Es war alles hier. Zugang zur Welt hatte ich dank der Romane, die Tante Doris aus Neuseeland mit jedem Schiff aus Rarotonga speziell für mich mitschickte: Abenteuer- und tragische Liebesgeschichten, Kriminalromane und ungewöhnliche Sachbücher. Am liebsten hatte ich die historischen Romane, die davon erzählten, wie Menschen einst gelebt hatten (oder hätten leben können): »Der Name der Rose« von Umberto Eco, »Das Geisterhaus« von Isabel Allende, »Kinder der Erde«. In meiner Vorstellung nahmen die Geschichten Form und Farbe und Klang an. Der Gedanke an all die Menschen, die auf der Erde gelebt hatten, erfüllte mich mit Ehrfurcht und Melancholie. Ich sprach allerdings nicht darüber, denn sonst hätte sich Nikau bis ans Ende meines Lebens über mich lustig gemacht.
An diesem Tag hatte ich »Der Alchimist« vom brasilianischen Autor Paulo Coelho dabei. Das Buch handelt von dem armen Hirtenjungen Santiago, der sich auf eine lange Reise begibt, um am Fuß der ägyptischen Pyramiden nach einem Schatz zu suchen. Ein weiser Mann sagt zu Santiago: »Wenn du etwas ganz fest willst, wird das ganze Universum darauf hinwirken, dass du es erreichen kannst.« Das war ein schöner Gedanke, aber ich war mir nicht sicher, ob er stimmte. Reichte es wirklich, etwas zu wollen? Würde mir tatsächlich das ganze Universum helfen, den Studienplatz meiner Schwester zu bekommen?
Ein Stöhnen des Patienten riss mich aus meinen Gedanken. Wegen seines starken Sonnenbrands hatte der Mann Schwierigkeiten, die Augen zu öffnen. Ich stand auf und beugte mich über ihn.
»Erik Bergman?«, fragte ich.
Ich hatte seinen Pass durchgeblättert und mir das Foto des hellhäutigen Mannes mit den wasserfarbenen Augen und dem traurigen Mund angesehen. Der Patient starrte wortlos an die Decke. Er war vierunddreißig Jahre alt.
»Sie sind auf Manihiki«, sagte ich. »In der Klinik in Tukao. Möchten Sie etwas trinken?«
Er hustete trocken und gab ein unverständliches Krächzen von sich. Ich hielt ihm einen Becher mit Strohhalm hin. Er saugte gierig daran.
»Haben Sie Hunger?«, fragte ich. »Mama Evelyn, die Krankenschwester, kommt gegen Mittag zurück und bringt Fischsuppe mit. Mögen Sie Fischsuppe? Sie ist mit Limette und Kokosmilch zubereitet.«
Er schloss die Augen und schlief sofort wieder ein, vielleicht hatte Mama Evelyn ihm etwas Morphium verabreicht.
»Wir essen fast alles mit Limette und Kokosmilch«, sagte ich zu dem schlafenden Mann.
Ich wechselte die Infusion, aber nicht den Urinbeutel, denn er war noch nicht voll. Der Blutdruck hatte sich normalisiert, der Puls war immer noch erhöht.
Ich las weiter im »Alchimisten«. Santiago hält um die Hand der schönen Fatima an, aber sie antwortet, sie könne ihn erst heiraten, wenn er das Ziel seiner Reise erreicht und den Schatz gefunden habe, was ich ziemlich hartherzig fand.
Dann war Mama Evelyn wieder da, sie sah nicht mehr ganz so hohläugig aus. Ich aß ein paar uto (Kokosnüsse), die ich mir hinter der Klinik holte, und ging zurück in die Perlenwerkstatt. Dort war die Stimmung gedrückt. Mein Bruder hatte für mich die Arbeit mit dem Spatel übernommen, die er nicht mochte, und Papa Tane schimpfte mit ihm, wenn er mit dem Spatel ausrutschte und die Perlmuschel verletzte. Jetzt machte Nikau sich aus dem Staub und überließ den Arbeitsplatz in der Werkstatt mir.
Wie immer bei der Perlenernte verging der Nachmittag wie im Flug. Die Brüder Brown holten aus der Lagune erntereife Schnüre herauf, Nikau und Ngaru bereiteten draußen auf dem Steg die Perlmuscheln vor, während ich sie in der Werkstatt mit dem Spatel ein kleines Stück öffnete. Ngaru war sauer und sah nicht in meine Richtung, er war es nicht gewohnt, abgewiesen zu werden. Das Wasser klatschte an den Steg, der abgezogene Wirbelsturm wirkte noch nach.
Ich dachte an den Mann in der Klinik, an seine Augen, die so hell waren wie der Himmel an einem diesigen Morgen. Aus Schweden stammte er, ich wusste nicht, wo das lag, aber es musste weit weg sein. Hatte das Universum ihn hierhergeführt, oder war das Leben nur eine Reihe zufälliger Ereignisse ohne tiefere Bedeutung?
Ich platzierte eine Perlmuschel nach der anderen in einem Gestell auf Papa Tanes Tisch. Mit seiner Zange öffnete er sie noch ein bisschen weiter, reinigte die Öffnung, entfernte einige der Fasern, mit denen sich die Muschel ans Tau geheftet hatte, drückte die Kiemen auseinander und schnitt vorsichtig in die Keimdrüse. Im sanften Nachmittagslicht kam die neugeborene Perle heraus. Ich hielt jedes Mal den Atem an. Sie war ein eigenartig lebendiges Juwel. Papa Tane legte sie zu den anderen auf das Tablett. Wenn die Perle groß und schön war, wurde die Muschel noch einmal verwendet. Papa Tane führte wieder Mantelgewebe und einen Kern in die Keimdrüse ein, sie mussten sich berühren, damit der Nukleus von Perlmutt überzogen und zu einer Kostbarkeit wurde. Die besten Perlmuscheln brachten drei- oder sogar viermal Perlen hervor. Sie wurden von Mal zu Mal größer und wertvoller.
Er verschloss die Muschel, und ich fixierte die nächste im Gestell. Die Sonne sank.
Ich betrachtete die Platte mit den Perlen, die golden, silbern, lila und grün schimmerten, die aufgereihten Quadrate aus Mantelgewebe, die ihnen Farbe und Glanz verliehen. In einem Jahr, vielleicht in anderthalb, würden diese Perlmuscheln wieder Früchte tragen. Zum Glück war Ngaru hier, er konnte die Empfängermuscheln wieder an den Tauen befestigen, und die Brüder Brown transportierten sie zurück in die Lagune. Aber als wir fertig waren, stieg Ngaru ins Kanu und paddelte ohne ein Wort nach Tauhunu. Nach dem Tod meiner Schwester war er bei mir geblieben, weil er mich nehmen durfte, sooft und wie er wollte, meistens hart und von hinten, ich ließ es zu, um mir wenigstens etwas zu bewahren.
An diesem Abend kam die Krankenschwester aus Tauhunu und wachte bei dem Patienten, damit Mama Evelyn schlafen konnte. Die Schwester brachte Mullbinden mit.
Und ich war allein im Zimmer über der Perlenwerkstatt, das ich mit Moana geteilt hatte. Ich horchte in der Dunkelheit nach ihr, aber im Plätschern der Wellen war sie nicht zu finden. Stattdessen machte ich die Lampe mit Schweinefett an und holte mir ihr Erdkundebuch und Collins Weltatlas.
Schweden war das drittgrößte Land Europas und lag weit oben im Norden, in Skandinavien, ein Königreich, das seit dem Mittelalter unabhängig war. Ich war verblüfft, als ich auf der Karte las, dass es am nördlichen Polarkreis lag. Auf dem entsprechenden Breitengrad auf der Südhalbkugel befand sich die Antarktis. Es musste grauenhaft kalt dort sein. Insgesamt hatte das Land acht Millionen Einwohner, was bedeutete, dass es dünn besiedelt war (kein Wunder bei dem Klima). Schweden hatte sich weder am Ersten noch am Zweiten Weltkrieg beteiligt, ein friedfertiges Volk also. In den vergangenen sechzig Jahren war die Regierungspolitik fast durchgehend von derselben politischen Bewegung geprägt worden, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (für meinen Geschmack klang das etwas zu kommunistisch). Man hatte einen gerechten Wohlfahrtsstaat mit kostenlosen Schulen und medizinischer Versorgung für alle, Arbeitslosenunterstützung und Krankengeld, kommunaler Kinderbetreuung und Altenpflege aufgebaut, was dazu geführt hatte, dass die Bürger sehr hohe Steuern zahlen mussten, egal ob die Sozialdemokraten die Wahlen gewannen oder nicht.
Ich pustete die Schweinelampe aus, sah aus dem Fenster und betrachtete das Mondlicht, das sich wie flüssiges Silber über die Lagune ergoss.
Alle Weltmeere hingen zusammen. Eine merkwürdige Vorstellung.
Oma Vaine war misstrauisch gegenüber der Natur, Fremden im Allgemeinen und papa’as (Weißen) im Besonderen. (Dass sie auf Maori papa’a genannt werden, hat nichts mit Vätern zu tun, sondern bedeutet mündlicher Überlieferung zufolge »vier Lagen Kleidung«, was auf die ersten Missionare zurückging, die unbegreiflicherweise so viel angehabt hatten.) Oma Vaine war auf Rakahanga geboren, aber früh als tamariki angai, Adoptivkind, zu einer kinderlosen Tante nach Rarotonga geschickt worden. Dort lernte sie irgendwann Opa Tane kennen, der aus dem Dorf Matavera stammte (daher unser Nachname), und als sie Tane, ihren dritten Sohn, bekamen, beschlossen sie, nach Manihiki zurückzukehren. Der Grund lag noch immer im Dunkeln, auch für uns engste Verwandte, aber es hatte etwas mit einem Kanu zu tun, wahlweise auch einer kleinen Geldsumme, um die Opa Tane von einem weißen Australier betrogen worden war. Seitdem war Oma Vaine felsenfest überzeugt, dass die Welt schlecht und Weiße extrem unzuverlässig waren (möglicherweise mit Ausnahme von Mama Evelyn, aber nur vielleicht). Die älteren Söhne, Tom und Matini, wurden als tamariki angai bei der mittlerweile ziemlich betagten Tante zurückgelassen.
Oma Vaine war alles andere als erfreut über den Patienten, der drüben in der Klinik im Krankenzimmer Nummer eins allmählich genas.
»E vaka putaputa«, sagte sie, was »ein Kanu mit vielen Löchern« bedeutete.
Großes Problem also.
Wie es bei uns Brauch war, hatte sie meinen Namen ausgesucht. Ich muss zugeben, dass ich ihr das übel nahm. Kiona war eine Art Nachtfalter, eine hässliche Motte, die nicht gut fliegen konnte und sich oft in Spinnennetzen verfing.
»Unsinn«, sagte Oma Vaine, wenn ich mich beklagte. »Kiona steht für Unabhängigkeit und Ansehen, dort, wo ich herkomme, ist es ein schöner und vielsagender Name.«
Ich wusste nicht, ob sie Rarotonga oder Rakahanga meinte, nahm aber an, dass der Name auf keiner der beiden Inseln diese Bedeutung hatte.
In jenen Tagen war Oma Vaine mürrischer als sonst. Es missfiel ihr, dass ich »die Lagune vernachlässigte« und mich stattdessen um den Patienten in der Klinik kümmerte.
Personen, auf die man sich verlassen konnte, bezeichnete sie manchmal als e maro ma’ana, einen warmen Lendenschurz. Weiße Männer, die es unter undurchsichtigen Umständen auf abgelegene Inseln verschlug, gehörten nicht dazu.
Als wir in Tukao keine Schmerzmittel mehr hatten, musste ich über die Lagune paddeln und aus der Klinik in Tauhunu neue holen. Schwester Vioora stammte von Atiu, einer Insel der südlichen Gruppe der Cookinseln, und sie war trotz der Sache, die Moana zugestoßen war, ziemlich nett zu mir. Nun erkundigte sie sich ausführlich nach dem Patienten. Sie wollte wissen, ob seine Genesung voranschritt, wo er herkam und wie er überhaupt auf das Riff geraten war. Aus irgendeinem Grund machte mich ihre Neugier verlegen.
»Er sagt nicht viel«, antwortete ich ausweichend.
»Aber er spricht doch Englisch?«
Als Police Officer Everest ihn zur Havarie befragte, hatte ich im Behandlungszimmer gesessen und alles mit angehört, der Patient sprach gut Englisch, sogar ausgezeichnet, und es war ungefähr so, wie die Männer in der ersten Nacht vermutet hatten: Erik Bergman war ein Abenteurer, ein Alleinsegler. Er hatte sich die Jacht auf Tahiti gekauft und war auf dem Weg nach Westen gewesen, als der Wirbelsturm ihn vom Kurs abbrachte. Beim Versuch, das Segel zu reffen, hatte er den Baum auf den Kopf bekommen und war ins Cockpit gestürzt und dort liegen geblieben. Dass das Boot zwei Tage später auf das Riff von Manihiki lief, war ein Wunder.
Ich machte, dass ich so schnell wie möglich aus Tauhunu wegkam.
Auf dem Weg zum Hafen kam ich am unbewohnten Palast vorbei, der ziemlich verfallen war. Ngaru saß auf der Veranda vor dem Haus seines Onkels und tat, als würde er mich nicht bemerken (oder sah mich wirklich nicht). Wie ich vermutet hatte, war er aus Tukao weggegangen, entweder um sich vor der Perlenernte zu drücken, oder weil er die Nase voll von mir hatte. Beschämt lief ich zum Hafen.
Was ich zu Schwester Vioora gesagt hatte, stimmte vollkommen, der Patient sprach wirklich nicht viel. Manchmal bat er um Wasser oder die Bettpfanne, das war im Grunde alles. Ich ließ ihn in Ruhe und saß meistens draußen im Behandlungszimmer und las, während ich wachte.
»Schwester«, rief er eines Abends, als Mama Evelyn zu Hause bei Oma Metua war (der es immer schlechter ging, die alte Dame hatte nur noch Wochen zu leben). Ich legte das Buch weg (»Die Säulen der Erde« von Ken Follett, mein absolutes Lieblingsbuch) und ging in Zimmer Nummer eins. Er saß halb aufgerichtet im Bett, ich hatte ihn rasiert. Die Verbrennungen im Gesicht verheilten allmählich, und die Schwellung an seiner Stirn war zurückgegangen.
»Ich möchte Sie etwas fragen«, sagte er. »Wo bin ich genau?«
»In Tukao«, sagte ich. »Auf Manihiki. Cookinseln, nördliche Inselgruppe. Wir gehören zu Neuseeland, sind aber ein unabhängiger Inselstaat.«
Er blinzelte verwirrt.
»Wo?«
»Südpazifik«, sagte ich. »In jeder Richtung weit und breit nur Wasser.«
Das stimmte nicht ganz, im Nordwesten verbarg sich Rakahanga hinter dem Horizont.
Der Patient schloss für einige Momente die Augen, dann sah er in die Dämmerung hinaus, die sich rasch senkte.
»Ein Polizist war hier und hat mich vernommen«, sagte er.
»Police Officer Everest«, sagte ich.
Er streckte die linke Hand nach dem Wasserbecher auf dem Nachttisch aus und trank mit dem Strohhalm. Stellte den Becher zurück, räusperte sich.
»Habe ich … etwas Verbotenes getan, als ich hier ankam? Gegen ein Gesetz verstoßen?«
Ich schob einen Stuhl ans Bett und setzte mich zu ihm.
»Eigentlich braucht man eine Genehmigung aus Rarotonga, um Manihiki anzulaufen, aber da Ihr Boot gesunken ist, bevor Sie an Land kamen, wurde beschlossen, dass Sie keine Erlaubnis brauchten.«
Ich lächelte.
»Sie haben ein Touristenvisum für einen Monat.«
»Und seit wann bin ich hier?«
Ich rechnete mit den Fingern nach.
»Seit elf Tagen.«
Er schwieg eine Weile.
»Manihiki, sagen Sie?«
»Wir sind ein Atoll«, sagte ich, »eine Lagune mit dreiundvierzig motus, kleinen Inseln. Die Lagune ist neun Kilometer breit. Zwei Dörfer, Tauhunu und Tukao, jeweils auf einer Insel. In Collins Weltatlas sind wir nicht verzeichnet.«
»Und es gibt keinen Strom?«
»Momentan nicht. Der Diesel für den Generator ist alle.«
Er sah mich an. Ein besonders schöner Mann war er nicht, sein Haar war zwar hell, aber nicht blond, und irgendwie auch dunkel, aber nicht braun, sein Kiefer war etwas zu kantig und seine Ohren zu klein.
»Und Sie arbeiten hier als Krankenschwester?«
Ich blickte auf meine Hände.
»Mama Evelyn ist die Krankenschwester, meine Mutter. Ich helfe nur aus. Meistens arbeite ich auf der Perlenfarm.«
Er zog die Augenbrauen auf eine Weise hoch, die sich als typisch für ihn erweisen sollte.
»Perlenfarm?«
»Sie gehört unserer Familie. Wir haben eine schwarze Perlenfarm, in der Lagune kommt pinctada margaritifera natürlich vor, man braucht nur zusammengeknotete Taue ins Wasser zu hängen, und nach drei Jahren sind sie voller Perlmuscheln. Ich bin Freitaucherin draußen auf der Farm, arbeite aber auch in der Werkstatt. Vielleicht werde ich mal Perlentechnikerin …«
Das stimmte, Papa Tane hatte gesagt, ich dürfte vielleicht einen Lehrgang besuchen und ein Zertifikat erwerben, wenn auf der Insel einer stattfand (falls der Schiffsverkehr jemals wieder in Gang kam).
»Die Perlenfarm ist schwarz?«, fragte er.
»Die Perlen«, sagte ich. »Man nennt sie so, aber sie können viele verschiedene Farben haben. Knapp die Hälfte ist nicht kategorisierbar, low grade, die übrigen werden nach Farbe, Form und Größe in die Kategorien A bis D eingeteilt.«
Erik Bergman sah wieder zum Fenster, draußen war es fast dunkel geworden. Der Mond nahm ab, und die Sterne wurden von Wolken verdeckt, es würde eine stockdunkle Nacht werden.
»Der Polizist sagte, mein Boot sei gesunken. Kann man es bergen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Es ist durchgebrochen und in der Tiefe verschwunden. Captain Mareko und seine Jungs haben Sie in letzter Minute rausgeholt.«
Er versuchte, sich ganz aufzusetzen.
»Könnte ich Sie um einen Gefallen bitten?«
»Natürlich.« Ich stand auf, um ihm ein Kissen in den Rücken zu stopfen.
»Mein Aktenkoffer.« Er deutete mit einer Kopfbewegung in die Ecke, wo sein Gepäck stand. »Können Sie ihn irgendwo aufbewahren? An einem trockenen Ort?«
Er bemerkte, dass ich ihn fragend ansah.
»Ich brauche ihn hier nicht«, sagte er, »es sind nur Papiere und Kleinkram drin.«
»Die Schlüssel sind leider weg«, sagte ich.
Er schloss die Augen und sank zurück ins Kissen.
»Hat jemand nach mir gesucht?«
Ich musste fast lachen, weil die Frage so absurd war.
»Es ist seit zwei Jahren kein Schiff mit dem Nötigsten mehr gekommen. Vor acht Monaten waren Perlengroßhändler mit einem gecharterten Flugzeug hier, aber abgesehen davon hatten wir seit 1988 keinen Besuch aus der Außenwelt. Abgesehen von Ihnen.«
»Wenn jemand nach mir fragt, bringen Sie ihn einfach hierher. Sagen Sie nicht, dass Sie mich kennen.«
»Wer sollte denn nach Ihnen suchen?«
Er legte den Kopf in den Nacken, murmelte etwas Unverständliches, oder vielleicht sagte er es auch in einer Sprache, die ich nicht kannte.
Ich wandte mich wieder meinem Buch zu. »Die Säulen der Erde« handelte vom Bau einer Kathedrale im zwölften Jahrhundert im englischen Kingsbridge. In diesem Jahr las ich es immer wieder. Es enthielt unheimlich viele Verschwörungen zwischen mächtigen Männern, die mich überhaupt nicht interessierten, aber das Gebäude! Oh, ich sah es vor mir, die schwebenden Gewölbe, das funkelnde Licht, die Pfeiler, die sich vom Himmel in die Erde bohrten. Ich war dort, ich befand mich fast immer an der Seite von Baumeister Tom, vor allem beim Tauchen.
Als Mama Evelyn mich ablöste, nahm ich den glänzenden Metallkoffer des Patienten mit, und nachdem ich eine Weile überlegt hatte, verstaute ich ihn in derselben Kiste wie Moanas alte Schulbücher, ganz oben im Regal im Vorratsschuppen hinter dem Wassertank. Ein trockener und guter Platz, das wusste ich.
Papa Tane hatte in der Funkstation neben dem Rathaus ein Gespräch mit Onkel Matini auf Rarotonga angemeldet, das noch an diesem Abend durchgestellt werden konnte (das Rathaus war nicht weit von der Klinik entfernt). Onkel Vaine und Amiria hatten gekocht (im Gegensatz zu mir hatte Amiria nicht nur Talent dafür, sondern auch Interesse am Kochen), an diesem Abend drehten sie Perlmuscheln durch den Fleischwolf und brieten sie, und dazu gab es Pfannkuchen aus uto, die mit Kokosmilch gegessen wurden.
Ich brachte Mama Evelyn und dem Patienten etwas zu essen und setzte mich dann vor dem Funkraum zu Papa Tane auf die Erde und wartete mit ihm, während es dunkel wurde, auf die Verbindung. Mehrere andere Familien hatten hier etwas zu erledigen, der Abend war heiß und feucht.
»Ich habe über eine Sache nachgedacht«, sagte ich. »Moanas Studienplatz …«
Meine Schwester war im Studiengang Politik und Internationale Beziehungen an der Universität in Auckland angenommen worden, sie wäre mit dem nächsten Schiff nach Rarotonga gefahren und von dort aus nach Neuseeland geflogen.
»Da rückt jemand nach«, sagte Papa Tane. »Sie haben genug Bewerber.«
»Vielleicht kann ich den Studienplatz übernehmen.«
Papa Tane wandte sich dem Riff zu.
»Kiona«, sagte er, »das würde nicht zu dir passen.«
»Ich kann auch studieren.«
Den Blick abgewandt, sagte er es zum ersten Mal: »Deine Universität ist die Lagune.«
Vaitomo, der Funker, kam raus und teilte mit, dass die Verbindung stand. Papa Tane ging ans Funkgerät, während ich in der Tür stehen blieb. Da Onkel Matini sich unten in Rarotonga um die Finanzen kümmerte, berichtete Papa Tane von der Situation auf der Perlenfarm, er gab die Zahlen, den Ertrag und die notwendigen Investitionen durch und beendete jeden Satz mit »kommen«. Wir lebten seit ewigen Zeiten mit den Perlen in der Lagune, aber die industrielle Herstellung, die Farmen und die Zucht waren moderne Errungenschaften. Ich verstand nicht genau, worüber sie sprachen, ihre langen Erörterungen des Budgets und der Bilanzen waren mir ein Rätsel. Ich hatte tatsächlich nicht so gute Noten wie Moana, vor allem nicht in Mathematik, aber ich las gerne und sprach fließend Englisch und Maori. Moana hatte sich mit Mathematik und Politik ausgekannt und konnte nicht nur Maori, Englisch und Französisch lesen, sondern verstand auch ein bisschen Chinesisch (die Mutter ihrer besten Freundin Reo Cheval kam aus Tahiti und war französisch-chinesischer Herkunft, sie hatte es Moana und Reo von klein auf beigebracht), aber ich wusste viel über Kathedralen und die mittelalterliche Geschichte Europas und kannte die Namen der meisten Länder und Hauptstädte der Erde. Ich mochte Gott und die Bibel, aber für Politik hatte ich überhaupt nichts übrig, mich interessierten nur die Lebensbedingungen der Menschen. Wenn Moana darauf beharrte, dass genau das Politik war, verstand ich nicht, was sie damit meinte.
Onkel Matini erzählte, dass in den Cook Island News über Moanas Tod berichtet worden war. Er und Tante Ama hatten der Redaktion ein Foto von Moana geliehen, das zwar in Schwarz-Weiß abgedruckt worden und auf dem sie vierzehn Jahre alt war, aber man konnte sie trotzdem erkennen, er hatte die Zeitung aufbewahrt.
Wir ließen Grüße an die ganze Familie ausrichten, ich durfte am Ende kurz mit meiner Cousine Vaiana sprechen, aber wir hatten uns nicht viel zu sagen, da wir uns erst einmal bei einem Begräbnisritual in Rakahanga begegnet waren. Wir sagten »Ende«, und dann gingen Papa Tane und ich nach Hause.
Ich dachte an die Zeitung, die Cook Island News, und daran, dass Moana nach ihrem Tod darin abgebildet gewesen war. Es war seltsam, dass jeder sie darin als Vierzehnjährige sehen konnte, obwohl sie nicht mehr existierte. Ein eingefrorener Ausschnitt der Zeit war übrig geblieben. Die Cook Island News ist eine Tageszeitung, die über Ereignisse auf den Cookinseln, in Polynesien und dem Rest der Welt berichtet. Onkel Matini schickte uns wichtige Ausgaben der Zeitung mit dem Schiff (wenn es denn fuhr), meistens waren dann Artikel über die Perlenindustrie darin, Papa Tane bewahrte sie in einer Schachtel aus Palmplättern unter dem Bett auf. Manchmal ging es in den Zeitungen jedoch auch um andere Dinge, wie damals, als der Sänger David Bowie in dem Film »Merry Christmas, Mr. Lawrence« mitspielte, der teilweise auf Rarotonga gedreht worden war, wo sich jemand aus dem Filmteam verlief und im Dschungel auf dem Vulkan im Inneren von Rarotonga verschwand. Obwohl die Insel nur zehn Kilometer breit ist, hat man den Mann nie gefunden. Noch heute liegen seine sterblichen Überreste irgendwo im Dschungel. Das Exemplar der Zeitung wurde auf einem Bord im Großen Zimmer aufbewahrt.
Ich fragte mich, wo Papa Tane die Zeitung mit dem Foto von Moana aufbewahrte. Sicher auch auf dem Regalbrett.
In dieser Zeit kam von Süden ein Unwetter auf, das Manihiki tagelang mit Stürmen und Blitzen überzog. Oma Vaine hatte keinen Zweifel: Hikahara grollte auf diese Weise über den Patienten in der Klinik. Hikahara, vor dem Christentum die Göttin auf Manihiki, war halb Frau, halb Mann. Sie herrschte über das Wetter, ob Regen oder Donner, ihr Körper war oben weiblich und unten männlich. Oma Vaine erzählte gerne von den Missionaren, die sich mit Hikahara angelegt hatten, mit den Jahren wurde ihre Geschichte immer besser, und schließlich klang sie, als wäre sie selbst dabei gewesen. Alle Menschen auf Manihiki hatten sich im Dorf Tukao bei den Steinen von Hikahara versammelt und die Göttin vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang um Regen angefleht, aber aus den Wolken kam kein Zeichen. Am zweiten Tag forderten die Missionare die Menschen zum Weitermachen auf, wieder ohne Erfolg. Dann baten die Missionare ihren Jehova um Regen, der daraufhin prompt einsetzte, und da merkten alle auf Manihiki, dass Jehova der wahre Gott war.
Die Perlenernte ruhte in diesen Tagen, bei Gewitter war es nicht ratsam, mit den Booten rauszufahren. Stattdessen sprach Papa Tane mehrmals über Funk mit Onkel Matini auf Rarotonga.
Onkel Matini hatte alle Hände voll mit seiner eigenen Firma und deren Vergrößerung zu tun (eine Baufirma, die sich auf den Import von Stahlprodukten spezialisiert hatte). Obwohl das Geschäft florierte, bereiteten die Finanzen Papa Tane Kopfzerbrechen. Alles, was mit Buchführung und Quittungen, mit Gewinnen und Steuern und Unkosten und Auslagen und Rechnungen zu tun hatte, überforderte Papa Tane.
Bisher war die Ernte dieses Jahres extrem gut, fast achtzig Prozent unserer pinctada margaritifera enthielten Perlen. Noch dazu waren viele rund und weitgehend makellos, B- und C-Qualität-Klasse, und sogar einige Perlen der Klasse A waren darunter. Fünfunddreißig Prozent der Perlmuscheln war wieder ein Kern implantiert worden, auch das übertraf die Erwartungen, und daher hätte das Leben im Großen und Ganzen gut sein müssen.
Als sich der Zustand des Patienten allmählich gebessert hatte, konnte ich tagsüber wieder auf der Farm arbeiten. Nikau und ich setzten die Ernte fort, überprüften die Tiefe von Tauen und Ankerleinen, und ich befand mich bei Baumeister Tom im Kingsbridge des zwölften Jahrhunderts. Die Lagune, die mich umgab, war das Kirchenschiff, die Korallen verwandelten sich in kunstvoll gemeißelte Pfeiler, die Meeresströmung war von mehrstimmigem Gesang erfüllt, und die Wasseroberfläche weit über mir wurde zu einem Himmelsgewölbe für Marmorengel. Ich wirbelte durch eine Finsternis aus Seligkeit, der Sauerstoffmangel in meiner Lunge erstickte jeden anderen Schmerz.
Abends half ich Mama Evelyn und löste sie in der Klinik ab, damit sie sich um andere Dinge kümmern konnte. Wir gipsten das linke Bein und das rechte Handgelenk des Patienten neu ein. Erik Bergman war, Gott sei Dank, Linkshänder. Das Bein sah nicht gut aus, es war wirklich ein Stück kürzer geworden. Ich fragte mich, wie das sein konnte, wo war das fehlende Stück Knochen abgeblieben?
Auf das lange Gewitter folgten Feuchtigkeit und ungewöhnlich intensive Hitze. Der Patient schwitzte so stark, dass ich an einem Abend zweimal sein Laken wechseln musste.
»Sind Sie nicht daran gewöhnt?«, fragte ich.
Erik Bergman stand nackt bis auf eine der Unterhosen, die er in seiner Sporttasche gehabt hatte, und mit einer Krücke in der linken Hand da, während ich das Bett frisch bezog.
»Nein, wirklich nicht«, sagte er. »Schweden liegt im hohen Norden, wir haben ein halbes Jahr Schnee und Minusgrade.«
»Am Polarkreis«, sagte ich.
Im Schatten der Schweinelampe sah ich, wie er wieder auf diese typische Art die Augenbrauen hochzog.
»In der Tat«, sagte er nachdenklich. »Waren Sie schon mal dort?«
Jetzt musste ich richtig lachen.
»Nein, wirklich nicht«, ahmte ich ihn nach. »Aber ich war schon einige Male auf Rakahanga.«
Ich ging mit den Laken zum Waschzuber und weichte sie ein. Der Regen hatte den Vorteil, dass alle Zisternen und Tanks mit Frischwasser gefüllt waren.
Als ich zurückkam, hatte er sich wieder ins Bett gelegt, die Hitze und die Schmerzen machten ihn offenbar müde.
»Darf ich Ihnen eine Frage über Schweden stellen?«
Wieder zog er die Augenbrauen hoch. Ich holte Luft.
»Gibt es dort Kathedralen?«
»Kathedralen?«
Er sah richtig verwundert aus und überlegte eine Weile.
»Wenn überhaupt, dann sind es Domkirchen«, sagte er schließlich. »Die in Lund und Uppsala könnte man vielleicht so bezeichnen und die in Skara und Linköping.«
»Sie wissen es nicht genau? Sind Sie kein Christ?«
»Wir nennen unsere Domkirchen nicht Kathedralen, aber ich nehme an, dass sie seinerzeit als solche galten. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Warum fragen Sie?«
Ich weiß nicht, warum ich darauf antwortete, aber ich tat es. Zum ersten Mal erzählte ich jemandem, dass die Lagune ein Kirchenschiff für mich war, die Korallenbänke waren Säulen und Altäre, die Schwärme von Schmetterlingsfischen schwindelerregende Lobgesänge, und ohne zu begreifen, warum, fing ich an zu weinen.
Er sagte nichts, und ich hörte ziemlich bald wieder auf.
Dann sprachen wir nicht mehr darüber.
Mittwochs und freitags ging Oma Vaine vor Tau und Tag zu den Morgenandachten der Cook Island Christian Church und sonntags in den Abendmahlsgottesdienst um zehn und zum Nachmittagsgebet um vier Uhr.
»Der Herr hat die Welt nach seinem Bilde und seinem Wohlgefallen erschaffen«, sagte sie, wenn sie im Morgengrauen zur Kirche taperte. (Sie hatte auch andere Sprüche auf Lager, »ihr werdet alle in der Hölle schmoren« war nur einer davon.)
Ich hätte sie gerne in die Kirche begleitet, aber dafür war keine Zeit. Allerdings ging ich jeden Sonntag zum Gottesdienst und manchmal auch zum Nachmittagsgebet. Der Kirchenraum war zwar keine Kathedrale, aber es herrschte dort ein Frieden, den ich nirgendwo sonst fand.
Die Frauen mit ihren schönen Hüten und den verhüllten Schultern, die Männer in Hosen, die die Knie bedeckten. Die hellen Stimmchen der Kinder wie eine Wand hinter dem dröhnenden Organ von Pastor Boyd.
Seit Erik Bergman auf Manihiki war, betete die Gemeinde besonders für ihn. Pastor Boyd rief den Herrn an, er möge dem Fremden Gnade und Genesung schenken, und dann bat er ihn, sein Angesicht über uns leuchten zu lassen und uns Frieden zu geben. Der fette Jensen blieb während der Lobgesänge wie üblich mit offenem Mund in der Kirchenbank sitzen und starrte auf meine Beine. Der Husten des alten Tupu war schlimmer denn je, Mama Evelyn schaute besorgt in seine Richtung. Zwei Reihen vor mir weinte Witwe Paetu mit bebenden Schultern, ihr Mann war im vergangenen Jahr verstorben, und das Grab vor ihrem Haus hatte noch immer kein Dach.
Die Predigt donnerte wie Gewitter und Geröll über die Gemeinde hinweg, sie peitschte ordentlich ein und verlockte zugleich. Das Licht, das durch die bunten Fensterscheiben drang, färbte Boden und Wände rot, blau, grün und gelb. Ein paar Wespen umkreisten verwirrt die Blumen auf den Hüten der Frauen. Der Lobgesang hallte von den Wänden wider und gab mir das Gefühl zu fliegen.
Hinterher versammelten wir uns unter dem Blechdach auf der Riffseite, und während die Katholiken in der Kirche nebenan weitersangen, tischten wir auf – gegrillten Papageienfisch und gekochten Lederjackenfisch, Brotfrucht und kalten Reis, ein frisch geschlachtetes Ferkel, in Meerwasser gekocht, Papa Tanes umustek, in Meerwasser notdürftig gekühlte nimata, Wasser in Plastikbehältern, Colaflaschen voller Kokosmilch, mehr Brotfrucht, mehr gekochten Fisch und einen Salat aus Makkaroni und Dosenmakrele, Kokospfannkuchen vom Vortag und Hefebrötchen aus dem letzten gesiebten Mehl auf der Insel. Ich aß ein Stück Brotfrucht. Barbie schleuderte die Pumps von den Füßen, ich half ihm, die Tischdecke mit Korallensteinen zu befestigen. Pastor Boyd betete ein pure, und dann aßen wir. Die Gespräche übers Essen plätscherten leise und langsam dahin, sogar die Kleinkinder bewegten sich weniger stürmisch und mit gedämpfter Lautstärke.
»Wir danken dem Herrn für seine Wunder«, sagte Pastor Boyd und setzte sich neben Mama Evelyn. »Wann dürfen wir den Fremden im Gottesdienst erwarten?«
Ich dachte bei mir, dass Mama Evelyn zur Genesung des Mannes mindestens so viel beigetragen hatte wie der Herrgott.
»Wunder brauchen Zeit«, sagte Mama Evelyn milde. »Die Wege des Herrn sind unergründlich, und wir können nicht von ihm verlangen, sich zu beeilen, nur weil seine Diener ungeduldig sind.«
Der Pastor stand auf und ging an den Nebentisch. Ich wusste, dass die Antwort ihm missfiel und er sich zurechtgewiesen fühlte. Mama Evelyn neigte dazu, unterschwellig vorwurfsvolle Bemerkungen zu machen.
Sie stocherte nun mit demütig gesenktem Blick in ihrem Papageienfisch.
Mama Evelyn kam in den Sechzigerjahren als frisch examinierte Krankenschwester aus Auckland nach Manihiki und blieb (einen Arzt haben wir hier meines Wissens nie gehabt). In all den Jahren kehrte sie nur einmal nach Neuseeland zurück, damals war ich noch ein Baby. Ohne Vorwarnung bestieg sie das Schiff nach Rarotonga und ließ Papa Tane mit der vierjährigen Moana, Nikau, der fast drei war, und dem wenige Monate alten Baby, also mir, allein. Ein gutes Jahr später kam sie mit gesenktem Blick und blassen Wangen, einem Kassettenspieler mit separatem Lautsprecher und einem Kühlschrank zurück, der von Anfang an nicht funktionierte. Ich hätte Angst vor ihr gehabt, wurde mir erzählt, ich hatte noch nie jemanden mit gelbem Haar und wasserfarbenen Augen gesehen. Tarita, die Frau, die in Papa Tanes Leben und Bett eingezogen war, musste ihre Siebensachen packen und zurück nach Tauhunu paddeln. Ich war offenbar verzweifelt, hatte die einzige Mutter verloren, die ich kannte, und musste von nun an mit einem wasseräugigen Monster zusammenleben. Mit fest angespannten Kinderarmen klammerte ich mich an Papa Tane und Oma Vaine (Opa Tane war während Mama Evelyns Abwesenheit gestorben), und ein Teil von Mama Evelyn verzieh mir das nie.
Diejenigen, die Mama Evelyn schon vorher gekannt hatten, sagten, sie sei nach dem Jahr in Neuseeland stiller geworden. Sie diskutierte nicht mehr lautstark mit den Leuten auf der Insel, sondern war stolz darauf, sich um ihren eigenen Kram zu kümmern und die Inselbewohner zu verarzten. Amiria wurde an meinem fünften Geburtstag geboren.
Nach vier Wochen konnte der Patient noch immer nicht mehr als ein, zwei Schritte gehen (da er sich nicht nur ein Bein, sondern auch einen Arm gebrochen hatte, nützten ihm Krücken nicht viel).
Police Officer Everest verlängerte das Touristenvisum um drei Monate, dann würde Erik Bergman mobil sein, und so Gott und die Regierung wollten, wäre bis dahin auch der Schiffsverkehr wieder angelaufen.
Das rechte Handgelenk heilte schlecht, der Mediannerv (von dem der Tastsinn des Daumens, des Zeigefingers, des Mittel- und des halben Ringfingers abhing) war entweder zerstört oder eingeklemmt. Erik fühlte nichts. Als nach acht Wochen der Gips abgenommen wurde, sollte er die Hand allmählich wieder bewegen, aber auch das ging nur schwer. Ein Bein war, wie gesagt, deutlich kürzer als das andere. Papa Tane stellte eine Spezialkrücke her, auf der er sich mit dem Ellbogen anstelle der Handfläche abstützen konnte, und dann schwankte er auf seinen Krücken zwischen Behandlungsraum und Krankenzimmer Nummer eins auf und ab, bis Mama Evelyn entschied, dass er die Klinik verlassen dürfe. Es war mühsam und zeitaufwendig, Lebensmittel zum Krankenhaus zu bringen und ständig Pflegepersonal bereitzuhalten, das ihm bei Toilettengängen und Körperpflege behilflich war. Stattdessen wurde er in die Honigfresserhütte bei der Dieselzapfsäule neben der Perlenwerkstatt verlegt. Er kam zum Frühstück und aß mit uns zu Mittag, abends saß er stumm und zurückhaltend am Rand des Feuerkreises. Tagsüber humpelte er immer größere Runden auf den Korallenwegen von Tukao, bis er sich an seinen ungleichen Krücken den Ellbogen aufgescheuert hatte.
Wir ernteten unsere letzten Perlmuscheln (das letzte Viertel war nicht mehr ganz so ertragreich wie die ersten drei, aber qualitativ vollkommen ausreichend).
Zum Dank für gute Arbeit durften Nikau und ich uns wie üblich je eine Perle aussuchen.
Und auf der Insel blieb es dunkel.
Der Schiffsverkehr nach Manihiki endete an dem Tag, als die Manuvai im Dezember 1988 auf das Riff vor Nassau lief (nicht die Hauptstadt der Bahamas, sondern eine kleinere Insel südöstlich von Pukapuka). Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, wir kannten die Namen und die Lebensgeschichten der Schiffe, die uns mit dem Nötigsten versorgten, wie Kinder die Namen ihrer Eltern kennen.
Die Manuvai war in Dänemark gebaut worden (das genau wie Schweden in Skandinavien liegt). Das Schiff war im Jahr 1960 vom Stapel gelassen worden und bereits gut eingefahren, als es Anfang der Siebzigerjahre von der Reederei Silk & Boyd (die nichts mit dem hiesigen Pastor Boyd zu tun hatte) übernommen wurde. Die Manuvai hatte ein Jahrzehnt lang in Europa als Frachter gedient und war in keinerlei Hinsicht für die Nutzung als Passagierschiff in den Tropen geeignet, aber für die nördlichen Cookinseln war sie gegenüber früheren Schiffen trotzdem eine erhebliche Verbesserung. (Übrigens war Moana im Alter von vierzehn Jahren mit der Manuvai nach Rarotonga gefahren.) Nach fast zwanzig Jahren in der Südsee war sie allerdings reif für den Schiffsfriedhof, ein Umstand, der früher als erwartet eintrat. Nach drei harten Tagen bei miserablem Wetter vor Pukapuka war die Manuvai auf dem Weg nach Nassau, als der Steuermann auf seinem Posten einschlief und das Schiff direkt auf das Riff fuhr (dem Schweden und seiner Jacht nicht ganz unähnlich). Danach wurde nichts mehr nach Manihiki befördert. Die Reedereien konnten sich mit der Regierung nicht über Subventionen und Frachtlizenzen einigen, die Männer waren einstimmig der Meinung, die Regierung unten in Rarotonga sei unfähig, eine Lösung zu finden. Onkel Matini informierte Papa Tane per Funkgerät darüber, wie sich die Situation entwickelte (beziehungsweise dies vielmehr nicht tat). Manihiki verfügte zwar über ein Flugfeld (es war am 10. Oktober 1988, dem Tag, als das erste Flugzeug landete, ordnungsgemäß gesegnet worden), aber kommerzieller Flugverkehr war nicht zustande gekommen. Die Einzigen, die den Flugplatz (äußerst sporadisch) nutzten, waren die Perlenhändler mit ihren Privatflugzeugen.
Einige Wochen nach der Perlenernte war es jedoch an der Zeit, das Flugfeld wieder zu benutzen.
Die Großhändler waren im Morgengrauen in Rarotonga gestartet, hatten auf Aitutaki einen Zwischenstopp eingelegt und die Tanks bis zum Bersten gefüllt und wurden um halb zwölf vormittags auf dem Korallensand erwartet. Fast alle aus Tukao und auch viele aus Tauhunu hatten sich am neuen Terminal (einer Pfahlbaracke mit Blechdach und acht Sitzbänken) versammelt, um sie in Empfang zu nehmen. Sie mussten lange warten, ohne Wind und mit wenig Schatten. Nikau hörte das Geräusch über den Wolken als Allererster, am Himmel wurde der weiße Fleck sichtbar, ich spürte ein Ziehen im Bauch, und dann setzte das Flugzeug auf wie ein überdimensionierter Grashüpfer. Mit dröhnendem Motor fuhr es zu den Kerosintanks und blieb stehen. Das Motorgeräusch wurde leiser und erstarb, die Tür ging auf, und die Perlenkäufer stiegen mit steifen Rücken und Beinen und einem breiten Grinsen im Gesicht aus. Es waren sechs Leute, die aus Japan und Australien stammten, und der Pilot (er war aus Rarotonga). Sie begrüßten Papa Tane und Captain Mareko und Herrn und Frau Erlandsen und einige andere große Farmer. Pastor Boyd sprach ein pure, segnete das Flugzeug, den Piloten und die Passagiere, und dann war es Zeit für ein üppiges Mittagessen bei der Kirche. Unsere ganze Familie war dort (außer Amiria, die Schule hatte, und Erik Bergman, der in seiner Hütte lag und sich ausruhte, weil es ihm nicht gut ging).
Papa Tane sprach ein paar kurze Begrüßungsworte, und dann hielt Herr Erlandsen (der seine eigene Stimme liebte) eine äußerst lange und inhaltslose Rede, die vor allem von seiner eigenen Wichtigkeit handelte.
Noch am selben Tag fuhren vier der Käufer und der Pilot nach Tauhunu hinüber. Die beiden anderen, ein Australier und ein Japaner, blieben in Tukao, um bei uns im Dorf die Ware zu kategorisieren und die Preise festzulegen. Die Luft schwirrte von den vielen Stimmen und Erwartungen, ein Wirbelsturm aus Dollarscheinen würde Manihiki in die Zukunft fegen. Ich blieb im Hintergrund, aber die Spannung kribbelte auch in meinem Magen. Die Käufer wurden bei Erlandsens einquartiert, an ihrer Verpflegung beteiligten sich alle Familien, und am Abend versammelten sich die Männer am Feuer vor unserer Perlenwerkstatt. Tangas Selbstgebrannter war gelungen, Barbie sang im Falsett, der Wind in der Lagune war so kühl wie schon lange nicht mehr.
»Komm zum Essen«, rief man vorbeikommenden Schatten zu. »Wir haben taro und ika mata!«
Ich saß, an die Perlenwerkstatt gelehnt, außerhalb des Kreises und lauschte den Stimmen und den Wellen. Moana hockte neben mir, ich spürte, dass sie zufrieden war. Der Schwede kam aus seiner Hütte und ließ sich, wie üblich, im äußeren Kreis nieder.
Es gab eigentlich nur eine Wolke an unserem Horizont, den Mangel an ökonomisch bewanderten Personen, die den Käufern assistieren konnten. Man beleuchtete die Frage von allen Seiten, zog die Eröffnung einer Bankfiliale auf der Insel in Erwägung, um kompetente Leute zu bekommen (falls denn das elende Schiff mal wieder fahren würde).
»Was ist mit dir?« Captain Marekos Frage war an Nikau gerichtet. »Kannst du nicht mit Zahlen umgehen?«
Es stimmte, Nikau war genauso ein Ass in Mathe wie Moana.
»Ich verstehe aber nichts von Buchführung«, sagte er.
Ohne Vorwarnung erhob sich der Schwede und stand mit der Krücke in der Linken wankend da. »Vielleicht kann ich weiterhelfen. Ich habe wirtschaftliche Erfahrung.«
Ein kurzes erstauntes Schweigen entstand, verblüffte Münder wandten sich dem Ausländer zu. Die Narbe auf seiner Stirn glühte im Feuerschein.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Prolog
Niemand weiß, dass ich hier bin. Niemand wird es je erfahren.
Ich bin vor siebeneinhalb Monaten vor der Küste Tansanias ertrunken.
Nein, ich schreibe nicht von der anderen Seite, obwohl ich immer noch überzeugt bin, dass es eine gibt. Egal, was Logik und Wissenschaft sagen. Wir Menschen glauben von Natur aus an etwas.
Meine Kinder fehlen mir. Die Sehnsucht nach ihnen ist ein physischer Schmerz, ein dunkles Loch in der Brust.
Es ist schön hier, nehme ich an. Mittlerweile weiß ich, dass man eine vertraute Umgebung nicht unbedingt zu schätzen weiß.