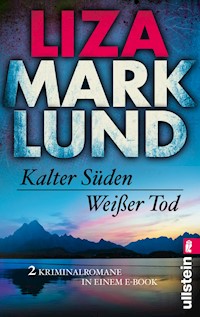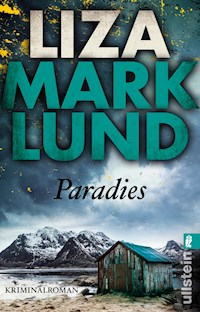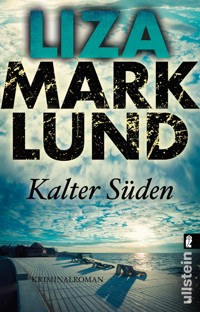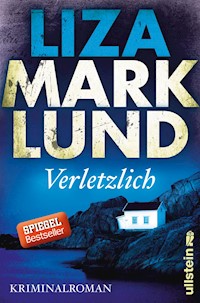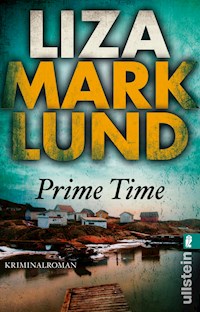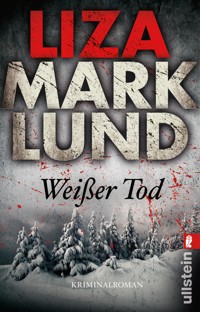
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vom Schrecken der Globalisierung - ein hochaktueller Schweden-Krimi In einer Schneewehe liegt eine blasse schöne Frau. Sie ist die vierte junge Mutter, die innerhalb weniger Wochen in einem Stockholmer Vorort erstochen wurde. Journalistin Annika Bengtzon kämpft gegen die Spekulationen rund um einen Serienkiller, an dessen Existenz sie als einzige nicht glaubt. Mitten in den Recherchen wird ihr Mann, Teilnehmer einer internationalen Delegation, während einer Konferenz in Nairobi als Geisel genommen. Die Entführer stellen inakzeptable Forderungen und exekutieren nach und nach die Menschen in ihrer Gewalt. Als Annika mit allen Mitteln versucht, ihren Mann zu retten, entdeckt sie plötzlich eine Verbindung zu den Morden in Stockholm. Ausgezeichnet mit dem Radio Bremen Krimipreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Liza Marklund
WEISSER TOD
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Anne Bubenzer und
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Du gamla, du fria bei Piratförlaget, Stockholm.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN 978-3-8437-0218-8
© 2011 by Liza Marklund © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: FinePic®
TAG 0
Dienstag, 22. November
Ich hatte keine Angst. Die Straßensperre sah aus wie alle anderen, die wir passiert hatten: Ölfässer auf beiden Seiten der Piste (ein Frevel, so etwas Straße zu nennen), quer darüber ein notdürftig von Ästen befreiter Baumstamm und daneben einige Männer mit verdreckten Maschinengewehren.
Kein Grund zur Beunruhigung also. Trotzdem drückte Catherine ihr Bein fest an meins. Das Gefühl strömte durch Muskeln und Nervenbahnen bis in meinen Schwanz, aber ich verfolgte es nicht weiter, sondern warf ihr nur schnell einen Seitenblick zu und lächelte sie vielversprechend an.
Sie war interessiert, wartete nur auf meinen nächsten Zug.
Ali, unser Fahrer, ließ das Seitenfenster runter und reichte unsere Passierscheine mit der beglaubigten Sicherheitsstufe hinaus. Ich saß direkt hinter ihm. Der Wagen war für den Verkehr im Commonwealth gebaut und hatte Rechtssteuerung. Ein heißer Wind wirbelte Staub herein, trocken und rau. Ich betrachtete die Landschaft: niedrige Dornenbüsche, struppige Akazien. Die Erde war verbrannt, der Himmel endlos. Ein Stück weiter vor uns war auf der rechten Seite ein schmutziger Lastwagen zu erkennen, vollbeladen mit leeren Flaschen, alten Kartons und einem Tierkadaver. Der andere Landcruiser hielt links neben uns, und die deutsche Staatssekretärin winkte durchs Fenster herüber. Keiner von uns machte sich die Mühe zu reagieren.
Warum wurde eine Staatssekretärin auf eine solche Reise geschickt? Diese Frage stellten wir uns alle.
Ich sah auf die Uhr. 13.23. Wir hatten ein wenig Verspätung, aber nicht nennenswert. Der rumänische Delegierte hatte jede Menge Fotos geschossen, und Catherine hatte bereits eine Art Briefing für die Konferenz abgeschickt. Ich konnte mir schon denken, warum. Sie hatte keine Lust, den Abend heute mit Schreibarbeiten zu verbringen. Sie wollte das offizielle Essen ausfallen lassen und mit mir allein sein. Sie hatte mich noch nicht gefragt, aber ich spürte es.
Jetzt lehnte sie sich an mich, doch ich beschloss, sie noch ein bisschen zappeln zu lassen.
»Thomas, was geht hier vor?«, flüsterte sie in schönstem BBC-Englisch.
Unser Fahrer hatte die Autotür geöffnet und war ausgestiegen. Männer mit Maschinengewehren umringten den Wagen. Einer öffnete die Beifahrertür und sagte etwas in lautem Kommandoton zu dem Dolmetscher. Der schmächtige Mann hob die Hände über den Kopf und stieg ebenfalls aus; ich hörte, wie einer der Bodyguards auf dem Sitz hinter uns seine Waffe entsicherte. Plötzlich sah ich Metall aufblitzen. In diesem Augenblick fand ich die Situation zum ersten Mal unangenehm.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte ich und versuchte, gelassen zu klingen. »Ali regelt das schon.«
Auf der Beifahrerseite wurde jetzt auch die hintere Tür geöffnet. Der französische Delegierte, Margurie, der direkt an der Tür saß, stieg demonstrativ seufzend aus. Trockene Hitze drang herein und vernichtete den letzten Rest der klimatisierten Luftfeuchtigkeit im Wageninneren, der rote Staub legte sich wie ein dünnes Flies auf die Lederbezüge.
»Worum geht es?«, fragte der Franzose mit nasaler Stimme. Er klang ehrlich entrüstet.
Ein hochgewachsener Mann mit gerader Nase und hohen Wangenknochen baute sich vor meiner Tür auf und starrte mich an. Sein schwarzes Gesicht kam sehr nah. Das eine Auge war rotgeädert, als ob es erst kürzlich einen Schlag abbekommen hätte. Er hob sein Maschinengewehr und klopfte mit dem Lauf ans Fenster. Hinter ihm flimmerte die Luft vor Hitze, der Himmel erschien weiß und löchrig.
Die Angst schnürte mir den Hals zu.
»Was sollen wir tun?«, flüsterte Catherine. »Was wollen diese Männer?«
Annikas Bild schoss mir durch den Kopf, ihre großen Augen und ihr regengleiches Haar.
»Macht demonstrieren«, sagte ich. »Mach dir keine Sorgen. Tu, was sie sagen, dann wird es schon gutgehen.«
Der Lange öffnete die Tür auf meiner Seite des Wagens.
TAG 1
Mittwoch, 23. November
Der Körper der Frau lag zugeschneit auf dem Waldboden, knapp zwanzig Meter von der Kindertagesstätte entfernt. Ein Stiefel ragte aus dem Schnee, wie ein heruntergewehter Ast oder wie ein Teil einer rausgerissenen Wurzel. Genau an dieser Stelle sah die Skispur auf dem Weg unsicher aus, die Abdrücke der Skistöcke waren unregelmäßig. Ansonsten war der Schnee unberührt.
Wäre der Stiefel nicht gewesen, hätte der Körper auch ein Stein sein können, ein Ameisenhaufen oder ein Sack mit Herbstlaub. Er wölbte sich wie eine weiße Robbe aus dem Unterholz, schimmernd und weich. Schneekristalle, die am Stiefelschaft hängengeblieben waren, glitzerten hier und da im Licht der Dämmerung. Der Schuh war braun, der Absatz spitz.
»Sie dürfen hier nicht hin.«
Annika Bengtzon kümmerte sich nicht um den Polizisten, der hinter ihr angeschnauft kam. Sie hatte sich über einen Pfad hinter dem Selmedalsvägen bis zum Fundort durchgeschlagen, vorbei an einem verlassenen Fußballplatz, einen Hügel hinauf und durch den kleinen Wald. Ihre Stiefel waren voller Schnee und es würde nicht mehr lange dauern, bis sie in den Füßen jegliches Gefühl verloren hätte.
»Ich kann keine Absperrung entdecken«, sagte sie, ohne die Leiche aus den Augen zu lassen.
»Dies ist ein Tatort«, sagte der Polizist. Es klang, als würde er seiner Stimme bewusst mehr Tiefe geben. »Ich muss Sie bitten, sich zu entfernen. Sofort.«
Annika machte noch zwei Bilder mit der Handykamera und schaute zu dem Polizisten auf. Er hatte nicht einmal richtigen Bartwuchs.
»Ich bin beeindruckt«, sagte sie. »Die Leiche ist noch nicht ausgegraben und Sie haben schon eine vorläufige Todesursache. Wie ist die Frau denn gestorben?«
Die Augen des Polizisten wurden schmal.
»Woher wissen Sie, dass es sich um eine Frau handelt?«
Annika sah wieder zur Toten hinüber.
»An und für sich stehen ja auch Transen auf hochhackige Schuhe, aber die tragen selten Größe … Was meinen Sie? Sechsunddreißig? Siebenunddreißig?«
Sie ließ ihr Handy in die Umhängetasche fallen, wo es in einem Meer aus Stiften, Kinderhandschuhen, Berechtigungsausweisen, USB-Sticks und Notizblöcken unterging. Ein Kollege des Beamten kam mit einer Rolle Absperrband in der Hand keuchend den Hügel herauf.
»Ist sie vermisst gemeldet?«
»Das ist doch zum Kotzen«, sagte der andere Polizist.
»Was denn?«, fragte Annika.
»Dass die von der Einsatzzentrale die Presse informieren, bevor sie eine Streife losschicken. Hauen Sie ab.«
Annika schulterte ihre Tasche, kehrte der Leiche den Rücken zu und ging wieder zum Fußballplatz hinunter.
Seit ein paar Monaten arbeiteten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in ganz Schweden mit dem neuen digitalen Funksystem RAKEL. Es war abhörsicher, und sämtliche zivilen Belauscher des Polizeifunks waren dadurch arbeitslos geworden. Das Personal der Bezirks-Einsatzzentralen hatte den Job und die Gehaltsaufbesserung, die bei den Medien für Hinweise auf Gewalt und Elend raussprang, begeistert übernommen.
Am Waldrand blieb Annika stehen und ließ den Blick über die vorstädtische Umgebung schweifen.
Die graubraunen neunstöckigen Häuser weiter unten waren in Frost und Nebel gehüllt. Die schwarzen Äste der Bäume spiegelten sich in den blanken Fenstern. Sicher waren die Häuser in den 70ern, ganz zu Anfang der staatlichen Großoffensive im sozialen Wohnungsbau, gebaut worden – die Fassaden vermittelten trotz allem eine Art Wertigkeit, als hätte man damals noch den Ehrgeiz gehabt, menschenwürdigen Wohnraum zu schaffen.
Sie hatte kein Gefühl mehr in den Zehen. Es war schon später Nachmittag. Zwischen den Betonklötzen schien der Wind zu pfeifen.
Axelsberg. Ein Wohngebiet ohne äußere Begrenzung, der Name einer zugigen U-Bahnstation.
»Es gibt eine Leiche hinter einer Kita in Axelsberg, kann noch nicht lange da liegen.«
Der Anruf war von der Telefonzentrale der Zeitung gekommen, als sie gerade auf dem Rückweg von IKEA in Kungens Kurva war. Daraufhin pflügte sie quer über alle vier Fahrspuren durch den Schneematsch, fuhr bei Mälarhojden von der Autobahn ab und erreichte den Fundort sogar eine halbe Minute vor dem ersten Streifenwagen.
Sie schickte zwei der Handyfotos an den Newsdesk, das eine zeigte den Fundort, das andere war eine Nahaufnahme des Schuhs.
Eine Leiche bedeutete nicht zwangsläufig, dass ein Verbrechen geschehen war. Die Polizei ermittelte immer bei unklaren Todesfällen, aber oft stellte sich heraus, dass eine natürliche Ursache vorlag, ein Unfall oder Selbstmord.
Etwas sagte ihr, dass dies hier nicht so war.
Diese Frau war nicht joggen gewesen und hatte dann einen Herzinfarkt bekommen. Nicht in solchen Schuhen. Und selbst wenn, wäre sie nicht durch das Gebüsch neben dem Weg gejoggt. Es war kaum wahrscheinlich, dass sie gestolpert und gefallen war, mehrere Meter weit und direkt ins Dickicht.
Die Leiche war zugeschneit, aber der Informant hatte recht gehabt: Sie konnte noch nicht lange dort gelegen haben.
Es hatte erst spät am Vorabend begonnen zu schneien. Scharfe Eiskristalle, die gegen die Fenster peitschten und jeden wie Nadeln ins Gesicht stachen, der wie Annika gezwungen gewesen war, um halb elf Uhr abends noch einmal das Haus zu verlassen und Milch zu kaufen.
Im Laufe des Morgens war der Schneefall stärker geworden, und der nationale Wetterdienst SMHI hatte eine Unwetterwarnung herausgegeben.
Vor einer Stunde hatte der Schneefall dann plötzlich aufgehört.
Die Frau konnte nicht die ganze Nacht dort gelegen haben, sonst wäre auch der Fuß eingeschneit gewesen.
Sie ist irgendwann in den Morgenstunden dort hingekommen, dachte Annika. Was hatte eine Frau in hochhackigen Stiefeln morgens um acht im Schneesturm und allein auf einem Fußweg hinter einer Kindertagesstätte zu suchen?
Annika bog nach rechts ab, hinunter zur Straße.
Auf dem Selmedalsvägen gab es nicht nur eine, sondern gleich zwei Kindertagesstätten direkt nebeneinander: eine städtische und eine private. Drei Streifenwagen mit rotierenden Saftmixern auf dem Dach produzierten vor den Kitaeingängen eine Wolke aus Abgasen, die in Schwaden zwischen Klettergerüsten und Rutschbahnen abzogen. Solange das Blaulicht eingeschaltet war, mussten die Motoren laufen, sonst entluden sich die Batterien. Mehr als einmal war eine entscheidende Verbrecherjagd gescheitert, weil die Polizeiwagen nicht angesprungen waren.
Zwei Frauen und ein Mann, vermutlich Eltern, näherten sich mit aufgerissenen Augen und schnellen Schritten. War etwas passiert? Doch wohl nicht in ihrer Kita? Doch wohl nicht ihren Kindern? Ach nein, dann hätte man sie ja angerufen.
Annika stellte sich hinter einen der Streifenwagen, um die Leute abzupassen. Der Vater übernahm das Kommando und ging zu dem Polizeianwärter, der in der Kälte abgestellt worden war, um die Presse und andere Neugierige abzuwimmeln.
Eine Person sei aufgefunden worden, vermutlich tot, oben im Wald … Nein, nicht auf dem Grundstück der Kita, oben auf dem Hügel im Wald … Nein, es sei unwahrscheinlich, dass eines der Kinder die Leiche gesehen habe … Nein, die Todesursache sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt und nichts deute darauf hin, dass der Todesfall im Zusammenhang mit der Kita stehe …
Die Eltern atmeten auf und eilten zu ihrem Nachwuchs, offensichtlich erleichtert, dass der Tod auch dieses Mal das Problem und die Sorge anderer Leute war.
Sie ging zu dem Polizeianwärter hinüber.
»Bengtzon«, sagte sie. »Vom Abendblatt. In welcher Kita hatte sie ihre Kinder?«
Der Anwärter schielte zur städtischen Kita hinüber.
»Eins«, sagte er. »Sie hatte nur ein Kind, soweit ich weiß. Einen Jungen.«
Annika folgte seinem Blick. Ein roter Pappstern leuchtete im Fenster der Eingangstür. Auf den Scheiben klebten ausgeschnittene weiße Schneeflocken.
»Wer hat denn Alarm geschlagen? Ihre Kollegen? Weil sie heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen ist?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ein Nachbar«, sagte er und trat einen Schritt zurück. »Aber darüber müssen Sie mit den Kollegen von der Einsatzzentrale sprechen oder einem Vorgesetzten. Ich weiß eigentlich nichts.«
Das Unbehagen begann wie ein dumpfer Bass in ihrer Magengegend zu vibrieren. Dass sie sich nie daran gewöhnte.
Eine junge Mutter mit kleinen Füßen und hohen Absätzen liefert ihr Kind in der Kita ab, geht heim und stirbt auf einem Fußweg im Schneesturm.
Sie merkte, dass sie vor Kälte zitterte. Der Pappstern drehte sich langsam im Fenster. Ein Mann auf einem Fahrrad fuhr den Selmedalsvägen entlang.
Sie durchwühlte ihre Tasche nach dem Handy, knipste ein Foto von der Kita, nickte dem Polizeianwärter kurz zu und ging zu ihrem Auto.
Seit es aufgehört hatte zu schneien, war die Temperatur beträchtlich gefallen. Ihr Atem gefror an der Innenseite der Windschutzscheibe, und sie musste das Heizgebläse ein paar Minuten auf höchster Stufe laufen lassen, ehe sie losfahren konnte. Sie schnürte ihre Stiefel auf und massierte energisch die Zehen am linken Fuß, um sie wieder zum Leben zu erwecken.
Ellen und Kalle gingen inzwischen allein vom Hort nach Hause. Das war allerdings weniger heldenhaft, als es klang, denn der Hort lag auf der anderen Seite der Hantverkargatan – auch ein Grund, warum sie sich noch nicht um ein neues Domizil gekümmert hatten, obwohl ihre gemietete Dreizimmerwohnung viel zu klein war.
Der Stau kam etwas in Bewegung, sie ließ die Kupplung kommen, und das Auto schlingerte ein paar Meter durch die Schneewehen. Nicht einmal die Stadtautobahn Essingeleden war geräumt. Ob nun der Klimawandel oder der neue Rechtsruck in der Kommunalpolitik für die Schneewälle auf der Autobahn verantwortlich war – möglich war alles. Annika seufzte, griff nach ihrem privaten Handy, rief die zuletzt gewählte Nummer an und lauschte dem Rauschen von Stürmen und Satelliten. Die Verbindung wurde hergestellt, ohne dass ein Rufzeichen zu hören gewesen wäre.
»Hello, you have reached Thomas Samuelsson at the Department of Justice …«
Genervt und eine Spur beschämt beendete sie die Verbindung. Ihr Mann war schon seit vorgestern Abend nicht mehr an sein Handy gegangen. Jedes Mal, wenn sie versucht hatte, ihn zu erreichen, landete sie bei dieser manierierten Mailboxansage, die er stur auf Englisch beibehielt, obwohl sie inzwischen seit fast vier Monaten aus Washington zurück waren. Und dann auch noch dieses deutlich ausgesprochene und betont nonchalante »Department of Justice«. Du liebe Güte …
Ihr Redaktionshandy klingelte irgendwo weit unten in ihrer Tasche. Sie kramte in aller Ruhe danach, weil der Verkehr ohnehin stand.
»Was zur Hölle hast du mir da für Bilder geschickt?«
Patrik Nilsson, der Nachrichtenchef des Blattes, hatte offenbar die Fotos vom Waldweg in die Finger gekriegt.
»Eine Tote. Die Frau hat ihren Sohn heute Morgen bei der Kita abgeliefert und ist auf dem Heimweg gestorben. Todesursache unklar. Ich wette einen Zehner, dass sie mitten in einer Scheidung steckt und der Vater des Jungen sie totgeschlagen hat.«
»Sieht aus wie eine Baumwurzel. Wie war es bei Ingvar?«
»Ingvar?«
»Ingvar Kamprad aus Elmtaryd Agunnaryd?«
Sie musste sich anstrengen, um sich an den Auftrag, für den sie ursprünglich losgeschickt worden war, zu erinnern.
»Das gibt nichts her.«
»Bist du sicher?«
Patrik hatte sich in den Kopf gesetzt, dass das Dach der IKEA-Halle in Kungens Kurva, der weltweit größten Filiale, wegen der Schneelast akut einsturzgefährdet sei. Zweifellos wäre das eine gute Story gewesen, wenn es denn gestimmt hätte. Das Personal an der Information war vollkommen überrascht, als Annika fragte, ob es Probleme mit einem einsturzgefährdeten Dach gebe. Sie tat so, als habe sie einen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, was allerdings nicht ganz der Wahrheit entsprach. Der »Hinweis« war vermutlich während der Elf-Uhr-Konferenz am Vormittag in Patrik Nilssons Gehirn entstanden. Folglich hatte man sie losgeschickt, um herauszufinden, ob sich die Wirklichkeit irgendwie den Bedürfnissen des Abendblatts anpassen ließ, was, wie sich in diesem Fall herausstellte, einigermaßen schwierig zu bewerkstelligen war. Das Personal an der Information hatte irgendeinen technischen Leiter in einem Zentralbüro angerufen, der telefonisch versicherte, dass das Dach eine Schneelast von zweiundzwanzig Metern aushielt. Mindestens.
»Kein marodes Dach«, sagte sie lakonisch.
»Verdammter Mist, haben sie dich raufgelassen, damit du nachsehen konntest?«
»Yes«, log sie.
»Nicht mal Risse?«
»Null.«
Plötzlich kamen die Autos um sie herum wieder in Bewegung. Sie schaltete in den ersten Gang, geriet im Schneematsch ein wenig ins Rutschen und konnte dann auf fast 20 Stundenkilometer beschleunigen.
»Was machen wir mit der toten Mama?«, fragte sie.
»Mit der umgestürzten Wurzel?«
»Die Polizei weiß so gut wie sicher, wer sie ist. Ein Nachbar hat angerufen und sie im Laufe des Tages vermisst gemeldet. Aber bestimmt geben sie den Namen heute Abend nicht mehr frei.«
»Ist das die, die hinter einer Kita gelegen hat?«, fragte Patrik mit neuem Interesse in der Stimme. »Ist sie von einem der Kinder gefunden worden?«
»Nein«, sagte Annika und schaltete in den zweiten Gang. »Einem Langläufer.«
»Bist du sicher? Vielleicht ist eines der Kinder mit einem Schlitten auf sie drauf gefahren? Vielleicht hat ja ein Arm rausgeguckt und sich in der Kufe verfangen?«
»Der Stau löst sich auf«, sagte Annika. »Ich bin in einer Viertelstunde da.«
Sie stellte den Wagen im Parkhaus der Zeitung ab und nahm die Treppe hinunter in die Katakomben. Früher hatte es vier Aufgänge zur Redaktion gegeben, aber Bombendrohungen und Besserwisser hatten dafür gesorgt, dass momentan alle bis auf einen geschlossen waren. Die einzige Möglichkeit, die Hausmeisterei zu umgehen, war der Weg vom Parkhaus hinunter in den Keller und dann mit dem Fahrstuhl hinter der Rezeption vorbei nach oben. Zwar war Tore Brandt gefeuert worden, als herauskam, dass er nachts schwarzgebrannten Schnaps an die Redakteure verkaufte, aber das alte Unbehagen, das sie immer überfallen hatte, wenn sie an dem langen Tresen vorbeimusste, steckte ihr noch in den Knochen, und sie entschied sich fast immer für den Weg durch den Keller.
Es dauerte ein paar Minuten, bis der Aufzug da war. Auf dem Weg nach oben zog sich wie jedes Mal, wenn sie in die Redaktion kam, ihr Magen in einer Art erwartungsvoller Spannung zusammen, bereit für alle Eventualitäten.
Sie holte tief Luft, dann betrat sie den fleckigen Teppichboden.
Die Bürolandschaft war während ihrer drei Jahre als Korrespondentin in Washington mehrfach umgebaut und zeitgemäß an die neuen Ansprüche von Teamarbeit und Flexibilität angepasst worden. In der Mitte schwebte der Newsdesk wie ein leuchtendes Raumschiff, um das herum waren wie zwei Halbmonde die Druck- und die Internetredaktion angeordnet, die mit dem Rücken zueinander sitzend auf ihre Computermonitore starrten. Berit Hamrin, ihre Lieblingskollegin, nannte sie »die Erdnussflips«. Die Leute vom Web-TV saßen nebenan, wo sich zuvor die Telefonzentrale befunden hatte. Über ihren Köpfen schwebte ein Dutzend gigantischer Bildschirme, über die Nachrichtenseiten aus dem Web-Fernsehen, Videotext und Dokusoaps flimmerten. Das Marketing und die Anzeigenabteilung waren nun auch räumlich ein Teil der Redaktion. Die Wandschirme, die sie von den Tischen der Tagesreporter getrennt hatten, waren allesamt abgebaut worden. Trotzdem erfüllte sie immer dieselbe konzentrierte Ruhe, wenn sie dort saß.
Ansonsten war alles beim Alten, nur ein bisschen beengter. Die zahlreichen Lampen verteilten noch immer dasselbe blau-flimmernde indirekte Licht. Die Tische quollen weiterhin über von Papier. Die Köpfe wurden noch immer konzentriert gesenkt. Zielstrebige Nervosität trieb die Wirklichkeit vor sich her, brach sie auf und erschuf sie neu.
Die Jahre in Washington erschienen Annika wie eine Geschichte, die jemand erzählt oder die sie in einem Roman gelesen hatte; wie die Überbleibsel eines Traums. Das Leben war wieder auf null gestellt. Genau hier hatte sie vor dreizehn Jahren als Sommervertretung angefangen, war Hinweisen nachgegangen, als Springer und Handlanger der Nachrichtenbranche.
Eine zähe Müdigkeit erfasste sie. Die Zeit drehte sich unablässig um ihre eigene Achse, Annika rannte noch immer den gleichen Frauenmorden hinterher wie in ihrem ersten Sommer, lediglich im Auftrag anderer Nachrichtenchefs. Sie war zurück und wohnte im selben Viertel wie früher, bloß in einer anderen Wohnung, die Wirklichkeit war davongelaufen und hatte sie zurückgelassen.
»Hast du schon gegessen?«, fragte sie Berit Hamrin, die konzentriert auf ihrem Laptop schrieb.
»Eine Scheibe Brot«, sagte Berit, ohne den Blick vom Bildschirm zu heben oder langsamer zu tippen.
Annika holte ihren Rechner aus der Laptoptasche. Selbst die Bewegungen waren die gleichen: Stecker einstöpseln, Schirm aufklappen, Rechner starten, ins Netzwerk einloggen. Berits Haar war grauer geworden, und sie trug eine andere Brille, ansonsten hätte die Welt um Annika herum dieselbe sein können wie in dem Jahr, als sie 24 geworden war. Damals war es heißer Sommer gewesen, und die tote junge Frau hatte hinter einem Grabstein auf einem Friedhof gelegen. Jetzt war es eiskalter Winter, und die Toten lagen hinter Kitas in einem Wäldchen. Oder auf Parkplätzen. Oder in einer Wohngegend oder oder oder …
Sie runzelte die Stirn.
»Du«, sagte sie zu Berit, »hat es im Herbst nicht mehrere Frauenmorde in Stockholm gegeben? Im Freien?«
»Nicht mehr als sonst auch, glaube ich«, sagte Berit.
Annika öffnete die Seite mediearkivet.se, ein kostenpflichtiges Online-Archiv, in dem die meisten Medien Schwedens ihre veröffentlichten Artikel und Beiträge speicherten. Sie suchte nach »Frau ermordet Stockholm«, dann »ab August« und erhielt einige Treffer. Die Texte waren keine richtigen Artikel, eher Kurzmeldungen, vor allem aus der Morgenpresse.
Ende August war in Fisksätra im Bezirk Nacka am Stockholmer Stadtrand eine 54-jährige Frau tot auf einem Parkplatz gefunden worden. In ihrem Rücken steckte ein Messer. Ihr Mann hatte früher bereits eine kurze Gefängnisstrafe verbüßt, weil er sie geschlagen und bedroht hatte. Offenbar hatte man ihn wegen Mordes angeklagt, später aber aus Mangel an Beweisen laufengelassen. Da der Ehemann sofort gefasst worden war, blieb es bei einer Nachricht in der Rubrik »Kurz und Knapp« im Stockholm-Teil der Morgenzeitung. Die Sache wurde als Familientragödie angesehen und abgehakt.
In derselben Rubrik fand sie die nächste Notiz – eine knappe Woche später veröffentlicht. Eine 19-jährige Ausländerin war an einem beliebten Badestrand am Ulmansjön in Arninge, nördlich der Stadt, ermordet worden. Sie war an unzähligen Messerstichen gestorben. Ihr Verlobter, ihr Cousin im Übrigen, wurde der Tat verdächtigt. Er bestritt, das Verbrechen begangen zu haben.
Und Mitte Oktober war eine 37-jährige Mutter dreier Kinder in einer Straße in Hässelby erstochen worden. Der Exmann der Frau kam unter Anfangsverdacht in Untersuchungshaft. Ob er angeklagt, freigelassen oder verurteilt worden war, konnte Annika dem Ausschnitt nicht entnehmen. Es gab auch noch eine Reihe von Morden und Körperverletzungen mit Todesfolge in anderen Teilen des Landes, aber die Texte dazu waren noch kürzer.
»Du, Annika«, sagte Patrik und baute sich vor ihr auf, »könntest du einen Brand in Sollentuna übernehmen? Scheint so, als würden die Weihnachtsbrände losgehen, irgendeine Alte hat ihren Adventskranz in Flammen gesetzt. Schreib irgendwas darüber, wie schlecht die Schweden mit ihren Feuerlöschern umgehen können und dass sie nie die Batterien in ihren Rauchmeldern erneuern. Kannst eine richtig gute Verbraucher-Aufklärung draus machen: So entkommen Sie den Killer-Kerzen …«
»Ich hab doch noch die tote Mutter bei der Kita«, sagte Annika.
Patrik blinzelte verständnislos.
»Aber das war doch nichts«, sagte er.
»Der vierte Mord, seit ich wieder hier bin«, erwiderte sie und drehte ihm den Bildschirm zu. »Alles Frauen, alle aus Stockholm, alle erstochen. Stell dir vor, es entgeht uns was! Wenn da jetzt ein Serienmörder frei rumläuft?«
Der Nachrichtenchef schien plötzlich unsicher zu werden.
»Meinst du? Wie ist die denn gestorben? Wo war das noch gleich? Bredäng?«
»Axelsberg. Du hast doch das Foto gesehen. Was hältst du davon?«
Patrik ließ den Blick über die Redaktion schweifen und kramte in seinem Gedächtnis nach dem Foto von der Baumwurzel. Vorläufig war sie noch ein Schneehaufen. Sein Blick wurde klar.
»Serienmörder?«, kicherte er. »Wunschdenken!«
Er machte auf dem Absatz kehrt und ging mit seinen Killer-Kerzen zu einem anderen Reporter.
»Dich haben sie also dahin geschickt«, sagte Berit. »Mutter von einem Kleinkind? Scheidung? Anzeige wegen häuslicher Gewalt, die niemand ernst genommen hat?«
»Wahrscheinlich«, sagte Annika. »Die Polizei hat ihren Namen noch nicht freigegeben.«
Ohne Namen konnte sie keine Meldeadresse ausfindig machen und somit auch keinen Nachbarn. Kein Hintergrund, keine Story – falls die Frau wirklich ermordet worden war.
»Irgendwas Interessantes?«, fragte Annika und wies auf Berits Text, während sie eine Apfelsine aus ihrer Tasche fischte.
»Erinnerst du dich noch an Alain Thery? Im vergangenen Herbst wurde viel über ihn geschrieben.«
Annika dachte nach. Vergangenen Herbst war sie vollkommen mit der Tea-Party-Bewegung und den amerikanischen Kongresswahlen beschäftigt gewesen.
Sie schüttelte den Kopf.
»Der französische Wirtschaftsmagnat, den sie auf seiner Yacht vor Puerto Banús in die Luft gesprengt haben«, sagte Berit und blickte sie über den Rand ihrer Computer-Lesebrille an.
Annikas Blick versank in Erinnerungen.
Weiße Boote und blaues Meer. Puerto Banús. Das war der Ort, wo sie und Thomas sich wieder nähergekommen waren, in einem Zimmer im Hotel Pyr neben der Autobahn. Sie hatte über den Gas-Mord an der Familie Söderström berichtet, Thomas lebte damals noch mit Sophia Grenborg zusammen. Er war zu einer Konferenz nach Málaga gekommen und dann mit Annika fremdgegangen.
»Auf YouTube ist ein Film veröffentlicht worden«, sagte Berit, »in dem behauptet wird, dass Alain Thery der größte Sklavenhändler Europas war. Sein gesamtes Wirtschaftsimperium war nur eine Fassade, hinter der junge Afrikaner nach Europa geschmuggelt und ausgebeutet wurden. Wenn nötig bis zum Tod.«
»Klingt nach posthumer Verleumdung«, sagte Annika, warf die Orangenschale in den Papierkorb und nahm sich einen Schnitz. Er war sauer wie eine Zitrone.
»Laut dieses YouTube-Films gibt es heute weltweit mehr Sklaven als jemals zuvor, und sie sind nie billiger gewesen.«
»Mit solchen Sachen beschäftigt sich Thomas«, sagte Annika, verzog das Gesicht und aß noch ein Stück Apfelsine.
»Frontex«, sagte Berit.
Annika warf den Rest der Frucht zu den Schalen.
»Genau. Frontex.«
Thomas und sein toller Job.
»Ich finde das einfach schrecklich«, sagte Berit. »Die ganze Frontex-Geschichte ist ein unglaublich zynisches Experiment. Ein neuer eiserner Vorhang.«
Annika loggte sich bei Facebook ein und scrollte durch die Statusmeldungen der Kollegen.
»Das Ziel ist, den armen Teil der Welt von Europas Überfluss auszuschließen. Und mit einer zentralen Organisation ersparen sich die Regierungen der einzelnen Staaten eine Menge Kritik. Sie werfen Leute aus dem Land und verweisen dann einfach auf Frontex und waschen ihre Hände in Unschuld, ungefähr wie Pontius Pilatus.«
Annika lächelte sie an.
»Und in deiner Jugend warst du Mitglied der FNL.«
Eva-Britt Qvist teilte mit, sie freue sich auf einen Theaterbesuch am Abend, Patrik hatte vor dreiundvierzig Minuten eine Fladenbrotrolle gegessen, Bilder-Pelle einen Link zu einer Dokumentation über das Abendblatt von 1975 gepostet.
»Frontex’ neuste Erfindung ist, dass die Dritte Welt ihre Grenzen selbst dichtmacht. Wie praktisch. Wir in der Ersten, alten und freien Welt brauchen uns mit dieser Frage kein bisschen auseinanderzusetzen. Gaddafi in Libyen hat von unserem EU-Kommissar eine halbe Million bekommen, damit er Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea und Sudan in riesigen Konzentrationslagern unterbringt.«
»Stimmt«, sagte Annika. »Aus dem Grund ist Thomas in Nairobi. Sie wollen, dass die Kenianer ihre Grenze nach Somalia schließen.«
Sie packte ihr privates Handy aus und wählte noch einmal Thomas’ Nummer.
»Hast du kein neues Telefon bekommen?«
»Doch«, sagte Annika.
»Hello, you have reached Thomas Samuelsson at the …«
Sie legte auf und versuchte, sich über ihr Gefühl klarzuwerden. Die Frage war, mit welcher Frau er heute Abend schlief. Der Gedanke löste keine Scham mehr bei ihr aus, lediglich dumpfe Resignation.
Als die Familie im Sommer nach Schweden zurückgekehrt war, hatte man Thomas eine Stelle im Justizministerium als Referent für Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten bei Migranten; für Flüchtlings-, Ausländer- und Asylpolitik angeboten. Kein sonderlich glanzvoller Posten. Thomas war ziemlich sauer gewesen. Er hatte geglaubt, nach den Jahren in Washington etwas Schickeres zu bekommen. Vielleicht hatte er sich mit den Konferenzen getröstet, zu denen er reisen würde.
Annika schob den Gedanken entschlossen beiseite und rief die für Verbrechen im Bezirk Nacka zuständige Staatsanwaltschaft an. Sie wusste, dass die Telefonzentrale rund um die Uhr besetzt war. Welcher Staatsanwalt in einem Mordfall ermittelte, der sich auf einem Parkplatz in Fisksätra ereignet hatte, konnte die Telefonistin ihr jedoch nicht sagen.
»Wir arbeiten auch nur am Bildschirm«, sagte die Frau von der Zentrale bedauernd. »Ich müsste Sie zur Verwaltung durchstellen, aber die macht um fünfzehn Uhr Feierabend.«
Na ja, es war einen Versuch wert gewesen.
Sie rief auch bei der Staatsanwaltschaft in Norrort und Västerort an, doch niemand wusste, wer für den Mord am Badestrand in Arninge und den im Villenviertel in Hässelby zuständig war. (Allerdings wusste jeder, wer die coolen Verbrechen – den spektakulären Werttransportüberfall per Helikopter oder die Drogendelikte berühmter Sportler – untersuchte.)
»Jetzt hat Frontex sogar angefangen, Flugzeuge zu chartern«, sagte Berit. »Sie sammeln in ganz Europa illegale Immigranten ein und fliegen sie nach Lagos oder Ulan Bator aus. Schweden hat auf diese Art schon x-mal Leute abgeschoben.«
»Ich glaube, mir reicht es für heute«, sagte Annika.
Sie fuhr den Computer herunter, packte ihn routiniert zusammen und stopfte ihn in die Laptoptasche, dann zwängte sie sich in ihre Jacke und ging zum Ausgang.
»Moment, Frau Bengtzon!«, hörte sie aus der Hausmeisterei, als sie schon fast durch die Drehtür war.
Verdammt, dachte sie. Die Autoschlüssel.
Sie machte eine Runde mit der Drehtür und kam mit einem angestrengten Lächeln zurück in die Eingangshalle.
»Tut mir sehr leid«, sagte sie und legte die Schlüssel von TKG 297 auf den Empfangstresen.
Der Hausmeister, ein neuer Kerl, nahm sie entgegen, ohne zu meckern oder zu fragen, ob sie getankt und das Fahrtenbuch ausgefüllt hatte (was nicht der Fall war).
»Schyman sucht Sie«, sagte der Neue. »Er sitzt im Konferenzraum Grodan, Sie sollen sofort dorthin kommen.«
Annika, die schon gehen wollte, blieb stehen.
»Warum das denn?«
Der Mann zuckte mit den Schultern.
»Noch fiesere Arbeitszeiten?«, schlug er vor.
Annika nickte anerkennend. Vielleicht gab es ja doch noch Hoffnung für die Hausmeisterei.
Sie machte sich auf den Weg zu den Konferenzräumen. Warum in aller Welt hieß der Raum Grodan?
Der Chefredakteur öffnete ihr die Tür.
»Hallo, Annika. Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz.«
»Werde ich nach Jönköping versetzt?«, fragte sie.
Drei ernste Männer in dunklen Mänteln erhoben sich von ihren Plätzen an dem kleinen Konferenztisch in heller Birke, als sie eintrat. Der Schein einer Halogenlampe spiegelte sich im Whiteboard an der hinteren Wand, und sie musste blinzeln.
»Was wird das hier?«, fragte sie und hob die Hand wegen der blendenden Tafel.
»Wir kennen uns ja bereits«, sagte der Mann, der ihr am nächsten saß, und streckte die Hand aus.
Es war Jimmy Halenius, Thomas’ Chef im Justizministerium. Sie erwiderte seinen Händedruck und wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Das ist Hans-Erik Svensson und das Hans Wilkinsson«, sagte er und deutete mit der Hand auf die beiden anderen Männer. Sie machten keine Anstalten, sie zu begrüßen.
Das doppelte Hänschen, dachte sie. Vor Wachsamkeit wurde ihr Rücken ganz steif.
»Annika«, sagte Anders Schyman, »setzen Sie sich doch.«
Wie aus dem Nichts überfiel sie die Angst und schlug ihre Krallen mit einer Kraft in sie, dass ihr der Atem stockte.
»Was ist?«, stieß sie hervor und blieb stehen. »Ist etwas mit Thomas? Was ist mit Thomas passiert?«
Jimmy Halenius trat zu ihr.
»Soweit wir informiert sind, ist Thomas nicht in Gefahr«, sagte er und erwiderte ihren Blick.
Seine Augen waren tiefblau, sie erinnerte sich daran, dass ihr schon damals aufgefallen war, wie blau sie waren. Ob er wohl Linsen trägt?, dachte sie.
»Sie wissen, dass Thomas an der Frontex-Konferenz in Nairobi teilnimmt. Es geht um die erweiterte Zusammenarbeit an den Grenzen zu Europa«, sagte der Staatssekretär.
Unser neuer eiserner Vorhang, dachte Annika. Du altes, freies Europa.
»Vier Tage lang hat Thomas an der Konferenz im Kenyatta International Conference Center teilgenommen. Gestern Morgen hat er dann den Kongress verlassen, um als schwedischer Delegierter an einer Erkundungsreise nach Liboi an der somalischen Grenze teilzunehmen.«
Aus unerfindlichen Gründen schoss ihr das Bild der eingeschneiten Leiche hinter der Kita in Axelsberg durch den Kopf.
»Ist er tot?«
Die dunkelgekleideten Männer hinter Halenius wechselten einen Blick.
»Darauf deutet nichts hin«, fuhr Jimmy Halenius fort, zog einen Stuhl hervor und bot ihr an, sich zu setzen. Sie sank auf die Sitzfläche und bemerkte den Blickwechsel zwischen den Männern namens Hans.
»Und wer sind die?«, fragte Annika und sah zu den beiden hinüber.
»Annika«, sagte Halenius, »ich möchte, dass Sie mir jetzt genau zuhören.«
Ihre Augen huschten durch den Raum auf der Suche nach einem Ausgang, einem Fluchtweg, aber es gab keine Fenster, nur eine weiße Schreibtafel und einen antiken Overheadprojektor in einer Ecke und das schwache Summen eines Ventilators unter der Decke. Die Wände waren hellgrün, eine Farbe, die in den Neunzigern modern gewesen war. Lime.
»Die Delegation, die aus sieben Repräsentanten verschiedener EU-Staaten bestand, sollte sich vor Ort ein Bild davon machen, wie die Grenzüberwachung nach Somalia funktioniert, um anschließend auf der Konferenz darüber zu berichten. Das Problem ist, dass die Delegation verschwunden ist.«
Ihr Puls dröhnte in den Ohren. Der braune Stiefelschaft mit dem hohen Absatz zeigte geradewegs in die Luft.
»Sie waren mit zwei Fahrzeugen der Marke Toyota Landcruiser 100 unterwegs. Von den Wagen und von den Delegierten fehlt seit gestern Nachmittag jede Spur …«
Der Staatssekretär verstummte.
Annika starrte ihn an.
»Was meinen Sie damit? Was soll das heißen, verschwunden?«
Er wollte etwas sagen, aber sie unterbrach ihn.
»Ich meine, wie denn? Was heißt ›jede Spur‹?«
Sie stand auf. Hinter ihr kippte der Stuhl um. Jimmy Halenius erhob sich ebenfalls, direkt neben ihr. Seine blauen Augen funkelten.
»Die Peilsender der Wagen sind unmittelbar außerhalb von Liboi gefunden worden«, sagte er. »Zusammen mit dem Dolmetscher und einem Bodyguard der Delegation. Der Dolmetscher und der Sicherheitsbeamte sind tot.«
Der Raum drohte umzustürzen. Annika klammerte sich an den Birkentisch, um Halt zu finden.
»Das ist nicht wahr«, sagte sie.
»Es gibt keine Hinweise darauf, dass andere Mitglieder der Gruppe zu Schaden gekommen sind.«
»Das muss ein Missverständnis sein«, sagte sie. »Vielleicht haben Sie sich verhört? Sind Sie sicher, dass sie sich nicht einfach verfahren haben?«
»Es sind mehr als vierundzwanzig Stunden vergangen. Wir können ausschließen, dass sie sich verfahren haben.«
Sie konzentrierte sich auf ihren Atem, sie durfte nicht vergessen zu atmen.
»Wie sind sie gestorben? Der Dolmetscher und der Bodyguard?«
Halenius betrachtete sie ein paar Sekunden, ehe er antwortete.
»Ihnen wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen.«
Sie stolperte zur Tür und griff nach ihrer Tasche, schleuderte sie auf den Tisch und wühlte nach ihren Handys, egal welches, aber sie fand sie nicht, sie kippte die Tasche auf dem Konferenztisch aus, und eine Apfelsine rollte weg und landete unter dem Overheadprojektor, da war das Redaktionshandy, sie griff mit zitternden Fingern danach und wählte Thomas’ Nummer, vertippte sich und musste noch einmal wählen, aber dann wurde eine Verbindung hergestellt, es knisterte und rauschte, es prasselte und knackte:
»Hello, you have reached …«
Sie ließ das Telefon fallen, es landete neben ihren Handschuhen und einem kleinen Notizblock auf dem Boden. Jimmy Halenius bückte sich und hob es auf.
»Das ist nicht wahr«, sagte sie, aber sie wusste nicht, ob die anderen es hörten. Der Staatssekretär sagte etwas, sie verstand es nicht, seine Lippen bewegten sich und er griff nach ihrem Oberarm. Sie schlug seine Hand weg. Sie waren sich ein paar Mal begegnet, aber Halenius wusste überhaupt nichts über ihr Verhältnis zu Thomas.
Anders Schyman beugte sich vor und sagte ebenfalls etwas, seine Augenlider waren geschwollen.
»Lassen Sie mich in Ruhe«, sagte Annika viel zu laut, denn alle starrten sie an, sie raffte ihre Sachen zusammen, außer dem kleinen Notizblock auf dem Boden, den brauchte sie ohnehin nicht, da waren nur ein paar Stichworte von diesem blödsinnigen Auftrag bei IKEA drauf, und dann ging sie zur Tür, zum Ausgang, zum Fluchtweg.
»Annika …«, sagte Jimmy Halenius und versuchte, sich ihr in den Weg zu stellen.
Sie schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht.
»Das ist Ihre Schuld«, sagte sie, und sie spürte, dass es die Wahrheit war.
Und dann verließ sie den Konferenzraum Grodan.
*
Der Lastwagen schaukelte langsam und unregelmäßig. Straßen gab es nicht. Die Reifen rumpelten über Steine oder blieben in Schlaglöchern hängen, Gestrüpp kratzte am Unterboden entlang und Äste raschelten am Verdeck über der Ladefläche. Der Motor brüllte, die Gangschaltung schrie. Meine Zunge war angeschwollen und klebte am Gaumen. Wir hatten seit dem Morgen nichts mehr getrunken. Der Hunger war zu einem konstanten Schmerzgefühl geschrumpft, jetzt war mir vor allem schwindelig. Ich hoffte, dass der Geruchssinn der anderen ebenfalls nicht mehr funktionierte, oder wenigstens Catherines.
Sébastien Magurie, der Franzose, war irgendwann verstummt. Sein nasales Lamento hatte in mir den Wunsch geweckt, dass sie ihn auch beseitigten. (Nein, nein, was rede ich da, das habe ich natürlich so nicht gemeint, auf keinen Fall, aber ich hatte schon vorher meine Schwierigkeiten mit ihm. Genug.)
Der spanische Kollege hingegen, Alvaro, war bewundernswert. Die ganze Zeit hatte er seine kühle Besonnenheit bewahrt, nichts gesagt, sondern einfach getan, was von ihm verlangt wurde. Er lag ganz hinten auf der Ladefläche, wo es am meisten schaukelte und rumpelte, aber er beschwerte sich mit keinem Wort. Ich hoffte, dass die anderen dasselbe von mir dachten.
Anfangs versuchte ich noch zu verfolgen, in welche Richtung sie uns fuhren. Als wir anhielten, stand die Sonne im Zenit, möglicherweise auch leicht im Westen, und zu Beginn fuhren wir in südlicher Richtung (glaube ich, und das war gut so, denn es bedeutete, dass wir uns immer noch in Kenia befanden, und Kenia ist ein funktionierendes Land, mit Straßenkarten und Infrastruktur und Handys), aber ich glaube, nach ein paar Stunden bogen sie nach Osten ab (was überhaupt nicht gut war, denn das hieß, dass wir uns irgendwo im südlichen Somalia befanden – einer Ecke, in der seit Beginn des Bürgerkriegs vor zwanzig Jahren das totale Chaos und Anarchie herrschen), und heute war ich beinahe sicher, dass wir erst Richtung Norden, dann nach Westen fuhren, was bedeuten würde, dass wir wieder ungefähr dort waren, wo alles angefangen hat. Das war relativ unwahrscheinlich, so viel war mir klar, aber man weiß ja nie.
Als Erstes hatten sie uns Uhren und Handys abgenommen, aber es war nun schon ziemlich lange dunkel, also mussten seit unserer Entführung rund sechsunddreißig Stunden vergangen sein. Mittlerweile hatte man sicher Alarm geschlagen. Schließlich waren wir eine offizielle Delegation, irgendeine Form von Hilfe sollte also unterwegs sein. Ich rechnete aus, dass es in Stockholm ungefähr sechs Uhr abends war, Kenia ist Schweden zwei Stunden voraus. Inzwischen würde Annika Bescheid wissen, bestimmt war sie jetzt mit den Kindern zu Hause.
Catherine lag an mich gedrückt, die Wange auf meiner Brust. Sie hatte aufgehört zu schluchzen. Ich wusste, dass sie nicht schlief. Meine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt und schon seit Stunden gefühllos. Die Männer hatten dafür diese schmalen Plastikbänder benutzt, die man durch eine Öse fädelt und dann nicht wieder zurückziehen kann. Kabelbinder nennt man die Dinger, glaube ich. Das Plastik schnitt bei der kleinsten Bewegung in die Haut und ließ sich nicht lockern. Wie wichtig war eigentlich die Blutversorgung von Händen und Füßen? Wie lange ging es ohne? Würden wir bleibende Schäden zurückbehalten?
Dann fuhr der Lastwagen durch ein besonders tiefes Schlagloch, und Catherine und ich stießen mit den Köpfen zusammen. Der Wagen blieb mit ziemlicher Schlagseite stehen, ich wurde gegen das weiche Fett der deutschen Regierungssekretärin gepresst, und Catherine rutschte in meinen Schoß. Auf meiner Stirn bildete sich eine Beule, die schmerzte und hämmerte. Die Fahrertür wurde geöffnet, Männergeschrei, der Wagen bekam noch mehr Schlagseite. Sie redeten und schrien, es klang, als stritten sie. Nach einer Weile (vielleicht fünf Minuten?) verstummten sie.
Die Temperatur sank.
Die Stille wuchs und war irgendwann umfassender als die Dunkelheit.
Catherine begann wieder zu weinen.
»Kommt irgendjemand an einen scharfen Gegenstand dran?«, fragte Alvaro, der Spanier.
Natürlich. Die Plastikbänder.
»Das hier ist vollkommen inakzeptabel«, sagte der Franzose Magurie.
»Sucht auf der Ladefläche nach einem spitzen Stein oder einem Nagel oder nach einem Stück Metall«, sagte der Spanier.
Ich versuchte mit den Fingern den Boden abzutasten, aber Catherine lag teilweise auf mir, die Deutsche war gegen mich gedrückt, und außerdem konnte ich meine Hände nicht mehr richtig bewegen. Im nächsten Augenblick hörten wir einen näherkommenden Dieselmotor. Das Fahrzeug hielt neben dem LKW, und Männer stiegen aus. Ich hörte das Klappern von Metallteilen und wütende Rufe.
Die Plane über der Ladefläche wurde aufgerissen.
*
Anders Schyman saß in seinem Aquarium und ließ den Blick über die Redaktion schweifen. Er zog es vor, die Bürolandschaft so zu nennen, auch wenn sie inzwischen das Marketing, die Auflagenanalyse und die Computerabteilung beherbergte.
Es war ein nachrichtenarmer Tag gewesen. Keine Unruhen in der arabischen Welt, keine Erdbeben, kein Politiker oder Dokusoapstar, der sich lächerlich gemacht hatte. Sie konnten morgen nicht noch einmal das Wetterchaos als Aufmacher bringen, gestern hatten sie vor dem Wetterchaos gewarnt, heute hatten sie über das Wetterchaos berichtet, und Anders Schyman kannte seine Leser (besser gesagt, er vertraute seinen Auflagenanalysten): Morgen musste etwas anderes als der Schneesturm auf das Werbeplakat, und bis jetzt hatten sie nur eine Notlösung. Patrik, der noch immer sauer war, dass er auf das einstürzende Dach von IKEA verzichten musste, hatte auf einer amerikanischen Website einen Hinweis auf eine Frau mit dem sogenannten Alien Hand Syndrome gefunden. Die beiden Hirnhälften der sechzigjährigen Harriet waren nach einer Operation am Kopf plötzlich uneins, die eine weigerte sich, die andere bestimmen zu lassen, und das hatte zur Folge, dass gewisse Körperteile ihr nicht länger gehorchten. Die arme Harriet wurde deshalb unter anderem von ihrer rechten Hand angegriffen, als würde diese von einer außerirdischen Kraft gesteuert (daher auch die Bezeichnung der Krankheit). Manchmal schlug oder kratzte sie Harriet, verschenkte Geld oder zog ihr die Kleider aus, ohne dass die Frau ihr Einhalt gebieten konnte.
Anders Schyman seufzte.
Während die Redaktion versuchte, aus einem Alien Hand Syndrome eine Titelseite zu basteln, saß er in seinem Aquarium auf dem Wissen für einen Superscoop. Natürlich war ihm in den Sinn gekommen, auf die eindringliche Bitte des Justizministeriums um Diskretion und Zurückhaltung zu pfeifen und die Story von der verschwundenen EU-Delegation trotzdem zu bringen, aber er hatte aus seiner Zeit beim staatlichen Fernsehen ein gerüttelt Maß an Ethik mitgenommen, das ihn letztlich davon abhielt. Und in gewissem Maß auch der Gedanke an Annika. Die Verschwörungstheorien der Bloggerwelt, wie die Medien ihre eigenen Leute schützten, waren extrem übertrieben, eigentlich war es sogar genau umgekehrt (man war krankhaft an den eigenen Leuten interessiert und berichtete konsequent im Übermaß über alles, was andere Journalisten sagten und taten), aber ein Rest normaler Mitmenschlichkeit war ihm noch geblieben. Bisher waren nur die engsten Angehörigen über den Vorfall informiert, und darunter waren keine Journalisten, wie ihm versichert worden war.
Die Frage war nur, welche Auswirkungen diese Sache auf Annika und auf seine Pläne mit ihr haben würde.
Er stand auf und trat an die Glastür, die Scheibe beschlug von seinem Atem.
Eine neue Zeit war angebrochen. Heutzutage gab es bei der Zeitung keinen Platz mehr für tiefgründige Enthüllungsjournalisten. Sie brauchten schnelle Multimediaproduzenten, die einen Fernsehbeitrag machen, ein kurzes Update im Netz schreiben und nebenbei vielleicht noch einen Artikel für die Abendausgabe zusammenbasteln konnten. Annika gehörte einer aussterbenden Spezies an, zumindest beim Abendblatt. Sie hatten nicht die Mittel, um komplizierte Rechtsstreitigkeiten zu untersuchen oder über zwielichtige kriminelle Banden zu berichten – was Annika am liebsten tat. Er wusste, dass sie es als Strafbefehl ansah, Patriks reißerische Schlagzeilen mit Stoff zu füllen, aber er konnte nicht ewig einen Unterschied zwischen ihr und allen anderen machen. Er konnte es sich auch nicht leisten, sie für immer in Washington zu lassen, genauso wenig wie er jedes Mal Patrik an den Pranger stellen konnte, wenn er mit einer verrückten Idee ankam. Das Abendblatt war nach wie vor die zweitgrößte Zeitung Schwedens, und wenn sie jemals den Konkurrenten überholen wollten, mussten sie anfangen, größer, breiter und dreister zu denken.
Tatsache war, dass er Patrik mehr brauchte als Annika.
Er wandte sich von der Glastür ab und drehte rastlos eine Runde in seinem kleinen Büro.
Sie hatte als Korrespondentin eigentlich keinen schlechten Job gemacht, ganz im Gegenteil. Den Mord am schwedischen Botschafter in den USA vor gut einem Jahr hatte sie beispielsweise außerordentlich gut im Griff gehabt. Daran bestand kein Zweifel.
Dass sie sich mit ihrem Mann versöhnt hatte, war ihr gut bekommen. Ein Quell der Lebensfreude und Unterhaltsamkeit war sie ohnehin nie gewesen, aber das Jahr, in dem sie und Thomas getrennt gelebt hatten, war für niemanden in ihrer Umgebung ein Spaß.
Schyman wagte nicht, daran zu denken, was passieren würde, wenn ihrem Mann etwas zustieß. Ihm war klar, dass seine Gedanken kalt, ja nahezu eiskalt waren, aber das Abendblatt war nun mal kein Erholungsheim. Sollte Thomas nicht zurückkommen, würde ihm nichts anderes übrigbleiben, als ihr eine saftige Abfindung zu zahlen und alles Weitere dem psychiatrischen Krisendienst und ihrem sozialen Umfeld zu überlassen.
Der Chefredakteur seufzte noch einmal.
Alien Hand Syndrome.
Ja, gütiger Himmel.
*
»Wann kommt Papa nach Hause?«
Sie haben einen sechsten Sinn, dachte Annika und strich ihrer Tochter übers Haar. Wie konnte es sein, dass etwas so Weiches und Zartes andauernd von Läusen heimgesucht wurde?
»Er arbeitet in Afrika, das weißt du doch«, sagte sie und packte das Mädchen in die Decke ein.
»Ja, aber wann kommt er wieder?«
»Am Montag«, kam es genervt aus Kalles Bett. »Du kannst dir aber auch gar nichts merken.«
Als Annika die Wohnung mit den Kindern allein bewohnte, hatten Ellen und Kalle jeder ein eigenes Zimmer gehabt. Annika hatte im Wohnzimmer geschlafen. Nach Thomas’ Rückkehr ging das nicht mehr. Kalle musste in Ellens Zimmer umziehen und betrachtete das als eine persönliche Beleidigung.
Sie schaute hinüber zum Bett des Jungen.
Sollte sie es ihnen sagen? Was sollte sie sagen? Die Wahrheit? Ein bisschen positiv eingefärbt: Papa ist in Afrika verschwunden und kommt am Montag wahrscheinlich nicht nach Hause. Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr nach Hause, dann kannst du dein altes Zimmer wiederhaben, ist das nicht schön?
Oder sollte sie aus Barmherzigkeit lügen?
Papa findet es so spannend, in Afrika zu arbeiten. Er möchte noch ein bisschen dort bleiben. Vielleicht fahren wir irgendwann mal hin und besuchen ihn, wie würdet ihr das finden?
Ellen drückte Poppy an sich, rollte sich zusammen und schloss die Augen.
»Schlaf schön«, sagte Annika und löschte die Bettlampe des Mädchens.
Das Wohnzimmer lag im Halbdunkel. In den Fensternischen leuchteten warm und gelb zwei kleine Lämpchen, die die letzte Untermieterin zurückgelassen hatte. Der Fernseher lief ohne Ton. Anscheinend sprach Leif GW Persson über das »Verbrechen der Woche«, eine Sendung, die sie sonst nie verpasste. Die blonde Frau, die seine Gesprächspartnerin war, sagte etwas in die Kamera, ein Filmbeitrag wurde eingespielt. Man sah die beiden durch kilometerlange Reihen von Ordnern und Vernehmungsprotokollen gehen. Ist wahrscheinlich das Palme-Archiv, dachte Annika und griff nach ihrem alten Handy. Keine versäumten Anrufe oder Mitteilungen.
Mit dem Telefon in der Hand setzte sie sich auf das Sofa und starrte die Wand hinter Leif GW Persson an. Auf dem Redaktionshandy hatte Schyman ununterbrochen angerufen, und jemand mit einer anderen Nummer, die sie nicht kannte, wahrscheinlich Halenius, nachdem sie den Konferenzraum Grodan verlassen hatte. Irgendwann hatte sie es ausgeschaltet und, als sie zu Hause war, ihr Festnetztelefon ausgestöpselt. Die Nummer ihres Privathandys hatte fast niemand außer Thomas und Anne Snapphane. Und jetzt lag es in ihrer Hand wie ein toter Fisch.
Trotz des Halbdunkels waren alle Farben klarer als sonst. Sie spürte ihren Pulsschlag. Jeder Atemzug war ihr bewusst.
Was sollte sie tun? Sollte sie davon erzählen? Konnte sie es erzählen? Wem? Wem musste sie es sagen? Ihrer Mutter? Thomas’ Mutter? Sollte sie nach Afrika fahren und ihn suchen? Wer kümmerte sich dann um die Kinder? Ihre Mutter? Nein, sie konnte ihre Mutter nicht anrufen. Oder doch? Wie wäre das?
Sie rieb sich das Gesicht mit den Handflächen.
Barbro würde sich aufregen. Sie würde in Selbstmitleid zerfließen. Alles so anstrengend. Das Gespräch würde damit enden, dass Annika sie tröstete und sich entschuldigte, ihr diese Unruhe bereitet zu haben. Wenn ihre Mutter nicht betrunken war, wohlgemerkt, sonst würde sie überhaupt nichts Vernünftiges aus ihr herausbekommen. In keinem Fall aber würde es ein gutes Gespräch sein, und das lag nicht an Thomas oder Afrika, sondern an etwas ganz anderem.
Barbro hatte Annika nie verziehen, dass sie nicht zur Hochzeit ihrer Schwester Birgitta nach Hause gekommen war. Birgitta hatte Steven (der seinem Namen zum Trotz so schwedisch war wie Knäckebrot) in der heißen Phase der amerikanischen Präsidentschaftswahlen geheiratet, und Annika hatte ihren frisch angetretenen Korrespondentenposten für ein Fest im Gemeindehaus Hälleforsnäs weder verlassen wollen noch können.
»Das ist der wichtigste Tag im Leben deiner Schwester«, hatte ihre Mutter von ihrer Wohnung in Tattarbacken über den großen Teich geschluchzt.
»Weder du noch Birgitta seid zu meiner Hochzeit gekommen«, hatte Annika gekontert.
»Ja, aber du hast doch in Korea geheiratet!« Verständnislose Indignation.
»Na und? Wie kommt es eigentlich, dass alle Entfernungen für mich immer viel kürzer sein sollen als für euch?«
Mit Birgitta hatte sie nach der Hochzeit nicht mehr gesprochen. Auch davor schon selten, um ehrlich zu sein, seit sie mit achtzehn von zu Hause ausgezogen war.
Berit konnte sie auch nicht anrufen. Natürlich würde die dichthalten, aber es kam ihr unfair vor, der Kollegin das Wissen um eine verschwundene EU-Delegation aufzubürden.
Thomas’ Mutter, Doris, musste sie natürlich informieren. Aber was sollte sie schon sagen? Dein Sohn geht seit ein paar Tagen nicht mehr ans Telefon, aber ich hab mir keinen Deut Sorgen gemacht, weil ich dachte, er vögelt bloß in der Weltgeschichte rum?
Sie stand vom Sofa auf, das alte Telefon noch immer in der Hand, und ging in die Küche. Ihre letzte Neuanschaffung, ein elektrischer Adventsleuchter von Åhléns am Fridhelmsplan, leuchtete schwach im Küchenfenster. Kalle hatte ihn ausgesucht. Ellen hatte gerade eine Engelphase und Kühlschrankmagneten in Form von Putten gekauft. Auf der Anrichte stand noch das Geschirr mit den Resten des indischen Essens, das sie geholt hatte. Sie schaltete das Licht ein und begann methodisch die Spülmaschine einzuräumen.
Sie fand Trost in den mechanischen Bewegungen, Wasserhahn aufdrehen, Spülbürste nehmen, mit kreisenden Bewegungen Essensreste abspülen, Bürste ins Abtropfgestell legen, Teller an seinen Platz in der Maschine stellen.
Ohne Vorwarnung brach sie in Tränen aus, ließ Bürste und Glas und Besteck los und sank auf dem Küchenboden zusammen, während das warme Wasser lief.
Sie blieb lange dort sitzen.
Was war sie für ein erbärmlicher Mensch. Ihr Mann war verschwunden, und es gab niemanden, den sie anrufen oder mit dem sie sprechen konnte. Etwas stimmte nicht mit ihr.
Sie drehte das Wasser ab, schnäuzte sich in ein Stück Küchenrolle und ging mit dem Telefon in der Hand ins Wohnzimmer.
Keine versäumten Anrufe oder Mitteilungen.
Annika ließ sich auf dem Sofa nieder und schluckte.
Warum war es ihr nie gelungen, sich so einen netten Freundeskreis aufzubauen wie Thomas? Alte Fußballfreunde und Kumpels vom Gymnasium, ein paar Typen von der Uni aus Uppsala, eine Clique von Arbeitskollegen und vielleicht noch die Mannschaftskameraden aus dem Hockeyverein. Und wen hatte sie? Außer vielleicht Anne Snapphane?
Während ihres ersten Sommers beim Abendblatt hatten sie zusammen gearbeitet, aber dann suchte Anne beim Fernsehen Erfolg. Ihre Freundschaft durchlief mit den Jahren diverse Hochs und Tiefs. Solange Annika als Korrespondentin in den USA war, hatten sie nicht viel Kontakt, aber in den letzten Monaten trafen sie sich immer wieder zu einer Tasse Kaffee am Samstagnachmittag oder einem Sonntagsausflug ins Museum.
Annika fand es beruhigend und anspruchslos, von Annes drolligen Eskapaden und hochfliegenden Plänen zu hören. Anne war immer kurz vor dem Durchbruch. Sie war für Großes ausersehen, und das bedeutete, sie würde berühmt werden und eine bekannte Fernsehmoderatorin. Sie dachte sich jede Woche ein neues Fernsehformat aus, Quizsendungen und Spielshows und unterhaltende Interviewformate, sie sammelte unablässig neue Ideen für Dokumentationen, bestellte bergeweise Forschungsberichte, um Missstände zu finden, die sie in einer investigativen Sendung aufklären konnte. Oft endeten die phantastischen Ideen als Blogbeitrag oder beklatschte Statusmeldung auf Facebook. (Anne hatte ein beliebtes Blog, das sie »Die wunderbaren Abenteuer und Erlebnisse einer Fernseh-Mama« nannte, und 4357 Freunde auf Facebook.) Soweit Annika wusste, hatte Anne nie mehr als eine halbe Seite für ihre großartigen TV-Pitches geschrieben, und zu irgendwelchen Treffen mit irgendwelchen Fernseh-Chefs war es nicht gekommen. Aber das schien keine nennenswerte Rolle zu spielen. Ihr Geld verdiente Anne als Rechercheurin bei einer Produktionsfirma, die Dokusoaps produzierte.
»Annika! Wie lustig, dass du anrufst. Ich habe gerade an dich gedacht.«
Annika schloss die Augen und spürte, wie Wärme und Tränen in ihr aufstiegen. Es gab doch noch jemanden, der sich Gedanken um sie machte.
»Brauchst du deine braunen Technica-Stiefel am Wochenende?«
»Thomas ist weg«, stieß Annika hervor und brach in hemmungsloses Weinen aus. Die Tränen liefen wie ein Bach in ihr Handy, sie versuchte es abzutrocknen, damit es keinen Wasserschaden bekam.
»Dieser Mistbock«, sagte Anne. »Dass er nie die Hose anlassen kann. Auf welcher Tussi liegt er jetzt?«
Annika blinzelte, die Tränen versiegten.
»Nein«, sagte sie. »Nein, nein, so ist es nicht …«
»Annika«, sagte Anne Snapphane, »du musst ihn nicht in Schutz nehmen. Zieh dir den Schuh nicht an. Das ist doch alles nicht deine Schuld.«
Annika holte tief Luft und spürte, wie ihre Stimme wiederkam.
»Du darfst niemandem etwas davon sagen, alles unterliegt bis auf Weiteres der Geheimhaltung. Seine Delegation ist verschwunden. An der Grenze nach Somalia.«
Sie hatte vergessen, wie der Ort hieß.
Verwunderte Stille am anderen Ende der Leitung.
»Eine ganze Delegation? Wie um alles in der Welt waren die denn unterwegs? In einem Jumbo-Jet?«
Annika schnäuzte sich noch einmal ins Küchenpapier.
»Sie waren zu siebt in zwei Autos unterwegs. Seit gestern sind sie verschwunden. Ihr Sicherheitsbegleiter und ihr Dolmetscher wurden gefunden. Kopfschuss.«
»Ach du lieber Himmel, Annika. Haben sie Thomas auch erschossen?«
Die Tränen liefen wieder, ein dünnes Wimmern drang aus dem Bauch.
»Ich weiß es nicht!«
»Aber Grundgütiger, was machst du denn, wenn er stirbt? Und wie sollen die Kinder damit zurechtkommen?«
Sie wiegte sich auf dem Sofa vor und zurück, die Arme um sich geschlungen.
»Arme, arme Annika, warum kriegst immer du alles ab? Du liebe Güte, tust du mir leid. Armes Ding …«
Es fühlte sich gut an, bedauert zu werden.
»Und armer Kalle, dass er jetzt ohne Vater aufwachsen muss. Hat Thomas eine Lebensversicherung?«
Annika hörte auf zu weinen, antwortete nicht.
»Und Ellen, sie ist doch noch so klein«, fuhr Anne fort. »Wie alt ist sie? Sieben? Acht? Sie wird sich ja kaum an ihn erinnern können. Lieber Himmel, Annika. Was machst du denn jetzt?«
»Lebensversicherung?«
»Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber in solchen Situationen muss man auch ein bisschen praktisch denken. Du solltest deine Papiere durchgehen und dir einen Überblick über deine Situation verschaffen. Das ist nur ein kleiner wohlgemeinter Ratschlag. Soll ich rüberkommen und dir helfen?«
Annika legte die Hand über die Augen.
»Danke, vielleicht morgen, ich glaube, ich gehe jetzt am besten schlafen. Es war ein harter Tag.«
»Ja, natürlich, du Arme, das verstehe ich. Ruf mich an, sobald du etwas hörst, versprich mir das …«
Annika murmelte etwas, das man als Bestätigung verstehen konnte.
Sie blieb noch eine Weile auf dem Sofa sitzen, das Telefon in der Hand. Leif GW Persson war längst nach Hause gegangen, und die hübsche dunkle Frau von den Spätnachrichten hatte seinen Platz eingenommen. Sie zeigten aus ganz Schweden Bilder vom Schneechaos, eingeschneite Sattelschlepper und überarbeitete Abschleppdienste und das Dach einer Tennishalle, das nachgegeben hatte. Sie griff nach der Fernbedienung und schaltete den Ton ein. Es sei ungewöhnlich, dass schon im November so viel Schnee fiel, aber nicht einmalig, berichtete die dunkle Schönheit. Sowohl in den 60er als auch in den 80er Jahren hätten sich in Schweden vergleichbare Szenarien abgespielt.
Sie machte den Fernseher aus, ging ins Bad und putzte sich die Zähne, dann spritzte sie sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, um am nächsten Morgen nicht völlig verquollen auszusehen.
Mit schmerzenden Gliedern legte sie sich auf Thomas’ Seite vom Bett.
*
Nachdem sie die Kabelbinder an unseren Handgelenken aufgeschnitten hatten, fielen wir nicht mehr so oft hin.
Es war eine große Erleichterung.
Der Mond stand am Himmel. Wir gingen im Gänsemarsch. Wie auf einer dunkelblauen Fotografie mit Silberrändern trat die Landschaft um uns herum dreidimensional hervor: stachelige Büsche, große Termitenhügel, vertrocknete Bäume, scharfe Felsblöcke und am Horizont die fernen Berge. Ich weiß nicht, ob man die Gegend als Savanne oder Halbwüste bezeichnet, aber sie war unwegsam und rau. Magurie, der Franzose, ging voran. Er hatte sich selbst zu unserem Anführer ernannt. Keiner von uns hatte seinem Beschluss widersprochen. Hinter ihm ging der Rumäne, dann kamen Catherine und ich, der Däne und Alvaro, der Spanier, und als Letzte stolperte die Deutsche hinterher. Sie jammerte und weinte, es war richtiggehend würdelos.
Catherine hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Kaum hatten wir den LKW hinter uns gelassen, war sie umgeknickt und hatte sich das linke Sprunggelenk verletzt. Ich stützte sie, so gut ich konnte, aber mir war schwindelig, und ich hatte solchen Durst, dass ich kurz vor einer Ohnmacht war. Eine große Hilfe bin ich also wohl kaum gewesen, fürchte ich. Andauernd blieb ich an den Dornen im Gebüsch hängen und hatte bald einen tiefen Riss in Hose und Haut unter dem rechten Knie.
Bei Tageslicht hatte ich aus dem Auto so gut wie keine Tiere gesehen, nur eine einsame Antilope und wohl ein Warzenschwein, aber die Nacht war voll von schwarzen Schatten und glühenden Augen.
»Ich verlange zu erfahren, wohin wir gebracht werden!«
Trotz allem muss ich dem Franzosen Sébastien Magurie für seine Beharrlichkeit meine Hochachtung aussprechen.
»Ich bin französischer Staatsbürger, und ich bestehe darauf, mit meiner Botschaft zu sprechen.«
Sein Englisch hatte einen beinahe komischen französischen Akzent. Zwischen seinen Ausbrüchen vergingen selten mehr als fünf Minuten. Je schwächer seine Stimme wurde, umso stärker wuchs seine Entrüstung.
»Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte! Ius cogens! Wir sind Angehörige einer internationalen Organisation, und Sie, meine Herren, machen sich eines Verbrechens gegen das Ius cogens schuldig!«
Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wo wir uns befanden. Kenia? Somalia? Sie hatten uns doch nicht so weit nach Norden verfrachtet, dass wir schon in Äthiopien waren? Die Nacht war undurchdringlich, egal, in welche Richtung man sich wendete. Nirgends erleuchtete der wunderbare Schein von Elektrizität den Horizont. Vor und hinter uns gingen bewaffnete Männer. Sie waren zu viert, zwei ganz junge Kerle und zwei Erwachsene. Catherine sagte, sie seien keine Kenianer. Außer Englisch beherrschte sie sowohl Arabisch, Swahili und Maa (die regionale Sprache der Massai), und sie verstand nicht, was die Männer untereinander besprachen. Natürlich konnte es irgendeine andere der sechzig regionalen kenianischen Sprachen sein, aber es war weder eine der nilotischen noch Bantu. Sie tippte auf Somali aus der Familie der afroasiatischen oder ostkuschitischen Sprachen. Einer der Männer, der Lange, der meine Autotür geöffnet hatte, sprach uns gelegentlich in schlechtem Swahili an, er hatte uns unter anderem verkündet, dass wir treulose Hunde seien, die es verdienten, einen langsamen und qualvollen Tod zu sterben, und dass der Große Führer oder der Große General über unser Schicksal entscheiden werde. Er nannte den Führer Kiongozi Ujumla, vielleicht war es aber auch das Wort für »Führer« in einer seiner Sprachen. Wer dieser Führer war oder wo er sich aufhielt, wurde nicht klar.
Dann blieben die beiden Männer vor uns stehen. Der Lange sagte etwas zu einem der jungen Kerle weiter hinten, er klang müde und gereizt, fuchtelte mit den Händen und mit seiner Waffe.
Der Junge verschwand in der Dunkelheit.
Der Lange zeigte mit der Waffe auf uns.
»Kukaa! Chini! Kukaa chini …«
»Er sagt, wir sollen uns hinsetzen«, sagte Catherine und sackte zusammen.
Ich setzte mich neben sie. Ich fühlte Insekten an den Händen, machte aber keine Anstalten, sie abzuschütteln. Stattdessen legte ich mich hin. Ameisen krochen mir in die Ohren. Ich bekam einen harten Tritt in den Rücken.
»Kukaa!«
Mühsam setzte ich mich wieder auf. Scheinbar durften die Frauen sich hinlegen, nicht aber wir Männer.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Die Kälte legte sich wie ein eiskalter Panzer auf meine verschwitzten Kleider, schon bald klapperte ich mit den Zähnen. Möglicherweise bin ich aber trotzdem eingeschlafen, denn plötzlich war der Junge mit der Waffe wieder da, und der Lange schrie uns an, wir sollten aufstehen (es bedurfte keiner Übersetzung aus dem Swahili, die Bewegung mit der Waffe war unmissverständlich).
Wir gingen denselben Weg zurück, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber Catherine kam nicht weit. Sie brach in meinen Armen zusammen. Ich fiel hin und sie landete auf mir.
Der Lange trat Catherine auf ihren verletzten Fuß und zog sie an den Haaren hoch.
»Kutembea!«
Der Rumäne – ich hatte seinen Namen bei der Vorstellungsrunde nicht mitbekommen und vergessen, in der Liste nachzusehen – stellte sich auf die andere Seite neben Catherine. Ich muss sagen, dass ich es eine Spur aufdringlich fand, wie er einfach nach ihr griff, aber ich war nicht in einer Position, um mich zu beschweren.
Ich weiß nicht, ob man sich im bewusstlosen Zustand aufrecht fortbewegen kann, aber für den Rest der Nacht kam und ging mein Bewusstsein. Aus einer Himmelsrichtung, die ich später nicht mehr wiederfand, schimmerte schwach die Morgendämmerung, als wir plötzlich vor einem Wall aus Reisig und trockenem Buschwerk standen.
»Eine Manyatta«, flüsterte Catherine.
»Das ist vollkommen inakzeptabel!«, rief der Franzose. »Ich verlange, dass wir Wasser und Nahrung bekommen!«
Ich sah, wie der Lange auf Sébastien Magurie zuging und den Gewehrkolben hob.
TAG 2
Donnerstag, 24. November