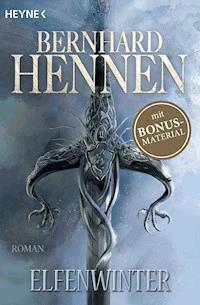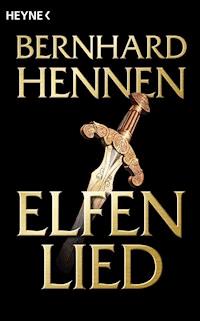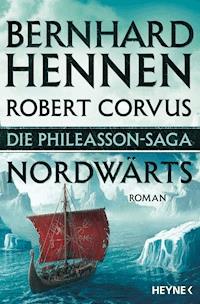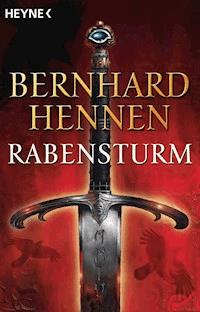12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Phileasson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit vielen Monden schon liefern sich die beiden Kapitäne Asleif Phileasson und Beorn der Blender eine erbitterte Wettfahrt rund um den Kontinent Aventurien. Sie haben die höchsten Türme erklommen, gewaltigen Seeungeheuern getrotzt und sengende Wüsten durchquert – und doch kann nur einer von ihnen den Ehrentitel »König der Meere« erringen. Ihr neuntes Abenteuer führt die wackeren Helden in ein abgeschiedenes Tal. Dort leben Wesen, die einst über ganz Aventurien herrschten. Doch nicht alle von ihnen träumen nur von der vergangenen Glorie, manche hoffen auch auf wiederkehrende Größe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1126
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAS BUCH
»Die Zeit der blutigen Schwerter ist angebrochen, doch vergeht euch nicht an etwas, dessen Macht ihr nicht abschätzen könnt. Manchmal muss man sich mit dem Bösen verbünden, um das Böse zu besiegen.«
Kalt ist das Blut der Echsischen, hart sind die Herzen ihrer Götter. Hoch auf dem Berg, der die Seelen frisst und wo ihre Tempel drohend in den Himmel aufragen, träumen die Geschuppten von alter Größe und dem Untergang der Menschenreiche. Als Shaya und die Siedler aus Brokscal ausgerechnet dorthin verschleppt werden, muss Phileasson erkennen, dass Waffenmacht alleine nicht ausreicht, um zu verhindern, dass ihr Blut auf alten Altären fließt. Doch den Göttern Thorwals gilt neben Mut und Stärke auch die List als Tugend …
Während Phileasson alles daransetzt, seine Freunde vor einem grausamen Opfertod zu retten, zeigt Beorn den Elfen der geheimnisvollen Inseln hinter dem Nebel, dass sie nicht auf die Art von Krieg vorbereitet sind, die Aventuriens größter Plünderfahrer zu führen versteht. Niemals wird er sich mit der Demütigung abfinden, dass eine Schöndenkerin ihm die Flöte gestohlen hat, die ihm eine Göttin zum Geschenk machte. Städte brennen und der Hort der Thorwaler wächst. Doch reicht die Kraft des Blenders auch aus, um seinen Schiffsjungen den Schatten des Todes zu entreißen?
DIE AUTOREN
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Als Journalist bereiste er den Orient und Mittelamerika, bevor er sich ganz dem Schreiben fantastischer Romane widmete. Mit seiner Elfen-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
www.bernhard-hennen.de
Robert Corvus, 1972 geboren, studierte Wirtschaftsinformatik und war in verschiedenen internationalen Konzernen als Strategieberater tätig, bevor er mehrere erfolgreiche Fantasy-Romane veröffentlichte. Er lebt und arbeitet in Köln.
www.robertcorvus.net
Mehr über die Phileasson-Saga erfahren Sie auf:
www.phileasson.de
Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Für Axel, der Aventurien und Bücher liebt.
BERNHARD
HENNEN
ROBERT CORVUS
ECHSENGÖTTER
DIE PHILEASSON-SAGA
NEUNTER ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2020
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2020 by Bernhard Hennen
Copyright © 2020 by Robert Corvus
Copyright © 2020 by Ulisses Medien & Spiel Distribution GmbH
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Umschlagillustration: Kerem Beyit
Innenillustrationen: Nadine Schäkel
Karten: Steffen Brand [[>>]]
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-23432-4V001
www.heyne.de
www.twitter.com/HeyneFantasySF@heyneFantasySF
PROLOG
DAS SPINNENMÄDCHEN
Spinnenberge,
dritter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
»Etwas kratzig, aber es glitzert wie Feenhaar.« Doswin stand vorgebeugt, als müsste er seine Froschaugen nahe heranführen, um zu erkennen, dass Ohnnam tatsächlich ein Tuch aus Spinnenseide in ihren Händen hielt. Oder als wollte er ihr etwas zuraunen, ohne dass jemand anderes es hörte. Dabei verstanden diese Waldmenschen ohnehin kein Garethi. »Diesen Glanz … den mögen die Damen in Drôl, lass es dir gesagt sein! Und nebenbei ist das Zeug fest genug, um vor einem Pfeil zu schützen.«
Es war seltsam, in dieser Umgebung an eine Stadt wie Drôl zu denken, wo dermaßen vornehme Menschen wohnten, dass sie allesamt aussahen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Ohnnam grinste. Die Keke-Wanaq würden eine solche Redewendung sicherlich wörtlich verstehen. Die Wilden wären imstande, jemandem, der ihnen nicht gefiel, einen Ast ins Maul zu rammen, bis er zum Hintern wieder rauskäme.
Wenigstens zeigten sie ihre Neugier offen. Auch in Drôl starrte man Ohnnam an – eine Halborkin war ein seltener Anblick, vor allem im Süden Aventuriens. Aber hier verbarg man die Blicke nicht. Ein Greis, der kaum Fleisch auf den Knochen hatte, deutete mit seinen knotigen Fingern auf sie, während er mit einer Frau sprach, die ein Band aus grünem Schlangenleder ins Haar geflochten hatte.
Die Haut der Wilden, die beinahe nackt zwischen den Laubhütten umhergingen, sah aus wie dunkler Samt. Ohnnam fragte sich, ob sie sich auch so anfühlte. Die vordere Hälfte der Köpfe hatten die Keke-Wanaq rasiert, Männer wie Frauen, aber das restliche Haar trugen sie lang. Die meisten von ihnen waren Kinder und Alte, aber dem traute die Halborkin nicht. Es war gut möglich, dass die Kämpfer im Wald lauerten.
Ohnnam schloss die Hände, sodass sie etwas von dem geknüllten Stoff in den Fäusten hielt. In den grünen Schatten des Urwalds sah alles falsch aus, die eigentlich schwarzbraunen Haare an ihren Unterarmen machten sie schlammfarben. Die Spinnenseide war hellgrau, wie Schnee in der frühen Morgendämmerung. Sie glitzerte auch so ähnlich, viele winzige Leuchtpunkte, und prickelte in den ledrigen Handflächen, als hätten die Wilden gemahlenes Glas eingearbeitet. Aber woher hätten sie das bekommen sollen?
Von Händlern wie Doswin, beantwortete sie ihre eigene Frage in Gedanken. Drei Tage hatte er sie durch den Urwald geführt, das war Ohnnam unnötig lange vorgekommen. Sie hatte schon gedacht, dass er den Weg verloren hätte. Aber da er die Keke-Wanaq schließlich gefunden hatte, musste er wohl wissen, was er tat.
Ohnnam zog die Fäuste auseinander.
Die Spinnenseide war tatsächlich fester, als sie aussah. Sie hatte nichts mit den Gespinsten voller vertrockneter Fliegen gemeinsam, wie sie sich im Gebälk der Goldhaken fanden, weit hinten, in den selten betretenen Bereichen des Laderaums. Dieser Stoff hielt sogar mehr aus als Leinen.
Die Halborkin grunzte vor Anstrengung. Nun, da sie einmal damit begonnen hatte, ihre Kraft mit dem Tuch zu messen, wollte sie auch als Siegerin daraus hervorgehen. Sie fühlte den spöttischen Blick von Kapitän Haggam auf sich. Er sollte keine Zweifel daran bekommen, dass sich seine Bootsfrau in jeder Situation durchsetzte. Und die Matrosen erst recht nicht. Schon der Verdacht einer Schwäche war gefährlich.
Kichernd richtete sich Doswin auf.
Aber am Ende hatte Ohnnam gut lachen. Das verdammte Tuch gab endlich nach. Erst ermutigte sie ein kleiner Riss, woraufhin sie tief einatmete und mit einem Grollen noch stärker zog. Dann weitete sich der Riss, ein Ratschen war zu hören, und schließlich ging es schnell, und sie hielt zwei Teile in den Fäusten.
Ihr Grollen ging in ein Hohnlachen über. »Das müssen dann wohl kleine Pfeilchen sein, die dieses Zeug aufhält.« Triumphierend sah sie zu Haggam hinüber.
Er nickte ihr mit einem schiefen Grinsen zu. Sein weißes Hemd hatte unter dem Marsch durch den Urwald gelitten, an ein paar Stellen war es eingerissen. Die blau-weiß gestreifte Hose hielt mehr aus. Besonderen Wert legte der Kapitän auf alle Lederteile. Er fertigte sie selbst: die Stiefel, den handbreiten Gürtel mit der Bronzeschnalle, an dem sein gerades Schwert hing, und auch den seltsamen, eng anliegenden Lederkragen, von dem er sich einredete, dass er ihn davor bewahrte, geköpft zu werden. Diese Vorstellung machte ihm richtig Angst, man konnte ihn gut damit aufziehen. Allerdings brauchte man dafür einiges an Standfestigkeit, sonst prügelte Haggam einen für solche Scherze durch.
Er befehligte einen zweimastigen Segler, die Lorcha Goldhaken, die mit ihrem flachen Rumpf auch seichte Küstengewässer ansteuern konnte. Sie war mal als Kauffahrer, mal als Piratenschiff unterwegs. Das wechselte schnell, je nachdem, welche Gelegenheiten sich boten. Im Moment waren sie Händler, die im tiefen Dschungel Ware für die Städte an der Westküste erwerben wollten. Das gefiel Ohnnam nicht besonders. Sie war schlechter im Feilschen als darin, Schädel zu knacken. Bei Verhandlungen stand die Halborkin normalerweise mit verschränkten Armen hinter Haggam und zog ein grimmiges Gesicht, das machte am meisten Eindruck. Um die Muskeln gut zur Geltung zu bringen, hatte sie die Ärmel bis unter die Achseln hochgekrempelt. Dass ihre dichte Körperbehaarung die Blicke auf sich zog, war sie gewohnt.
Den Hauer eines Keilers, den sie links in der Unterlippe trug, hatte sie am Morgen poliert. Wie die meisten Seefahrer legte sie einen großen Teil ihres Vermögens in Schmuck an, weil man es so immer dabeihatte und es keiner klauen konnte. Ein Kunstschmied in Al’Anfa hatte ihren Hauer mit Silber überzogen und ein paar Spiralen hineinziseliert. Selbst in diesen verdammten Waldschatten glänzte er.
Leider machte diese Veredelung das Schmuckstück auch schwer. Statt aufrecht zu stehen wie der Hauer eines reinblütigen Orks, kippte es nach vorn und zog die Unterlippe auf der linken Seite hinunter. Ständig lief Speichel aus. Das musste nicht unbedingt schlecht sein, das Geifern passte dazu, wie man sich einen kampflustigen Ork vorstellte. Erstaunlicherweise lockte ihr silberner Hauer Insekten an, als wollten sie ihm huldigen. Andauernd musste Ohnnam an ihrem Mund herumfummeln, um sie loszuwerden. Wenigstens schmeckten ein paar von den Käfern nach Nüssen.
Doswin verzog sich zu Parihm, der Steuerfrau der Goldhaken. Nur sie und Haggam standen im Rang über der Bootsfrau. Dafür, dass sie bei den Orks als schwächlich gegolten hatte, war Ohnnam weit aufgestiegen. Nummer drei in einer vierzigköpfigen Besatzung. Ihren Vater hätte sicher überrascht, was aus dem Blag geworden war, das er mit einer Menschensklavin gezeugt hatte, die ein paar Jahre später an einem Schnupfen gestorben war.
Ob Haggam sie nicht beim Schiff zurückgelassen hatte, weil er in ihr eine Rivalin sah? Mit den zehn Matrosen, die jetzt die Takelage ausbesserten, ein paar gerissene Planken ersetzten und die Segel flickten, hätte sie keine weite Fahrt wagen können. Um mit der Lorcha in einem Sturm zu bestehen, reichten so wenige nicht aus. Sie hätte allerdings irgendein Piratennest auf Al’Toum ansteuern können, um eine neue Mannschaft an Bord zu nehmen, die keine andere Kapitänin kannte als sie …
Ohnnam grinste. Achtlos ließ sie die Fetzen von Spinnenseide ins Gras fallen.
Da sie zum Verhandeln ohnehin nicht taugte, konnte sie genauso gut grimmig aussehen und ein wenig durch das Lager stapfen, um die Wilden von dummen Gedanken abzuhalten.
Die Halborkin rüttelte an einem der gebogenen Äste, aus denen die Hütten geflochten waren. Das Blattwerk raschelte wie eine Baumkrone, in die ein Windstoß fuhr. Beinahe hätte sie den Unterschlupf umgerissen.
Ein Mädchen kroch heraus. Es schob sich einfach durch das mit Spinnweben verklebte Laub, eine Tür oder gar Fenster gab es nicht. Auch das Kind hatte die vordere Kopfhälfte bereits rasiert. Aus großen Augen sah es zu ihr hoch.
Schnell beugte sich Ohnnam zu ihm hinab. »Buh!«
Das Kind blinzelte noch nicht einmal. Stattdessen griff es herauf und zupfte am Silberzahn in der Lippe der Halborkin.
»He!« Entrüstet zuckte Ohnnam zurück. Sie überlegte, wie es aufgenommen würde, wenn sie ihre Faust auf den Schädel des Rotzbalgs schmetterte. Für Verhandlungen war das vielleicht schlecht, aber eine Bootsfrau durfte sich nichts gefallen lassen.
Sie fasste die aufgerollte Peitsche an ihrem Gürtel und sah sich um. Die Matrosen hatten sich im Lager verteilt, immer mindestens zu zweit. Arime, die am Morgen wieder einmal geheult hatte, weil der Wald ihrem ach so hübschen Blondhaar zusetzte, begutachtete leuchtend weiße Seide, während Urrman, der bald platzen würde, wenn sie es nicht endlich mal wieder mit ihm triebe, sichtlich gelangweilt daneben stand. Bassil, Zajin und Rantiber, die drei Maraskaner in den kreischbunten Klamotten, deren für gewöhnlich wilde Locken klatschplatt an den Köpfen klebten, ließen ein paar Keke-Wanaq einen Säbel mit minderwertigem Griff betatschen. Sie waren Drillinge und der Überzeugung, dass es eine segensreiche Sache wäre, wenn einer von ihnen stürbe, damit sie nur noch zu zweit wären. Deswegen hatten sie sich den Piraten angeschlossen. Im Moment waren sie damit beschäftigt, mit Stöcken ein halbes Dutzend rattengroßer Spinnen auf Abstand zu halten. Solche Biester gab es überall in diesem Lager. Irgendwo musste die Seide schließlich herkommen.
Niemand beachtete Ohnnam. Nur das Mädchen starrte sie an. Seine Augen waren so dunkel, dass es in den Waldschatten aussah, als wären seine Iriden schwarz. Und groß waren sie. Und unverschämt furchtlos, wenn man bedachte, dass das Kind einer Halborkin gegenüberstand, die den kleinen Körper mühelos zerreißen könnte.
Klein, feingliedrig, schwach, mit samtiger Haut, im tiefen Süden geboren, offenbar ein nachdenklicher Charakter … dieses Mädchen war so etwas wie das Gegenteil von Ohnnam.
»Irulla!«, rief ein vielleicht zwanzigjähriger Krieger, der das mit schwarz umrandeten Flecken gemusterte Fell eines Jaguars als Umhang trug.
Das Kind sah zu ihm hinüber.
Er winkte und streichelte dabei eine kleine Raubkatze, neben der er hockte. Das Tier sah aus wie ein junger Jaguar, aber es hatte schwarzes Fell. Ohnnam fragte sich, ob es schwarze Jaguare gab.
Ohne die Halborkin weiter zu beachten, ging Irulla – falls das der Name des Mädchens war – zu dem Krieger.
Ohnnam sah noch ein bisschen zu, wie sie mit dem Mann sprach und mit der Raubkatze spielte. Das Mädchen drehte einem bunten Vogel den Hals um, dessen Gekrächze der Bootsfrau schon die ganze Zeit auf den Geist gegangen war, und verfütterte ihn an den Jaguar.
Als ein kleiner Junge dieselbe Hütte verließ, aus der Irulla gekommen war, entschloss sich Ohnnam, ihre Runde um das Lager zu vollenden.
Wenn die Wilden Wachen aufgestellt hatten, sah die Bootsfrau sie nicht. Stattdessen entdeckte sie einen kahl gefressenen und in Spinnenfäden eingesponnenen Baum. Im Innern des Gespinsts wimmelten achtbeinige Körper, die meisten faustgroß. Drei dieser Tiere huschten durch das Gras auf Ohnnam zu, richteten ihren Vorderleib auf und fuchtelten drohend mit den Beinen.
Die Bootsfrau machte einen Schritt zurück. Sich mit diesen Biestern anzulegen versprach keinen Gewinn.
Sie beendete ihre Runde und ging zu Haggam. Die Kisten neben ihm enthielten bereits einige gefaltete Tücher aus Spinnenseide, aber viele lagen auch abgelehnt auf einem unordentlichen Haufen daneben.
Die Frau mit dem Schlangenlederband im Haar hielt ihm eine Spinne entgegen, deren Leib durch das flauschige Haar kugelförmig erschien. Sie wuschelte mit dem Zeigefinger durch den Pelz.
»Ich weiß nicht, ob sich die vornehmen Damen und Herren in Drôl für ein solches Haustier erwärmen können«, gestand Doswin. »Es frisst sicher weniger als ein Hund, aber der Anblick ist doch sehr ungewohnt.«
»Das ist Unfug.« In sichtlichem Ekel spie Haggam aus und fuhr sich mit der Hand durch den sonnengelben Bart. »Die Seide ist in Ordnung, aber jetzt lass uns zur Sache kommen. Dieses Traumgift … haben sie es oder haben sie es nicht?«
Doswin sah sich um.
Die Frau nahm den Arm mit der Spinne hinunter.
»Es wäre ungewöhnlich, wenn Keke-Wanaq kein Kekeyatonba dabeihätten«, murmelte Doswin.
»Dann frag sie danach!«
»Das ist nicht so einfach. Sie geben es eigentlich nur an Stammesangehörige, das habe ich ja schon erklärt. Wir müssten erst ihr Vertrauen gewinnen.«
Haggam schnaubte. »Was meinst du, Ohnnam? Hast du nicht auch Lust, deine haarigen Hinterbacken wieder ins Meer zu tauchen, um die Käfer aus der Ritze dazwischen zu spülen?«
»Würde Zeit.« Tatsächlich begann die bezeichnete Stelle, wieder zu jucken.
»Finde ich auch.« Ungeduldig winkte er in Richtung der Waldmenschenfrau, sah aber Doswin an. »Mach vorwärts!«
Der Händler richtete seine Glupschaugen auf die Frau und redete in der vokalreichen Urwaldsprache auf sie ein. Klack- und Schmatzlaute unterbrachen die Silben.
Die Frau streichelte weiterhin ihre Spinne, während sie antwortete.
»Ich glaube, sie sagt, wir sind zu klein für Kekeyatonba«, übersetzte Doswin.
»Zu klein?« Verblüfft sah Haggam Ohnnam an.
»Oder zu jung«, erklärte Doswin. »Zu unerfahren. Das ist vielleicht die beste Übersetzung: zu unerfahren.«
Haggam lachte auf. »Der gebe ich zu unerfahren! Hier, schau her, was die Erfahrung lehrt: So geht ein Kapitän mit Leuten um, die ihm frech kommen!« Mit dem Handrücken verpasste er der Frau einen so heftigen Wangenstreich, dass ihr Kopf zur Seite flog.
Die flauschige Spinne sprang in Haggams Gesicht.
Er schrie auf und wischte sie fort. »Das Biest hat mich gebissen!« Seine Wange blutete.
Ohnnam zerstampfte das zu Boden gefallene Tier.
Die Frau mit dem Schlangenlederband sah sie an. Erst nach einer Weile kehrte ihr Blick zu Haggam zurück, der jetzt seine Wange hielt und sie zornerfüllt anstarrte. Sie sagte etwas.
»Sie hat das Wort für Feind gebraucht«, übersetzte Doswin. »Ich glaube, wir sind hier nicht mehr willkommen.«
»Wir quasseln sowieso schon zu lange rum.« Haggam machte einen Schritt auf die Frau zu und riss gleichzeitig das Schwert aus der Scheide. Diese Bewegung hatte Ohnnam oft bei ihm beobachtet. Auch diesmal hatte er die Überraschung auf seiner Seite. Bevor sein Gegenüber ausweichen konnte, schmetterte er ihm die Parierstange seiner Waffe ins Gesicht. Zähne knackten.
Gefällt stürzte die Frau.
»Na endlich.« Ohnnam löste die Peitsche vom Gürtel und zog ihren Säbel.
Spinnenberge,
dritter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
Irulla hörte auf, den jungen Jaguar zu streicheln, als ihre Mutter unter dem Schlag des Manns mit dem sonnengelben Haar stürzte.
Ihr Zwillingsbruder war näher am Geschehen. Während ringsum alles schrie und Waffen aufeinanderknallten, rannte er zu dem Mann und biss ihm in den Oberschenkel. Wie alle Blasshäute schämte er sich seines Körpers und verbarg ihn unter vielen Lagen von Kleidung. Irulla fragte sich, ob die Zähne ihres Bruders die weiß-blau gestreifte Hose durchdrangen.
Der Mann schrie, aber das mochte mehr an der Wut als am Schmerz liegen. Er riss den Mund weit auf. Die Sonne tanzte über das kurze goldene Haar, das Kinn und Wangen bedeckte. Er benutzte die Faust, in der er sein Schwert hielt, um mit dem Knauf zuzuschlagen.
Irullas Bruder spuckte Blut und fiel ins Gras.
Um Irulla herum herrschte Chaos. Ihr Vater hätte die Krieger vielleicht in Kampfgruppen eingeteilt und auch die Spinnen, die in schwarz wimmelnden Haufen gegen die Blasshäute fluteten, auf die wichtigsten Gegner gelenkt. Irullas Vater hatte ein noch größeres Schwert als Sonnenhaar. Seit er diese Waffe erbeutet hatte, genoss er herausragendes Ansehen unter den Keke-Wanaq.
Aber er war mit Irullas zweitem Bruder und den meisten Kriegern in Shan’R’Trak, um der großen Spinne in ihrem Kampf gegen den fürchterlichen Skorpion beizustehen. Diejenigen, die im Lager zurückgeblieben waren, mussten allein klarkommen. Irulla ballte die Hände zu Fäusten.
Aritto wankte auf Sonnenhaar zu. Das Jaguarfell, das er um die Schultern trug, verriet jedem, dass er ein Held war. Er hatte die Raubkatze mit einem Speer und demselben krummen Dolch besiegt, den er auch jetzt in der Rechten hielt. Aber er hatte sich noch nicht wieder von der Verletzung erholt, die er aus diesem Kampf davongetragen hatte. Tunutee, der Erwählte des Schamanen, meinte, dass Aritto immer die Spuren des Jaguars an der rechten Seite seines Körpers tragen würde. Sie waren mehr als ein Ehrenzeichen, sie waren auch die Mahnung, dass die Raubkatze ihm ihr Junges anvertraut hatte. Er musste Ibu, den schwarzen Jaguar, so lange aufziehen, bis der aus eigener Kraft töten könnte.
Jetzt strich Ibu um Irullas Beine. Das beruhigte sie. Überhaupt schien sie die Ruhigste im Lager zu sein. Um sie herum wurde gekämpft und gestorben, aber das ängstigte Irulla nicht. Sie hatte noch nie Angst vor dem Tod gehabt, weder vor ihrem eigenen noch vor dem von anderen. So stand sie unbewegt, mit geballten Fäusten, während ein Säbel einen Arm durchtrennte, während ein Schwarm Gelbzahnspinnen einen Piraten unter sich begrub, während ein Speer über ihren Kopf hinwegzischte, während die glupschäugige Blasshaut, die das Mohisch zumindest stottern konnte, in eine Laubhütte krachte und diese umriss.
Irullas Mutter war so angeschlagen, dass sie es nicht schaffte, wieder auf die Füße zu kommen. Mehr fallend als gehend versuchte sie, die Bäume zu erreichen.
Sonnenhaar packte sie im Nacken und schleuderte sie herum. Sie rollte über den Boden und stieß gegen Aritto, der sich schützend über sie stellte. Sein Jaguarfell sah prächtig aus, aber er bog den Oberkörper seltsam nach rechts. Irulla erkannte, dass er zwar die Raubkatze getötet, diese ihn aber ebenfalls besiegt hatte. Er konnte nicht mehr kämpfen.
Die Peitsche der Frau, die Irulla an einen Büffel erinnerte, wickelte sich knallend um seinen Hals. Sie riss Aritto von Irullas Mutter fort.
Dass die Männer der Blasshäute Pelz im Gesicht hatten, war normal. Bei dieser Frau kamen jedoch nur einzelne Borsten aus Warzen auf den Wangen. Dafür wucherte dichtes Haar auf ihren Armen. Alles an ihr wirkte grob: die Pranken, der Kantschädel, die stämmigen Beine, der massige Rumpf, die platte Nase mit den sich blähenden Nüstern, die Wülste, auf denen die Brauen saßen. Nur die Muster auf dem silbernen Wildschweinzahn, der ihre Lippe auf der rechten Seite herunterzog, waren fein gearbeitet. Sie waren nicht bloß aufgemalt, sondern eingeritzt. Irulla hatte das gefühlt.
Die Büffelfrau schlug Aritto seinen Dolch mit ihrem Säbel aus der Hand. Die Waffe flog ins Gras, die große Klinge krachte mit der flachen Seite gegen Arittos Schläfe.
Der Krieger stürzte.
Sonnenhaar schleifte derweil Irullas Mutter mit sich. Er brüllte auf sie ein, wobei er immer wieder auf seine blutende Wange zeigte. Er regte sich wohl auf, weil die Mondspinne ihn gebissen hatte. Irulla fand das dumm. Wenn er ungern sterben wollte, hätte er besser die Büffelfrau gebeten, ihm den oberen Teil der Wange wegzuschneiden und den Rest auszubrennen. Dafür war es jetzt schon zu spät, das wusste jedes Kind.
Trotzdem grollte er Irullas Mutter. Er trat sie mehrfach in den Bauch und stieß ihr sein Schwert in den Rücken.
Sterbend sah sie zu den Bäumen hinüber, wo Irullas Zwillingsbruder stand. Sie winkte ihm. Er rannte in den Wald hinein. Das taten viele. Die Keke-Wanaq gaben auf, sie liebten den Tod nur bei anderen und liefen vor ihm davon.
Sonnenhaar brüllte schon wieder, das tat er wohl gern. Mit der blutigen Klinge zeigte er hinter Irullas Bruder her. Ein paar Blasshäute folgten ihm in den Wald.
Die Büffelfrau gehörte nicht dazu. Sie starrte Irulla an, grinste und kam zu ihr.
Irulla wollte nicht weglaufen. Stattdessen hockte sie sich hin und umarmte Ibu. Sein Fell war nicht weich, sondern kratzig, und an den Zähnen klebte noch Blut von dem Vogel, den er verspeist hatte. Das gefiel Irulla.
Die Büffelfrau steckte den Säbel neben ihr in den Boden und hockte sich hin.
Ibu knurrte. Ganz schwach waren die Flecken zu erkennen, die auch sein schwarzes Fell musterten, wenn die Sonne im richtigen Winkel darauffiel.
Die Büffelfrau schlug ihm auf die Nase.
Jaulend zuckte der junge Jaguar zurück.
Der Wind spielte im borstigen Haar auf den Armen der Büffelfrau ebenso wie im Gras, als sie mit ihren ledrigen Fingern Irullas Gesicht betastete. Sie führte eine Strähne von Irullas Haar zu ihrer Nase und beschnupperte sie. Ihr Grunzen klang zufrieden.
Die Blasshäute kamen aus dem Urwald zurück. Sonnenhaar brüllte wieder.
Die Büffelfrau zog Irulla auf die Beine und stieß sie zu einer Gruppe von Kriegern, die von den Blasshäuten am Rand des Dorfs zusammengetrieben wurden. Tunutee sah verzweifelt aus, er hatte seine Schamanenkeule verloren. Samale dagegen hielt das Kinn stolz erhoben. An seinen Ohrläppchen baumelten Fingerknochen von erschlagenen Blasshäuten. Auch heute hatte er bestimmt einige Leben genommen, und sein Blick verriet, dass er noch viele weitere nehmen wollte, auch wenn er aus Schnitten an Brust und Oberschenkeln blutete und ein Strick seine Hände fesselte.
Irulla sah sich um. Neun Erwachsene wurden aneinandergefesselt. Doppelt so viele waren tot, was bedeutete, dass ungefähr zehn entkommen sein mochten. Oder sie verbluteten im Wald.
Sonnenhaar und die Büffelfrau zogen Aritto auf die Beine. Er stand jetzt noch schiefer als vorher und hatte sichtlich Schmerzen beim Auftreten. Sonnenhaar schlug ihm den Kopf von den Schultern, brüllte dann aber wieder herum und versuchte vergeblich, das Blut aus dem Jaguarfell zu schütteln. Er drückte es Glupschauge in die Hand, der es im Gras abrieb.
Irulla fand es interessant, den zerschnittenen Hals zu sehen, die hellen Wirbel des Genicks, die Luftröhre, die großen Adern, aus denen das Blut erst stoßweise und dann in einem kontinuierlichen Strom ins Gras floss.
Die Blasshäute warfen die Laubhütten um und stöberten im Besitz der Keke-Wanaq. Den Toten rissen sie die Ohrringe ab, wenn sie aus Onyx gefertigt oder kunstvoll geschnitzt waren.
Auch unter ihnen gab es Tote. Sie nahmen den vier Leichen ihre Ausrüstung ab und legten sie auf einen Haufen, zu dem sie die Laubhütten aufschichteten. Dann gossen sie etwas Zähflüssiges aus drei Fläschchen über sie und zündeten sie an.
»Sie haben ihnen nicht die Augen vernäht«, sagte Irulla. »Auch nicht die Münder, Nasen und Ohren.«
»Das ist nicht so schlimm«, meinte Tunutee. »Blasshäute haben keinen Tapam. Ich hoffe, dass sie unsere Brüder und Schwestern einfach liegen lassen. Wenn wir weg sind, können diejenigen, die ihre Freiheit gerettet haben, zurückkehren und dafür sorgen, dass die Toten nicht als ruhelose Geister durch den Wald streifen müssen. Sie können den Tapams den Weg hinter die Sonne zeigen.«
Irulla sah hinauf ins Gesicht des Schamanenschülers. Er hatte sich eine sichelförmige Narbe in die rechte Wange gebrannt. Seitdem sah er stets ernst aus, aber heute besonders. Daran änderte auch die leuchtend rote Papageienfeder im linken Ohr nichts.
»Ich kümmere mich um Ibu«, versprach Irulla. Der Jaguar strich noch immer um ihre Beine.
»Das ist gut«, befand Tunutee. »Auch in harten Zeiten müssen wir Kamaluqs Tier Ehre erweisen.«
»Sind wir jetzt Sklaven?«, fragte Irulla.
»Nur, wenn du diesen Gedanken in deinem Herzen wohnen lässt«, zischte Samale. »Was andere über dich sagen, ist unwichtig.«
Die Büffelfrau band einen Strick um Irullas Handgelenke. Er war viel zu locker, sie hätte ihn jederzeit abstreifen können. Aber wenn alle anderen Fesseln trugen, wollte sie auch welche haben.
Die Blasshäute zündeten die Hütten an. Zum Schluss legten sie Feuer an das Gespinst um den Baum der Gelbzahnspinnen.
Die Büffelfrau knallte mit ihrer Peitsche.
Während sie nach Norden geführt wurden, sah Irulla zurück auf die Zerstörung. Das Haarband aus grünem Schlangenleder trieb auf der Blutlache, die ihre Mutter umgab. Sie hoffte, dass jemand kam und die Öffnungen in ihrem Kopf mit Nähten verschloss, damit kein böser Geist Einlass fand.
Tyrinth,
achter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
Die Halborkin roch die Krankheit des Kapitäns. Er stank süßlich, als würde Zucker statt Salz aus seinen Poren gespült. Den kalten Schweiß zu kosten traute sich Ohnnam nicht. Offensichtlich kreiste Gift in Haggams Adern, löste Schüttelfrost und Brechreiz aus und färbte seine Augen gelb. Wer wusste schon, wie viel von dem Zeug er ausschwitzte?
Er war ein Kämpfer, auch wenn sie seinetwegen ewig gebraucht hatten, um zurück zur Küste zu kommen. Bereits am ersten Tag hatte er viel häufiger Rast befohlen, als zur Orientierung notwendig gewesen wäre. Immerhin hatten sie am Anfang noch ihrem frisch ins Dickicht gehackten Pfad zurück folgen können, bis sie ihn am zweiten Tag verloren hatten. Spätestens am dritten Tag hätten sie eigentlich eine Trage für ihn bauen müssen. Bei jedem anderen aus der Mannschaft hätten sie das wohl auch getan, aber er war der Kapitän, und sie wagten es nicht einmal, ihn zu fragen. Wer nicht auf den eigenen Beinen stehen konnte, verlor das Kommando, das war ein ungeschriebenes Gesetz.
Jetzt, am Strand, hielt Haggam die Nase in den Wind und atmete die frische Luft in tiefen Zügen. Der Schweiß tropfte aus seinem Bart. Die Bewohner der Hütten, die am Waldrand standen, starrten zu ihnen herüber, trauten sich aber wohl nicht näher heran. Doswin sprach mit ihnen, die Frau neben ihm mochte seine Gemahlin sein.
»Spül dir das Gesicht ab«, raunte Parihm Haggam zu.
Ohnnam überlegte, ob sich die Steuerfrau wünschte, dass der Kapitän abkratzte, damit sie das Kommando über die Goldhaken bekäme, die knapp einhundert Schritt draußen auf dem Meer in sicherer Tiefe ankerte. Und was sie, Ohnnam, dann tun sollte. Wäre das eine gute Gelegenheit, das Schiff für sich selbst zu fordern? Oder war es besser, jetzt auf Einigkeit zu setzen?
Parihm trug ständig ein ledernes Stirnband, das speckig glänzte. Für ihr rotes Haar brauchte sie das nicht, es war so kurz geschnitten, dass es ihr nicht die Sicht nehmen konnte. Sie vertraute wohl darauf, dass die thorwalsch aussehenden Runen ihren Dickschädel schützten. Dabei stammte sie gar nicht aus dem Nordwesten, sondern aus Perricum, wo man lernte, Harpunen zu schleudern, bevor man gehen konnte. Bei einem Enterangriff vor Khunchom hatte sie zwei hintereinanderstehende Gegner mit einem einzigen Speerwurf erwischt. Sie waren nicht sofort tot gewesen, aber zappelnd aneinandergeheftet. Ihr Geschrei hatte ihren Kameraden den Mut geraubt.
Parihm legte sich Haggams rechten Arm über die Schultern. So ließ er sich von ihr zum Wasser führen. Er trug noch immer den Lederkragen, das war ein Zeichen seines Stolzes.
Ohnnam entschied, dass sie selbst nützlicher war, wenn sie die anderen antrieb, die Beute aufs Schiff zu bringen. Die beiden Beiboote lagen auf dem Strand, eines bauchig und gut geeignet, um Ladung aufzunehmen, das andere schlank und schnell. Die zehn zurückgebliebenen Piraten begrüßten die Rückkehrer und begutachteten die Sklaven – neun Männer und das Mädchen Irulla –, dazu die schwarze Raubkatze, die wohl tatsächlich ein junger Jaguar war. Mit Doswins Hilfe hatte Haggam Irulla klargemacht, dass sie ihm Krallen und Zähne ausreißen würden, wenn er Ärger machte.
»Na los, erst mal die Kisten rein!«, herrschte Ohnnam die Piraten an.
Spinnenseide und Schnitzereien sahen zwar weniger interessant aus als Gefangene, aber sie hatten das Zeug nicht tagelang durch den Urwald geschleppt, um nun herumzutrödeln.
Murrend gehorchte man Ohnnam. Sie brauchte noch nicht einmal die Hand an die Peitsche zu legen. Offensichtlich war jedermann froh, dass es jetzt bald wieder auf See hinausginge. Bevor eine al’anfanische Galeere vorbeikäme und nachfragte, was die Goldhaken geladen hatte. Ein Gutteil davon stammte von einem Kauffahrer, dessen maraskanische Seide, bedruckt mit Rabenköpfen, nun wohl nicht mehr den Weg zum Borontempel finden würde. Stattdessen sollte sie im Lieblichen Feld gutes Silber bringen, wenn Ohnnam Haggam richtig verstanden hatte. Dadurch stand ihnen eine Fahrt um das für seine Stürme berüchtigte Südkap bevor.
»Wie seid ihr mit der Takelage vorangekommen?«, fragte sie Fjodder, das erstbeste Besatzungsmitglied, das sie zu packen bekam.
Mit beinahe vierzig gehörte der Bornländer zu den Ältesten an Bord. Er würde es nie zu etwas bringen. Wer halbwegs ein Händchen für Silber hatte, hielt es gut genug zusammen, um sich mit dreißig in irgendeiner Hafenstadt zur Ruhe zu setzen, das war Ohnnams Meinung. Oder man wurde Bootsfrau, dann Steuerfrau und hatte schließlich sein eigenes Schiff. Aber Fjodder hatte sich jahrzehntelang von Sonne und Wind die Haut gerben lassen, ohne mehr zu werden als ein einfacher Matrose. Wenn er seinen Beuteanteil wenigstens verprasst hätte … Aber er war schlicht zu gutmütig, wenn er nicht gerade mit seinem Säbel auf einem gegnerischen Deck herumfuchtelte. Mit den dämlichsten Geschichten konnte man sein Mitleid erregen, und schon schenkte er einem sein Silber. In Thalusa hatte Ohnnam zwei volle Tage damit zugebracht, einem Bettler den Geldbeutel wieder abzujagen, den Fjodder ihm geschenkt hatte.
Aber von der Seefahrt verstand er etwas. »Das stehende Gut ist überholt.« Er zeigte hinüber zur Lorcha, deren Rumpf sich in der seichten Dünung hob und senkte.
Zumindest auf die Entfernung sahen die Wanten, die gleich dreieckigen Netzen die beiden Masten hinaufstrebten, wieder gut aus. Die Drachensegel waren herabgelassen und die Latten miteinander verlascht.
»Wir haben schwer geschuftet, damit hier keiner auf dumme Gedanken kommt«, fuhr Fjodder fort. »Die kleinen Lecks sind mit Teer und Werg kalfatert. Vorne backbord haben wir die gerissenen Planken ausgetauscht.«
»Ersatzholz?«, fragte die Bootsfrau.
Fjodders Geste strich über den Wald, der hinter dem bei Niedrigwasser fünfzig Schritt breiten Sandstrand begann. »Holz haben wir hier ja genug. Nur leider kein abgelagertes. Ich fürchte, wir werden bald wieder kalfatern müssen. Im nächsten Hafen sollte sich das jemand anschauen, der sich damit auskennt. Sonst saufen wir irgendwann ab. Eine Säge ist leider auch gebrochen, aber da waren unsere Planken schon fertig.«
Am Waldrand standen zwei Dutzend Holzhäuser. In welchen davon Menschen wohnten und welche nur Lagerschuppen waren, ließ sich schwer sagen. Nur der Schrein für Efferd, den Gott des Meers und der Stürme, stach heraus. Seine Front schmückten Hunderte angenagelte Muscheln, manche klein wie ein Daumen, andere größer als Ohnnams Pranken.
Weitaus imposanter, sogar ein bisschen unheimlich, waren die von Wind und Zeit gezeichneten Pyramiden, die nicht weit entfernt aus dem Urwald emporragten. Ihre nach oben hin kleiner werdenden Stufen waren aus schwarzem Stein geschlagen. Für Ohnnam sahen sie aus wie Schatten einer fernen, bösen Vergangenheit.
»Die Wasserfässer sind mit Essig gereinigt und frisch aufgefüllt. Verpflegung haben wir auch reichlich aufgenommen«, sagte Fjodder. »Hauptsächlich Früchte.«
»Hoffentlich vergammelt uns das Zeug nicht unterwegs.«
Er zuckte mit den Achseln. Seine Schultern waren sehr schmal, die meisten Hemden, die sie erbeuteten, waren ihm zu groß. Er war nicht gerade kräftig, aber immerhin zäh. »Wenn es zu faulen anfängt, werfen wir es eben über Bord. Hat nicht viel gekostet.«
Die Bewohner der Holzhütten standen in Gruppen zu fünf oder zehn herum und sahen den Piraten bei der Arbeit zu. Ohnnam fiel es schwer, sich vorzustellen, wie man so leben konnte. Immer an einem Fleck, vollkommen bedeutungslos … wie oft mochte ein Schiff wie die Goldhaken an diesen Strand finden? In den Monden zwischen solchen Besuchen sah man nur die stets gleichen Gesichter. Leute, mit denen man ein Leben lang auskommen musste, was sogar zünftige Keilereien schwierig machte. Ab und zu kamen Wilde vorbei, um Felle und Schnitzereien gegen Metall zu tauschen. Für die war sicher auch die zerbrochene Säge noch gut genug.
Ob man stolz darauf sein konnte, eine kaputte Säge gegen den Rüssel eines Waldelefanten getauscht zu haben?
Ohnnam spie aus. Jedenfalls nicht so stolz wie darauf, einen al’anfanischen Kauffahrer hochgenommen zu haben. Oder sich mit einem ganzen Dorf von diesen Spinnenleuten angelegt zu haben.
Haggam stützte sich nicht mehr auf Parihm, während die beiden vom Wasser zurückkamen. Die Sonne glitzerte in den Juwelen, in denen der Reichtum der Steuerfrau steckte. Sie trug sie an mehreren Ketten um den Hals.
»Ich bin froh, dass wir aus diesem schwülen Dschungel raus sind.« Das Gesicht des Kapitäns war klatschnass. Das lag nicht nur am Wasser, mit dem er es abgespült hatte. Ohnnam roch, dass er schon wieder schwitzte.
Doswin stapfte über den nassen Sand zu ihnen. Der angeblich so kundige Waldläufer hatte sich neben einem Ameisennest schlafen gelegt. Seitdem kratzte er sich ständig. »Da wäre noch die Sache mit meiner Bezahlung«, sagte er.
»Kümmert ihr euch darum«, wies Haggam die beiden Frauen an. »Ich sehe auf der Goldhaken nach dem Rechten.«
Damit wankte der Kapitän zu dem breiten Boot, das inzwischen mit den Kisten und den Sklaven beladen war. Gerade hoben Zajin und Bassil das Mädchen und den Panther hinein.
»Er heißt Tod. Glaube ich jedenfalls«, sagte Doswin.
»Wer?«, fragte Parihm.
»Der Jaguar«, warf Ohnnam ein. Es gefiel ihr, mehr zu wissen als die Steuerfrau. Der Übersetzer hatte es ihr schon auf dem Weg erzählt.
»Die Keke-Wanaq sprechen einen eigentümlichen Dialekt«, erklärte Doswin. »Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ibu bei ihnen Tod heißen müsste.«
»Also holen wir uns den Tod an Bord?« Das Zucken von Parihms Nasenflügeln verriet ihren Unwillen.
»Nur ein Kätzchen.« Ohnnam lachte. »Und ein so besonderes dazu, dass man in Neetha oder Grangor eine Menge Silber dafür geben wird.«
Parihm studierte die wenigen Wolken, die über den Himmel zogen. »Eine beständige Brise. Die sollten wir nutzen.« Mit dem Wetter kannte sie sich aus.
»Da wäre noch die Sache mit meiner Bezahlung«, erinnerte Doswin.
»Was ist damit?«, fragte Parihm.
»Ich sollte den zehnten Teil der Summe kriegen, die ihr für die Waren der Keke-Wanaq bezahlt habt.«
Parihm zog die Brauen zusammen. »Und?«
»Ihr habt nichts bezahlt.«
Ohnnam lachte schadenfroh. »Der zehnte Teil von nichts ist nichts. Das kann sogar ich ausrechnen.«
»Das ist ungerecht!«, protestierte der Händler. »Ihr verdankt mir einen großen Gewinn. Allein die Sklaven …«
Schwer legte Ohnnam ihm eine Pranke auf die Schulter. »Jetzt lernst du eben, dass das Leben ungerecht ist.« Diesen Spruch hatte sie von einem Würfelspieler in Sinoda gelernt. Dem Mann hatte sie dafür den Kiefer gebrochen, aber der Spruch gefiel ihr gut.
»So kann man keine Geschäfte machen.« Doswin sah richtig bockig aus.
»Nicht?«, fragte Ohnnam belustigt.
»Na, wir wollen mal nicht so sein«, sagte Parihm gutmütig. »Ein paar Münzen können wir schon springen lassen. Aber du musst zugeben, dass deine Fähigkeiten als Übersetzer nicht vonnöten waren.«
»Mag sein«, brummte er.
»Wir haben die ganze Arbeit gemacht«, stellte Ohnnam fest. »Das Raufen und auch die Schlepperei mit den Kisten. Da hast du keinen Finger gerührt.«
»Ich bin kein Kämpfer.«
Sie kniff in seinen Oberarm. »Und schlapp bist du auch.«
»Zwanzig Silberoreale, damit wir beim nächsten Mal wieder freundlich empfangen werden«, bot Parihm an.
»Das ist viel zu viel!«, rief Ohnnam.
»Nein, es ist zu wenig«, wagte Doswin zu widersprechen. Mit schalkhaftem Grinsen zeigte er zu einer Gruppe von zehn Dörflern. »Für das, was ich euch noch anzubieten habe.«
»Noch mehr Sklaven?«, fragte Ohnnam misstrauisch.
»Aber nein. Viel besser!«
Er winkte den Frauen, ihm zu folgen.
Ein Dorfbewohner, der eine verdorrte Echsenklaue um den Hals trug, zog einen Sack von einer Platte aus schwarzem Stein. Sie war viereckig, einen halben auf etwas mehr als einen Schritt, an den Kanten abgeschlagen, als hätte man sie nicht eben zartfühlend mit einem Stemmeisen aus einer Halterung gebrochen. Das hineingeschlagene Relief war nur leicht verwittert.
»Ist das eine Schlange, die einen Menschen frisst?« Das Zittern in ihrer Stimme ärgerte Ohnnam. Wenigstens beherrschte sie sich so weit, dass sie nicht den Blick zu den drohenden Pyramiden hob.
»Einen Menschen mit vier Armen?« Parihm lachte. »Das sind mindestens zwei.«
»Nein, es ist nur einer«, meinte Doswin. »Und er wird nicht gefressen. Seht genau hin.« Er hockte sich in den Sand und fuhr mit dem Zeigefinger über das Relief. »Stellt euch etwas nach rechts, dann erkennt ihr es besser. Ja, so. Das hier ist der Unterleib, wie bei einer Schlange. Der Kopf ist auch der eines Reptils.«
Ohnnam bemerkte die Giftzähne im aufgerissenen Maul.
»Aber dazwischen …«, fuhr Doswin fort, »… der Oberkörper eines Manns mit vier Armen.« Er deutete bei sich selbst an, wo das untere Armpaar aus dem Brustkorb hervorkam. »Er hält einen Stab, an dessen Spitze ein Kristall leuchtet.«
»Der sieht aus wie eine Sonne«, meinte Parihm.
»Wegen der Strahlen, die davon ausgehen«, stimmte Doswin ihr zu. »Die waren vielleicht einmal mit Gold ausgelegt. Und in der Vertiefung über dem Stab könnte ein echter Karfunkel gesteckt haben.«
»Was für ein Ding?«, schnappte Ohnnam missmutig. Es gefiel ihr überhaupt nicht, dass sie sich mit etwas beschäftigten, das vermutlich aus diesen schwarzen Pyramiden stammte. Wenn es jemand dort begraben hatte, dann sicher aus gutem Grund. Es gehörte nicht in diese Zeit. Und Ohnnam gehörte nicht auf diesen Strand. Der Kapitän hatte recht, die Planken unter den Füßen fehlten ihr.
»Ein Karfunkel«, wiederholte Doswin. »Ein Zauberstein. Aber wenn der noch hier wäre, und dazu das Gold … dann würde ich dieses Bildnis selbst nach Al’Anfa bringen und als reicher Mann zurückkehren. Eigentlich wollte ich das auch hiermit machen, aber jetzt liegt es schon ein Jahr hier herum … Euer Glück! Macht mir einen guten Preis.«
»Wir fahren aber nicht nach Al’Anfa«, blaffte Ohnnam.
»Das stimmt. Aber woanders könnten wir das vielleicht auch loswerden.« Die Gier stand überdeutlich in Parihms Gesicht.
Das machte Ohnnam stutzig. »Glaubst du, jemand würde Silber für so einen alten Stein geben?«
Parihm lachte.
Das mochte Ohnnam nicht. Sie hätte Parihm gern einen Fausthieb verpasst. Aber da die Steuerfrau im Rang über der Bootsfrau stand, hätte sie dafür ihre eigene Peitsche geschmeckt, von Haggam persönlich geschwungen. Diese Erfahrung hatte sie bereits gemacht, einmal im Leben reichte.
»Magier sammeln das seltsamste Zeug«, raunte Doswin. »Ihr müsst nur aufpassen, wem ihr das hier zeigt.« Er strich mit der flachen Hand über das Bildnis. »Die Inquisitoren der Praioskirche verstehen keinen Spaß. Die könnten es euch abnehmen und kaputt schlagen, ohne dass ihr einen Heller dafür seht.«
»Wir werden schon nicht so dumm sein, es den Falschen anzubieten.« Selbstsicher hakte Parihm die Daumen hinter ihren Gürtel.
»Zwanzig Oreale für meine Dienste«, sagte Doswin, »das ist eine Golddublone. Und noch vier Dublonen für diesen Schatz, dann sind wir bei fünf.«
Fragend sah Parihm Ohnnam an.
Die Halborkin blickte nun doch hinüber zu den schwarzen Pyramiden. Sicher kam dieser Stein dorther. Wenn er wirklich wertvoll war, könnten sie die Besatzung zurückrufen, selbst dorthin gehen und die Bauwerke ausplündern. Aber schon bei dem Gedanken stellten sich Ohnnams Nackenhaare auf. Dort mochten Gefahren lauern, die sich von Säbelhieben und Faustschlägen unbeeindruckt zeigten. Sie wollte nur noch weg.
»Gib ihm die Münzen und dann nichts wie aufs Schiff.«
Parihm grinste sie spöttisch an.
»Das Wetter ist günstig!«, schützte die Bootsfrau vor. »Das hast du selbst gesagt. Wir sollten Segel setzen.«
»Ich hoffe, es wird eine ertragreiche Fahrt für euch.« Doswin lachte gut gelaunt. »Und wenn ihr das nächste Mal kommt, habe ich einen dreiköpfigen Drachen für euch.«
Goldene Bucht,
neunter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
Die Blasshäute warfen böse Blicke auf Ibu. Die Schiffskatze, die der Jaguar gerade verspeiste, war wohl beliebt gewesen.
Irulla hätte Ibu gern gestreichelt. Ein guter Jäger verdiente Anerkennung, nicht Anfeindung. Aber sie wusste, dass man besser Abstand zu einem Raubtier hielt, wenn es sich mit seiner Beute beschäftigte. An Ibus Schnurrhaaren klebte Blut. Er schmatzte, schlang und schob das Maul wieder in den aufgerissenen Bauch der Katze, die ohnehin schon alt gewesen war. An einigen Stellen war ihr Fell grau.
Irulla war die einzige Keke-Wanaq, die nicht gefesselt war. Den Männern waren die Hände auf den Rücken gebunden. Ansonsten konnten sie sich frei in diesem Raum der riesigen Holzhütte bewegen, deren Decke und Wände so dicht gefügt waren, dass kein Licht hereindrang. Auch der Wind war ausgesperrt, Irulla hörte ihn draußen heulen.
Überhaupt war es eine merkwürdige Hütte. Sie war mehrfach unterteilt, in Ebenen und Räume, ähnlich wie die Steinhütten in Shan’R’Trak. Nur, dass es dort Fenster gab. Hier sperrte man kleine Feuer in durchsichtige Gefäße, die man an den Balken aufhängte.
Die Ebene, in der sich die Keke-Wanaq und auch viele Blasshäute aufhielten, war, von einigen kleinen Kammern am Rand abgesehen, ein einziger, großer Raum. Zwei astlose Baumstämme verbanden Boden und Decke. Irulla glaubte, dass es dieselben waren, die sie oben, im Freien, auch schon gesehen hatte. Dort waren Querstangen daran angebracht. Inzwischen hatten sie sich entfaltet wie die Flügel einer Motte. Irulla hatte sie fasziniert angesehen, wenn man sie nach oben gelassen hatte, damit sie sich über die niedrige, umlaufende Holzwand hockte, um sich zu erleichtern.
Das hatte sie vom schrecklichen, aber auch aufregenden Anblick des großen Wassers abgelenkt. Rund um das Holzhaus gab es nichts als Wellen. Die Bäume des Walds waren nirgendwo zu sehen. Tunutee, der Lehrling des Schamanen, sagte, dass Kamaluq dieses endlose Wasser nicht geschaffen hatte. Es war das Reich der Nachtschwarzen Herrin, vor der sich selbst die mächtigsten Geister fürchteten.
Hier unten, wo sich die Keke-Wanaq die meiste Zeit aufhalten mussten, benutzte man die beiden Baumstämme, um Hängematten daran zu befestigen. Sternförmig gingen sie von den Stämmen aus und verbanden sie mit den leicht gewölbten Wänden. Die Blasshäute schliefen oder dösten darin.
Die Keke-Wanaq schliefen auf dem Holz. Sie benutzten größere Früchte, um die Köpfe daraufzulegen.
Unter dem Boden gab es weitere Räume. Die Blasshäute kamen und gingen durch Klappen dorthin. Über vier steile Treppen konnten sie nach oben ins Freie gelangen, wann immer ihnen danach war.
Tunutee pendelte mit dem Oberkörper vor und zurück. Dabei öffnete und schloss er die Lippen, sein Kehlkopf hüpfte, aber Irulla verstand keine Wörter, obwohl sie nah neben ihm saß.
Ibu unterbrach sein Mahl, für den Moment hatte er wohl genug. Er begann, sein Fell abzulecken.
Irulla schob die Hand in die Bauchwunde der Katze und lutschte das Blut von ihren Fingern.
Tunutee hielt inne und sah sie an.
»Willst du auch?«, fragte sie. »Es ist noch schön warm.«
Er schüttelte den Kopf, wodurch die Papageienfeder in seinem linken Ohrläppchen wild tanzte.
»Was machst du?« Irulla nahm noch etwas Blut. »Sprichst du mit den Geistern?«
»Das würde ich gern, aber es ist nicht einfach. Die Glatthäute haben uns das Kekeyatonba weggenommen, da fällt es schwer zu träumen.«
»Ich habe noch nie Kekeyatonba getrunken, aber ich träume trotzdem oft.«
»Du bist noch zu jung dafür«, versetzte Tunutee.
Das ärgerte Irulla, sie war nicht gerne zu jung. Missmutig streichelte sie Ibus Pelz.
»Es ist eine andere Art von Traum, wenn man mit den Geistern spricht«, erklärte Tunutee versöhnlich. »Ein Traum, bei dem man sehr wach ist.«
»Man träumt, aber man ist auch wach?«, versicherte sich Irulla.
»Ein Schamane lebt in zwei Wirklichkeiten zugleich«, sagte Tunutee.
Er wippte wieder vor und zurück. Diesmal sang er lauter, aber Irulla verstand die Wörter trotzdem nicht. Sie waren ebenso fremd wie die Sprache der Blasshäutigen.
Einer von denen fühlte sich gestört. Er rollte sich aus seiner Hängematte und sprang auf die Füße, an denen er lederne Überzüge trug, die bis zur Hälfte der Waden hinaufreichten und knallten, als sie den Boden berührten. Mit lauten Schritten und zusammengezogenen Brauen kam er zu ihnen. Er gehörte zu den drei Männern, deren Haar in zahllose Locken gedreht war und die einander so ähnlich sahen, dass Irulla sie für Brüder hielt. Manchmal sprachen sie anders als die anderen Blasshäute. Die Silben, die er jetzt hervorstieß, glichen einer aufgescheuchten Affenhorde, in der sich die Tiere in panischer Flucht gegenseitig überholen wollten.
Tunutee sang weiter, er bemerkte die Blasshaut gar nicht.
Bis diese ihm auf die Wange schlug, wo ihn das Brandmal in Form einer Mondsichel zierte.
Tunutee verstummte und starrte zu dem Mann hinauf.
Was die Blasshaut jetzt sagte, klang zufrieden. Brummelnd kehrte sie zu ihrer Hängematte zurück.
»Sie lassen dich nicht singen«, stellte Irulla fest.
»Wenn wir die Geister nicht um Hilfe bitten können, müssen wir unsere Feinde anders bekämpfen«, sagte Samale, der gemeinsam mit Yuguir auf den Knien zu ihnen rutschte. Obwohl auch ihnen die Hände auf den Rücken gebunden waren, wirkten sie nicht hilflos. Ihre Augen waren noch immer die von freien Männern, nicht die von Gefangenen, wie die Keke-Wanaq sie manchmal nach Shan’R’Trak brachten.
»Wollt ihr kämpfen?«, fragte Tunutee. »Wir haben keine Waffen, sie sind zahlreicher, wir sind gefesselt und du bist verwundet.«
Samale lachte trotz der vielen Schnitte, die nur oberflächlich verkrustet waren. »Ich bin noch immer stärker als jeder von ihnen.«
»Aber wir haben etwas anderes vor«, fiel Yuguir ein. »Wir haben eine Mondspinne gefunden. Die Dummköpfe haben sie mit den Früchten hierhergeholt.« Er drehte ihnen den Rücken zu.
Die dünnbeinige Spinne hockte in seiner locker geschlossenen Hand.
»Ihr wollt sie vergiften?«, fragte Tunutee.
»Das geht nicht«, wandte Irulla ein. »Das ist ein Weibchen.« Anders als die Männchen waren die weiblichen Mondspinnen dürr, ganz ohne flauschigen Pelz. Ihr Biss schmerzte, war aber ansonsten harmlos.
»Wenn wir ein bisschen Geduld haben, ist ein Weibchen noch besser«, meinte Yuguir. »Diese Schönheit ist trächtig. Sie kann so viele Männchen in die Welt bringen, wie ein Pfeilbeerenstrauch Früchte trägt, wenn sie eine Bruthöhle findet, wo sie gut versorgt ist und nicht gestört wird.«
»Wieso schaust du mich dabei an?« Sein Blick gefiel Irulla nicht. Er sah sie an wie eine Hütte, die man abreißen sollte, weil ihr Laub schimmelte.
»Yuguir meint, Irulla sollte sie tragen.« Samale klang wenig überzeugt.
»Sie ist nur ein Kind«, verteidigte Yuguir seinen Plan. »Im Kampf ist Irulla unnütz.«
»Es kostet viel Kraft, eine trächtige Mondspinne in sich zu tragen«, sagte Tunutee zögernd.
»Glaubst du, sie ist sogar dafür zu schwach?«, fragte Yuguir enttäuscht.
Irulla stand auf, ging zu ihm und zog an seinem linken Ohrläppchen, das unter dem Gewicht eines grauen Steinkopfs mit spitzzahniger Grimasse ohnehin schon weit herunterhing.
Er schrie auf.
»Ich bin nicht schwach!«, stellte sie klar.
Er zappelte, konnte sich aber nicht wehren, weil er gefesselt war und auf den Knien hockte. »Lass los!«
»Erst, wenn du sagst, dass ich nicht schwach bin.« Sie kniff ihn zusätzlich in die Nase.
Yuguir riss den Mund so weit auf, dass Irulla die Lücke sah, wo der Eckzahn abgebrochen war. Er hatte Upada beweisen wollen, dass er eine Kieselnuss knacken konnte. Der Zahn war an der Aufgabe gescheitert, was sicher daran lag, dass ein Rivale um Upadas Gunst sie gegen einen echten Kiesel ausgetauscht hatte. Seitdem war Yuguir ständig wütend.
Die Blasshäute grummelten ungehalten.
»Seid still!«, forderte Tunutee.
»Er soll zugeben, dass ich nicht schwach bin«, beharrte Irulla.
»Ja! Ja, ist ja gut. Du bist ein starkes Mädchen.«
Sie ließ ihn los.
»Stark genug, um die Mondspinne zu tragen«, fügte Yuguir trotzig an.
»Wenn Irulla stirbt, bevor die Brut schlüpft, verlieren wir alles«, gab Tunutee zu bedenken. »Sind die Eier erst einmal gelegt, lässt sich die Mondspinne nicht mehr umbetten.«
»Das sagst du nur, weil du Mitleid mit ihr hast!«, warf Yuguir ihm vor. »Du hast das Mädchen schon immer gemocht.«
Tatsächlich unterhielt sich Irulla gern mit Tunutee. Er war noch lange kein ausgebildeter Schamane, aber er konnte viel Interessantes über die Welt der Geister erzählen. Die Nipakau wohnten in jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Stein. Sie wussten alles über den Wald, und wenn ein Schamane die richtigen Worte kannte, wenn er seine Keule geschickt schwang und die gewünschten Opfer brachte, halfen sie ihm. Sie konnten auch die Verbindung zu den Geistern der Ahnen und den Tapams herstellen oder zu den noch mächtigeren Wesenheiten, die große Dinge zu tun vermochten.
Samale lachte auf. »Lasst nur. Ich nehme sie.«
»Du?«, rief Yuguir. »Du bist viel zu wertvoll im Kampf.«
»Keine Sorge, die kleinen Spinnen werden mich schon nicht von innen auffressen. Sobald es so weit ist, werde ich viele Blasshäute töten. Wenn Irulla meine Fesseln löst, kann ich sie erwürgen. Aber erst einmal …« Er rutschte zurück, bis er sich an den körnigen schwarzen Stein lehnen konnte, der an der Wand verzurrt war.
Das Bild einer Schlange mit vier Armen war hineingeschlagen. Irulla fand es unheimlich, weil es so falsch wirkte. Ein solches Wesen sollte es nicht geben, noch nicht einmal in der Vorstellungskraft.
»Der Schnitt unter meinem Brustkorb.« Samale atmete tief ein. »Der ist am besten geeignet, da kriegt sie Luft. Reiß ihn auf, Irulla.«
Um Bestätigung bittend sah sie Tunutee an.
Er setzte sich in die Sichtlinie zwischen Samale und den Blasshäuten. Die übrigen Keke-Wanaq stießen sich an und beobachteten das Geschehen neugierig.
Irulla kratzte den Schorf von der Wunde, bevor sie die Fingernägel benutzte, um sie aufzuziehen.
Samale wimmerte, aber sie glaubte nicht, dass jemand anderes als sie es hörte, und sie würde es niemandem verraten. »Weiter«, verlangte er. »Sie muss ganz reinpassen, und für die Eier muss auch Platz sein.«
Irulla erfüllte seinen Wunsch.
Sie nahm Yuguir die Mondspinne ab und hielt sie an die Wunde, die sie mit der freien Hand aufspreizte.
Wärme und Blut lockten das Tier an. Es huschte in die Höhle aus lebendem Fleisch und drehte sich so, dass der Kopf nach außen gerichtet war.
Behutsam löste Irulla den Griff, sodass sich die Wunde schloss. Über dem frischen Blut, das ausgetreten war, verrieten nur noch zwei dicht beieinanderliegende Punkte, wo die Spinne steckte. Das waren ihre Kieferklauen, mit denen sie die Öffnung aufbiegen konnte, um zu atmen.
»Wie fühlt es sich an?«, wollte Tunutee wissen.
»Ich glaube …«, Samale stöhnte, »… das war doch keine so gute Idee.«
Straße von Sylla,
elfter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
»Por… …ligan«, stöhnte Haggam. »…kehren. Kenne … Heiler … Porto Paligan.«
Ohnnam wunderte sich, was für eine Kraft im Biss einer Spinne steckte, die sie in ihrer Hand hätte zerquetschen können. Man sah sogar noch die beiden winzigen Wunden, wo die Kieferklauen in die Wange gedrungen waren. Sie hatten sich nie geschlossen, aber der Bereich war ausgetrocknet. Auf einer Fläche mit dem Durchmesser einer Dublone war die Haut weiß wie Schnee. Auch sonst war Haggam bleich, aber die Farbe glich vergorener Milch, mit einem ungesunden Gelbstich. Er musste unentwegt trinken, weil er am gesamten Leib schwitzte. Wenn man ihn nicht gerade mit einem Tuch abgerieben hatte, war er so nass, als wäre er über Bord gefallen.
»Heiler in … Porto Paligan.« Fahrig wischte seine linke Hand durch die Luft. »Kann mich … retten. Schuldet … mir was.«
»Porto Paligan gehört den Al’Anfanern«, stellte Ohnnam fest. »Die haben da eine uneinnehmbare Festung. Wenn wir da hinfahren, nehmen sie uns hoch.«
Sie sprach nicht mit Haggam, der ohnehin kaum etwas mitbekam, sondern mit Parihm. Die Steuerfrau und die Bootsfrau bewohnten eigentlich gemeinsam die Steuerbordkajüte im Heckaufbau der Goldhaken. Da nahezu immer wenigstens eine von ihnen die Mannschaft herumscheuchte, merkte man die beengten Verhältnisse nicht allzu sehr.
Jetzt aber standen sie in der Backbordkajüte, die dem Kapitän allein vorbehalten war. Mit Haken so sicher an den Wänden befestigt, dass sie sich auch bei hohem Seegang nicht lösten, hingen hier Dutzende Messer und Zangen, die Haggam für die Lederbearbeitung benutzte. Er besaß auch einige Brandeisen, gebogen und gerade, in unterschiedlicher Stärke. Wenn er damit Muster in Bänder und Laschen presste, summte er Kinderlieder vor sich hin.
»…aligan«, stöhnte Haggam.
Ohnnam sah Parihm an. »Wir können unmöglich Porto Paligan anlaufen.«
»Natürlich nicht!«, blaffte die Steuerfrau. »Wenn die Goldhaken dort am Kai festmacht, wird sie so schnell nicht mehr auslaufen. Die Hafenwache wird an Bord kommen, um unsere Ladung zu schätzen, und wenn sie dann die Seide des Kauffahrers finden, den wir erleichtert haben, werden sie ärgerliche Fragen stellen. Wir könnten von Glück sagen, wenn sie uns ein Vermögen abnähmen, um zur Seite zu schauen. Und die Stoffbahnen mit den aufgedruckten Rabenköpfen würden sie wahrscheinlich trotzdem beschlagnahmen, damit sie bei den Boron-Pfaffen gut dastehen.«
Ohnnam sah den bleichen Mann an. Der süßliche Geruch seiner Krankheit wurde immer stärker, er überdeckte sogar den Duft des Leders in seiner Kajüte. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass er ohne Hilfe überleben würde.
»Vielleicht, wenn wir vor der Bucht Anker werfen«, überlegte sie. »Nachts. Und ihn mit dem schnellen Beiboot an Land bringen.«
Wieder blickten die Frauen einander an. Es war ein bewölkter Tag, nur trübes Licht fiel durch die Kajütenfenster herein. Aber Ohnnam hatte scharfe Augen. Sie sah, wie es in der Steuerfrau arbeitete.
»Wir müssten sofort wieder in See stechen«, überlegte Parihm. »Bevor die Al’Anfaner uns bemerken würden.«
»Eine oder zwei Stunden könnten reichen.«
Haggam stöhnte unartikuliert. Er lag in einem großen Bett, das sie aus einer Villa geraubt hatten, die unvorsichtig nah am Meer gebaut war. Die Bewohner hatten nicht den Mut des Löwen besessen, der als Schnitzerei das Kopfende zierte. Sie waren sofort geflohen, sodass die Piraten das Anwesen in aller Ruhe hatten plündern können.
»Wenn wir ihn einfach nur auf die Mole legen, halten sie ihn für einen Bettler und werfen ihn ins Wasser«, meinte Parihm.
»Dann müssen wir ihm einen Beutel mit Münzen mitgeben«, schlug Ohnnam vor.
Parihm lächelte auf diese herablassende Art, die Ohnnam so hasste. Das bedeutete, dass sie der Halborkin jetzt wieder genüsslich auseinandersetzen würde, wie dumm sie war. »Na klar«, begann die Steuerfrau, »wenn du einen wehrlosen Mann irgendwo herumliegen sehen würdest, der ein Vermögen bei sich hat – den brächtest du sofort zu einem Medikus, dem du dann getreulich die Münzen in die Hand drücken würdest, was? Weil du ja so herzensgut bist. Deswegen hast du es auch zur Bootsfrau gebracht. Das hier«, sie fasste an die Peitsche, die an Ohnnams Gürtel hing, »ist ja nur zur Zierde da. Aber ich muss dich enttäuschen.« Sie legte eine Hand auf Ohnnams Schulter. »Es gibt auch böse Menschen in der Welt. Das sind sogar die meisten. Die würden das Silber einstecken und den Besitzer verschwinden lassen. Ganz einfach.«
Die Aussicht, dass Haggam sterben könnte, störte Ohnnam nicht besonders. Aber sie ärgerte sich über ihre Dummheit. Betreten sah sie den Kranken an. Es gab wohl kein leichteres Opfer für einen Straßenräuber als ihn.
Parihm ließ ihre Schulter los. »Wir müssten ihn bis zu dem Heiler bringen. Und wenigstens einer von uns müsste bei ihm bleiben, bis er gesund wäre. Das kann Wochen dauern. Wenn es überhaupt gelingt.«
Der süßliche Gestank verursachte ein flaues Gefühl in Ohnnams Magen. Haggam war wirklich mehr tot als lebendig.
»Und mit denjenigen, die bei ihm bleiben müssten, meine ich dich oder mich«, sagte Parihm eindringlich. »Oder traust du irgendwem aus der Mannschaft so weit, dass er die Münzen nicht mit dem Heiler teilen würde, der sich dann die Arbeit sparen dürfte?«
»Fjodder vielleicht«, überlegte Ohnnam.
Parihm schnaubte verächtlich. »Da kannst du das Silber gleich dem erstbesten Bettler schenken.«
Dagegen ließ sich nichts anbringen. Der Bornländer hatte seine Einfalt allzu oft unter Beweis gestellt.
»Wenn es dumm läuft«, sagte Parihm, »nimmt der Heiler das Silber und er verreckt trotzdem. Und die Goldhaken könnten wir obendrein verlieren.«
Ohnnam wischte den Speichel von ihrem Kinn. Was Parihm da erklärte, gefiel ihr nicht. Und wenn sie sich aufregte, sabberte sie. Unter Orks war das nicht ungewöhnlich, aber Menschen wussten das nicht richtig zu deuten. »Ich will das Schiff aber nicht verlieren.«
»Ich auch nicht«, stimmte Parihm zu. »Erst recht nicht für jemanden, der schon tot ist.« Sie sah auf den Kapitän hinab.
Er drehte den Kopf auf dem Kissen hin und her, als wollte er den Seegang ausgleichen.
»Und wenn wir einfach weiterfahren?«, schlug Ohnnam vor. »Um Kap Brabak herum, und dann hoch nach Drôl, wie wir es vorgehabt haben? Wir könnten sagen, dass wir das Gebrabbel des Kapitäns nicht verstanden haben. Dann führen wir nur seinen letzten Befehl aus.«
Unter dem Stirnband mit den Runen legte sich Parihms Stirn in nachdenkliche Falten. »Aber wenn ihn einer aus der Mannschaft hört?« Langsam schüttelte sie den Kopf. »Das könnte sie aufbringen. Es gibt zu viele an Bord, die ihn mögen. Einigen hat er den Arsch gerettet, wenn es hart auf hart ging.«
Ohnnam grunzte zustimmend.
»Kap Brabak ist meistens stürmisch«, murmelte Parihm. »Das wird eine Qual für ihn … Besser, er müsste das nicht mehr durchmachen.«
»Für wen wäre das besser?«, fragte Ohnnam. »Für ihn oder für dich?«
Parihm blickte ihr erst forschend in die Augen, grinste dann aber. »Ach komm schon! Wir beide können die Goldhaken so steuern, dass sie unsere Taschen füllt.«
»Zusammen?«
»Auf jedem Schiff kann es nur eine Kapitänin geben«, grollte Parihm.
Ohnnam erkannte, dass sie jetzt besser nicht zu weit ging. Beschwichtigend hob sie die Hände. »Du stehst im Rang über mir.«
Parihm nickte. »Deswegen trage ich die Verantwortung. Und ich sage: Statt unseren Kapitän Haggam in seinen letzten Stunden zu quälen, gönnen wir ihm ein paar schöne Träume.« Sie öffnete ihre Gürteltasche und holte einen Flaschenkürbis heraus, so klein, dass man ihn zwischen Daumen und Zeigefinger halten konnte.
»Ist das dieses Traumgift mit dem unaussprechlichen Namen?« Ohnnam glaubte, ein solches Gefäß bei einem der Wilden gesehen zu haben.
»Kekeyatonba«, bestätigte Parihm. »Doswin war sehr deutlich, als er davor gewarnt hat, mehr als ein paar Tropfen davon zu nehmen.«
»Hei…ler«, stöhnte Haggam.
Die beiden Frauen sahen auf sein bleiches Gesicht hinab. Er trug noch immer den ledernen Kragen, der so eng um seinen Hals lag. Während einer Ohnmacht hatten sie diesen Schutz entfernt, um ihn am ganzen Körper zu waschen. Nachdem er erwacht war, hatte er unartikuliert geschrien, bis ihm Arime, die ihn als Erste gehört hatte, die eigenwillige Panzerung wieder angelegt hatte.
Parihm zog den aus grauer Spinnenseide gedrehten Stopfen aus dem Hals des Flaschenkürbisses. »Halt seinen Mund auf.«
Ohnnam drückte die Pranke auf Haggams Nase, sodass er den Mund öffnen musste, um Luft zu holen.
Die Steuerfrau goss die irisierend weiße Flüssigkeit hinein.
Kap Brabak,
dreizehnter Tag im Schlachtmond, vor einunddreißig Jahren
Die Blasshäute waren ausgelassener Stimmung. Sie tanzten über das Deck des Schiffs, wobei sie sich aneinander festhielten und in engen Kreisen drehten. Auf dem Dach des Heckaufbaus saßen drei Matrosen im Sonnenschein und spielten auf Instrumenten, von denen Irulla nur die Flöte kannte. Die anderen beiden ähnelten großen Flaschenkürbissen, über die Fäden längs gespannt waren. Die Männer zupften an diesen Fäden, was die Töne erzeugte.
»Laute.« Ohnnam zeigte auf die Instrumente.
So hieß die Büffelfrau mit dem Silberzahn in der Lippe: Ohnnam. Sie brachte Irulla Wörter in der Sprache der Blasshäute bei. Deswegen wusste das Mädchen nun, dass man die schwimmende Hütte Schiff nannte und die Mottenflügel, in die der Wind griff, Segel. Die glatten Baumstämme waren Masten. Ohnnam war eine Bootsfrau und zugleich eine Steuerfrau. Immer, wenn sie das sagte, lachte sie zufrieden.
Sie tanzte nicht. Stattdessen saß sie auf der Reling neben einer offenen Kiste, aus der sie ein weiteres Kleid nahm und dem Mädchen hinhielt.
Irulla überlegte, ob es ihr gelingen konnte, Ohnnam ins Wasser zu stoßen, wenn sie ihr beide Hände gegen die Brust rammte. Aber die Büffelfrau war sehr massig, vielleicht reichte Irullas Kraft dafür nicht aus. Außerdem mochte die Büffelfrau sie im Fallen packen und mit sich hinabreißen. Und man starb nicht sofort, wenn man ins Wasser fiel. Wenn die Nachtschwarze Herrin Ohnnam nicht sogleich ertränkte, könnten ihre Freunde sie wieder herausziehen. Irulla dagegen würde niemand helfen, die anderen Keke-Wanaq waren im Laderaum.
Außerdem war Ohnnam heute nicht gemein zu Irulla. Sie ließ das Mädchen keine Kleider anziehen, weil sie es hässlich gefunden hätte. Es gehörte einfach zu den Sitten der Blasshäute, sich zu verhüllen. Das taten sie alle.