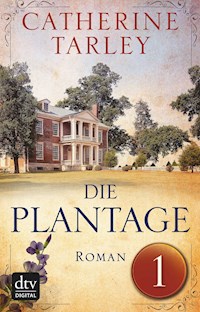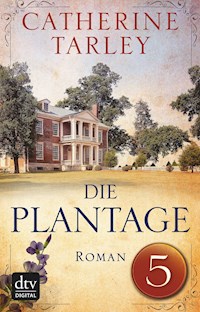1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das zweite eSequel des Bestsellers Das große Südstaatenepos als eSequel in 5 Teilen. South Carolina 1783, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die junge Witwe Antonia Lorimer lebt alleine auf ihrer vom Krieg beschädigten Plantage Legacy. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Plantage wieder instand zu setzen und einen schwer verwundeten britischen Colonel gesund zu pflegen: William Marshall. Dass in den Kriegswirren ausgerechnet er ihren Mann Henry erschossen hat, weiß die junge Frau nicht und verliebt sich in den Colonel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Teil 2
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Emily und Colin
III. Henry Lorimer
9.
Wegen der hochsommerlichen Temperaturen erstieg Theodore Hocksley mit gebremstem Schwung die Eingangsstufen der Trader’s Bank. Das Gründerhaus an der geschäftigen Kreuzung von Broad und Meeting Street stand Tür an Tür mit den Kontoren der Pflanzerbarone Carolinas, im Zentrum des wirtschaftlich bedeutsamen Dreiecks, das von Charles Towns Handelsvereinigung, dem Planters Club sowie dem Exchange and Custom House gebildet wurde. Die Traders’s Bank, Hocksleys Hausbank, war mit dem Sklavenhandel eines halben Jahrhunderts groß geworden. Noch heute unterhielt sie auf der Südroute eine eigene Flotte, die die Westindischen Inseln mit schwarzen Sklaven von der Elfenbeinküste belieferte. So hatte Trader’s auch in den schwierigen Zeiten des Krieges Profite gemacht, während andere Häuser untergingen. Nur das Finanzhaus Ashley & Bolton konnte mit Trader’s konkurrieren.
Hocksley hatte den stellvertretenden Direktor der Trader’s Bank, seinen langjährigen Freund James Fowler, um ein Gespräch unter vier Augen gebeten. In Fowlers Büro empörte sich Hocksley über die Besatzungspolitik der Engländer.
Im Frühjahr 1780 hatte die britische Invasionsarmee den Süden erneut angegriffen. Vor dem vereinten Heer der Generale Sir Clinton und Lord Cornwallis war die Kontinentalarmee mit den örtlichen Milizen über den Cooper River nach Norden geflohen. Ohne auf nennenswerte Gegenwehr zu treffen, unterwarfen die britischen Truppen den Lowcountry und riegelten den Zugang zur Hauptstadt ab, indem sie eine Belagerungslinie von Edisto Island über Ashley und Cooper River bis Georgetown kontrollierten. Am 11. Mai 1780 unterschrieb General Lincoln die Kapitulation, Charles Town war eine besetzte Stadt.
»Cornwallis’ Truppen verwüsten die Plantagen und vertreiben die Pächter«, ereiferte sich Hocksley. »Und unsere Sklaven fliehen in Scharen, um sich ihren englischen ›Befreiern‹ anzuschließen.«
Auch Prospero Hill war betroffen. Die verbliebenen Sklaven mussten die Arbeit der Entflohenen miterfüllen, doch sie waren der Belastung nicht gewachsen, Qualitätsverluste und Ertragsrückgang waren die Folge. Aber gerade jetzt, im Erntemonat Juli, konnte Hocksley es sich nicht leisten, mit der Produktion seiner Baumwolle in Rückstand zu geraten, kauften doch die Lieferanten beider Armeen, Briten und Amerikaner, ihre Rohstoffe bei seinen Kommissionären.
»Um weiter im Geschäft zu bleiben, brauche ich neue Sklaven!«
»Wo ist das Problem?«, fragte Fowler. »Kaufen Sie welche.«
Hocksley schnaubte: »Sie wissen so gut wie ich, dass die Händler die Preise für Plantagensklaven nahezu verdoppelt haben. Und ich habe keine Lust, absurd hohe Fangprämien an Sklavenjäger zu bezahlen oder gar an die Briten, die unsere übergelaufenen Sklaven inzwischen als Kriegsbeute für teures Geld verkaufen. Nein, James, ich will Ihnen ein lukrativeres Geschäft vorschlagen.«
»Lukrativ?« Der Bankier hob die Brauen. »Inwiefern?«
»Nehmen wir an, Sie kaufen von der Handelsagentur Ihrer Bank vierzig Sklaven. Als Direktor von Trader’s würde man Ihnen ein gutes Angebot machen, maximal fünfundzwanzig Prozent über dem Vorkriegspreis. Zu diesem Preis nun verkaufen Sie die Sklaven an mich. Dafür verpflichte ich mich, nach Kriegsende meine Überproduktion an Baumwolle zwei Jahre lang zum halben Marktpreis an Ihre Kommissionäre zu verkaufen … Natürlich bleibt das unter uns.«
Fowler schwieg mit düsterer Miene.
»Warum so zugeknöpft?«, fragte Hocksley. »Ich erinnere mich an Gelegenheiten, da sind Sie mir bereitwilliger entgegengekommen.«
»Ich bitte Sie, Theodore!«, verwahrte sich Fowler. »Verwechseln Sie kleine Gefälligkeiten unter Freunden nicht mit meinen Geschäftsentscheidungen für die Bank. Trader’s vertritt amerikanische Investoren. Daher werde ich keine Spekulationen auf den Ausgang eines Krieges befürworten, in dem unsere eigenen Landsleute den Feind mit Handelsgütern unterstützen – Sie nehmen das bitte nicht persönlich!« Unvermittelt setzte er in privatem Ton hinzu: »Ehe ich es vergesse: Wir bitten am Donnerstag unsere engsten Freunde zum Dinner. Würden Sie und Diane uns die Ehre geben?«
Hocksley hatte das Gespräch mit höflichen Belanglosigkeiten beendet. Nun stand er verärgert vor dem Portal, schwitzend unter der Julisonne in seinem teuren Rock. Wegen Fowlers feiger Absage war er in der Sache nicht weitergekommen. Doch wenn er keine billigen Arbeitskräfte fand, würde er an diesem Krieg nichts mehr verdienen. Vielleicht sollte er versuchen, im Planters Club in Erfahrung zu bringen, wie die anderen Pflanzer ihr Sklavenproblem lösten? Kaum hatte er den Entschluss gefasst, sah er Henry Lorimer den Platz überqueren. Eilends lief er die Freitreppe hinunter.
»Hallo, Lorimer, wie geht es Ihnen?«, tönte er zur Begrüßung. »Kommen Sie, begleiten Sie mich zum Essen in den Club.«
Henry winkte ab, die Vorstellung, mit seinem Schwager den Planters Club aufzusuchen, behagte ihm ganz und gar nicht.
»Danke, Hocksley, wie Sie sehen, bin ich nicht passend gekleidet. Ich möchte die Anwesenden nicht in Verlegenheit bringen durch den Anblick eines Mannes in schmutzigen Stiefeln.«
»Aber ich bitte Sie! Dann suchen wir uns eben eine zwanglosere Umgebung. Was halten Sie vom Southern Sun Inn, unten bei den Piers?«
Er wandte sich nach Osten, dem Viertel mit volkstümlichen Schänken am Hafen zu, und zog Henry ohne Umstände mit.
Nach allem, was vorgefallen war, gab es zwischen ihnen keinerlei Sympathien. Doch Henry betrachtete die Dinge leidenschaftslos. Er erwartete sich nichts von den Menschen, dafür war er zu klug, infolge seiner puritanischen Erziehung vielleicht auch zu selbstgerecht. In jungen Jahren hatte er sich hohe Ziele gesteckt, in den Bostoner Salons die Nähe zur amerikanischen Intelligenzija gesucht und später Philosophie und Ökonomie an der Harvard University studiert. Der Ruf an das neu gegründete College von Charles Town verschaffte ihm einen Lehrstuhl für Philosophie und befriedigte fürs Erste seinen intellektuellen Ehrgeiz. In den Kreisen der verwöhnten Jugend Carolinas fand der junge Gelehrte viele Bewunderer, darunter Antonia Bell, deren aufgeklärte Ansichten sie in Henrys Augen wohltuend von den wenig gebildeten Frauen ihres Standes unterschieden. Besonders beeindruckte ihn, dass sie, getreu ihrer liberalen Geisteshaltung, die Sklaven ihrer Plantage freigelassen hatte. Bald heiratete er sie, und als neuer Herr auf Legacy versuchte er sich erstmals als Pflanzer.
Die Gegebenheiten dort kamen seinen sozialromantischen Vorstellungen entgegen. Um das Land ohne Ausbeutung von Sklavenarbeit zu bewirtschaften, beschäftigte er freie Schwarze neben weißen Landarbeitern und zahlte allen den gleichen Lohn. So brachte er in kürzester Zeit die Großgrundbesitzer der Region gegen sich auf, deren riesige Monokulturen, so auch Hocksleys Prospero Hill, von Sklavenarbeit abhängig waren. Schon früher wurden auf einzelnen Plantagen Sklaven freigelassen. Das führte mitunter zu Unruhen bei den Unfreien der umliegenden Besitzungen. Einmal kam es sogar zu einer echten Revolte. Die Erinnerung an den Stono-Aufstand war allenthalben noch frisch.
Natürlich war Henry für die etablierten Grundherren kein Konkurrent. Doch weil sein Konzept das Gesellschaftssystem der Kolonie gefährdete, wollte man ihn loswerden. Der einfachste Weg war ein Boykott seiner Waren. Hocksley gelang es, den einflussreichen Planters Club und die örtlichen Handelsvereinigungen davon zu überzeugen, Lorimers Produkte vom Handel an den Warenbörsen auszuschließen, war es doch unter der Würde der Reis- und Baumwollkommissionäre, über Preise für Obst und Gemüse nachzudenken.
Hocksley hielt seinen Schwager für einen Narren, der eine schöne Plantage ruinierte, indem er teure Lohnarbeiter beschäftigte und für ein akademisches Experiment das Vermögen seiner Frau aufs Spiel setzte. In einem Punkt stimmte Henry ihm zu: Es war ihm nicht gelungen, seinen Platz im konservativen Gefüge der Südstaaten zu finden. Zu spät hatte er erkannt, wie wichtig Familientraditionen waren, um sich in der Pflanzergesellschaft zu behaupten. So sah er sich weniger als ein Opfer seiner wirtschaftlich überlegenen Umgebung denn seiner Selbstüberschätzung. Er hätte sich nie auf den Süden einlassen sollen.
Sie fanden einen Tisch in einer holzgetäfelten Fensternische des zu dieser Stunde gut besuchten Southern Sun Inn. Hocksley bestellte Wein und Brot, gebratene Krebse und Austern, Okra und Grits. Dann kam er ohne Umschweife zur Sache: »Ich weiß, dass Sie am Ende sind, Lorimer. Der Ausschluss aus dem Handelsverein hat Ihnen das Genick gebrochen, es ist absehbar, wann Legacy unter den Hammer kommt. Ich will jedoch keine solche Blamage in meinem nächsten Wirkungskreis. Deshalb mache ich Ihnen einen Vorschlag, den Sie nicht ablehnen können.«
Eine junge Mulattin brachte den Wein. Hocksley schenkte ein und trank seinem Gast zu. Henry drehte schweigsam sein Glas in der Hand, den Blick auf die von anstößigen Schnitzereien bedeckte Tischplatte gesenkt. Er wusste, er müsste aufstehen und gehen, bevor Hocksley mit einem schäbigen Vorschlag seine Ehre beschmutzte. Es war die letzte Gelegenheit, seine Seele zu retten. Doch er ließ sie verstreichen, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und bedeutete Hocksley fortzufahren.
»Sie wissen, Lorimer, uns laufen die Sklaven davon, um bei den Engländern unterzukriechen. Allen Pflanzern entstehen dadurch erhebliche Verluste, Lieferverzug, Ausfallschäden – keine Sorge, ich werde Sie nicht mit Details langweilen. Was ich Ihnen erklären möchte, ist, dass die meisten Grundbesitzer es sich etwas kosten lassen würden, wenn sie ihre Sklaven zurückbekämen.« Henry schenkte sich schweigend nach und trank. Also fuhr Hocksley fort: »Sehen Sie sich die Loyalisten an. Sie kämpfen auf Seiten der Briten gegen uns, aber die meisten sind Pflanzer wie wir und betrachten es als ihre Pflicht, übergelaufene Sklaven aufzugreifen und den Eigentümern zurückzubringen; gegen einen vernünftigen Rückkaufpreis, versteht sich. Ich denke, ein entschlossener Mann mit den richtigen Verbindungen könnte hier gute Geschäfte machen. Was meinen Sie? – Ah, unser Essen!«
Das Mädchen brachte alle Gerichte auf einmal. Hocksley aß genüsslich von den scharf gewürzten Speisen und bemerkte zwischendurch: »Greifen Sie zu, mein Freund, das weckt die Lebensgeister!«
Henry ignorierte das Essen, schenkte sich aber noch ein Glas Wein ein. »Gemeinhin nennt man Leute, die diese Art Geschäfte betreiben, Sklavenhändler«, bemerkte er leise, während Hocksley ungerührt weiteraß. »Wenn aber jemand diese Geschäfte im Krieg betreibt und sich um des Profits willen auf die Seite des Gegners schlägt, wie nennen Sie so jemanden, Hocksley? Verräter?« Er trank sein Glas aus und goss sich gleich wieder nach.
Hocksley tupfte mit dem Schnupftuch das Fett von seinen manikürten Händen. »Sie trinken zu viel, Lorimer. Und Sie sitzen auf einem ziemlich hohen Ross. Sie sollten froh sein, wenn Sie die Chance bekommen, Ihre Schande wieder wettzumachen.«
»Schande, Sir?«
»Ja, Schande!«, rief Hocksley voller Verachtung. »Es bringt nun einmal Schande über einen Mann, wenn er das Vermögen seiner Frau durchbringt, wenn er seine Geschäfte dilettantisch führt, ruinöse Wettschulden anhäuft und die übrige Zeit wirren Utopien nachhängt! Die Party ist zu Ende, Mr. Lorimer. Es wird Zeit, dass Sie etwas unternehmen. Die Familie Ihrer Frau will nicht am Schluss die Zeche zahlen!«
Henry war getroffen, solcher Vorwurf wog schwerer als alle persönlichen Misserfolge. Das Schlimmste war, Hocksley hatte recht. Henry hatte der Verantwortung gegenüber seiner Frau nicht genügt. Antonia hatte sich mit Hab und Gut seinen Idealen verschrieben. Ihr Haus stand seinen Freunden und Studenten offen, ihre Bibliothek wurde zum Treffpunkt von Leuten, die sich zur Reform der amerikanischen Gesellschaft bekannten. Doch mit der Zeit verlor sich der Idealismus, das Debattieren wurde mehr und mehr Selbstzweck. Skandalträchtige Feste und einige Affronts gegen das Establishment zogen Antonias Ruf in Mitleidenschaft. Es war Henry längst klar, dass sie ihre eigenen menschenfreundlichen Ziele ohne sein Zutun besser hätte verwirklichen können. In ihrer pragmatischen Art hatte sie begonnen, aus Legacy eine gemeinsame Lebensgrundlage für sich und ihre freien Landarbeiter zu machen. Doch ihr schöner, schlichter Ansatz war verdorben, weil er seinen akademischen Anspruch nach universaler Gültigkeit verfolgte. Am Ende war nichts von Bestand, er verlor seinen Lehrstuhl, die freie Gesellschaft der »Selbsternannten Philosophen« löste sich auf, Legacy verfiel. Seine Situation war mehr als verzweifelt, und darüber war Hocksley präzise im Bilde.
»Wenn ich Ihren Vorschlag annehme«, hörte er sich fragen, »Was springt am Ende für mich dabei heraus?«
Es kostete Hocksley sichtlich Mühe, sich das Hochgefühl seines Triumphs nicht anmerken zu lassen.
»Hören Sie, Lorimer, gehen Sie nach Hause und schlafen Sie sich erst einmal aus. Morgen Punkt neun Uhr erwarte ich Sie in meinem Büro.«
Er legte Geld für Essen und Wein auf den Tisch und ging.
Henry rief nach der Mulattin und bestellte eine Flasche von dem starken karibischen Rum, für den das Southern Sun Inn bekannt war.
10.
Als Henry am anderen Morgen zur Halle hinunterging, hörte er durch die angelehnte Tür des Speisezimmers, wie Antonia vor ihrer schwarzen Köchin Charlene geduldig die Haushaltsausgaben für die kommende Woche rechtfertigte. Er blieb am Treppenabsatz stehen und überlegte, ob er unbemerkt das Haus verlassen konnte, in das er zu nachtschlafender Zeit zurückgekehrt war, und das in einem Zustand, den er seiner Frau nicht hätte zumuten wollen. Als Joshua die Eingangshalle betrat, lief Henry die restlichen Stufen zur Halle hinunter und bedeutete ihm wortlos, ihm nach draußen zu folgen. Er ließ sofort anspannen, kurz darauf waren sie auf dem Weg nach Prospero Hill. Henry lehnte in den Polstern des Landauers und ließ den vergangenen Abend Revue passieren.
Die Flasche Rum und die süße Gegenwart des Mädchens hatten ihn bewogen, sie für ein paar Stunden Vergnügen zu kaufen, und die Mulattin nahm ihn mit zu der schmalen Kammer im oberen Stock.
Als er den Wirt später für die Dienste der kleinen Sklavin bezahlte, hatte sich das Publikum im Southern Sun Inn auffallend verändert. Junge Stutzer mit ihren Mädchen mischten sich unter die Arbeiter von den Piers. Seeleute waren da und Soldaten mit ihren Liebchen. In den überhitzten Räumen wurde gespielt und getrunken. An einem improvisierten Spieltisch im hinteren Teil des Lokals erkannte Henry einen jungen Mann, der früher mit seinen Studenten nach Legacy gekommen war. Er hieß Oliver Roscoe, Henry hatte ihn zuletzt vor Monaten beim Pferderennen gesehen. Roscoe hatte sich von ihm Geld für Wettschulden geliehen, die Summe aber nie zurückgezahlt. Jetzt hatte er Henry entdeckt.
»Lorimer!«, rief er quer durch den Schankraum. »Hey, Lorimer, was hat Sie hierher verschlagen? Kommen Sie herüber!«
Roscoe war Kreole und sah ungewöhnlich gut aus, etwas feminin mit wimpernbeschatteten Augen und feinem Teint. Es hieß allerdings, er neige zu Brutalität. Als Henry sich nun einen Weg zwischen den Tischen hindurch zu den Kartenspielern bahnte, wusste er nicht recht, ob ihm daran lag, bei ihrer früheren Freundschaft anzuknüpfen. Roscoe aber zog ihn ungezwungen heran und präsentierte ihn den anderen Herren und ihren Begleiterinnen.
»Gentlemen, Ladies: Mein Freund Henry Lorimer«, sprach er in eigentümlich schleppendem Tonfall. »Ich wette, Sie erinnern sich an den Mann, der es wagte, den Planters Club herauszufordern …«
»Lassen Sie es gut sein, Roscoe, um Gottes willen!«, wehrte Henry sofort ab. »Können wir diesen Teil der Geschichte nicht überspringen?«
»Sie haben recht, mein Freund. Trinken wir lieber.«
Die Gesellschaft hatte das Spiel wieder aufgenommen, während Roscoe am Tisch zwei Gläser mit dunklem Rum füllte und Henry eins davon in die Hand gab. Das andere Glas hob er kurz an und trank es aus, bevor Henry seines überhaupt an die Lippen führen konnte. Während Roscoe sich einen neuen Drink einschenkte, erhob sich ein paar Plätze weiter ein vornehm gekleideter Mann und kam zu ihnen herüber.
»Gestatten Sie, Sir, dass ich mich vorstelle? Algernon Reed, aus Richmond in Virginia. Mr. Roscoe hat mir von Ihrem Salon erzählt.«
Roscoe reichte Reed ganz selbstverständlich sein Glas, aus dem er soeben getrunken hatte, und wandte sich an Henry: »Sagen Sie ihm, dass ich nicht nur wegen der Parties zu Ihnen kam, Lorimer.«
»Mr. Roscoe war der Jüngste in unserem Kreis«, tat Henry ihm den Gefallen. »Meine Studenten vom College brachten ihn mit. Anfangs wurde noch ernsthaft über die Zukunft Amerikas diskutiert. Die Parties kamen später.«
»Ihr Zirkel hatte einen gewissen Ruf«, sagte Reed.
Henry winkte bescheiden ab. »Es war ein Debattierclub.«
»Auf hohem Niveau. Es heißt, intellektuelle Prominenz kam in Ihr Haus?«
»Das stimmt. Ein paar unserer besten Männer waren auf Legacy zu Gast, Rutledge, der junge Drayton, Julien Longuinius. Auch Ben Franklin und Alexander Hamilton kamen aus Philadelphia zu uns.« Henry wirkte plötzlich ernüchtert. »Tja, Mr. Reed, die Sache hatte sich irgendwann überlebt. Der Zirkel von Legacy ist Geschichte.«
»Schade. Es müssen inspirierende Zusammenkünfte gewesen sein. Selbst für unseren Freund Roscoe!«
Roscoe ignorierte die Beleidigung und trank unbeteiligt seinen Rum. Er lebte auf anderer Leute Kosten, das war bekannt. Zurzeit lebte er offenbar auf Reeds Kosten. Er nahm den Zynismus seines Gönners teilnahmslos hin, fast beneidete Henry ihn um seine Gleichgültigkeit.
»Meine Herren, wir sollten die Umgebung wechseln«, entschied Reed, rief den Wirt und bezahlte ihre Drinks. Roscoe holte die Hüte und Stöcke, und Henry verließ mit den beiden Freunden das Southern Sun Inn. Er wusste, dass Antonia ihn seit Stunden zurückerwartete. Er sollte den Wagen in Lyndon House abholen und heimfahren.
Als er sich verabschieden wollte, tat Reed überrascht: »Sie wollen doch jetzt nicht nach Hause?«
Henry zögerte.
Was Reed nicht entging. »Mr. Roscoe und ich werden noch etwas unternehmen in dieser wundervollen Nacht«, sagte er und legte seinem Freund einen Arm um die Schulter. »Was hielten Sie davon, sich uns anzuschließen, Mr. Lorimer?«
»Kommt darauf an«, sagte Henry vage.
»Ausgezeichnet!« Reed lächelte. »Gentlemen, wir werden Mrs. Harper besuchen.« Mrs. Harper betrieb das teuerste Bordell der Stadt.
»Tut mir leid, Mr. Reed«, sagte Henry, »ich bin inzwischen ein armer Mann.«
»Ihre Offenheit ist rührend, Lorimer«, bemerkte Roscoe. »Aber es ist Algernons Abend, Sie können es ihm nicht abschlagen.«
»Mr. Roscoe hat recht«, meinte Reed, »Sie sind mein Gast.«
Mrs. Harpers Champagner war gut, und es wurden mehr Flaschen geöffnet, als sie trinken konnten, Reed kam es nicht darauf an. Die Huren von Mrs. Harper hatten professionelle Klasse, sie waren sehr hübsch, verschwiegen und nicht dumm. Sie bedienten die Männer mit exquisiter Liebestechnik, mit Unterwürfigkeit oder Wollust. Für gutes Geld täuschten sie Verlangen und Hingabe vor und ließen keine Wünsche offen.
Reed und Roscoe kamen oft zu Mrs. Harper, immer zusammen. Sie nahmen Henry mit auf ein Zimmer ganz aus rotem Samt, mit einem großen Bett in der Mitte. Die Huren kamen und begannen, sie auszuziehen. Henry hatte nichts dagegen, die Frauen waren geschickt, und die Gegenwart der beiden Männer störte ihn nicht. Reed und Roscoe schienen die Mädchen kaum zu beachten. Sie waren sich selbst genug, lagen beieinander und umarmten sich. Als Henry bemerkte, wie sie sich anfassten und küssten, wollte er sich abwenden, aber es erregte ihn auch, ihnen zuzusehen. Erst als Roscoe sich auch ihm zuwandte, flüchtete er. Die beiden Freunde vermissten ihn nicht. Sie teilten sich die Huren und das Bett und blieben die ganze Nacht zusammen.
Henry war in den Salon zurückgekehrt, er trank noch mehr Champagner. Was Roscoe und Reed taten, war ihre Sache. Ihm hatte die kleine Mulattin am Nachmittag vollauf genügt. Wenn er sein Glas ausgetrunken hätte, würde er nach Hause fahren. Doch Mrs. Harper ließ ihn nicht gehen. Sie führte ihn in ein schwarzes Zimmer. Eine Frau mit Katzenaugen kam herein, mit seidenfeinem Haar, und legte sich zu ihm. Sie trug schwarze Spitze, sie trug sie bis zuletzt. Er griff nach ihr, zog sie unter sich und drang in sie ein. Aber sie lachte nur über seine stumpfe Gier, schob ihn von sich herunter, drehte ihn auf den Rücken und hielt ihn so. Sie ließ sich Zeit, strich ihm durchs Haar und küsste ihn. Wie nie zuvor fühlte er seinen Körper unter ihren Händen, in ihrem Mund. Als er den Gipfel der Lust erreichte, ließ sie sich zurücksinken und ihn in sich kommen.
Nie hatte er besseren Sex. Später in der Nacht fiel ihm die Begegnung mit Hocksley wieder ein. Er erinnerte sich an keine Einzelheiten, nur an ein undeutliches Gefühl von Scham und Selbstmitleid. Doch das war nun vorbei. Er lag in einem seidenen Bett, mit einer wunderschönen Frau, und all sein Begehren war befriedigt. Er wollte sich nicht mehr verachten.
»Sie sehen ziemlich mitgenommen aus, wenn ich das sagen darf.« Joshua hatte den Landauer auf der Zufahrt von Prospero Hill angehalten und stand kopfschüttelnd am Wagenschlag. »Was haben Sie nur gemacht?«
»Was schon? Getrunken.« Henry strich nachlässig sein Haar zurück. »Und ich war mit ein paar Freunden in diesem Haus in der Water Street … Komm schon, Josh, mach nicht so ein ernstes Gesicht! Du bist auch ein Mann.«
»Aber Sie sind ein Gentleman! Was Sie auch immer tun, Sie dürfen nicht die Haltung verlieren – verzeihen Sie, Sir.«
»Schon gut.«
Henry blickte über die weite Ebene des Lowcountry. Zwischen den Reisfeldern glitzerten die Gezeitenflüsse des Plains und Cooper River unter der Sommerglut. Warum bin ich nur hierhergekommen?, fragte er sich, müde in den Fond seines eleganten Wagens gelehnt. Doch die Frage war müßig, zumindest hätte er sie sich früher stellen und den Süden verlassen sollen, nachdem ihn das College nicht mehr unterrichten ließ. Vielleicht wäre ja Antonia damals mit ihm gekommen. Doch jetzt war es zu spät. Er konnte nur versuchen, ihre Plantage zu retten, indem er tat, was Hocksley von ihm verlangte. Er hatte keine andere Wahl.
»Alle werden mich verachten«, sagte er leise.
»Ich werde Sie niemals verachten!«, widersprach Joshua, der Henrys düstere Worte seiner angeschlagenen Verfassung zuschrieb.
»Du vielleicht nicht, Josh.« Henry lächelte traurig. »Jetzt lass uns weiterfahren. Ich möchte es hinter mich bringen.«
Der Wagen hielt vor dem großen Haus. Um Henrys Ankunft Würde zu verleihen, riss Joshua den Schlag auf und verneigte sich tief. Henry schritt durch den Säulengang und die Tür aus rotem Zedernholz, die ein Sklave in Livree für ihn offen hielt.
Prospero Hill deprimierte ihn jedes Mal aufs Neue. Das überladene Dekor, das Hocksleys Reichtum zur Schau stellte, war seinem puritanischen Geschmack zuwider. Die eigentliche Ursache für sein Unbehagen aber war weitaus konkreter: Es war das Wissen um das unwandelbare Los jener, die für die Prunksucht der Hocksleys tagein, tagaus hart arbeiten mussten und bei geringsten Verfehlungen schwer geschunden wurden.
Um den afrikanischen Leibeigenen Gehorsam und Disziplin beizubringen, machten Sklavenhalter wie Hocksley sich nicht selber die Hände schmutzig, sie brachten sie ins Work House, ein Zuchthaus am Stadtrand von Charles Town, und ließen sie gegen Bezahlung auspeitschen. Die Prügelknechte des Work House wussten die Bestrafung möglichst schmerzhaft zu machen, ohne die Leistungsfähigkeit der Sklaven auf Dauer einzuschränken.
Als Henry die verschlossenen Mienen der Schwarzen sah, flog ihn eine so starke Beklommenheit an, dass er sich zwingen musste, nicht unverrichteter Dinge wieder umzukehren.
»Sie sind tatsächlich pünktlich, Lorimer.« Hocksley sah von seinem Schreibtisch kaum auf, während er mit der Erledigung seiner Korrespondenz fortfuhr. Schließlich läutete er nach einem Diener und übergab ihm die Briefschaften. Erst jetzt bot er seinem Schwager einen Stuhl an. Es befriedigte ihn, Henry so erniedrigt zu sehen und ihn nach seiner geschäftlichen Niederlage nun auch persönlich seiner Willkür ausgeliefert zu wissen. Dennoch konnte er den Moment nicht so auskosten wie erhofft. Er spürte, dass sein Triumph nicht vollkommen war, und der Unmut darüber nagte an seiner neidischen Seele.
In Wirklichkeit hatte er durch Henrys Demütigung Antonia treffen wollen, diesen Snob, die seit jeher voll intellektuellen Hochmuts auf ihn herabsah. Theodore Hocksley war Ende zwanzig gewesen, als er dem Kontor ihres Vaters Robert Bell vorstand. Seine Beflissenheit und seine Durchsetzungsfähigkeit verschafften ihm Bells Wohlwollen, seine Untergebenen hingegen lernten, ihn zu hassen. Mit der Zeit wurde Hocksley die Ehre zuteil, im Familienkreis der Bells empfangen zu werden. Die beiden älteren Misses Bell gehörten zu den besten Partien Charles Towns, und Hocksley gab sich über die Maßen charmant, bis er die Gunst von Diane und Lydia Bell gewonnen hatte. In Wahrheit aber begehrte er die jüngste der Schwestern, Antonia.
Sie aber fühlte sich von Hocksley abgestoßen. Nachdem er bei einer Gelegenheit versucht hatte, sich an ihr zu vergreifen, ersann sie eine wirkungsvolle Methode, sich seiner Zudringlichkeiten zu erwehren. Wenn er fortan zu Besuch kam, führte sie ihn coram publico aufs Glatteis seiner mangelhaften Bildung. Von einem Backfisch lächerlich gemacht zu werden, hätte einen anderen beschämt, Hocksley aber war tödlich beleidigt. Ab jetzt tat er so, als übersähe er das vorlaute Mädchen, und bald heiratete er die Älteste der drei Schwestern, Diane. Im Herzen aber hegte er unversöhnlichen Hass gegen Antonia.
»Ihre Frau macht sich gewiss die größten Sorgen«, sagte er jetzt. »Ich meine, es kann Antonia nicht entgangen sein, was für einen erbärmlichen Anblick Sie bieten, mein armer Schwager.«
Henry ging auf die beleidigenden Worte nicht ein. Er hatte die Kristallkaraffen auf einem Serviertisch beim Fenster im Blick.
»Kann ich einen Drink haben?«
»Bedienen Sie sich. Sie scheinen es zu brauchen!«
Henry stand auf, schenkte sich einen Brandy ein, nahm einen großen Schluck und wartete darauf, dass die Wärme des Alkohols seinen revoltierenden Magen beruhigte.
»Wenn Sie sich an meine Instruktionen halten, wird unsere kleine Absprache für Sie wie für mich von Vorteil sein«, begann Hocksley und erklärte ihm seinen perfiden Plan. »Sie werden im Feldlager von General Cornwallis auf Silk Hope vorstellig und bekunden Ihren glühenden Eifer für die Sache König Georges und der Engländer. Damit das Ganze überzeugend wirkt, werden Sie gleich eigene Gefolgsleute mitbringen; Sie bekommen ausgesuchte Männer von meinen Besitzungen als Eskorte. Bestehen Sie unter Berufung auf Ihre gesellschaftliche Stellung auf einem höheren Offiziersrang. Sie treten standesgemäß in die Britische Armee ein, Lord Cornwallis wird Ihnen das nicht verwehren. Und lassen Sie sich nicht auf eine Erörterung Ihrer nicht vorhandenen militärischen Erfahrung ein. Das spielt in Ihrem Fall keine Rolle. Sie sollen Ihre loyalistischen Einheiten schließlich nur zur richtigen Zeit an den richtigen Ort führen, den Rest erledigen andere. Niemand wird von Ihnen Heldenmut verlangen; auch die Briten verlieren nicht gerne ihre Offiziere.«
Hocksley machte eine kurze Pause. »Kommen wir nun zu Ihrer eigentlichen Mission: Sie werden unsere entlaufenen Sklaven aufgreifen, die in den britischen Forts und Feldlagern als Hilfskräfte und Dienstpersonal arbeiten. Als Offizier der Britischen Armee haben Sie Zutritt zu jedem Lager, es sollte für Sie also nicht schwer sein, die Sklaven in gezielten Razzien gefangen zu nehmen und an vereinbarten Treffpunkten meinen Aufsehern zu übergeben. Alles Weitere geht Sie nichts mehr an. Ach ja, jede Razzia wird nach Kopfzahl entlohnt.« Er fasste Henry scharf ins Auge. »Die Sache verlangt eine gewisse Skrupellosigkeit.«
»Wenn ich Skrupel hätte, wäre ich nicht hier.«
»Klingt einleuchtend. Vielleicht habe ich Sie unterschätzt, Lorimer.«
Henry trank aus und stellte das leere Glas auf den Serviertisch. »Wann geht es los?«
»In drei Tagen. Die Männer, die Sie als Ihr Gefolge begleiten werden, kommen zum Treffpunkt an die Mündung von Plains und Cooper River. Punkt acht Uhr. Ich werde auch dort sein. Bringen Sie Ihren Kleidersack gleich mit.«
Henry salutierte ironisch und wandte sich zum Gehen.
»Und seien Sie um Gottes willen nüchtern!«, rief Hocksley ihm nach.
Auf der Rückfahrt war Henry schweigsam. Als sich der Wagen der Einfahrt von The Willows näherte, entschloss er sich spontan, Frank Shaughnessey einen Besuch abzustatten. Shaughnessey war ein Freund der Bells, er kannte Antonia seit ihrer Kindheit, und nachdem sie Henry geheiratet hatte, entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden Männern. In diesen Tagen wirkte The Willows verlassen, denn Shaughnessey hatte seine Familie kurz vor der Besetzung Charles Towns nach Barbados in Sicherheit gebracht. Die Shaughnesseys stammten von den ersten Kolonisten dieser westindischen Zuckerinsel und besaßen dort noch eine alte Pflanzung, die von einem Cousin verwaltet wurde. Shaughnessey hatte auch seine Sklaven nach Barbados geschafft und nur zwei Hausdiener behalten.
»Sie bleiben doch zum Essen?«, fragte er.
»Danke, Frank, ich habe keinen Appetit. Aber einen Brandy würde ich nehmen.«
Nachdem Shaughnessey jedem ein Glas eingeschenkt hatte, kam er auf die Kriegsberichte zu sprechen: Die Lage in den umkämpften Gebieten zwischen North und South Carolina sei prekär, General Washington rufe die örtlichen Milizen auf, verstärkt Truppenunterstützung zu leisten.
»Letzten Sonntag kam Major Marion ins Versammlungshaus nach St. James’ Parrish, um persönlich Leute für die Landwehr anzuwerben. Viele unserer Nachbarn haben sich ihm angeschlossen – Herrgott, wenn ich nur zehn Jahre jünger wäre! Was ist mit Ihnen, mein Freund, werden Sie sich melden?«
Henry zuckte nur die Schultern und schenkte sich ein zweites Glas ein.
Shaughnessey sah ihm mit gerunzelten Brauen zu. »Sagen Sie einmal, Henry, irgendetwas stimmt doch nicht mit Ihnen. Ich kenne Sie jetzt lange genug, aber in solcher Verfassung habe ich Sie noch nie gesehen.«
Henry seufzte. Er hatte gehofft, bei seinem Freund die Unterredung mit Hocksley für eine Weile vergessen zu können. Aber Shaughnesseys Rechtschaffenheit führte ihm seine fatale Lage und seinen schmählichen Abstieg zum Befehlsempfänger umso deutlicher vor Augen. Erst jetzt wurde ihm in aller Klarheit bewusst, dass sein Schicksal durch das Abkommen mit Hocksley besiegelt war. Er befand sich im Würgegriff einer bösartigen Macht, die ab heute sein Leben bestimmen würde, ein Leben als Menschenhändler und Verräter. Der Gedanke schmerzte ihn, Shaughnesseys Achtung zu verlieren, wenn an den Tag käme, was aus ihm geworden war. Noch schlimmer wäre es, wenn Antonias nachbarschaftliches Verhältnis durch sein Verhalten Schaden nähme.
Die Shaughnesseys bezeigten seit jeher mitfühlendes Interesse an den Lorimers. Während Frank ihnen in geschäftlichen Fragen weiterhalf, hielt Erynn Shaughnessey wiederholt intime Aussprachen mit Antonia, in »familiären Dingen«, wie sie es nannte, zumal die Ehe der Lorimers kinderlos blieb.
Henry hatte nie darüber nachgedacht, ob seine Frau darunter litt, keine Kinder zu haben. In der ersten Zeit waren sie sich selbst genug gewesen, auch gab es reichlich Ablenkung durch die Zusammenkünfte ihres intellektuellen Zirkels. Als dann die unbeschwerten Tage vorbei waren, mussten die Lorimers um die Erhaltung der Plantage kämpfen; damals sprachen sie nicht über Kinder.
Allerdings wusste Henry sehr genau, dass er noch kein Kind in die Welt gesetzt hatte, obwohl sein promiskuöser Lebenswandel jede Menge Gelegenheit dazu geboten hatte. Doch weil Antonia sich für die Kinderlosigkeit ihrer Ehe anscheinend allein verantwortlich fühlte, ließ er sie in diesem Glauben.
Er begegnete Shaughnesseys ernstem Blick. So vieles hätte er sich gerne von der Seele geredet, aber dafür war es jetzt zu spät.
»Frank, Sie sind mein Freund und haben mir oft geholfen. Aber Sie wissen, es gibt Dinge, denen man sich eines Tages stellen muss.« Er machte eine Pause. »Was immer geschieht, bewahren Sie meiner Frau Ihre Wertschätzung, ich bitte Sie! Antonia ist der aufrichtigste Mensch, den ich kenne, und sie hat jemand Besseren verdient als mich. Stehen Sie zu ihr, wenn ich es nicht mehr kann und niemand sonst mehr zu ihr hält. Wollen Sie mir das versprechen, Frank?«
Shaughnessey nickte. Sonst konnte er nichts für ihn tun.
11.
Der 12. Juli 1780 versprach ein heißer Tag zu werden. Schon früh am Morgen flimmerte die Luft über den Flussniederungen. Ein Trupp von neun Reitern mit leichtem Marschgepäck war auf der Schotterstraße zu den Reispflanzungen am Oberlauf des Cooper River unterwegs. Auf einer Kuppe, kurz bevor die Straße sich wieder neigte, bogen die Reiter nach Süden in eine Allee. Sie passierten mehrere Wachtposten, bevor sie an dem von doppelten Palisaden gesicherten Tor zur Plantage Silk Hope Einlass begehrten.
Für die Wachsoldaten waren Neuzugänge dieser Art an der Tagesordnung. Seit das britische Armeekorps unter General Lord Cornwallis sein Feldlager auf der großen Pflanzung unterhielt, meldeten sich fast täglich königstreue Plantagenbesitzer mit ihren Gefolgsleuten zum Dienst für die Krone. In Loyalistenregimenter der Britischen Armee eingegliedert, unterstützten sie fortan England im Krieg gegen ihre rebellischen Nachbarn, deren Wunsch nach Unabhängigkeit sie nicht teilten.
Weisungsgemäß hatte Henry um ein persönliches Gespräch mit Lord Cornwallis gebeten. Wie Hocksley vorausgesagt hatte, verschaffte ihm seine gesellschaftliche Stellung das Entree bei einem der ranghöchsten Offiziere des britischen Heeres. Der General empfing ihn bei guter Laune, informell in einen bestickten Hausrock gekleidet, während er sein zweites Frühstück zu sich nahm.
»Mr. Lorimer, was verschafft mir das Vergnügen Ihres frühmorgendlichen Besuchs?«, fragte Cornwallis jovial.
»General«, begann Henry, »es ist mein glühender Wunsch …«
Weiter kam er nicht, die Flügeltüren wurden aufgestoßen, ein Offizier in voller Montur und staubbedeckt vom Ritt betrat den Saal. Mit klirrenden Sporen kam er an den Tisch und salutierte vor seinem General.
»Ah, Colonel Spencer!«, rief Cornwallis erfreut. »Gut, dass Sie zurück sind! Man hat mir schon von Ihrem Erfolg berichtet.«
Er machte die beiden Männer kurz miteinander bekannt und bat Spencer, ebenfalls Platz zu nehmen. Dann ließ er von der Ordonnanz frischen Tee servieren und forderte Henry auf fortzufahren.
»Wie ich bereits sagte, General«, begann dieser erneut, »ist es mein Wunsch, im Heer seiner Majestät König Georges zu dienen und als treuer Untertan meinen Beitrag zu leisten, damit die Rebellion gegen die Krone niedergeworfen wird.«
»Großer Gott, noch ein königstreuer Amerikaner!«, sagte Spencer gelangweilt. »Manchmal frage ich mich, gegen wen wir hier eigentlich kämpfen.«
»Nehmen Sie es ihm nicht übel«, sagte Cornwallis zu Henry. »Der Colonel kommt soeben aus einem Gefecht und ist verständlicherweise ungnädig!« Dann wandte er sich wieder an Spencer. »Vor drei Stunden bekam ich Meldung von Ihrer Aktion bei Sumter. Bemerkenswert! Die Depesche von Colonel Coates hebt die Leistung der Dragoons lobend hervor; er schrieb, dass Sie Gates’ Nachschubtruppen vollkommen aufgerieben haben. Wann bekomme ich Ihren Bericht?«
»My Lord, ich erwarte noch eine genaue Aufstellung der erbeuteten Pferde, Waffen, der Munition und des Konvois. Lieutenant Mercey hat die Ränge der Gefallenen und Verwundeten beider Seiten aufgenommen; er ist mit mir angekommen und steht Ihnen zur Verfügung. Hier haben Sie meinen vorläufigen Bericht.« Er öffnete die zwei obersten Knöpfe seiner goldbetressten Uniformjacke und zog ein versiegeltes Schreiben hervor, das er vor Cornwallis auf das weiße Tischtuch legte.
»Danke, Colonel.« Cornwallis brach das Siegel, entfaltete das Schreiben, sagte im Aufstehen: »Bitte behalten Sie Platz, Gentlemen«, und ging zur Fensterfront des Raumes, um sich in die Lektüre des Berichts zu vertiefen.
Henry überlegte, ob Konversation angebracht war. Doch die Frage erübrigte sich, als er Spencers Blick begegnete, der ihn über den Tisch hinweg unbewegt und völlig ausdruckslos ansah. Henry wusste nur zu gut, wer ihm da gegenübersaß. Spencer war ein gefürchteter Kommandeur. Wo immer er mit seinen Reitertruppen auftauchte, behauptete er das Feld. Während der Kampagnen in den nördlichen Provinzen musste General Washington wuterfüllt mitansehen, wie Spencer mit seinen Dragoons die amerikanischen Truppen zersprengte und selbst fliehende Soldaten erbarmungslos niedermachen ließ. Seit der Eroberung Charles Towns hielt Spencer den Widerstand der Milizen durch eine Taktik rigoroser Anschläge in Schach. Er war ein glänzender Soldat, der seine militärischen Ziele skrupellos verfolgte.