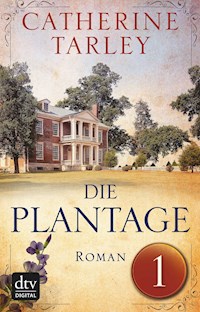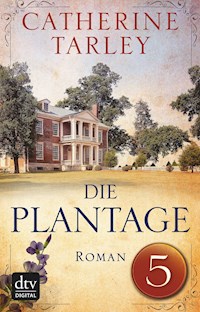1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das dritte eSequel des Bestsellers Das große Südstaatenepos als eSequel in 5 Teilen. South Carolina 1783, kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die junge Witwe Antonia Lorimer lebt alleine auf ihrer vom Krieg beschädigten Plantage Legacy. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Plantage wieder instand zu setzen und einen schwer verwundeten britischen Colonel gesund zu pflegen: William Marshall. Dass in den Kriegswirren ausgerechnet er ihren Mann Henry erschossen hat, weiß die junge Frau nicht und verliebt sich in den Colonel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CATHERINE TARLEY
DIE PLANTAGE
Teil 3
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Emily und Colin
VI. Algernon Reed
23.
Charles Town war das Herzstück des amerikanischen Handels gewesen, solange die englische Krone aus dem Wohlstand ihrer Kolonien den eigenen Vorteil zog. Jetzt, im Frühjahr 1782, nach den schweren Kriegsjahren, wähnte das düpierte Empire, der rebellische Süden läge wirtschaftlich vernichtet am Boden. Doch die Pflanzer und Händler Carolinas taten ihm diesen Gefallen nicht. Trotz hoher Einbußen durch die Zerstörung der Fluren und den Verlust vieler Sklaven nahmen sie die Geschäfte wieder auf, und trotz aller Repressalien und Schikanen durch die Besatzungsmacht begann der Handel wieder zu florieren.
Weil die traditionelle Börsenhalle im Exchange von der britischen Militärverwaltung als Kaserne genutzt wurde und für den Warenhandel geschlossen war, wurden die Markthallen zur Börse umfunktioniert. Die Stimmung an dem provisorisch eingerichteten Sellers Board war optimistisch. Alte Handelsbeziehungen lebten auf, Verträge wurden neu verhandelt, Prognosen für die kommende Ernte abgegeben. Endlich war man wieder im Geschäft.
Der April war ungewöhnlich warm, die Leute vom Land kamen in offenen Wagen zur Stadt. An den Toren staute sich der Verkehr, die Wachposten ließen die Farmer aus dem Umland erst nach umständlichen Kontrollen die Stadtgrenze passieren. Joshua hieß den Kutscher, an der Kreuzung Bay Street und Market Street zu halten, und stieg ohne Eile aus. Seit er die Plantage führte, besuchte er regelmäßig die Börse. Die schlichte Würde seiner Stellung als Verwalter stärkte sein Selbstvertrauen, trotzdem kostete es ihn jedes Mal Überwindung, sich unter die weißen Sklavenhalter zu begeben. Die Gelassenheit, die er in ihrer Gegenwart an den Tag legte, war nicht echt. Er blieb auf Abstand. Sie wiederum vermieden es, ihn zu beachten.
Die Erntezeit war noch fern, in der Markthalle herrschte mäßiger Betrieb. Vor den Tafeln mit den Notierungen debattierten einzelne Händler und Kommissionäre über Mengen und Preise. Joshua überblickte die Halle, er war verabredet und allem Anschein nach als Erster eingetroffen. Um die Zeit des Wartens zu nutzen, blätterte er in den ausliegenden Zeitungen und notierte sich die tagesaktuellen Kurse.
»Hallo, Mr. Robert«, ertönte es vom Eingang her. »Ich bin spät dran. Der alte Seth hat sich verfahren, ist das zu glauben!«
»Guten Tag, Mr. Shaughnessey!« Joshua verneigte sich. »Ihr Kutscher kommt allmählich in die Jahre.«
»Das kann man wohl sagen. Seth hat mich schon kutschiert, da war ich noch ein Junge in kurzen Hosen.«
Shaughnessey erkundigte sich nach Antonia und der Plantage. Er wollte Joshuas Meinung hören, wie viel Reis sie wohl in diesem Jahr produzieren würden. Als Antonias Geldgeber hatte Tyler ihn darüber informiert, dass die Bank mit Legacy wegen der kommenden Ernte in Kaufverhandlungen stünde.
»Das stimmt«, bestätigte Joshua. »Ashley & Bolton drängt darauf, dass Mrs. Lorimer schon jetzt den Vertrag unterzeichnet. Angeblich muss die Bank die gesamte Ernte aufgekauft haben, bevor das erste Reiskorn reif ist, sonst, so meint Mr. Tyler, könnte die Handelsvereinigung uns später Schwierigkeiten machen.« Er wiegte skeptisch den Kopf. »Sie kennen ja Mr. Tylers Spitzfindigkeiten.«
»Seien Sie getrost, der Mann weiß, was er tut«, antwortete Shaughnessey munter. »Die Herren vom Planters Club werden vor Wut schäumen, wenn sie merken, dass ein cleverer Yankee sie ausmanövriert hat! Gilbert Ashley hat mir erzählt, in den vergangenen Wochen habe Tyler die Plantagen im Umland aufgesucht und eine ganze Reihe Pflanzer am Cooper und Santee River davon überzeugen können, exklusiv an Ashley & Bolton zu verkaufen. Gilbert scheint sehr zufrieden, Tyler wird der Bank beachtliche Marktanteile sichern. Antonia ist also gut beraten, wenn sie ihm ihre Angelegenheiten anvertraut.« Er hatte sich unterm Reden umgesehen. »Da drüben ist mein Nachbar Grandle. Der Schlaukopf hat unter der Hand Loyalistenland gekauft, sein Grund reicht jetzt bis rauf nach St. James’ Parrish. Nun gut, ich werd meinem Nachbarn nicht in die Suppe spucken, Geschäft ist Geschäft. Kommen Sie, Mr. Robert, wir wollen ihm Guten Tag sagen.«
Sie gingen zur Mitte der Halle, wo Shaughnessey den biederen Mann herzlich begrüßte. Grandle erwiderte Shaughnesseys Gruß, aber als Joshua sich vorstellte, nickte er kaum. Shaughnessey überging sein abweisendes Gebaren, indem er Joshua ganz selbstverständlich in die Unterhaltung mit einbezog.
»Mr. Grandle und ich gehen seit Jahren gemeinsam zur Jagd, Mr. Robert«, erzählte er. »Wir haben so manchen armen Vogel auf dem Grund von Legacy geschossen. Mrs. Lorimer hat mir deswegen oft Vorhaltungen gemacht.«
»Dabei ging sie früher selber in den Flussniederungen jagen«, sagte Joshua. »Was sie verabscheut, sind diese Gesellschaftsjagden, bei denen sich keiner die Mühe macht, die erlegten Tiere aufzulesen.«
Grandle wandte sich an Shaughnessey: »Wir wollen nächsten Sonntag auf Enten und Wasserhühner pirschen. Sind Sie dabei?«
»Sie können auf mich zählen.«
»Also abgemacht!« Grandle überlegte kurz, dann sagte er zu Joshua: »Du wirst deiner Herrin Bescheid sagen, damit alles seine Ordnung hat, wenn wir über ihr Land reiten. Hast du verstanden?«
»Ja, Sir.« Joshuas Augen verengten sich unmerklich.
Die Turmuhr begann zu schlagen.
»Zeit für den Lunch!«, rief Shaughnessey. »Mr. Robert?«
»Ich esse in Lyndon House.«
»Gut. Ich denke, Grandle, wir gehen in den Club.«
Die Männer wandten sich gerade zur Tür, als Theodore Hocksley und Algernon Reed eintraten. Joshua wartete im Hintergrund, während die anderen sich begrüßten. Hocksley führte gleich wieder das große Wort, Reed gab sich zurückhaltend. Joshua hatte ihn seit Kriegsende nicht mehr gesehen. Wie immer wirkte Reed vornehm und elegant, sein Auftreten war von ausgeprägter Höflichkeit. Joshua hatte gehört, er verwalte seinen riesigen Grundbesitz Hollow Park mit vorausschauender Präzision. Trotzdem war er sich nicht sicher, was er von ihm halten sollte, und fragte sich, warum jemand, der seine Geschäfte so erfolgreich betrieb, die meiste Zeit wie ein Einsiedler lebte, ohne Familie, nur von seinen schwarzen Sklaven umgeben.
Während er darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass Reeds Blick abschweifte und erstarrte, als fixierte er einen imaginären Punkt. Fast eine Minute stand Reed vollkommen reglos, bevor er langsam den Kopf wandte, um zum Gespräch der anderen zurückzukehren. Joshua senkte rasch den Blick, als hätte er etwas Unerlaubtes gesehen. Was war das gerade? Reeds Lässigkeit erschien ihm plötzlich falsch, wie eine einstudierte Pose. Er beobachtete genau Reeds weltläufiges Gebaren, wie er lächelnd in einer vollendeten Geste den Hut abnahm und sich vor einem Bekannten verneigte. Als er sich wieder aufrichtete, fiel Sonnenlicht durchs Portal herein und ließ sein dunkles Haar scharlachrot aufleuchten, dass Joshua unwillkürlich zurückwich. Reed, der seine Reaktion bemerkt hatte, trat lächelnd auf ihn zu.
»Kennen wir uns nicht?«
»Ich war Mr. Lorimers Leibdiener, Sir«, antwortete Joshua mit einer Verbeugung.
»Richtig, Lorimers schwarzer Adjutant.« Reed wandte sich an Shaughnessey: »Gehört der Mann jetzt zu Ihrem Gefolge?«
»Aber nein! Mr. Robert ist kein Diener. Er ist der Verwalter von Legacy.«
»Sie sagen also, dieser Mann hier leitet die Plantage für Mrs. Lorimer?« Reed überlegte. »Ich erinnere mich, dass Mrs. Lorimer einen Verwalter engagiert hatte. Aber wie ich sie verstanden habe, handelte es sich um einen ehemaligen Offizier.«
»Sie meinen Colonel Marshall«, sagte Joshua mit einem Seitenblick auf Hocksley. »Er hat Legacy bis vor Kurzem geleitet. Aber er ging fort.«
»Höchste Zeit, dass meine Schwägerin diesen unbeherrschten Mann loswurde!«, schaltete Hocksley sich ein.
»Es stimmt leider«, sagte Shaughnessey, »mit seiner ruppigen Art hat er manchen vor den Kopf gestoßen. Aber vergessen Sie nicht, in welch kurzer Zeit er die maroden Pflanzungen auf Vordermann gebracht hat. Das war ziemlich beeindruckend.«
»Trotzdem hätte Antonia nicht jemanden einstellen dürfen, über den sie praktisch nichts wusste.«
»Erzählte Ihre Schwägerin nicht, ihr Mann Henry habe Marshall gekannt?«
»Wie auch immer«, sagte Hocksley, »jetzt ist er fort, und das ist gut so. Nur scheint Antonia aus dieser Erfahrung nichts gelernt zu haben. Wie wir sehen, fiel ihr nichts Besseres ein, als die Verantwortung für ihren Besitz in die Hände eines freigelassenen Sklaven zu legen.« Er wandte sich direkt an Joshua: »Vergessen Sie nie, wo Ihr Platz ist, Mister Robert!« Und leise, dass nur Joshua es hören konnte, setzte er hinzu: »Kein Nigger bedroht mich ungestraft mit der Waffe.«
Joshua vermied es, darauf zu antworten. Schnell verabschiedete er sich von Shaughnessey und den andern und machte sich auf den Heimweg. Als er bei der Einfahrt von Lyndon House ankam, zögerte er, ging dann weiter die Straße hinauf und folgte einem Fußweg zur Rückseite des Anwesens. Durch die Gartenpforte betrat er das Sklavendorf, ein paar armselige Hütten zwischen Hühnerhof und Wäschebleiche. Gefolgt von einer Horde Kinder ging er zum Küchenhaus und setzte sich an der Hauswand auf eine Bank. Er seufzte schwer, wischte sich den Schweiß von Stirn und Gesicht. Die Köchin hantierte drinnen laut mit Töpfen und Pfannen. Der Duft von Gumbo und frisch aufgebrühtem Kaffee stieg ihm in die Nase, aber der Appetit war ihm vergangen. Seine Gedanken kreisten ununterbrochen um Hocksleys Drohung. Eins war klar: Wenn Hocksley ihn verklagte, war er verloren.
24.
In der Nacht zum Sonntag fegte Gewitterregen über das Land. Bei Sonnenaufgang roch die Luft frisch und würzig nach nassem Laub, es war ein guter Tag für die Jagd. Auf dem Anger gegenüber der Pfarrkirche von St. James’ formierte sich die Jagdgesellschaft. Hundegebell und das unruhige Wiehern der Pferde störten den sonntäglichen Frieden, in dem Reverend Stowe seine Gemeindemitglieder an der Kirchpforte mit seinem Segen und einem persönlichen Wort verabschiedete.
Wie jeden Sonntag hatte Hocksley mit seiner Familie am Gottesdienst teilgenommen. Um seine Jagdfreunde nicht warten zu lassen, verließ er die Kirche als einer der Ersten, entrichtete die obligatorische Spende für Bedürftige und schüttelte dem Reverend unbeteiligt die Hand. Reed kam über den Kirchhof herüber, um die Hocksleys zu begrüßen. Er reichte der älteren Tochter Dora seinen Arm und geleitete sie und die jüngere Jane-Eliza, den Eltern folgend, zur Kutsche. Als der Wagen abfuhr, gingen die beiden Männer zu ihren Pferden.
Kurz darauf trafen Shaughnessey und Grandle ein und der Jagdmeister gab das Hornsignal zum Aufbruch. Vom Gebell der Meute begleitet, setzten sich die Jäger mit ihren Reitknechten, Hundeführern und dem Tross in Bewegung. Sie folgten der Straße in östliche Richtung nach Red Bank, setzten über den Cooper River und ritten weiter nach Hartford. Dort stieß ein kleiner Reitertrupp hinzu, Mr. Ball, der Besitzer der Plantage Limerick, und Mr. Davenport, der Verwalter von Silk Hope, mit Gefolge. Die Gesellschaft war nun vollzählig und ritt in zügigem Tempo die vier Meilen nach Daniel Island, wo das erste Jagen begann. Der Tross zog schon voraus nach Barton Blure;die Jäger wollten sich dort zur Mittagszeit treffen, um vor der melancholischen Ruine des Herrenhauses einen Imbiss einzunehmen.
Von der Morgenfrische war nichts mehr zu spüren. Kein Windhauch bewegte die Rispen des mannshohen Schilfs, als die Jäger allein oder zu zweit in das von Wasserläufen durchzogene Gelände pirschten. Hocksley und Reed folgten ihren Jagdgehilfen, die einen trittsicheren Pfad zu den Nistplätzen der Wasservögel suchten. Wolken von Stechmücken schwebten über den Tümpeln, je weiter sie in die Sumpfwildnis vordrangen, desto unangenehmer wurde der feuchtwarme Brodem stehender Luft. Reed hatte schon bald genug und erklärte Hocksley, er wolle nach Barton Blure vorausgehen und dort auf das Eintreffen der übrigen Jagdgesellschaft warten.
Es war nur ein kurzer Fußmarsch nach Barton Blure. Riesige Lebenseichen bezeichneten den Verlauf einer Auffahrtsallee, von den Gebäuden der alten Plantage war jedoch nicht viel übrig geblieben, ein paar Grundmauern und die Sockel der Kaminzüge, Überreste einer Freitreppe und ein Haufen vermoderter Bretter und Bohlen, die im sumpfigen Untergrund versanken. Auf den Bruchstücken dessen, was einmal der Portikus war, bereiteten die Diener das Picknick für die Jäger vor. Reed ließ sich eine Decke und Wein bringen und machte es sich im Schatten der Alleebäume bequem.
Vom Cooper River kam ein sachter Windhauch; er fing sich in den Flechten von Spanischem Moos, die von den Ästen herabhingen und in der Brise wehten wie silbrige Schleier. Dann und wann waren Gewehrschüsse zu hören und weit entferntes Hundegebell. Reed lachte verächtlich, er fand es lächerlich, kleinen Vögeln in unwegsamem Gelände nachzustellen. Man ruinierte sich im Morast die Stiefel und war zu guter Letzt gezwungen, mit nassen Füßen zu dinieren.
Die Menschen seiner Klasse und ihre Vergnügungen langweilten ihn, er war ein Einzelgänger, Geselligkeiten waren ihm zuwider. Dennoch begab er sich von Zeit zu Zeit unter Leute, pflegte sogar die eine oder andere Bekanntschaft. Er tat es, um sich und der Welt den Anschein zu geben, dazuzugehören. Er tat es um der Privilegien willen, die man hierzulande den Mitgliedern der Geldaristokratie zubilligte wie einst den Feudalherren in der Alten Welt. Nur im Schutz dieser Privilegien war es ihm gelungen zu überleben. Auf ihren Schutz war er angewiesen, wenn er tun musste, was sein kranker Geist ihm auferlegte.
Algernon Reed entstammte einer Puritanerfamilie aus Richmond, die es nach drei Generationen im Tabakhandel zu einigem Wohlstand gebracht hatte. Weil seine spät berufenen Eltern sich die Erziehung ihres einzigen Sohnes nicht zumuten wollten, wurde Algernon mit sieben Jahren in die Obhut des streng geführten Holdon-Instituts übergeben. Die Internatsjahre waren hart. Der Schulleiter, Mr. Holdon, hielt nichts von einer Unterbrechung der Lehrzeiten. Mit Ausnahme von zwei freien Tagen am Ende jedes Trimesters gab es für die Schüler keine Ferien, ebenso wenig waren Besuche zu Hause bei der Familie vorgesehen. Algernon sah seine Eltern zweimal im Jahr für ein paar Stunden in Holdons Besucherzimmer. Während Mrs. Holdon Tee reichte, durfte er vom Schulsport berichten und von den sonntäglichen Bibellesungen. Nur am Ende, auf dem Weg zum Tor, wo die Droschke wartete, konnte er mit seinen Eltern einige persönliche Worte wechseln. Es waren befangene Momente, sodass Algernon es nicht über sich brachte, von seinen Kümmernissen zu reden.
Dabei durchlebte er einen Albtraum. Jede Nacht lag er halbtot vor Angst im Dunkeln und betete, es möge einen der anderen Jungen treffen. Doch regelmäßig kam die Reihe auch wieder an ihn, Holdon trat im Schlafsaal an sein Bett, hieß ihn aufstehen und mitkommen in ein Kellerverlies. Algernon musste sich ausziehen und auf eine Bank legen. Holdon nannte eine willkürlich gewählte Zahl und schlug mit einem Stock erbarmungslos auf ihn ein, bis die genannte Zahl an Schlägen erreicht war. Es war schiere Grausamkeit. Gleichgültig gegen Algernons Schreie vollzog Holdon die Züchtigung bis zum letzten Schlag. Der Hausknecht brachte Algernon danach zurück in den Schlafsaal. Am nächsten Morgen las Holdon vor dem Unterricht aus dem Buch Hiob.
Algernon war sechzehn Jahre, als kurz nacheinander beide Eltern starben. Ihr Tod brachte ihm neben der lange ersehnten Freiheit auch die Leitung des Familienunternehmens. Gewohnt, hart zu arbeiten, erwarb er sich die im Handelsgeschäft notwendigen Kenntnisse, um seinen Wirkungskreis über Virginia hinaus zu erweitern. Er handelte mit Reis und Indigo aus Carolina und stieg in den aufblühenden Baumwollhandel ein. Nach wenigen Jahren unterhielt er Handelsniederlassungen von den Häfen Georgias über die Ostküste hinauf bis nach Boston. Mit Anfang zwanzig war er bereits ein gemachter Mann. Viele bemühten sich um den jungen Unternehmer, man stellte ihm manches heiratsfähige Mädchen vor.
Doch Reeds Interesse ging nicht in diese Richtung, Gefühle kannte er nicht. Wenn er sich einer Frau näherte, dann weil er es auf ihre Hingabe abgesehen hatte. Die körperliche Befriedigung erwies sich jedoch als Enttäuschung. Während ihn das Verlangen in immer neue Abenteuer trieb, wurde die Ernüchterung von Mal zu Mal größer. Obwohl er nicht genau wusste, wonach er sich sehnte, spürte er, dass er es durch Liebesgetändel nicht bekommen würde.
Zu der Zeit begannen die Anfälle. Sie glichen einer Art vorübergehender Abwesenheit, wie wenn er in Trance reglos innehielt. Sie kündigten sich nicht an und dauerten kaum Minuten. Reed wusste nicht, was mit ihm geschah, er empfand dabei nichts, nur Stille, Leere. Anfangs hielt er es für eine körperliche Schwäche und versuchte, mehr auf sich zu achten, aß und schlief regelmäßiger, in der Hoffnung, die seltsamen Absencen würden vorübergehen. Doch sie hörten nicht auf. Da sie aber für ihn keine Beeinträchtigung darstellten, fand er sich damit ab.
Er führte das Leben eines Einzelgängers, was ihn nicht sonderlich betrübte, denn er hatte nie erfahren, was es hieß, Familie zu haben. Er wohnte allein in dem großen Haus am Stadtrand. Wenn er sich einsam fühlte, fuhr er zu den Dörfern am James River, wo er sich die Gesellschaft von Frauen kaufte. In seiner Kutsche nahm er sie mit an einen ungestörten Ort. Einmal bei einer solchen Gelegenheit löschte eine Absence sein Bewusstsein aus. Etwas anderes trat an dessen Stelle …
Als die Frau seinen glasharten Blick bemerkte, wich sie befremdet zurück. Aber er hielt sie fest.
»Was denn, hast du Angst vor mir?«
In seiner Stimme schwang ein lauernder Ton, der sie erschreckte. Was war auf einmal in ihn gefahren? Wieso starrte er sie an wie ein hungriges Tier? Sie wollte raus aus dieser Kutsche, nur fort von ihm! Um sich zu befreien, versetzte sie ihm einen beherzten Stoß.
Als hätte er nur auf Gegenwehr gewartet, warf er sich auf sie und drückte sie mit seinem Gewicht nieder. Eine Weile ließ er sie kämpfen, dann schlug er zu.
»Wärst besser nicht in meinen Wagen gestiegen!«
Er schlug sie wieder und wieder. Als Blut aus ihrem Mundwinkel lief, hielt er inne. Witternd wie ein Hund kam er heran und fing an, das Blut von ihrem Gesicht zu lecken. Sie lag verängstigt und angewidert unter ihm und wagte kaum zu atmen. Plötzlich spürte sie, wie seine Zähne in ihr Fleisch eindrangen …
Vielleicht trat sie ihn in die Weichteile oder ihre Faust traf ihn, als sie in Panik um sich schlug. Jedenfalls kam er zu sich. Desorientiert, verwirrt von ihren Schreien, stammelte er Entschuldigungen, beteuerte, er habe ihr nicht wehtun wollen. Schließlich gab er ihr Geld, um sie zu trösten und damit sie schwieg. Zu Hause grübelte er lange über das Geschehene nach. Er musste einen Anfall gehabt haben. Die Frau war außer sich vor Angst gewesen, offensichtlich hatte er sie brutal misshandelt. Doch er konnte sich an nichts erinnern. Was auch geschehen war, er hatte die Kontrolle verloren; das durfte nicht wieder geschehen. Von nun an ging er Frauen aus dem Weg, auch vom übrigen gesellschaftlichen Leben zog er sich zurück. Seine Bekannten, die sein Verhalten natürlich nicht verstehen konnten, kamen zu dem Schluss, der Erfolg habe ihn überheblich gemacht, und wandten sich bald von ihm ab.
Einsam und frustriert konzentrierte er sich auf seine Arbeit. Das lenkte ihn ab, und seine Geschäfte florierten. Zu Beginn des Krieges hatte er sein Firmenvermögen annähernd verdoppelt, er war ein reicher Mann. Doch seit der Konflikt mit den Kolonien eskalierte, bekam auch er zunehmend die Restriktionen zu spüren, die England dem amerikanischen Handel auferlegte. Bei dem Gedanken, dass er durch seine Steuerzahlungen den Krieg gegen seine Heimat Amerika mitfinanzierte, fühlte er sich in seiner patriotischen Seele verletzt. Als mit dem Einmarsch englischer Truppen in Virginia der Handel zwischen den freien Provinzen und den besetzten Nordstaaten zum Erliegen kam, sperrte Reed seine Kontore zu und begab sich in den Süden zu den Rebellen.
Im Herbst 1776 kam Reed nach Charles Town. Er war achtundzwanzig Jahre alt, vermögend und für einen Neuengländer überaus salonfähig. Er kaufte ein Haus in einer noblen Gegend, seine Umgangsformen verschafften ihm das gesellschaftliche Entree. Die verwöhnten Charlestowner überhäuften ihn bald mit mehr Einladungen, als er wahrnehmen konnte. Nachdem er die vergangenen Jahre meist allein zugebracht hatte, machten ihn die vielen Menschen in seiner Nähe nervös, vor allem die lebenshungrigen Frauen, jene Southern Belles, die so anders waren als die Mädchen in Virginia, und die selbstbewusst seinen Salon belagerten.
Um zeitweise zur Ruhe zu kommen, verbrachte er manchen Abend der Woche in seinem Kontor am Frachthafen. Oft ging er erst, wenn die ganze Stadt schlief, zu Fuß nach Hause. Eines Nachts auf seinem Heimweg durchs Hafenviertel beobachtete er, wie ein junger Stutzer mit zwei Matrosen um eine Straßendirne stritt. Ein Wort gab das andere, auf einmal gingen die Matrosen auf den Stutzer los. Reed erwog noch, dem Mann zu Hilfe zu eilen, da zog der eine Matrose ein Stilett und stach zu. Der junge Mann ging schwer verletzt zu Boden, während die beiden Angreifer sich davonmachten.
Die Prostituierte, die den Kampf verfolgt hatte, kniete neben dem Bewusstlosen und versuchte, seine Wunden zu versorgen. Reed stand unschlüssig abseits. Im Licht der ersten Dämmerung sah er, wie das Blut des Verletzten der Frau über die Hände rann. Er konnte den Blick nicht mehr abwenden, gebannt starrte er auf ihre blutigen Hände. Plötzlich konnte er das Blut riechen. Er atmete den erregenden Geruch tief ein, und sein Herz schlug schneller; er wollte das Blut nicht nur riechen, er wollte mehr. Lautlos hob er das Stilett auf, das der Matrose zurückgelassen hatte, und trat heran, griff die Frau beim Haarschopf, riss ihr den Kopf zurück und führte einen langen Schnitt von ihrem rechten Ohr bis zum Schlüsselbein. Im Schwall trat Blut aus der Wunde, stoßweise schoss es hervor und floss dunkel über ihren Körper herab. Er hielt ihren Kopf, stierte auf das hervorquellende Blut. Ihre Augen waren aufgerissen, der Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Als der Blutfluss versiegte, ließ er sie los. Sie kippte zur Seite, ihr Kopf schlug aufs Pflaster.
Reed nahm das Messer zwischen die Zähne, dann packte er die Frau bei den Handgelenken und zog sie in den nächsten Torweg, drehte sie auf den Rücken und setzte sich rittlings auf ihre Oberschenkel. So hielt er sie zwischen seinen Knien fest, während ihr Körper von Krämpfen geschüttelt wurde. Ungeduldig zerriss er ihr Kleid und zerrte das Mieder herunter. Er legte das Stilett zwischen ihre Brüste, beugte sich herab und betrachtete aus kürzester Distanz ihr Gesicht, die grauen Lippen, blutbespritzten Wangen, starrenden Augen. Er kam noch näher, witternd wie ein Hund den Geruch von Blut und Schweiß und Angst. Plötzlich drangen gurgelnde Laute aus ihrer Kehle. Mit einem Knurren fuhr er zurück, riss einen Ärmel von ihrem Kleid und stopfte ihr den Fetzen in den Mund.
Nun schob er ihre schlaffen Arme nach oben. Die Spitze des Stiletts stach er in ihre linke Achselhöhle und begann, mit flach geführter Klinge einen Streifen Haut bis zum Brustbein abzuheben. Dasselbe wiederholte er auf der rechten Körperhälfte. Danach schnitt er einen flachen Bogen um ihre linke Brust und genauso um die rechte. Methodisch führte er Schnitt um Schnitt in zwanghafter, irrer Symmetrie, während die Frau unter ihm verblutete.
Endlich legte er das Messer zur Seite und betrachtete sein Opfer mit nachdenklich zur Seite geneigtem Kopf, beugte sich dann herab und leckte ihr das Blut vom Gesicht und von den Lippen. Der Geschmack des Blutes erregte ihn, er zog ihr den Knebel aus dem Mund, saugte an ihren Lippen, küsste ihren blutigen Mund. Keuchend riss er seine Kleider auf, fasste sein hartes Glied, rieb sich und kam schnell zum Höhepunkt. In Ekstase und höchster Lust schrie er auf, warf sich auf die Sterbende, presste sich an ihren geschundenen Leib. Er hörte, wie ihr Herz zum letzten Mal schlug. Erschöpft schloss die Augen.
Als er wieder zu Bewusstsein kam, lag er auf der Toten. Seine Kleider klebten, von kaltem Blut durchtränkt, auf seiner Haut. Würgender Ekel überkam ihn, er kroch ein Stück fort, übergab sich. Schaudernd vor Übelkeit und Kälte lag er auf Händen und Knien, ohne einen klaren Gedanken fassen zu können. Irgendwo in der Nähe hörte er ein Geräusch, es war der junge Stutzer, der vor Schmerz ächzte. Reed sah von dem Verletzten zu der verstümmelten Leiche der Frau. Er wusste nicht, was passiert war, nur sein Instinkt sagte ihm, dass er sich jetzt besser in Sicherheit brächte.
Als man die Leiche fand, geriet die Stadt in höchste Aufregung. Die Zeitungen berichteten voller Abscheu über die Tat. Frauen wagten es nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr, alleine vor die Tür zu gehen. Der Stadtrat stellte Trupps mit Knüppeln bewaffneter Burschen zusammen, die nachts in den Straßen patrouillierten. Die Bevölkerung war so aufgebracht, dass sie die Polizei bei ihren Nachforschungen mit Hinweisen überhäufte und der Commissioner der Flut von Verdächtigungen im Einzelnen gar nicht nachgehen konnte. Doch auch nach Wochen fehlte von dem Täter noch immer jede Spur.
Reed hatte sich mit letzter Kraft in sein Haus in der Queen Street geflüchtet, dann zwangen ihn die Nachwirkungen des Anfalls in die Knie. Apathisch lag er hinter vorgezogenen Bettvorhängen in trübem Dämmerschlaf. Nach zwei Wochen zeigten sich endlich Anzeichen einer Besserung. Es musste noch eine weitere Woche verstreichen, bis sein kranker Geist zur Ruhe kam. Dann stand er auf, und es ging ihm erstaunlich gut. Bald fühlte er sich besser als je zuvor, wie erlöst, als wäre er von einer Bürde befreit, die ihn jahrelang niedergedrückt hatte. An die Vorgänge jener Nacht erinnerte er sich nicht.
Nach seiner Genesung erfuhr er von dem bestialischen Mord an einer Prostituierten. Der Vorfall lag fast einen Monat zurück, doch in der Tagespresse wurde immer noch darüber berichtet. Reed reagierte betroffen, gleichzeitig übte der Fall eine besondere Faszination auf ihn aus. Immer wieder las er die Zeitungsartikel, in denen die seltsamen Verletzungen des Opfers geschildert wurden, und glaubte, den blutüberströmten Körper der Frau bildlich vor Augen zu haben. Selbst ihre Haarfarbe und das Muster ihres Umschlagtuchs hätte er beschreiben können; er war erstaunt über seine Vorstellungsgabe. Dann fand er seine blutbesudelten Kleider. Sie lagen in einer verschlossenen Kommode neben seinem Bett. Er selbst musste sie dort hineingelegt haben, denn er trug den Schlüssel immer bei sich. Was hatte das zu bedeuten?
Der Mord hatte sich in der Nacht seines schweren Anfalls zugetragen. Er konnte sich nicht erinnern, was auf dem Heimweg geschehen oder wie er nach Hause gekommen war. Doch sah er vor dem geistigen Auge den Schauplatz des Mordes, sah seine eigenen blutverschmierten Hände und die verstümmelte Leiche einer Frau. Er musste dort gewesen sein und etwas getan haben, das die blutstarrenden Kleider in der Kommode erklärte.
Natürlich wusste Reed, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Die ständigen Absencen hingen mit einem Defekt zusammen, der schon einmal dazu geführt hatte, dass er eine Frau misshandelt hatte. Doch seitdem war er auf der Hut, er hatte sich keiner Frau mehr genähert. Wenn er etwas mit dem Mord am Hafen zu tun haben sollte, dann musste etwas passiert sein, worauf er keinen Einfluss hatte.
Schon in früher Kindheit fiel ein Schatten auf Reeds Gemüt. Unbemerkt hatte eine Krankheit in ihm gekeimt und einen Fremdkörper hervorgebracht, ein missgestaltetes Imitat seines Wesens, das sich von den Demütigungen und dem seelischen Leid seiner Jugend nährte. Als junger Mann hatte er erstmals Absencen. Ein unüberwindbarer Widerwille hinderte ihn daran, deren Ursache zu ergründen; seine Versuche, den Erinnerungsverlust einer Absence nachzuvollziehen, steigerten die innere Abwehr, konnten sogar zur Ohnmacht führen. Auch jetzt musste er mit erheblichem inneren Widerstand rechnen, wenn er versuchen würde, die Vorgänge der Mordnacht zu rekonstruieren. Also wählte er einen anderen Weg: Er rief sich seine Vision des Tatorts vor Augen.
Die Wirkung war so heftig, dass ihm schwindelte. Sein dunkler Zwilling, die Kehrseite seines Bewusstseins, packte ihn mit eiserner Faust und ließ ihn seinen aggressiven Willen spüren. Er sog ihm den Atem aus den Lungen, warf ihn zu Boden und hielt ihn dort fest.
Was willst du von mir?, dröhnte es hinter seiner Stirn wie Glockenschläge.
Stöhnend schloss er die Augen und dachte: Hast du die Frau getötet?
Du warst es! Du tust, was ich tue!
Wer … bist du?
Ich bin Algernon. Ich bin, was du bist. Tu, was ich tue!
Am nächsten Morgen fühlte er sich zerschlagen. Ich bin ein Mörder, sagte er zu sich, und ich bin geistesgestört. Gefasst überdachte er seine Lage. Bisher hatte niemand die Spur bis zu ihm verfolgt, und es war unwahrscheinlich, dass man ihn mit der Mordsache in Verbindung brächte. Aber die Anfälle würden wiederkehren, und da er jetzt wusste, wozu er dann fähig war, musste er etwas unternehmen. Zunächst las er alles, was er an Literatur über psychische Abnormitäten in die Hände bekam. Dabei stellte er fest, dass die Wissenschaft zwar verschiedene Erscheinungsformen des Irrsinns beschreiben konnte, die Ursache der Erkrankung aber im Dunkeln blieb. Und trotz aller Gelehrsamkeit war es offenbar nie gelungen, geistesgestörte Menschen zu heilen. Stattdessen verbarg man sie vor der Welt, ließ sie in Käfigen dahinvegetieren oder verkaufte sie zu Studienzwecken an zweifelhafte Gelehrte. Für Kreaturen wie ihn gab es wenig Hoffnung, und wenn er nicht auf elende Art enden wollte, musste er dafür sorgen, dass niemand von seinem Zustand erfuhr.
Er war immer zurückhaltend gewesen, nun wurde er menschenscheu. Gesellschaftlichen Umgang pflegte er nur noch, wenn es aus geschäftlichem Interesse unvermeidbar war. Um Höflichkeitsbesuchen von Nachbarn oder Bekannten zu entgehen, verbrachte er die freien Nachmittage auf den Rennplätzen vor der Stadt, wo er den Jockeys beim Training seiner englischen Vollblüter zusah. Manchmal schaute er sich auch eines der Footballspiele an, die samstags auf einer Pferdeweide hinter den Rennställen stattfanden. Hafenarbeiter traten gegen die Soldaten von Fort Sullivan an. Es kamen alle möglichen Zuschauer, Fuhrknechte, Dandies, einfache Leute. Wetten wurden abgeschlossen, Krüge mit Ale und Rum herumgereicht.
Die Schauerleute waren die Champions dieser Saison. Im Entscheidungsspiel wurden mehrere Stürmer schwer gefoult und mussten ausgewechselt werden. Als den Schauerleuten die Ersatzspieler ausgingen, sprang ein Mann aus dem Publikum über die Absperrung und lief zum Kapitän. Die Zuschauer schienen ihn zu kennen. Der Bursche sei ein Streuner, entnahm Reed den Bemerkungen der Umstehenden, ein junger Glücksritter, der wegen seiner Spielschulden wohl bald aus der Stadt geworfen werde.
Die Teamchefs hatten sich unterdessen geeinigt. Der neue Mann band sich die grüne Schärpe der Schauerleute um und lief unter dem anerkennenden Beifall des Publikums aufs Feld. Reed schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Unter den anderen Spielern wirkte er wie ein Halbwüchsiger, erwies sich im Spielverlauf jedoch als kampferprobt und reaktionsschnell wie kaum ein anderer. Von Anfang an blieb er hart am Gegner, übernahm die Sturmspitze, brachte den Ball konsequent nach vorn und warf nach wenigen Minuten sein erstes Tor. Die Leute applaudierten und skandierten seinen Namen: Roscoe! Roscoe!
Wegen seiner rauen Taktik wurde Roscoe vom Schiedsrichter mehrfach verwarnt. Aber er warf Tore und brachte seine Mannschaft in Führung. Als der Schlusspfiff ertönte, hatten die Hafenarbeiter die Soldaten haushoch besiegt. Rund ums Spielfeld gab es begeisterten Beifall, die Champions ließen sich feiern, Wettgewinne wurden ausgezahlt, allmählich brachen die Leute auf. Auf dem Weg zu seinem Wagen kam Reed an der Spielerbank vorbei. Roscoe saß dort allein für sich. Unberührt von der Siegesfreude seiner Mitspieler, blickte er teilnahmslos vor sich hin, während er sein Hemd zuknöpfte. Reed blieb stehen und sah zu, wie er seine Stiefel anzog und die Stiefelriemen schnürte. Als er endlich den Kopf hob, berührte Reed mit behandschuhter Hand die Hutkrempe.
»Ich könnte Sie im Wagen in die Stadt mitnehmen.«
Roscoe strich sich das schweißnasse Haar aus der Stirn und sah ihn mit unbestimmtem Ausdruck an. Auf Reeds einladende Geste hin stand er auf, nahm Rock und Hut und folgte ihm wortlos zum Kutschenstand.
Die geräumige Calèche war schon vorgefahren. Der Kutscher riss den Wagenschlag auf und wartete in serviler Haltung, bis Reed eingestiegen war. Roscoe, einen Fuß auf dem Antritt, stand vollkommen versunken in Betrachtung des luxuriösen Wagens und strich sacht mit den Fingerspitzen über den makellos schimmernden, nachtblauen Lack; eine Geste naiver Bewunderung, die Reed lächerlich fand und doch auch rührend.
»Als ich ein Junge war, hatten wir eine Kutsche und schöne Pferde«, sagte Roscoe mehr zu sich selbst. »Im Frühling fuhr Mamá mit mir ans Meer.« Er sprach in einem eigenwillig schleppenden Tonfall und überdehnte die einzelnen Silben. Noch nie hatte Reed jemanden so reden gehört.
25.
Roscoe war Kreole aus der einstmals spanischen Kolonie East Florida. Nachdem der Familienbesitz verloren und die verarmte Familie zu Verwandten nach Georgia gezogen war, verbrachte er seine Jugend mit anderen jungen Tagedieben am Hafen von Savannah. Er konnte weder lesen noch schreiben und lernte, sich mit seinen Fäusten Respekt zu verschaffen. Eine Weile verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Schaukämpfen, bis er sich mit siebzehn Jahren zum Dienst in der britischen Kolonialarmee verpflichtete. Nachdem er außer Kämpfen nichts gelernt hatte, brach er wahllos Duelle vom Zaun, um sich abzureagieren. Als er dazu überging, Untergebene zu quälen, endete die Episode bei der Armee mit seiner unehrenhaften Entlassung.