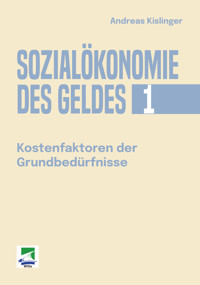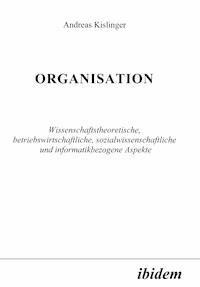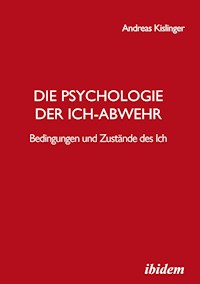
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die innerpsychischen Variablen und Faktoren, die in Summe das Ich konstituieren und ausmachen, befinden sich immer auch in einem bestimmten Verhältnis zum Fremd-Ich. Die Psychoanalyse richtet den Blick auf die äußerst komplexe innere Dynamik des Ich und entwickelt diese primär aus der existenziell-substantiellen Verbundenheit mit dem primären Fremd-Ich der Mutter. Aus dieser Symbiose löst sich das menschliche Lebewesen nur sehr langsam und wächst zu einem eigenständigen Ich heran. Ausgangspunkte der psychoanalytischen Themen dieses Bandes sind: • Hilflosigkeit, Abhängigkeit, Deprivation und Regression; • Depression und Manie als entfremdete Ich-Zustände; • Manie, Narzissmus und Wahn als gewaltauslösende Ich-Zustände; • die Anpassungsvorschreibungen der gewaltausübenden Ich- Haltungen. Der Analysegesichtspunkt der Ich-Abwehr beschreibt die Regulationsnotwendigkeiten der naturgegeben widerstreitenden inneren Wünsche, Impulse und Ausrichtungen des Ich, die zu wesentlichen Teilen die Anpassungsvorschreibungen des Fremd-Ich abbilden und aushandeln. – Der vorliegende Band will beispielgebend sein für die Intention, individualpsychologische Ansätze der Ich-Abwehr in ihrer aktuellen massenpsychologisch-gesellschaftlichen Relevanz zu erfassen und zu analysieren, und leistet damit einen Betrag zur Neutralisierung und Prävention gesellschaftlicher Selbstzerstörung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
I. Vorbemerkungen
Inhaltliches
Orthographisches
a) Historische Bestimmungselemente deutscher Sprach- und Pronomenbildung
Ein Fallbeispiel heute gültigen Sprachgebrauchs
b) Genus und Sexus
c) Das Geschlecht neutralisierende Substantiv und das verweiblichende Relativpronomen
d) Zur gewählten orthographischen Form
Zum Aufbau des Inhaltsverzeichnisses
II. Existentielle Grundlagen des Ich
A. Hilflosigkeit und Abhängigkeit
B. Symbiose und Individuation
C. Die Versorgtwerdensfunktionen des Selbst
D. Regression
III. Energetisch gebundene Ich-Zustände
1. Depression
Die Angst vor Verlust des guten Objektes
Die Unmöglichkeit einer Objektdistanzierung
Die Distanzierung des Ich von sich selbst
Depression als Mangel von substantiell Notwendigem
Die nach ‚unten' führende, innere Spirale eigener, sich selbst verstärkender Ich-Zustände
Depression als kognitives Überbelastungsderivat
Die soziale Realität der Depression
Suizid oder das Prinzip Hoffnung
Zu wenige soziale und materielle Ressourcen als zentrales Belastungsmerkmal der Depression
Depression als Verdrängungs- und Entfremdungsrest gewusst-geglaubter Ich-Effizienz
Die Ereignisse des Ich als Sozietätskorrelat
2. Panikattacken
Erregung und Depersonalisation
Die Neuro- und Gehirnbiologie der Panikattacke
3. Schizophrenie
4. Manie
Anpassung-Manie-Anpassung
Das verzweifelte Scheitern an der realen Normalität und der normalen Realität
5. Wahnhafte Ich-Zustände
6. Hassen
7. Überinkludierende Realitätsbewertung als regressive Ich-Störung
Die Rolle der zentralen Bezugsperson(en) und deren immanenter Prägungsfaktor bei regressiven Denkstörungen
Die regressive Turbulenz der Denkstörung
IV. Ich-Zustände als Ausgangspunkt und Folge der sozialen Bedingungen
1. Depression
Die Rolle der Depression im (über)individuellen Handlungsverlauf
Depressionspharmakologie als Abbild einer Unlustgesellschaft
2. Hassen
Die Rolle des Hassens im (über)individuellen Handlungsverlauf
Unterwerfungsereignisse im Zeitverlauf
V. Das Fremd-Ich der Anderen und das eigene Ich
VI. Extravertierte, Gewalt vermittelnde Ich-Zustände
1. Abwesenheit von Empathie und wahnhafte Realitätsfixierung
Fallbeispiel 1
Fallbeispiel 2
Psychopathieforschung
2. Größenwahn
3. Manie als realitätsfixative Ich-Störung
4. Die psychische Gewalt der extravertierten Ich-Zustände
4.1. Die psychische Ich-Fremd-Ich-Relation
4.1.1. Ich, Ich, und Ich: Die Kontaktstörung
4.1.2. Ich, Ich und Ich: Die Absenkung der Kritikschranke
4.2. Die Ich-Fremd-Ich-Unterdrückungsrelation
4.2.1. Das Manische und seine Fremd-Ich-Wirkung
4.2.2. Das Psychopathische und seine Umgebung
4.2.3. Das Wahnhafte als hermetische Autorität
5. Die dissoziale Gewalt der extravertierten, Gewaltvermittelnden Ich-Zustände
Die notwendige Prämisse der dissozialen Gewalt
VII. Die Realitätsvorschreibung weniger und die Ich-Zustände vieler
Analyseschema und Ausgangspunkt: Kognition und Glaube weniger – empfindendes Denken vieler
Die wundersame Richtung üblicher Erfolgsattribution
VIII. Der (sozial) deprivative Ich-Zustand
A. Sozialer Anpassungsdruck
Die libidinöse Besetzung von Objekten
Ich-Bedürfnisse
B. Deprivation
a. Deprivation und religiöse Leidtheorien
Die vorherrschenden Axiome der Erklärungstheorien menschlichen Leids
b. Umfassender Kontrollverlust als Deprivation
c. Hunger als Essensdeprivation
Die Psychologie des (Nicht)Essens(dranges)
Essen als eigentümliche Machtdemonstration
d. Überreizungsdruck versus erlebte Deprivation
Die soziale und psychische Gestalt der Deprivation
e. Das Wissen über die Bedingungen der relevanten Anderen
f. Deprivationsabwehr als politische Aufgabe
g. Deprivation als verunmöglichte Ich-Abwehr
C. Persönlich-subjektive Verletzlichkeit als Deprivationskorrelat
Die Macht der Ressourcen
Die mit Ideologie versenkte Wahrnehmung der Grundbedürfnisse
Macht oder Ohnmacht des sozialen Zusammenhalts?
Der soziotechnisch-psychologische Konstruktionsfehler der modernen westlichen Gesellschaften
Die Innen- / Außenrelationen des Ich
IX. Die Ich-Grenze zwischen Innen und Außen
Die faktisch-physikalisch fassbare(n) Grenze(n) des Ich
Die psychische Funktion der Ich-Grenzen
X. (Paar)Beziehung
A. Relative Autonomie und Anpassung
B. Mann-Frau Unterschiede
C. Symbiose
Sublimierung
Verschmelzungsdruck
Die Funktion der menschlichen Haut
Narzissmus
Liebe und Hass
D. Persönliche Verletzung und Verletzbarkeit
E. Anpassung
a. Anpassung mittels Erwartungsantizipation
b. Widerstand als Gegenpol von Anpassung
c. Anpassungszwang durch Verlustangst
d. Anpassen-lassen durch das eigene Größenselbst
Das gewalttätige Größenselbst in der Dyade
Die Eigenschaften des Größenselbst zentraler Führungsfiguren
Historische Erkenntnisse über ein vormodernes Größenselbst
Dissozialität
Das modellierte Simulieren von Stärke
XI. Die Ich-Entfremdung durch Gewalt
1. Die alltäglich-öffentliche Beziehungsgewalt
2. Die sadomasochistischen Arbeitshierarchien
3. Häusliche Gewalt
XII. Die Psychologie der Ich-Abwehr
1. Das Ich und Ihre Abwehr(mechanismen)
Anpassung
Reaktionsbildung
Projektion
Verschiebung
2. Psychische Abwehr in einer Angriffs-Verteidigungspolarität
2.1. Angriff
Der symbolisierende Rollenwechsel
Witzbildung
Fremdschädigende Eigenliebe
Verleugnende Abspaltung
Projektive Identifizierung
Rollenumkehr
Psychologie der Rollenumkehr
Neid erzeugen
Hass
Fremdaggression
Verschiebung
2.2. Verteidigung
Der symbolisierende Rollenwechsel
Selbstschädigende Fremdliebe
Psychiatrische Beschwerdeformationen
Die Panikattacke
Selbstaggression
Neid empfinden (müssen)
Verleugnende Abspaltung
Hassen
Verschiebung
2.3. Die Verquickung von Angriff und Verteidigung
2.3.1. Frau / Herr über Leben und Tod – Lebens- und Tötungsobjekt Relation
2.3.2. Der Angriffs-Verteidigungszwitter: Das Wahnhafte
Die Vergesellschaftung einer wahnhaften Privatwelt
Die individuelle Abwehr als Bilanz der vielen Ich
XIII. Aggression, Gewalt und Libido
1. Aggression und Gewalt
Aggression und Destruktion
Gewalt, Fanatismus und Hass
Psychopathie als psychische Grundlage von Gewalt
Individuell-psychische Reaktionen auf Gewalt
Das Gewalt-gewaltlos Spektrum von Beziehungsanordnungen
Der soziale Zusammenhang des ausgewählten, gehassten Objektes
2.Die generelle psychosoziale Verantwortungsmatrix
3. Die Libidofixierung
XIV. Formen libidogespeist-anerkannter Gewaltregulative
1. Öffentlichkeit
Die Regeln der öffentlich dargestellten Ich-Zustände
Die Verteilung öffentlicher Aufmerksamkeitszuwendung
2. Arbeit
Die Bedeutung der narzisstischen Kränkung in der Arbeitswelt der ‚kleinen' Angestellten
Geiz als Ergebnis permanenter Aufmerksamkeitserpressung
Das dargestellte Arbeitsglück von Firmen- und Bildungshomepages
Die Rolle obsessiv manischen Verhaltens
Die aneinandergereihten Ich-Manien als gesellschaftlicher Grundbaustein
XV. Die Norm als generalisierte Ich-Haltung
A. Die Instanz der Ich-Kontrolle
a. Die Belohnungs- und Bestrafungsfortschreibung des Über-Ich
b. Aufbau und Destruktion des Ich durch das Ich-Ideal
B. Die Abspaltungen der generalisierten Ich-Haltung
a. Narzissmussstörung als Fremd-Ich abspaltender Ich-Zustand
Die behandelten Ich-Eigenschaften der Narzissmusforschung
Die ontogenetisch frühen Gründe der Ich-Abspaltung und der späteren Fremd-Ich Abspaltung
Ich-Kohäsion und -Kohärenz als Zentrum narzisstischer Wahrnehmungs-, Handlungs- und Reaktionsmodi
Strukturell-interaktive Kennzeichen des Narzissmuskonzepts
Regelmechanismen und pragmatische Abwehr der narzisstischen Persönlichkeitsstörung durch die psychische(n) Umwelt(en)
Der öffentliche Narzissmus-Diskurs
Juristische und psychologische Kennzeichen des pathologisch-narzisstischen Ich-Zustands
b. Zwangsstörung als Libido abwehrender Ich-Zustand
Zur Gehirnphysiologie der Zwangsstörung
Arbeitsteilung zwischen pathogenem Narzissmus und Zwangsstörung
XVI. Das Narzissten / Psychopathen-Idealisierungs-Gleichgewicht
Der im Sozialsystem eingebettete pathogene Narzissmus
Idealisierung und Systembezug
1. Öffentlichkeit
Die Bewunderungsemotion als zentrales Fundament
Die Implikationen des systemisch und systematisch erzeugten Narzissmus / Psychopathie Phänomens
2. Arbeit
3. Hilflosigkeit und Abgrenzungsnotwendigkeit
3.1. Gezielt-systematische Evokation von Neid
Die libidinöse Logik der Neiderzeugung
Stolz und Scham
Identifikationsmechanismen mit den dargestellten Ich-Zuständen der gesellschaftlich festgelegt-definierten Stärke
Die Wissenschaft als MitproduzentIn gesellschaftlicher Bedingungen
Die unumkehrbare gesellschaftliche Neidhierarchie
Der Ich-Zustand des Neides / Neidens
Die Ich-Zustände im Gefälle einer Neiderzeugungs-Unterdrückungs-Hierarchie
3.2. Der lange Weg des eigenen Hassempfindens
Der permanent-wahnhafte Unterdrückungszwang
Die doppelgesichtige Funktion des Hassens
Die erkämpfte Notwendigkeit einer Deidealisierung
XVII. Der Abspaltungszwang der eigenen Bedürfnisse
A. Die Funktion der Bedürfnisse für das eigene Überleben
B. Künstlich erzeugte Bedürfnisse
C. Das Partnerschaftsbegehren
Die normierte Begrenzung der eigenen Ich-Zustände
XVIII. Die Grenzen des Ich und die implizierte Ich-Abwehr
A. Entwicklungspsychologische Aspekte der Ich-Abwehr
Für eine duale Entwicklungspsychologie
Entwicklungspsychologie, Macht und Gewalt
Kennzeichen psychosexueller Entwicklung und biologischer Alterung
B. Persönliche Grenzen und das Nicht-Ich
XIX. Die unbewusste Übereinstimmung der normierten Abwehr-Ich
A. Das Ich und die Masse
B. Libido, Suggestion und Identifizierung
C. Die Masse und die Urhorde
D. Das kollektive Gesamt-Ich
E. Frauenbild als normiert-teilkollektive Ich-Abwehr
Psychoanalyse sozialpsychologischer und innerpsychischer Triebdynamik
Das Fehlen eines modernen Menschen- und Frauenbildes: Gewalt gegen Frauen (und Kinder)
Der öffentliche Frauendiskurs
F. Das eigene Bild vom Fremd-Ich
Die Ordnung der Geschlechter und das Begehren
Die subjektive Bild des Fremd-Ich als Ordnungs- und Subjektivitätshybrid
XX. Literatur
I. Vorbemerkungen
Inhaltliches
Das erste größere zentrale psychologische Koordinatensystem, das eine Matrix psychologisch relevanter Ich-Zustände unterscheidet und beschreibt, ist das ‚Drei Instanzen Modell‘ von S. Freud (‚Es‘ – ‚Ich‘ – ‚Überich‘).
Mit dieser neu erfundenen Errungenschaft wurde das 20. Jahrhundert eröffnet und man begann, ins Innere des Menschen zu blicken. Bereits in diesem Modell werden drei signifikant unterschiedliche Ich-Zustandsmengen fokussiert, die als gleichsam unterschiedliche innere, psychisch wirksame ‚Machtzentren‘ miteinander im beständigen Widerstreit stehen. Diesem kontinuierlichen inneren Machtkampf, in dem jeweils entschieden wird, welcher Impuls im jeweiligen Inneren des Menschen gerade die Oberhand gewinnt und nachher hat, sind wir Menschen unterworfen.
Im vorliegenden Band wird diese innere Matrix durch eine äußere ergänzt, und dabei wird versucht, aus dieser implikativ-totalitär-abgeschlossenen Innensicht – die das Eigentliche der Psychologie ausmacht – des Individuums zu entkommen. Das bedeutet die explizite Hinzunahme einer Außenwelt, die in der herkömmlichen psychologischen Sicht nur dem Innen zugeordnet ist.
Dieses Aufbrechen der allumfassenden Innensicht ist es zu verdanken, dass das aus der Außenwelt, das über unsere Wahrnehmungsorgane zur inneren Realität wird, wieder nach außen in die vermeintliche Objektivität zurück übersetzbar wird und im vorliegenden Werk explizit übersetzt wird, was nach diesem Vorgang der Verinnerlichung der äußeren Bedingungen dann als sekundär veräußerte Bedingung wieder im Außen ankommen soll.
Damit wird versucht, die psychologisch-psychoanalytisch übliche, als allumfassend betrachtete Analyse des Inneren ins Außen und zurück zu transzendieren. Die AutorIn erachtet diese ständige Übersetzungsarbeit von Innen nach Außen und zurück als unverzichtbar-unerlässlichen Bestandteil psychologischer Analyse, der nicht umhinkommt, vor allem im psychoanalytischen Kontext, immer wieder explizit betont werden zu müssen.
Natürlich, wenden die universitär geschulten PsychologInnen an dieser Stelle ein, die Psychologie tut dies spätestens in den 1950ern seit B. F. Skinner genauso. Die AutorIn wendet aber an diesem Punkt ein, dass die herkömmliche Psychologie an der Psychoanalyse vorbei forscht und umgekehrt und dass beide Ansätze unverbunden, die Erkenntnisse der jeweils anderen Richtung nicht nur negiert, sondern mit Füßen tritt.
Der Grund dafür ist unter anderem darin zu finden, dass beide Seiten derselben Medaille offensichtlich nichts voneinander wissen, und / oder wissen wollen, weil esnicht deren methodischen Ansatz entspricht und sie damit überfordert wären, etc. Eine Wissenschaft, die das objektiv Messbare zum Thema hat, kann es sich schließlich nicht erlauben, sich in die Tiefen menschlicher, rein subjektiver Begründungen zu begeben und die Psychoanalyse hat es offenbar auch nicht nötig, sich statistisch vergleichender und gewichtender Methoden zu bedienen.
Der vorliegende Text positioniert sich auf der Seite und Sicht der Psychoanalyse, unter starker Einbindung einer explizitenAußensicht der menschlich-psychologischen Phänomene und der sie umgebenden und diese widerspiegelnden Bedingungen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen kleinen Beitrag zu im mitteleuropäischen Kontext aus dem Blick geratenen bzw. nicht im Blick befindlichen Forschungsgegenstand zu erneuter Aufmerksamkeit und vermehrter Rezeption zu verhelfen.
Im vorliegenden Text wird unterschieden zwischen Ich1 und Ich2, dem Fremd-Ich von Ich1, je nach gewählter Perspektive eben Ich1 oder ein nahe stehendes Ich2. Das Ich2 ist nach philosophischer Sicht dem Ich1 als Realität gegeben und aufgegeben.
Das Nicht-Ich ist vom Blickpunkt Ich1 aus die Menge von Ich2-n, das sind alle Personen, die eben nicht Ich1 sind, die sich von insgesamt einer zweiten Person, über die relevanten Anderen bis zur gesamten Erdbevölkerung hin erstrecken kann und / oder erstreckt.
Da aufgrund einiger Befunde zu beobachten ist, dass sich Ich1-16 zum Beispiel von Ich17 (die in der Mehrzahl häufig auch die eine oder andere gesellschaftliche Funktion als Leitfigur bekleiden) in jeder gewählten Stichprobe signifikant unterscheidet, wäre davon auszugehen, dass dieser regelhafte gesellschaftliche Persönlichkeitserscheinungstypus den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich unübersehbar und überdeutlich abbildet. Daraus ist zu folgern, dass die gesamte Gesellschaftsrezeption einem kräftigen Bias unterliegt, nämlich in jene Richtung, die zum Beispiel Ich17 unübersehbar und überdeutlich zuarbeitet. Und da der Forschungsdiskurs darüber während der letzten Jahrzehnte fast gänzlich fehlt, wäre es höchste Zeit, dieses öffentliche Analysedefizit in Auftrag zu geben und forscherisch zügig und effizient abzuarbeiten und auf diesem Wege zu beseitigen.
Aus Sicht der AutorIn kann und sollte der vorliegende Band eine Anregung dafür sein, Hypothesen zu einem öffentlich großflächignegierten Themenfeld zu generieren, deren umfassende empirische Überprüfung nicht im aktuellen Blickfeld ist und daher stark unterrepräsentiert ist und erscheint.
Die begründenden Faktoren dafür werden in einer übermäßigen Spezialisierung vermutet, die in einem Nebeneinander und in Summe im wissenschaftlichen Tun sich ganz unintendiert und häufig nicht wirklich bewusst vorgibt, was modern und wichtig zu sein hat und was nicht, das sich in einem mit tiefem Brustton der Überzeugung verfochtenen, aber nichts desto weniger in einem diesbezüglich eklatanten Forschungsmangel zeigt.
Ganz leicht ließe sich in diesem Zusammenhang unterstellen, dass ganz psychologische Forschungszweige den mächtigen Ich17 nicht wirklich bewusst, aber dafür umso effizienter, dienlich zuarbeiten, mit all den dabei implizierten blinden Flecken.
Ein Grund dafür ist auch dort zu suchen und zu finden, dass es keine Zusammenschau der diversen unterschiedlichen psychologischen und psychoanalytischer Ansätze gibt. Und ein weiterer Grund ist eben im Mangel bestimmter psychologischer Sachthemen zu erblicken, die, in diesem Zusammenhang wesentlich, die Psychopathie von Leitfiguren zum Thema hat. Schon das Wort ‚Psychopathie' wird aus erstem und zweitem Grunde als völlig unmodern bewitzelt, was sich bereits an der genauen Titelführung der wenigen einschlägigen Publikationen ganz offensichtlich und leicht ablesen lässt. Oft ist es ja die detail-affine universitäre psychologische Ausbildung, die den AbsolventInnen, solche nur allzu leicht als ‚banal' diskreditierbare Ableitungen, nicht nur erschwert, sondern systematisch abgewöhnt.
Natürlich ist gerade dieser soziale und psychologische Tatbestand konsequent nach psychoanalytischen Prinzipien zu bewerten und eben jenen unbewusst abwehrenden AutorInnen als Spiegel vorzuhalten. Wenn und da ‚Psychopathie' ein sehr schwerwiegendes psychisches Phänomen darstellt, sollte gerade von fachlicher Seite nicht versucht werden, sich daran möglichst unbemerkt vorbei zu schummeln. Die Konsequenzen dieser permanenten Unaufrichtigkeit hat dann nämlich eine Gesellschaft als Ganzes zu tragen.
Auch will es sich die AutorIn an dieser Stelle nicht nehmen lassen, zu vermerken, dass psychologische Wissenschaft dazu instrumentalisiert werden kann und in hohem Maß unter Verdacht steht, sich dazu instrumentalisieren zu lassen, unerwünschtes, störend-lästiges Gedankengut gesellschaftlich höchst erwünscht, honoriert und effizientest abzuwehren. Um es in schöne Worte über die herrschenden Verhältnisse einzukleiden. Und das lässt sich am besten im Sinne eines allseits anerkannten Schmunzelns, das zeigen soll, wie sehr es sich dabei nur um ein völlig übliches Kavaliersdelikt handeln kann, bewerkstelligen.
Auf diese, einer mächtigen Mehrheit dienliche Funktion herabgestuft, müssen sich psychologische Ansätze somit den Vorwurf gefallen lassen, zu den ErfüllungsgehilfInnen einer breitenwirksamen Machtaufassung zugerichtet und zurechtgestutzt worden zu sein.
Damit sind die Analysemöglichkeiten einer modernen Psychologie mit den Kenntnissen der Macht des Unbewussten und der blinden Flecken weitgehend lahmgelegt und außer Kraft gesetzt, mit welcher Rationalisierung diese insgesamt resultierenden Manöver der und in der Psychologie dann auch immer auf oberflächlich-rationalen Niveau ausgestattet sind und werden. Zudem hat die moderne Psychologie damit ihre ureigenste Bestimmung leichtfertig über Bord geworfen, gänzlich und überhaupt bevor sie zum Hauptteil ihres Aufgabenfeldes vordringen konnte.
Trotz alledem ist die AutorIn sich sicher, dass der vitale Antrieb, sich eben genau das Abgespaltet-Abgewehrte, Verachtet-Verdrängte und Hinausgemobbte einer aktuellen Gesellschaftsform, deren ProtagonistInnen und deren pathologisch-pathogene Auswüchse und -wucherungen bis ins Kleinste sezieren zu wollen, nicht aussterben wird und kann.
Orthographisches
Die orthographische Schreibpraxis ist über die Jahrtausende gewachsen und dass wir und so wie wir schreiben, ist ein (Ab)Bild von Sprachgewohnheiten, die mit den Sprachgewohnheiten unserer Vorfahren und im Besonderen mit den Sprachgewohnheiten unseres näheren und ferneren sozialen Umfelds verbunden ist. Die (geschriebene) Sprache ist eine Form von orthographischem Gedächtnis.
Im Folgenden werden– ausgehend von großen historisch-sprachgeschichtlichen Bewegungen der deutschen Sprache – Sprachgewohnheiten thematisiert, die sich in den letzten Jahrzehnten verändert haben und sich vorhersehbar noch verändern werden, und es wird ein konkreter Vorschlag unterbreitet, der für die Veränderungsnotwendigkeit überkommener Sprachstrukturen und Schreib- und Sprechgewohnheiten höchst offensichtliche Daten aufzeigt und zur Sprache bringt.
Da Sprache Abbild von Machthierarchien und auch von deren Auflösung ist und sein kann, sollten lange gewachsene Sprachgewohnheiten und Sprachkonstruktionen genau in den Blick genommen werden, jenseits der eigenen eingelernten Systemblindheit, die uns in Form von psychischen Wiederholungszwängen die ständige perseverative und unbedarfte System- und Sprachsystemreplikationen diktieren. Im Folgenden wird kurz aus dem Blickpunkt der deutschen Philologie der heutige Sprachbestand auf den Punkt gebracht.
a) Historische Bestimmungselemente deutscher Sprach- und Pronomenbildung
In der deutschen Philologie wird der Beginn der indogermanischen Sprachen auf circa 3000 vor Christus datiert, ihre weltweite Verteilung fand durch die europäische Expansion im 15. Jahrhundert, innerhalb der Jahrtausende durch die Völkerwanderungen, statt (Wikipedia, ‚indogermanische Sprachen').
Das Germanische wird mit schlechter Quellenlage zwischen 1000 vor Christus und 500 nach Christus datiert. Ab dem 5. Jahrhundert haben sich durch zwei Lautverschiebungen hochdeutsche Sprachtypen entwickelt (Wikipedia, 'germanische Sprachen').
Das Wort ‚deutsch' erscheint zum ersten Mal 786 in einem mittellateinischen Dokument, ‚Althochdeutsch' wird auf circa 750 bis 1050 datiert (Wikipedia ‚Althochdeutsch'). Seit dem Alt- und auch Mittelhochdeutschen (bis 1350) besteht eine Logik der Übereinstimmung von Wörtern und Satzteilen.
In der regelhaften Übereinstimmung zwischen Wörtern ist die Übereinstimmung des Geschlechts des Nomen und des Pronomen zu finden, die sich bereits im Mittelalter (ab circa 1000) herausgebildet hat.
Seit dem Mittelalter (vgl. Helm 1975, S 37) besteht bis heute (vgl. Duden Band 4, 2016, S 275 und S 303) das maskuline und das damit gänzlich gleichbedeutende neutrum und das feminine Possessivpronomen (‚sin' ist das maskuline und neutrum Possessivpronomen, heute ‚seine'; ‚ire' ist das feminine Possessivpronomen, heute ‚ihre').
Den heute gültigen Grammatikstand zeigt folgende Tabelle:
Sache,Ding
Person, Kind
Pronomen
es
es
Possessivpronomen
sein
Tabelle 1: Das deutschsprachige ‚Es / es‘ und ‚Sein / sein‘ Possessivpronomen
Sowohl die Sache als auch der Mensch weisen ein männliches Pronomen seit dem Mittelalter auf, obwohl das Kind auch weiblichen Geschlechts sein kann. Diese nur geschichtlich erfassbare, vom heutigen Sprachempfinden her widerstrebende Logik wird nun in einen psychologisch-machtdynamischen Zusammenhang zwischen den Geschlechtern gebracht.
Ein Fallbeispiel heute gültigen Sprachgebrauchs
‚Das Kind besitzt das / ein Fahrrad, … ': Ein sächliches ‚Es' besitzt ein sächliches ‚es'. Durch die grammatikalische Gleichstellung des Dings und des Menschen wird einerseits das Ding zu einem lebendigen Gegenstand und andrerseits der Mensch zu einer leblosen Sache, die beiden koexistierenden Bedeutungen des somit gar nicht mehr neutralen neutrum Pronomen entfalten ihre konnotative Macht und ihre Deutungshoheit wechselseitig aufeinander.
‚Das Kind besitzt das Fahrrad, das ihm seine Mutter geschenkt hat'. ‚Das' als Relativpronomen nach dem Beistrich leitet einen Nebensatz ein, indem das Kind (im 3. Fall ‚er', nämlich ‚ihm') in der momentan gültigen deutschen Sprachregelung vermännlicht wird, indem es mit ‚seiner' Mutter oder auch ‚seinem' Vater in Beziehung gesetzt wird.
Das Kind, ‚Es', ist durch das, ‚sein' Possessivpronomen, zum Mann geworden, obwohl es geno- oder phänotypisch auch eine Frau oder ein Mädchen sein kann.
Und die Mutter wird durch die Beziehungssetzung zum ‚Es', dem Kind, auch rein sprachlich ein bisschen durch ‚dessen' Possessivpronomen vermännlicht. Die Definitionsmacht des Possessivpronomens dis- oder entneutralisiert das grammatikalisch als neutral grundgelegte ‚Es' in Richtung Vermännlichung.
In diesem geschlechtspronomialen Verhältnis ‚Er–Es', ‚Sie–Es' ist ein Machtkampf um die Deutungshoheit des Possessivpronomens inhärent, das das Possessivpronomen ‚sein' des ‚Es' auf der Seite des Vaters positioniert.
Es sei festgehalten, dass das Possessivpronomen des Pronomens ‚Es' in Sinne auch der letzten Rechtsschreibreform, die die zurzeit gültige Sprach- und Sprechregelung zum Inhalt hat, ‚sein' lautet und, dass es nicht ‚ihr' lautet oder über ein noch zu erfindendes eigenes ‚Es-Possessivpronomen' verfügt und das, obwohl das ‚Es' ein Bub oder ein Mädchen sein kann.
Will man diesem Sachverhalt der inkomplett und inkorrekt bezeichnenden Benennung Rechnung tragen, würde das eine nicht unwesentliche Veränderung des Sprach- und Satzbaus bedeuten, das von einer Rechtschreibreform geleistet werden sollte und müsste. Und es vielleicht auch tut, wenn es mehrere, auch namhafte Personen einforderten.
b) Genus und Sexus
In der deutschen Sprache hat ‚das Kind' (ein) sächliches Geschlecht, deshalb unterscheidet man in der deutschen Philologie zwischen natürlichem Geschlecht, dem Sexus, und dem grammatischen Geschlecht, dem Genus.
Wenn man sich die obige Tabelle vor Augen führt, ist zu konstatieren, dass der sächliche Genus des Kindes in 50% der Fälle, in denen das Kind ein Mädchen ist, inkongruent mit seinem Sexus ist und mit diesem dann in einem (heftigen) Widerspruch zu einer täglich erfahrbaren Lebenswelt eines medizinisch-biologisch referenzierend-kategorisierten und -kategorisierenden substantivischen Subjekts stehen.
Auf diese Überlegungen beziehen sich das rechte Drittel der Tabelle, die nur 50% (schematisierend vereinfacht) des Bedeutungsfeldes des Pronomens ‚es' repräsentiert und abbildet.
Für die anderen 50% der Bedeutung des ‚es' und dessen pronomialen Geltungsbereiches, der die Sache, das Ding kennzeichnet und referenziert, befinden sich sexus und genus in Kongruenz und sind somit nicht mit germanistischen und lebensweltlichen Widersprüchen behaftet.
Nicht in Kongruenz befindet sich das Possessivpronomen ‚sein', wenn es die geschlechtliche Gegebenheit einer Person vermännlicht und in seiner natürlichen, auf ein weibliches Neutrum bezogenen Gegebenheit durch die inhärente grammatikalische Konstruktion verunstaltet und unkenntlich gemacht wird und ist. Es gibt kaum ein besseres Beispiel, an dem gezeigt werden könnte, wie unumstößlich Sprachstrukturen die jeweils gegebenen Machthierarchien absichern und exekutieren.
Dieses Beispiel zeigt, dass der Sexus, das sächliche Nicht-Geschlecht (im Fall der ersten 50% der Bedeutung bei Sache und Ding) oder das sächliche Geschlecht (im Fall der restlichen 50% der Bedeutung bei der Person, dem Kind), undifferenziert bzw. nicht legitimiert als vermännlichterPlatzhalter für beide Geschlechter zur Anwendung kommt. Und, dass das Geschlecht des Possessivpronomens sich dabei mit seinem auf ein Neutrum bezogenen Genus, dem grammatischen Geschlecht, nur zu den schematisierten 50% in Übereinstimmung befindet.
c) Das Geschlecht neutralisierende Substantiv und das verweiblichende Relativpronomen
In den 80ern ist die männlich-weibliche Verschmelzungsform von Substantiven mit einer relativ breiten Varietät zu datieren, die Universität Wien zum Beispiel sieht folgende Formen geschlechtergerechter Sprache vor, die sich über die Jahre entwickelt haben:
Leser / innen, Leser_innen, Leser*innen, LeserInnen mit dem Binnen-I bzw. Majuskel-I, sind als grammatische Formen weitgehend anerkannt.
Das Majuskel-I geht als erstes auf Christoph Pusch (1981) und auf die feministische Germanistin Luise F. Pusch (1982) zurück (vgl. Wikipedia).
Die Entwicklungsformen geschlechtergerechter Sprache sind, wenn man vom Indogermanischen ausgeht, seit seinem Beginn vor circa 3000 vor Christus, wenn man vom Germanischen ausgeht, seit seinem Beginnen circa 1000 vor Christus, nach circa 5000 / 3000 Jahren eingetreten. Gerechnet vom Anbeginn der indogermanischen Sprachfamilie als sehr unspezifische, historisch und, bezogen auf die unterschiedlichen Spracharten sehr weitreichende Sprachfamilie, sind die letzten Sprachentwicklungen auf einer historischen Landkarte kaum auszumachen.
Wenn man vom Neuhochdeutschen ab 1550 (Frühneuhochdeutsch ab 1350) ausgeht, kommt man auf einen Zeitraum von circa 470 Jahren, als Vorläufer der jüngsten Entwicklungen der letzten 40 Jahre.
Eine Frage, die dabei entsteht, ist, welches Veränderungspotential von Sprache, von dieser Grundlage aus, in Zukunft erwartet werden kann und zu erwarten ist.
Zum Beispiel wäre ein großgeschriebenes ‚Die', das einen Relativsatz einleitet, der sich auf ein Wort mit zum Beispiel einem Binnen-I bezieht, als verweiblichendes Relativpronomen zu bezeichnen, das im vorliegenden Text verwendet wird.
‚LehrerInnen, Die …' wäre das hier referenzierte Beispiel. Das Majuskel-I wäre ein Beispiel, bei dem eine grammatisch weibliche Form eine männliche verdrängt und sich zum weiblichen Phänotypus erhebt mit der Einschränkung, dass das großgeschriebene ‚I' in der Mitte des Wortes eine damit wieder erneute Integration des Männlichen durch die Hintertür bedeutet und anzeigt.
d) Zur gewählten orthographischen Form
Der Autor hat sich für die breitere Form ‚die AutorIn' entschieden, weil Sie sich damit umfassender und weitläufiger mit dem menschlichen Geschlecht identifizieren will. Ebenfalls soll sich die LeserIn breiter identifizieren können.
Das persönliche Fürwort ‚sein', das sich in der deutschen Sprache auf ein neutrales, wie männliches Substantiv bezieht, ersetzt die AutorIn durch ein großgeschriebenes ‚Ihr', um damit einer konkludenten,gegenderten Schreibweise für die 50%ige Bedeutung des Pronomens im Fall des neutralen Personalpronomens, das auch beim Wort ‚Ich' der Fall ist, Rechnung zu tragen. Wer, wenn nicht die Psychologie, sollte über die sprachliche Ausstattung des Wortes ‚Ich' entscheiden dürfen?
Wie die AutorIn auch den Artikel ‚der' durch ein großgeschriebenes ‚Die' ersetzt, und da es der AutorIn reichlich egal sein will, welches Geschlecht eine AutorIn hat, wird auf diese mit einem großgeschriebenen ‚Sie' Bezug genommen.
Die duofunktionale Verallgemeinerung wird hier im Gegensatz zur üblichen unifunktionalen Form der Verallgemeinerung zur Anwendung gebracht, und so lauten die Endungen ‚-In', ‚-Innen', Sie', ‚Ihre', ‚Die', usw.
Da viele Substantive in der derzeitig gültigen deutschen Sprache, wie zum Beispiel der Mensch, der Säugling, das Individuum, etc. auch mit dem männlichen Pronomen ‚sein' ausgestattet sind, obwohl ‚er / es' auch weiblich sein kann, müsste gemäß vorliegendem Entwurf ein großes ‚Ihr' eingesetzt werden, was aber nur exemplarisch beim Wort ‚Ich' und dem Wort ‚Kind' vorexerziert wird. Ein Vorhaben, das darüber hinausgeht würde die AutorIn wie die LeserInnen in einem zu hohen Ausmaß strapazieren und irritieren, und wird daher sein gelassen. Hierarchisch-strukturell nötig und angezeigt wäre es allemal, kann aber sinnvoller Weise nur von einer Gesellschaft als Ganzes mit all ihren Rechtschreibreformen geleistet werden, in welche Richtung dieser Text einen Impuls setzen will.
Zum Aufbau des Inhaltsverzeichnisses
A, B, C, … zeigt die Ich-nahen, 1,2,3, … die Ich-fernen Anteile, Themen und Thematiken an.
II. Existentielle Grundlagen des Ich
A. Hilflosigkeit und Abhängigkeit
Wie es den Primaten entspricht, werden wir auf die Welt geworfen und es ist hell, unsagbar hell und unsagbar laut. Die Wärme und der Geruch eines nahen, lebendigen Körper(objekte)s wird aus einem dunklen Nichts heraus erschlossen.
Das menschliche Wesen ist eine Art kosmischer Gedanke. Es ist als ob, und weil wir immer noch nur wenig über das Mysterium des uns umgebenden Weltalls wissen, wir eine Energieform, die aus den unsagbar unendlichen Möglichkeiten des Seins in ein irdisches Dasein ‚hineinübersetzt' wären.
Ob und inwieweit diese inkarnierte Übersetzungsarbeit gelungen ist oder nicht, darüber ließe sich streiten. Wie uns der eigene Lebensbeginn und das Lebensende nur überraschen konnte und uns überraschend oder weniger überraschend hinwegfegen wird, dieses Faktum zeigt, dass wir vorher darüber nichts haben wissen können und auch nachher werden wir nichts (darüber) wissen können. Wenn wir es könnten, ist es auch ungewiss, ob wir dann noch etwas darüber wissen wollten.
Denn vielleicht ist das ganze menschliche Leben a big joke. Oder zumindest ein übergroßes Rätsel, dem wir kosmische Kleinstexistenzen nicht gewachsen sind. Eine große Zumutung, die uns zugemutet wird, ob wir es wollten oder nicht, denn gefragt hat uns dazu niemand. Und auch die Generationen vor uns konnten dazu nicht befragt werden, wie auch die zukünftigen Generationen nicht befragt werden können, ob sie leben wollten, bevor sie zum Leben erweckt wurden. Die Abfolge der Billiarden Leben ist miteinander ‚verschraubt' wie die mikroskopische Anordnung eine DNS-Moleküls.
Zunächst ist in diesem anfänglichen Lauf des Lebens fast Nichts und sehr, sehr viel Unlust. Der kleine Mensch, den wir geschichtlich, wie jeder Baum seine Baumringe, in uns ständig in einem ‚Nachher' in und mit uns tragen, muss sich ständig ganz grundlegend mit der Welt auseinandersetzen, ob Sie (leben) will oder nicht.
Geschützt ist das Neugeborene zunächst durch eine sehr fundamental wirksame Reizbarriere gegenüber der auf Sie einstürzenden Reizflut:
„Im Allgemeinen besteht die Umgebung des Neugeborenen aus ungeordneten (weil es noch nicht gelernt hat zu ordnen) und fragmentarischen Reizen … Glücklicherweise macht die Erbausstattung des Neugeborenen sein Nervensystem relativ undurchlässig für von außen kommende Reize. Diese relative Undurchlässigkeit heißt Reizbarriere (Kaplan 1983, S 54f).“
Das psychologische Wesen menschlicher Existenz ist das Eingebundensein in zwischenmenschlichen Beziehungen, die dem Menschen aufgegeben sind und die die Grundausstattung der für den menschlichen Primaten gegebenen relevanten Umweltreize ausmachen.
Die ersten Deprivationserfahrungen des Säuglings, und das sind die ersten Erfahrungen von fundamentalem (Trieb)Befriedigungsmangel, sind gekennzeichnet durch den ständigen Versuch der Mutter, dem Säugling das gänzlich neue Leben primär durch ihre animalisch-menschliche Anwesenheit und Wärme zu ermöglichen und in weiterer Folge die zentrale frühkindliche Entfaltungsbewegung zu begleiten (Lehmkuhl 1993, S 27 zitiert Lichtenberg 1991).
Vernachlässigung, Ablehnung und mangelnde Anreize sind die Risiken, dem das frühkindliche Leben ausgesetzt ist, die Bowlby (1973 zitiert nach Lehmkuhl 1993, S 27) zum Thema ‚Bindungstheorie' ausführt und A. Freud spricht von frühkindlichen Traumen.
„Die Mutter ist für das Kind emotional und physisch unentbehrlich: sie ist die einzige und wesentliche Quelle für Schutz, Wärme und Zufriedenheit, aber von ihr gehen auch Frustrationen aus, die eine weitere wesentliche Lebenserfahrung sind. Die Balance dieser Erfahrungen macht die emotionale Sicherheit aus, auf deren Boden später neue Erfahrungen gesammelt werden (Lehmkuhl 1993, S 27).“
Die Abwesenheit von Empathie und libidinöser Zuwendung für eine autarke Ich-Entwicklung beginnt im Idealfall einer gegebenen, positiven Beziehung zur Mutter erst in kleinsten Schritten ab circa frühestens dem ersten Jahr bedeutsam zu werden und diese kann am besten während gewusster Unterstützung der primären Beziehungsperson(en) verarbeitet werden.
Deprivative Ich-Zustände können im Gegenzug zu libidinös geleiteter Zuwendung auch dann entstehen, wenn die gute, überprotektive Mutter oder der gute, überprotektive Vater dem heranwachsenden Kind im späteren Entwicklungsverlauf zu wenig Freiraum für eine gesunde Autarkie lässt, die schon in kleinen Anfängen möglich sein sollte, sodass selbstständiges Verhalten in nicht genügendem Ausmaß positiv verstärkt und unterstützt wird. In den ersten frühkindlichen Jahren stehen jedoch die mitmenschliche Anwesenheit, Unterstützung und Wärme im Vordergrund.
Nur durch die kontingente Treue des primären menschlichen Beziehungsobjektes, der zentralen Bezugsperson, lernt der kleine Mensch sehr, sehr langsam, die Unlust durch die innerliche Repräsentation der gerade nicht gegebenen Triebbefriedigung zu überbrücken. Die erste Triebbefriedigung wird durch die weibliche Brust ermöglicht, so lehrt es die Psychoanalyse, und die bedeutet Lust.
Gemäß Psychoanalyse und Psychotherapie werden die so gelernten Kontingenzen als erste zentrale Gedächtnisspuren unverrückbar ab- und eingespeichert. So wird die erlebte eigene, primäre Hilflosigkeit, im positiven, wünschenswerten Fall menschlicher Entwicklung, mit der (sehr) selten auftretenden Lust gekoppelt.
Das Eingebundensein in die emotionalen Beziehungsbande zu den Bezugspersonen lässt den vernunftbegabten Primaten wie an Fäden gleichsam schwerelos bewegen. Doch dieses Erscheinungsbild der Schwerelosigkeit täuscht. Es sind dies die Beziehungsbedingungen, die dem Primaten seinen Platz ganz zentral in seinem Schicksalsverlauf zuweist.
Bei der Geburt steht die passiv-aktive Rolle der Frau und der psychoanalytisch formulierte, vor allem unbewusste und nicht ausformulierte Neid der Männer, die mit ihrer aktiv-aktiven Rolle nur untergeordnet Leben schaffen können, im Zentrum. Mit diesen langatmig und nachhaltig äußerst bedeutsamen und wirkungsvollen rein Fremd-Ich bezogenen Entwicklungsleistungen, sind typischerweise fast ausschließlich die Frauen der tragende und ausschlaggebende Moment in den ganz frühen Entwicklungsstufen der Kinder. Mann und Frau sind in dieser Hinsicht gänzlich ungleich.
Gleich sind beide Geschlechter dahingehend, als sie gleichermaßen beide nicht gefragt wurden, ob und wann sie geboren werden wollten und ob sie da sein wollen, wohin sie geboren wurden. Auch Zeitpunkt, Ort und Art des Todes sind ungewiss und weitgehend außerhalb des Einflussbereiches der beiden Geschlechter und der Menschen. Sie wurden auch zu ihrem Geschlecht nicht gefragt, das sie in den meisten Fällen dann ihr ganzes weiteres Leben zum Ausgangspunkt ihres Fühlens, Denkens und Handelns mitgegeben bekommen haben.
Nicht nur als Kind, sondern auch betagt, müssen wir eine abhängige Hilflosigkeit erleben, diese verteilt sich mehr oder weniger abgeschwächt auf das ganze Leben. Da und je mehr Jede von äußeren Ressourcen abhängt, die Ihr Überleben physisch und psychisch sichern, die Sie aber – typisch-schematisiert gedacht– am Anfang und am Ende des Lebens nicht eigenständig bestreiten können, ist Ihr autonomer Bewegungsspielraum vor allem in diesen zeitlichen Abschnitten eingeschränkt bzw. gar nicht gegeben.
Vor allem in diesen Zeitabschnitten muss der Mensch mehr oder weniger passiv sein und kann sich nur extern versorgen lassen und ist dann quasi ‚spezialisiert' und muss sich dann aufs Nehmen einlassen bzw. in den letzten Jahren spezialisieren.
Die deutsche Sprache ist nicht besonders einfallsreich, wenn es darum geht, die nicht aktiven, passiven Ich-Zustände des Lebens zu beschreiben: Nichtstun, Müßiggang, (innere) Ruhe und Stille, Meditation, meditative Kontemplation, empfangen, nehmen, (er)leiden, ??, während auch schon (er)träumen und zuhören wieder auf einer eher aktiven Seite eines passiven menschlichen Ich-Zustands zu finden sind. ‚Chillen' ist in diesem Zusammenhang der modische Begriff eines sozial offensiv vorgetragenen ‚Schaut her, ich tue jetzt nichts und fühle mich sehr gut dabei'-Ich-Zustands, der über die soziale Demonstration sich quasi als Überreaktion der damit neutralisierten gesellschaftlichen Abwertung Raum und Platz für die anzuerkennende eigene Passivität zu verschaffen sucht.
Grundsätzlich ist es in einem öffentlichen Auffassungsverständnis Passivität etwas, das an Krankheit, Alter, Behinderung und eklatant unzufriedene oder als mit ‚unzufrieden' ausgewiesene Ich-Zustände gekoppelt wird und demnach dann auch ist. Grundlos passiv zu sein bedeutet etwas Anrüchiges, das uns zwar von der ersten Sekunde an mitgegeben wurde, aber im Verlauf des Lebens auf Geheiß der Gesellschaft hin fast gänzlich verdrängt werden muss.
Die permanenteAktivität, ohne bewusste Handhabung als Gegenstück zu passiven Ich-Zuständen wie dem Schlaf zum Beispiel – auf welcher Basis jeder aktive Ich-Zustand am Tag letztlich operiert und operieren muss – wird besonders in den westlichen Gesellschaften hochgejubelt und bis aufs Verrecken zelebriert. Es verwundert daher auch nicht, dass eine ganze Gesellschaft Probleme mit dem Schlaf hat, was auch den schlafbezogenen Medikamentenverbrauch der vielen letzten Jahrzehnte in die Höhe schnellen lässt.
Aktivität bedeutet für den Menschen Unabhängigkeit und Leben, Inaktivität ist von Grund auf an Hilflosigkeit, Versorgt werden müssen und in letzter Konsequenz an Sterben gekoppelt. Besonders in unserer auf Selbstverantwortlichkeit getrimmten, momentanen Gesellschaftsform ist Inaktivität zu verleugnen, will man als ein gänzlich anerkanntes und nützliches Subjekt einer Sozietät erscheinen, sich als dieses – makellos – präsentieren und als solches selbst auch fühlen können. Diese Modalitäten der Verleugnung sind sehr gut an den öffentlichen, momentan gültig-einflussreichen Ich-Präsentationsformen und Ich-Sprechakten abzulesen.
Und Werbesujets machen uns glauben, dass nur die Aktiven schön sein können und, dass nur die Schönen aktiv sind, eine sich selbsterklärende Gleichung mit quasi synonymen Termen links und rechts. Im Zentrum steht der Glaube und die inhärente Überzeugung, dass das Individuum der Schöpfer seines eigenen Ich ist, das stark, kräftig und aktiv im Leben steht und gänzlich erhaben ist über seine eigene hilflose Abhängigkeit von einem sozialen Zuarbeiten der (relevanten) Anderen und seine damit gegebene externe Versorgungsbedürftigkeit.
Schon das Wort ‚Nichtstun' und das Wort ‚Müßiggang‘ besteht zur Hälfte aus mit Aktivität und zur Hälfte mit Passivität affizierten und ausgestatteten Ich-Zuständen. Die erste Hälfte der dabei sprachlich abgebildeten Bestandshaftigkeit des Ich des (Er)Leidens wird gerade in einer zurzeit besonders gehypten normativen Eindimensionalität ausgespart und abgespaltet.
Kann sich eine Person heute als aktiv-gesund für alle glaubhaft präsentieren, bekommt sie dafür gesellschaftliche Aufmerksamkeit und wird mit hohem Status belegt und die gibt die öffentlichen Zuordnungsrelationen zu Personen vor, die diesem Schema nicht entsprechen und / oder zuarbeiten wollen und können.
Die gesellschaftlich-sozialen Figuren und Formationen der Unterordnung der etikettiert-ausgewiesenen und auf diesem Wege isolierten Passiven werden schon früh in die Gehirne und Beziehungskulturen der Einzelindividuen eingebrannt. Zentral dabei sind die durch Sanktion und Gratifikation herausgebildeten Ich-Zustände, die durch spezifische Aktivitäts- und Passivitätsprofile gekennzeichnet sind und als herzustellen und unbedingt nachahmenswert gekürt oder als nicht erstrebens- und verachtenswert gebrandmarkt werden.
B. Symbiose und Individuation
In der Biologie und Lebenskunde ist unter Symbiose das Zusammenwirken mindestens zweier Organismen gemeint, das für die beteiligten Mitwirkenden eine Erleichterung, einen Vorteil und Gewinn bringt bzw. ohne das ein Überleben gar nicht gesichert werden kann. Oft sind es die in der Natur beobachtbaren ‚Kooperationspartner', die verschiedenen Arten zuzurechnen sind, wie zum Beispiel die Symbiose zwischen Baum und Pilz. Deren Symbiose manifestiert sich in mannigfaltigen Netzwerken aus Fäden, die den Transport und den Austausch von Substraten zwischen Baum und Pilz bewerkstelligen.
Im Fall Organismus Mensch ist das erste Netzwerk des intrauterinen Fötus die Nabelschnur, die die Mutter direkt mit dem Kind für deRen Versorgung mit Sauerstoff und deRen allumfassende Ernährung in einer untrennbaren Verbindung mit der Mutter unterhält. Das ist der Rahmen des substanziellen (Über)Lebens des neu ins Erduniversum eintretenden Organismus, der im gänzlichen Zentrum eines und des Mutterorganismus platziert ist. Die Biologie schreibt und spricht man von Wirt und Symbiont, einem großen und einem kleinen, in gegenseitiger, miteinander im Einklang befindlicher Organismen, deren Symbiose für beide Seiten überlebensnotwendig und -relevant ist.
Die weitere Kindheit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch als vernunftbegabter Primat ein Nesthocker ist,er gehört zu den Primaten mit der längsten extrauterinen Brutzeit. Die erste und längste Form Ihrer Symbiosen ist die Symbiose mit der Mutter, dem Vater oder mit anderen, vor allem in den ersten Lebenseintrittsphasen anwesend-präsenten primären Bezugspersonen, die zumeist und hoffentlich ganz zentral in Form der Ernährung mit der Milch spendenden Mutterbrust beginnt.
Die Richtung der Symbiose setzt eine Individuation des koevolutionären Organismus Mensch in Stand, die das (Über)Leben ermöglichen muss und diesem Ziel alle Begleitbedingungen unter- und nachordnet. In erster Linie bedeutet Individuation Trennungsangst und für die WirtIn und SymbiontIn die Notwendigkeit des psychischen Loslassens Ihrer WirtIn / Ihrer SymbiontIn.
Mahler, Pine und Bergman (1996, S 263f) beschreiben die Polarität zwischen dem Stimmungsabfall durch die Abwesenheit der Mutter einerseits und dem ersten, mit fünf bis zehn Monaten einsetzenden Drang nach autonomer Ich-Entwicklung, zusammen mit Interesse und Lust am Funktionieren und Erforschen, andrerseits.
Für die Ausbildung autonomer Ich-Funktionen bedarf es Selbstvertrauen und Trennungsreaktionen wirken selbstbegrenzend (s.o. S 264). Die Zuwendung zum Vater und anderen, die Mutter ersetzenden Bezugspersonen, beendeten zum Beobachtungszeitpunkt von 16 Monaten die Trennungsreaktionen abrupt (s.o.).
Die Symbiose zwischen der Mutter (den Eltern) und dem Kind, verbindet die zwei sehr unterschiedlich gelagerten Machtzustände und besonders in den ersten Jahren ist die Abhängigkeit vom Kind zur Mutter, bis auf die emotionale Abhängigkeit der Mutter vom Kind, in vollem Ausmaß einseitig, weil das Kind für seine Erhaltung nur sehr wenig beitragen kann, es muss essen, seine oft angstvollen und aversiven Ich-Zustände aushalten, langsam heranwachsen, etc.
Symbiose und Individuation ist ein Themenbereich mit einer sehr langsamen, langatmigen Dynamik, dieser Prozess geht nie zu Ende und je nach Beobachtungszeitraum und Alter lassen sich bestimmte Themen eingrenzen, die in den jeweiligen Altersstufen im Vordergrund stehen.
Später bezieht sich das Begriffsfeld der Ich-Autonomie auf den gewonnenen Abstand zu den eigenen Trieben, zu den primären Bezugspersonen, wie auch auf den gelebten individuell-autonomen Bewegungsspielraum in den primären und sekundären Liebesbeziehungen, in den Beziehungen zu den eigenen sozialen Netzen und in den Beziehungen in den Institutionen und Gruppenszenarien der Arbeit, usw.
Die erste Beziehung ist die des Säuglings zu Ihrer Mutter, sein primär zentrales Beziehungsobjekt, das zuallererst als primäres äußeres Aktivitätszentrum fungiert, um den naturgegeben in seinem Bewegungsraum eingeschränkten und hilflos-passiven Säugling zu versorgen.
Individuation ist in dieser Logik erst dann möglich, wenn der Säugling zu einer in den ersten Lebensjahren grundlegenden Aktivität im Stande ist, die nicht primär dem Bereich, der überlebensrelevant ist, zurechenbar ist. Individuation ohne Symbiose ist in den ersten Lebensjahren nicht möglich und stellt einen nicht wünschens- und erstrebenswerten Zustand eines Kleinkindes dar, der sich dann nur quasi ganz von selbst einstellen sollte.
Somit ist davon auszugehen, vor allem in einem überdeutlichen Gegensatz einer öffentlich gehypten Ich- und Selbstpräsentation, dass jegliche Individuationsprozesse in der Symbiose mit dem menschlichen Wirten grundgelegt wird und ist.
C. Die Versorgtwerdensfunktionen des Selbst
Das Individuum ist auf sich selbst gestellt und wenn es überleben will, soll und muss, muss es zumindest a la long Nahrung aufnehmen, das heißt es muss essen. Wie gezeigt werden wird, ist der Essensbereich ein Bereich, der sich einerseits aus substantiell-materiell zu befriedigenden Bedürfnissen zusammensetzt und gleichzeitig andrerseits durch die libidinöse Versorgungsnotwendigkeit einer externen Ich-VersorgerIn und einer substantiell-materiellen Abhängigkeit von dieseR gekennzeichnet ist.
Neben der sehr unmittelbar-hilflosen Abhängigkeit von einer externen substantiell-libidinösen Zuwendungs- und Aufmerksamkeitszufuhr (Libido ist kurz mit ‚Lebensenergie' übersetzbar) besteht die frühkindliche Abhängigkeit von der extern gegebenen Nahrungsquelle, deren Versorgungspotenz auch den inneren Essensdrangdes Säuglings reguliert, wenn dieser ungestört zum Ausdruck kommt und kommen kann und darf.
„Die Essfunktion dient in erster Linie dem biologischen Körperbedürfnis nach Nahrung und steht im Einklang mit den Es- und Ichkräften, die gemeinsam auf die Selbsterhaltung des Individuums hinarbeiten. Sie liegt deshalb außerhalb der Sphäre psychischen Konflikts … Andrerseits kann das Essen sexuelle und aggressive Bedeutung annehmen und auf diese Weise sekundär zum symbolischen Vertreter von Esswünschen werden … (A. Freud 2006, S 23).“
Abgesehen von der sexuellen und aggressiven Überhöhung des Essenstriebes, wird die Stillung des Hungers durch die gebilligt-akzeptierte Nahrungszufuhr als Befriedigung erlebt und ist mit Lust verbunden. Damit kann schon der frühe Säugling Unbehagen und Schmerz vermeiden und Lust gewinnen und die so gewonnene ‚Lustprämie' wirkt als Verstärkung des Antriebs zur Selbsterhaltung durch Essen (s.o.).
Zwei Möglichkeiten fasst Freud (s.o.), auf welche Art und Weise diese Essfunktion störungsanfällig werden kann:
durch Veränderungen des Organismus, die den Überlebenstrieb und / oder sein Nahrungsbedürfnis schwächen können,
durch Veränderungen im Lustcharakter bzw. des Lustcharakters der Funktion als nichtorganische Störungen des Essensdranges, der durch einen entstehenden Konflikt zwischen Esstätigkeit und Ichkräften in Form von Aggressivierung und / oder Sexualisierung der Essfunktion entstehen kann.
In dem Maß, in dem die primäre Essfunktion von anderen zentralen (An)Trieben überlagert wird, sinkt somit die hilflose Abhängigkeit von der externen Nahrungsquelle, unter der zumindest kurzfristigen Gefährdung der Selbstexistenz, was langfristig aber einen vitalen Überlebenstrieb im sozialen Ganzen befriedigen und darstellen kann.
Ontogenetischganz früh befindet sich damit die Menschheit, vermittelt über den grundlegenden Essensdrang, im Bereich der Umwelt-Ich- bzw. Ich-Umwelt-Beziehungsregulation.
Losgelöst von substantiellen Bedingungen lässt sich der Versorgungsprozess des Menschen auch ausschließlich nach denlibidnös gegebenen Bedingungen auswerten: Vor allem steht die frühe Kindheit als ultrasensible Phase primärer Fremd-Ich-Steuerung im Zentrum, wie das von der herkömmlichen Psychoanalyse sehr gut herausgearbeitet wird, die die intrapsychischen und interpsychischen Bedingungen (kindlicher) Entwicklung aus einer originären Perspektive heraus aufbaut und analysiert.
Das Ich benötigt Aufmerksamkeit und Zuwendung, wenn Sie das nicht bekommt, verkümmert Sie und magert im übertragenen Sinn ab, wie Eine Magersüchtige; ist dann ein Minimum an libidinöser Energie, die von außen zugeführt werden müsste, nicht in ausreichendem Ausmaß gegeben, entstehen a la long pathologische Zustandsbilder.
Die Tendenz der PsychoanalytikerInnen, in das Neugeborene erwachsene psychische Orientierungen und Bewegungen hineinzuinterpretieren, wird von Ihnen selbst als ‚adultomorph' bezeichnet und ausgewiesen. Aus psychogenetischer Sicht lässt sich gegen diese eigene adultomorphe Tendenz argumentieren, dass die psychischen Eigenschaften, die sich im späteren jungen Leben zumindest ansatzweise herausbilden werden, beim Neugeborenen auch schon in irgendeiner Weise gegeben sein müssen.
Irgendeine Form einer Ambivalenz zwischen Hass auf die VersorgerIn, von der das Neugeborene abhängig ist und von einem Schuldspektrum, in der sich das Neugeborene aufgrund der eigenen frühen Fähigkeit zur Verweigerung der Nahrungsaufnahme und der Akzeptanz und Aufnahme der Zuwendung der Mutter befindet, wird es wohl im frühkindlichen Alter (auch) sicher schon geben, wie auch in den späteren Kindheitsjahren.
Das zumindest rudimentär gegebene Empfinden des Neugeborenen von persönlichem Hass und vor allem einer Form von Ablehnung einerseits und des Erlebens von persönlicher Schuld andrerseits sind in diesem Zusammenhang auch als persönliche Blockaden und als persönlich initiiertes Unterbrechen des von der Mutter angebotenen Geben-Nehmens-Flusses zu interpretieren. Natürlich unterbricht auch die Mutter den Geben-Nehmens-Fluss ihrerseits.
Es ist auch davon auszugehen, dass es, besonders in der ultrasensibel-empfänglichen Phase des Säuglings und des führen Kindes, zu massiven Beeinträchtigungen zum Beispiel durch unangemessene Sauberkeitserziehung oder durch das Ausüben direkter physischer und / oder psychischer Gewalt kommt.
Das sind Beispiele, die zeigen, dass die externe Versorgung mit positiv-libidinöser Energie des Kindes schon früh fundamental-massiven, oftmals irreparablen Schaden erleiden kann, der einen gänzlich – nach psychologischen Leitkriterien – nicht tolerierbaren Verstoß gegen die sehr frühen Persönlichkeitsrechte eines Menschen darstellt.
Als psychische Repräsentanz von willentlich oder unwillentlich zugefügtem Schaden subsumiert Fiedler (2013, S 13) die Reaktion auf Traumen mit drei Punkten, das implizite Gedächtnis wirke dabei unbewusst:
konditionierte Reaktionen in Form von Ängsten oder Phobien
intrusives Wiedererleben traumatischer Erfahrungen
Reaktivierung affektiv-kognitiver Schemata, die zu komplexen Handlungsfolgen führen können.
Traumen sind wiederkehrende, über die persönlichen Grenzen weit hinausgehende Belastungen, die in ihrem Kern, quasi eingebaut, auf primäre Belastungen und Belastungsformen verweisen, indem sie sich im Verlauf eines Lebens summieren und potenzieren.
In ihrem Buch ‚Was schenken wir Kindern' beschreiben Hüther und Stern (ohne Jahreszahl, S 70) sehr treffend den Einprägungsprozess bei kindlichen Traumen:
„Frühkindliche Amnesie, also Gedächtnisverlust, nennen die Psychologen das Phänomen, das nach Traumatisierung auftritt, die Kinder bereits sehr früh, vor dem Spracherwerb erleiden müssen. Das furchtbare Erleben ist dann später nicht mehr bewusst erinnerbar, bleibt aber im ganzen Körper verankert und äußert sich in einer Vielzahl unterschiedlicher körperlicher Symptome und Beschwerden. Dass das für die glücklichen Erfahrungen der frühen Kindheit und den damit einhergehenden körperlichen Empfindungen in gleicher Weise gilt, war bisher nur wenigen bewusst. Wie sehr sich eine Person später im Leben mit ihrem Körper verbunden und in ‚ihrer Haut' wohlfühlt, hängt also ganz entscheidend davon ab, ob sie als Kind die Erfahrung machen konnten, sich als angenommen, wertgeschätzt und geliebt zu erleben.“
Hopkins (2008, S 83) bezieht sich auf Winnicot 1970, Die sich auf Bowlby´s Bindungstheorie bezieht, Die davon ausgeht, dass die Mutter, indem sie den Säugling in einer bestimmten Art und Weise hält, bereits überdeutlich Liebe und / oder Abweisung signalisieren kann.
Die AutorIn möchte nicht mit Ihren Ausführungen die unvermeidbare ‚Boshaftigkeit' der auch willentlich guten Eltern beschreiben, sondern auf die sensiblen Zonen des libidinösen Versorgungsstromes hinweisen, dem sowohl die Mutter wie auch das Kind ausgesetzt sind bzw. sein sollten und / oder sein könnten.
Im späteren Leben wird die Angst vorMutterverlust durch die allgemeinere Angst vor Liebesverlust ersetzt, die dann auch die libidinöse Versorgung durch egalitäre BeziehungspartnerInnen der sogenannten Erwachsenen kennzeichnet bzw. kennzeichnen muss, wenn psychische Gesundheit vorliegt, die sich in einem sehr grundlegend-autonomen Spektrum befindet oder befinden sollte.
Soweit zu einer individuell positiv zu lesenden Entwicklungsgeschichte.
Gemäß Kenntnis der psychoanalytischen Literatur als Nicht (praktizierende) PsychoanalytikerIn bleibt für die AutorIn im Dunkeln, inwieweit Psycho- bzw.Soziopathie als primäre und sekundäre Verarbeitungsrealität frühkindlicher Traumen als verursachter,irreversibler Schaden zu werten ist, oder inwieweit den gehirnphysiologischen Daten zu vertrauen wäre, denen entsprechend ein zum statistischen Schnitt nicht gegebenes genetisches emotionales Reaktionsmuster bei Psychopathie angenommen werden muss, das bei 5% einer normalen Bevölkerung gemäß diesen Befunden auftritt (vgl. Stout 2006, Externbrink / Keil 2018). Gemäß Einschätzung und Erfahrung der AutorIn liegt die durchschnittliche Verteilung von sozio- und psychopathischen Charakteren bei Leitfiguren und in sozialen Netzen, jedoch bei circa 8%.
Im ersten Fall ist Psychopathie als Reaktion auf einen extern zugefügten Schaden im frühkindlich-libidinösen Versorgungsstrom zu verstehen, auf den eine Minderheit mit ontogenetisch permanenter Fremdaggression reagiert, anstatt mit permanenten Traumen und persönlichem Leid, wie bei der Mehrzahl der frühkindlich Geschädigten; im anderen Fall ist es eine gehirnphysiologisch-genetische Eigenschaft der gefühls(-verarmt-)entleerten menschlichen Erscheinungsform des Psychopathen.
Inwieweit diese statistisch seltene gehirnphysiologische Eigenschaft auch durch frühkindliche Traumen eingraviert wurde, dazu gibts nach Wissen der AutorIn nur sehr vereinzelte Untersuchungen.
D. Regression
Gemäß S. Freud ist das Unterbewusstsein das (phylogenetisch und ontogenetisch) älteste System des menschlichen Ich. Es birgt
„… das große Reservoir libidinöser, triebhafter Wünsche (Geißler 2001, S 42). Die anderen Systeme [, die Systeme des denkfähigen und regelgeleiteten Bewusstseins,] gehen aus ihm hervor, in erster Linie als Folge enttäuschter Triebansprüche.“
Regression kann auch mit Rückfall in phylo- und ontogenetisch frühere und vorhergehende Ich-Zustände und Verhaltensmuster charakterisiert und kurzgefasst werden. Alle enttäuschten Triebansprüche, die ins Unterbewusstsein versenkt werden, um nicht ständig die täglichen Routinen zu stören, kommen irgendwann einmal in Form von Regressionen wieder ans Tageslicht oder können, ausgelöst durch mannigfaltige Stimuli, wieder zum Vorschein kommen. Dabei können ältere, früher valide Verhaltens- und Empfindungsmuster wieder in den Vordergrund treten.
Regression bedeutet, in der eigenen und / oder kollektiven Entwicklung zurückzugehen und in sich wiederholende Entwicklungsstadien der Vergangenheit einzutreten, das wäre dann eine eigene, individuelle Regression oder eine Paarregression oder eine kollektive Regression. Häufig sind dabei extreme Belastungen oder die Vorwegnahme von Belastungen die Auslöser.
Die Regression kann sich in Form eines Rückzugs auf extrem aktive oder extrem passive Verhaltenstendenzen zeigen, das Selbst kann sich dabei in verschiedenem Ausmaß desintegrieren oder fragmentieren (Geißler 2001, S 66).
Bei neuen, zum Beispiel technisch-digitalen Entwicklungsschüben, die allgemein und gesellschaftlich stattfinden und Platz greifen, können diese neuen kognitiven und motorischen Anforderungen, die zum Beispiel die Erfordernisse des Bedienens von Computern und deren Programmen an jedes einzelne Ich stellen und ohne die eine normale Bewältigung des Alltags zunehmend unmöglich wird, die Wahrscheinlichkeit einer individuellen und kollektiven Regression erhöhen.
Regression setzt auch dann ein, wenn Bedingungen und die Bewältigung von Bedingungen unausweichlich über das Ich hereinbrechen, über die es die Kontrolle verliert und ziemlich rasch mit diesen neuen Bedingungen umzugehen hat und die mit diesen neuen Bedingungen einhergehenden Anforderungen neu erlernen muss.
Der Pathologie zuzurechnen sind dabei Ich-Zustände, bei welchen es für das Ich nicht mehr möglich ist, über sich selbst die Kontrolle zu bewahren dahingehend, dass die Ich-Zustände und Verhaltenstendenzen in einer nach außen gerichteten, extravertierten, überaktiven Richtung (zum Beispiel Kontrollwahn durch obsessive Gewaltexzesse) oder einer nach innen gerichteten, introvertierten Richtung (zum Beispiel Kontrollverlust, auf welchen psychologisch-therapeutische Intervention spezialisiert ist) abgleiten.