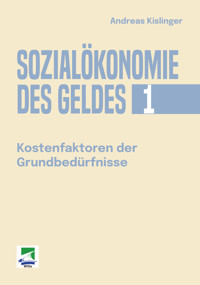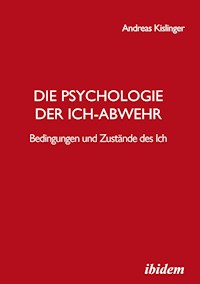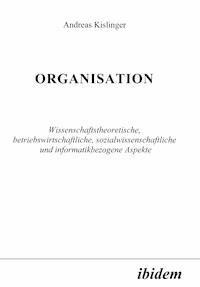19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Andreas Kislinger behandelt historische, politische, rechtshistorische und wirtschaftliche Aspekte des modernen Staates, dessen Beginn als Territorialstaat im Mittelalter angesetzt wird. Im Zentrum stehen historische Auf- und Abbauprozesse, die den Verlauf der jeweiligen politischen Herrschaftsform bedingen und prägen. Wichtige historische Wendepunkte: • Ab 1648 Durchsetzung der ersten individuellen Rechte. • Um 1790 kam es zu französischen Revolutionsverfassungen, zur polnischen und zur amerikanischen Verfassung. • 1831 beinhaltete die kurhessische Verfassung die Grundrechte Gleichheit vor dem Gesetz, Religions- und Berufsfreiheit sowie eine Eigentums-, Markt- und Finanzverfassung. • Ab den 1950ern waren und sind die Nachkriegsstaaten in Europa durch Demokratien und parlamentarische Monarchien als Staats- und Regierungsform gekennzeichnet. • Die sich durchsetzende Wirtschaftsorientierung in den Demokratien und parlamentarischen Monarchien basiert auf der engen Kooperation zwischen Staat und Arbeitssphäre in den 1940ern und den 1970ern. • Abgelöst wurden und werden die Demokratien der 1970er durch die Staatsform des autoritären Etatismus (Nicos Poulantzas). Andreas Kislinger gibt eine aktuelle Zusammenschau der mit der Staatsthematik befassten Denkrichtungen und stellt damit eine Beurteilungsgrundlage für gegenwärtige staatspolitische Entwicklungen bereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Für Edda, Michael, Anja und Lennart
(Verwandte nach Alter abwärts gereiht)
Inhalt
Vorbemerkungen
1. Grundlagen des modernen Staates
1.1 Territorium, Gewalt und Kriege
1.2 Der Nationalstaat
1.2.1 Nationalstaat als politische Kategorie und Einheit
1.2.2 Völkerrecht als nationalstaatliche Grundlage
1.2.3 Der Nationalstaat als organisationelle Einheit
1.2.4 Gesellschaftsklasse, Ethnie und Staat
1.2.5 Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung
1.2.6 Nationalismus
1.3 Der moderne Staat
1.3.1 Kriterien und Kategorien des modernen Staates
1.3.2 Gewaltenteilung des modernen Staates
1.3.3 Historische Elemente des Mehrparteiensystems
1.3.4 Staat, Regierung und Parlament
2. Politik
2.1 Definitionsmerkmale von Politik
2.2 Kennzeichen politischer Herrschaft
2.3 Geschichte des staatlich gültigen Rechts
2.3.1 Entwicklungselemente des staatlichen Rechts
2.3.2 Staatliche Verfassung im 19./20. Jahrhundert
3. Politische Entwicklung
3.1 Faktoren historisch-politischer Entwicklung
3.1.1 Materialismus, Aufklärung und Rationalität
3.1.2 Menschen-, Völker- und Frauenwahlrecht
3.1.3 Geschichte zentraler staatlicher Organisationen
3.1.4 Zur Betriebswirtschaft des Nationalstaats
3.1.5 Staatliche und staatsnahe Unternehmen
3.2 Faktoren historisch-politischen Umbruchs
3.2.1 Staatliche Herrschaft und ihre Ablöse
3.2.2 Ideologiewechsel
3.2.3 Gesellschaftliche Polarisierung
3.2.4 Öffentliche Güter als linkes Projekt?
3.3 Zeitdimensionalität von Staatsentwicklungen
3.3.1 Historizität politisch wirksamer Kräfteverteilungen
3.3.2 Auf- und Abbau von Rationalität
3.3.3 Die Ungleichzeitigkeit von Entwicklung
4. Demokratie
4.1 Demokratie- und Wirtschaftsgeschichte
4.1.1 Historische Etappen in der Politikwissenschaft
4.1.2 Parlaments-, Parteien- und Rechtsdemokratie
4.1.3 Historische Logik des nationalen Steuerwesens
4.1.4 Finanzstruktur von Nationalstaaten
4.1.5 Die europäischen Nachkriegsstaaten
4.2 Die Verfasstheit des demokratischen Staates
4.2.1 Geschichte der demokratischen Verfassung
4.2.2 Logik und Prinzipien von Rechtstaatlichkeit
4.2.3 Völkerrechtliche Gliedstaatenstruktur
4.2.4 Partikuläre Verfasstheit: Sozialpartnerschaft
4.3 Staatsdemokratische Basisfunktionen
4.3.1 Faktoren demokratischer Institutionen
4.3.2 Zivilgesellschaftliche Selbststeuerung
4.3.3 Zentrale Demokratieprinzipien
4.3.4 Das regulatorische Potential von Demokratien
5. Die Revision eines Staatsapparates
5.1 Imperialismus
5.2 Die Auswirkungen einer Weltordnung
5.3 Denationalisierung als staatliche Revision
5.4 Ungleichgewichtete rechte Bewegungen
5.5 Machtzuwachs innerstaatlicher Rechtsanwendung
5.6 Postnationale Demokratien in der EU
6. Der Staat im 20./21. Jahrhundert
6.1 Faschismus
6.2 Die Macht rechtspolitischer Ordnung
6.3 Die prinzipielle Ausrichtung von rechts und links
6.4 Der innerstaatliche Neoimperialismus
6.5 Der europäische Verfassungsrahmen
Nachbemerkung
Literaturverzeichnis
Vorbemerkungen
Inhaltliches
Menschenrechte und Grundrechte stellen unverrückbare, unwiederholbare historische Meilensteine dar, und man kann in diesem Fall nicht von einer historischen, zumindest relativen zeitlich-geschichtlichen Invarianz von politischen Entwicklungen ausgehen. Die diesbezüglichen historischen Ereignisse sind, was die Vergangenheit betrifft, unwiderrufbar abgeschlossen, sie haben stattgefunden und gelten von diesem Zeitpunkt der konsensualen Beschlussnahme dieser Rechte an.
Natürlich können bestimmte rechtliche Errungenschaften wieder rückgängig gemacht werden, die den Bereich der sozialstaatlichen Demokratietheorie markieren, was im Moment ein zentrales Krisenszenario der Demokratie darstellt.
Historische Wiederholbarkeit und die tatsächliche Wiederholung kann hauptsächlich dann zu einem bestimmten Ausmaß unterstellt werden, wenn verschiedene Erdteile miteinander verglichen werden und deren jeweilige Entwicklungen in das insgesamt gezeichnete Bild mit hineingenommen werden, in dem sich Entwicklungen und Prozesse, die in einem Erdteil als relativ abgeschlossen gelten können, in anderen Erdteilen noch nicht eingetreten sind, und sich daher im Vergleich zum ausgehenden Betrachtungsbeispiel, zum Beispiel Europa, noch wiederholen können.
Wenn die Menschenrechte in einem Erdteil gänzlich nicht stattgreifend eingetreten sind und möglicherweise auch nie eintreten werden, ist dort das Ausmaß der ständig sich vollziehenden, relativen zeitlich-geschichtlichen Invarianz in einem überschaubaren und absehbaren Zeitraum gleich Null. In diesem Fall lässt sich in globalem Zusammenhang eine relativ umfassende politische Varianz unterstellen.
Als relativ invariant sind die historischen Entwicklungen während des dritten Reiches zu bezeichnen, da Autokratien, wie stringent und konsequent sie auch durchorganisiert wurden und werden, überall auf dem Erdglobus zu finden waren und sind.
WIKIPEDIA ('Autokratie') definiert autoritäre und totalitäre Regime, die auch nach neuester Fassung hybride Regime und defekte Demokratien als Mischform dabei integrieren, als Autokratie.
Für Mitteleuropa in der Mitte des 20. Jahrhunderts arbeitet ARENDT (2014) die Merkmale totaler Herrschaft aus. Diese Thematik wird aber im Folgenden nur gestreift und erhofft sich dabei eine verstärkte Repräsentanz des Arendtschen Ansatzes in historisch-politischer Forschung.
Der Ansatz des vorliegenden Textes verfolgt vielmehr das Ziel, staatstragende politische Bestandteile und Entwicklungen, die heute (noch) aktuell sind, vor dem geschichtlichen Hintergrund zentral ausgehend vom frühen Mittelalter in Europa, herauszustellen.
Staatspolitische Strukturen und Prozesse sind in großen Zeiträumen im Längsschnittvergleich als historisch relativ variabel zu fassen, obwohl demokratische Basisstrukturen zum Beispiel anfänglich schon im Griechenland der Antike gegeben waren.
Zwischen Autokratien und repräsentationsliberalen Demokratien sind signifikante Unterschiede in der Funktion der Gewaltenteilung, Parlamente und Partei(en) auffind- und charakterisierbar, in diesem Vergleich gibt es eine relativ große Varianz politischer Entwicklungsgeschichte, die sich im historischen Längs- und Querschnittvergleich zeigt (oder zeigen würde, wenn diese in vermehrtem Ausmaß durchgeführt würden).
Die demokratischen Verfassungen sind durch die tragenden wirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Basisfunktionen gekennzeichnet, die auf menschenrechtlich-grundrechtlichem Fundament gebaut sind, dessen Legitimation in den letzten Jahrzehnten im Zuge einer Revision des Staatsapparates und des sich durchsetzenden autoritären Etatismus einer delegitimierenden neoimperialistischen Erosion ausgesetzt zu werden begann.
Der aktuelle, neuere Trend der liberal-demokratisch-parlamentarischen, in Europa gegebenen Verfassungen, hat verstärkt unter anderem die parteiübergreifende Möglichkeit der mittels Misstrauensvotum absetzbaren Regierung zum Inhalt, die in der Analyse bis zum aktuellen historischen Zeitpunkt als relativ neu und variabel bezeichnet werden kann.
Ethisches
Der Verfasser bestätigt, dass die ehrenamtlich tätige WIKPEDIA, die im vorliegenden Werk immer wieder in Form von klärenden, häufig fundamental-orientierenden, manchmal vereinfachenden Ankernachweisen zum Einsatz gebracht wird, zwar allerorts freimütig benützt wird, von außerhalb, von wissenschaftlicher Seite zum Beispiel als semikonkurrent, unter qualitativen Gesichtspunkten andererseits aber als bestenfalls untergeordnet eingestuft wird, aber trotzdem von dieser Seite ausgehend, in einem unleugbaren Ausmaß misstrauisch beäugt wird.
Der Verfasser bestätigt weiters, dass eine schlichtweg dankbar-mitfinanzierende Haltung für die umfassend hoch-qualitative freiwillige Arbeitsleistung der global freiwillig-engagiert-mitarbeitenden Millionen vielerorts – vor allem vom Profit Sektor, zu dem auch die Universität mit Ihren lohnfinanzierten MitarbeiterInnen aus Sicht der häufig umwegfinanzierten sogenannten Ehrenamtlichen zählen – großmütig ausgespart bleibt.
Betrachtet man dieses Verhältnis zwischen den ehrenamtlichen erzeugten und vom Profitsektor freimütig eingesetzten Arbeitsergebnisoutput näher, kommt man nicht umhin, ganz unprätentiös anzufangen, über die an dieser Schnittstelle wirksam-gültig-allumfassend-herrschende Betrugslogik, von den BetriebswirtInnen salopp und einfach als 'Verwertungslogik' bezeichnet, räsonieren zu müssen.
Verwertung, so wie die Luft zum Atmen, die ist da und man nimmt sie sich einfach, man kann sie eben sehr gut an passender Stelle einsetzen, wenn man damit öffentlich konfrontiert würde, nimmt man natürlich weit Abstand davon, dass man sich eingestehen würde und müsste, dass man im Allgemeinen darauf angewiesen ist und sie schließlich braucht.
Wofür die einen fast gänzlich unfinanziert und statusmäßig häufig abgewertet ihre Lebenszeit freiwillig im Dienste aller zur Verfügung stellen, meint der Großteil der übrigen Arbeitswelt meinen zu müssen, ernsthaft, ehrlich und anständig genau darüber verfügen zu können, und wissen sich dabei voll im Recht und in herausragender Legitimation.
(Zu) Viele denken und glauben sich dabei und dafür rundum-gänzlich und im besten Sinne aller Welten autorisiert.
Natürlich, so werden die BetriebswirtInnen einwenden, ist das gesamte staatlich-steuerliche Gemeinwesen von betriebswirtschaftlicher Wertschöpfung abhängig.
Und natürlich, so wird das millionenschwere Ehrenamt im Gesamt-Erde-bezogenen Zusammenhang einwenden, dass sie von dieser, ach so hehren Wertschöpfung noch kein direktes Geld für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit gesehen haben (manche arbeiten bei der Wikipedia freiwillig 60 Wochenstunden und mehr), sondern vielmehr von den zugeworfenen Krümeln und Almosen einer nicht unbedingt zugewandt-wohlgesinnten 'Gemeinschaft' ihr engagiertes Dasein zu fristen hätten.
Dieser streitgesprächig-gesprächsstreitige Argumentationsstrang ließe sich endlos weiterführen, vertreten die beteiligten Parteien ihren Ausgangspunkt unbeirrt und hartnäckig immer und immer so weiter.
Die Zitationen des vorliegenden Textes
Die Begriffserklärungen sind meist der WIKIPEDIA entnommen und auch war sie bei der Erarbeitung der zusammenhängen Sachverhalte äußerst zweckdienlich.
Die den zitierten WIKIPEDIA-Einträgen unterlegten Hyperlinks sind entfernt und daher nur auf der jeweiligen Internetseite nachlesbar.
Die WIKIPEDIA-Zitate sind im Zeitraum des Buchschreibens entnommen, d.h. sie können sich im Verlauf der vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an kommenden Zeit ändern, weil sie laufend überarbeitet werden und dann häufig in der zitierten Form nicht mehr abrufbar sind. Der vorliegende Band dient dann einer geschichtlichen Betrachtung der WIKIPEDIA-Einträge.
Natürlich muss an dieser Stelle auch der allgemeine, gratis zugängliche online Duden erwähnt werden.
Um die Lesbarkeit und Aufnahme der wissenschaftlichen Texte zu erleichtern, hat der Verfasser den Text gedehnt dahingehend, dass bei den Zitaten Absätze eingefügt wurden, wo es im Originaltext keine gibt. Das wurde mit drei Punkten vor- und nachher gekennzeichnet.
Das ist zwar missverständlich, weil die Punkte im Text sonst immer anzeigen, dass Text ausgelassen wurde. In diesem Fall zeigt es das Gegenteil an, es wurde Platz eingefügt.
Die Klammern […] beinhalten Erklärungen des Verfassers, die meist in Zitate eingefügt sind.
Sternchen in Klammer (*) bedeutet im zitierten Text: Die vorausgehende, meist Fett- oder Kursiv-Formatierung ist durch den Verfasser dieses Buches aufgehoben bzw. anders vorgenommen worden. Ebendiese Feststellung, die normalerweise jeweils im Text angezeigt werden müsste, wird aus Gründen der Arbeitserleichterung ausgespart.
Orthographisches
Die orthographische Schreibpraxis ist über die Jahrtausende gewachsen und dass und so wie wir schreiben ist ein (Ab)Bild von Sprachgewohnheiten, die mit den Sprachgewohnheiten unserer Vorfahren und den Sprachgewohnheiten unseres näheren und ferneren sozialen Umfelds verbunden ist.
Die (geschriebene) Sprache ist eine Form von orthographischem Gedächtnis und sie hat ihre Geschichte.
a) Historische Bestimmungselemente des Germanischen
In der deutschen Philologie wird der Beginn der indogermanischen Sprachen auf cirka 3000 vor Christus datiert, ihre weltweite Verteilung fand durch die europäische Expansion im 15. Jahrhundert, innerhalb der Jahrtausende durch die Völkerwanderungen, statt (WIKIPEDIA, 'indogermanische Sprachen').
Das Germanische wird mit schlechter Quellenlage zwischen 1000 vor Christus und 500 nach Christus datiert. Ab 500 haben sich durch zwei Lautverschiebungen hochdeutsche Sprachen entwickelt (vgl. WIKIPEDIA 'Zweite Lautverschiebung').
Das Wort 'deutsch' erscheint zum ersten Mal 786 in einem mittellateinischen Dokument, 'Althochdeutsch' wird auf circa 600 bis 1050 datiert (WIKIPEDIA, 'Althochdeutsch').
b) Geschlechtsneutralisierendes Substantiv
Die Entwicklungsformen geschlechtergerechter Sprache sind, wenn man vom Indogermanischen ausgeht, seit seinem Beginn vor cirka 3000 vor Christus, wenn man vom Germanischen ausgeht, seit seinem Beginnen cirka 1000 vor Christus nach cirka 5000/3000 Jahren eingetreten. Gerechnet vom Anbeginn der indogermanischen Sprachfamilie als historisch und sprachartenbezogen weitreichende Sprachfamilie sind die letzten Sprachentwicklungen auf einer historischen Landkarte kaum auszumachen.
Wenn man vom Neuhochdeutschen um 14., 15. Jahrhundert ausgeht, käme man auf einen Zeitraum von cirka 600 Jahren, bis die doppelgeschlechtlichen Sprach- und Sprechformen einsetzten, als Vorläufer eben dieser jüngsten Entwicklungen, die vor 40 Jahren einsetzten.
In den 80ern ist die männlich-weibliche Verschmelzungsform von Substantiven mit einer relativ breiten Varietät zu datieren, die Universität Wien zum Beispiel sieht folgende Formen geschlechtergerechter Sprache vor, die sich über die Jahre entwickelt haben:
Leser/innen, Leser_innen, Leser*innen, LeserInnen mit dem Binnen-I bzw. Majuskel-I sind als grammatische Formen weitgehend anerkannt.
Das Majuskel-I geht als erstes auf Christoph Pusch (1981) und auf die feministische Germanistin Luise F. Pusch (1982) zurück (vgl. WIKIPEDIA).
Zum Beispiel wäre ein großgeschriebenes 'Die', das einen Relativsatz einleitet, der sich auf ein Wort mit zum Beispiel einem Binnen-I bezieht, als feminisiertes Relativpronomen mit doppelgeschlechtlicher Bedeutung zu bezeichnen. 'LehrerInnen, Die...' wäre das hier zu referenzierende Beispiel.
Das wäre ein Beispiel, bei dem eine grammatisch weibliche Form eine männliche verdrängt mit der Einschränkung, dass das großgeschriebene 'I' in der Mitte des Wortes eine erneute Integration des Männlichen durch die Hintertür bedeutet und anzeigt.
c) Zur gewählten orthographischen Form
Weil es für den Verfasser keinen Unterschied machen will, ob eine zitierte AutorIn ein Mann oder eine Frau ist, wird auf die jeweilig zitierte AutorIn nur mit einem großgeschriebenen 'Sie' Bezug genommen. In diesem Fall wird auch das Personalpronomen 'der' durch ein großgeschriebenes 'Die' ersetzt.
Somit wird die verweiblichte Verallgemeinerung im Gegensatz zur üblichen vermännlichten Form der Verallgemeinerung zur Anwendung gebracht. Die Worte oder Silben sind dann: '-In', '-Innen', 'Sie', 'Ihre', 'Die', etc.
1. Grundlagen des modernen Staates
1.1 Territorium, Gewalt und Kriege
Die Tendenz, sich territorial zu organisieren, zeigt sich vor allem in den heutigen europäischen Gebieten ab dem 12. Jahrhundert. Alle Personen, die sich auf einem bestimmten Territorium befinden, unterliegen dabei den staatlichen Herrschaftsansprüchen (vgl. WIKIPEDIA, 'Territorialstaat').
Es bilden sich Territorialstaaten mit Territorialverfassungen heraus (s.o.). Dabei wird von den Stammesherzogtümern abgerückt, zugunsten des Territoriums als Grundlage von Herrschaft:
"Unter einem Territorialstaat(*) versteht man seit dem hohen Mittelalter einen Staat, in dem sich der Herrschaftsanspruch des Regierenden, dem Territorialfürsten, über ein gewisses Territorium und dessen Bevölkerung erstreckt. Die Verfassung eines solchen Staates wird entsprechend als Territorialverfassung bezeichnet. Im Gegensatz zu den alten Stammesherzogtümern(*) oder als Personenverbandsstaat organisierten Herrschaften ist im Territorialstaat das Territorium und nicht die Stammeszugehörigkeit oder andere personenbezogene Rechte Grundlage der Herrschaft."
Die geographische Ausdehnung wird im Vergleich zu den sozialethnisch definierten Gesichtspunkten von Herrschaft zur dominanten kognitiven Ordnung und Bezugsgröße von herrschaftlichem Einzugs- und Wirkungskreis. Die früheren Stammeshierarchien wandeln sich zur ebenfalls vertikalen Verankerung der sich herausbildenden territorialstaatlichen Organisation und Hierarchie.
Als zeitlich versetzte Antwort auf die Herausbildung des Territorialstaates entsteht das nach innen und außen wirksame Gewaltmonopol (die Entstehung des Gewaltmonopols ist auf das Spätmittelalter zu datieren; vgl. WIKIPEDIA, 'Frühe Neuzeit'), es funktionalisiert, ordnet, zerstört und erzeugt Leid.
Im Friedensfall wird das staatliche Gewaltmonopol innerstaatlich auf die einzelne PolizistIn übertragen, im Kriegsfall auf den einzelnen Soldaten, sodass diese damit zur Anwendung von Gewalt autorisiert sind und werden.
Die als Nationalismus und nationalistische Bewegungen bezeichneten politisch-sozialen Phänomene konnten sich erst nach den Agrargesellschaften herausbilden: Durch die Ständehierarchie in den Agrargesellschaften war die kulturelle Übereinstimmung der Mitglieder des politischen Verbandes und somit Nationalismus unmöglich (vgl. Ionescu 2011, S. 49).
Prozesse der Staatsbildung und des Staatszerfalls
Wenn man den frühen Beginn der Moderne auf 1800 datiert, umfasst die Vormoderne gemäß WIKIPEDIA ('Vormoderne') die Zeit vor der Moderne, also zum Beispiel auch schon die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit.
Die Anfänge der Entwicklung des modernen Staates und zum modernen Staat sind in einzelnen Entwicklungsschritten und -komponenten identifizierbar und verortbar.
"An der Schwelle von Vormoderne zu Moderne kumulierten zahlreiche Entwicklungsstränge in einem Prozess, in dem der moderne Nationalstaat entstand, den Jellinek...als Einheit aus Staatsgebiet, Staatsgewalt und Staatsvolk charakterisiert hat.. Mit dieser juristisch etablierten Dreidimensionalität des Staatsbegriffs (Drei-Elemente-Lehre) ergibt sich die Variationsbreite der Legitimitätsfrage...
Sind Territorialität, Gewalt und Staatsvolk die konstitutiven Kriterien eines Staates, stellen sie zugleich auch Modi dar, die nicht nur als Legitimation, sondern auch als Delegitimation dienen können, sind also ihrem Wesen nach ambivalent und nur als funktionale Kategorien konstitutiv für den abstrakten Staat, während sie als substantielle Kategorien konkrete Staaten auch desavouieren können...(SALZBORN 2011, S. 480)."
Einerseits sind die drei Kategorien Territorium, Gewalt und Staatsvolk die Bedingungen für den Aufbau des Staates, auf welchem dieser sich gründet und fußt, andererseits ist es die Bedingung der Unterjochung und Zerstörung von Volksgut und -anteilen, die nach innen und außen ihre Zerstörungskraft entfalten muss, um wirksam sein zu können.
Besonders in den Entstehungsphasen von Staaten werden Kriege geführt, REINHARD (2007, S. 77) bezeichnet sie in Bezugnahme auf Johannes Burkhardt als Staatsbildungskriege, bei denen sich die werdenden Staaten mit überstaatlichen Ordnungsvorstellungen auseinandersetzten, wie diese "etwa unter dem Schlagwort der spanischen und französischen 'Universalmonarchie' gehandelt wurden" (s.o. S. 78).
In Zeiten der Monarchie kristallisierte sich gewaltsam heraus, wie sich nach innen die Gewichte zwischen der Krone und den Ständen zu organisieren hatten (s.o.).
Staatsbildungskriege und die dafür nötige Rekrutierung von Kampftruppen gehören zu den ersten allgemeinen, kollektiven und arbeitsteiligen Organisationsleistungen der bis dahin lose gekoppelten Bevölkerungseinheiten. Diese Organisationsleistung kann ohne kollektiv-nationale Willensbildung nur schwer gedacht werden.
Indem Kriege geführt werden, bilden sich Staaten heraus, das heißt das Prozesshafte steht immer schon im Vordergrund bei der Erklärung der Bildung und des Zustandekommens von Staaten.
Dieser (Entwicklungs-)Prozess des Zustandekommens eines Staates lässt sich in mehrere sozialpsychologischeVariablen zerlegen: Die Verdinglichung des Staatsvolkes – die Entfremdung des Staatsvolkes, die da sind die psychologischen Auswirkungen von staatlicher Gewaltanwendung – die kognitiven Rechtfertigungsfiguren der Staatsherrschaft und die Verteilungsorganisation der herrschaftseigenen Legitimitätsüberzeugungen.
Als zentrale psychologische Variable lässt sich in diesem Staatsbildungsprozess die Entfremdung durch und in Form von Verdinglichung anführen, die die primäre Funktion der Gewalt und Herrschaft bei den Beherrschten erzeugt.
Die Entfremdung ist deren Reaktion auf die meisten der Ergebnisse der Nutzungs- und Rechtfertigungsanstrengungen der herrschenden Elite großteils als widerrechtlich zu kennzeichnenden ursprüngliche Tendenz, die Macht an sich zu reißen und diese für längere Zeit erfolgreich zu beanspruchen; unter dem nur sehr eingeschränkt gültigen Vorwand und der nur sehr eingeschränkt gegebenen Legitimation, das allgemeine Interesse zu vertreten und sicher zu stellen.
Die staatliche Funktion der Gewalt ist schwerer messbar als die Form von Gewalt, die in kleineren Strukturen stattfindet, wie zum Beispiel in Unternehmen oder Familien. Oft ist der zeitliche und räumliche Abstand zwischen gewalttätigem Verhalten und dem Einsatz staatlich-regulativer Maßnahmen langatmiger als bei den direkt beobachtbaren Formen von Gewalt.
Der Zusammenhang und das Nachvollziehen von Kontingenzen ist im Allgemeinen zeitlich weitgespannter und abstrakter, da diese sich nur sehr vermittelt in Form bürokratischer Regeln in späteren, scheinbar unzusammenhängenden Handlungen, vollziehen und darstellen.
Den Prozess, bei dem eine erste Form des Staates hervorgeht, bestimmt BASSO (1975, S. 16f) mit den Kategorien Arbeitsteilung, Entäußerung, Usurpation und Klassenunterdrückung. Aus einer unspezifisch gedachten gesellschaftlichen Situation geht in einem Prozessverlauf, der durch die Kategorien eingegrenzt ist, eine Form von Staat hervor:
"Die Arbeitsteilung entspricht der Tendenz oder dem Zwang, bestimmte gesellschaftliche, militärische oder religiöse Aufgaben von allgemeinem Interesse bestimmten Personen zu übertragen, die dazu qualifiziert sind oder es zu sein scheinen. Zur Entäußerung kommt es, weil sich die Träger dieser Funktionen als besonderes Organ konstituieren, das mit spezifischen Vollmachten ausgestattet ist...
Natürlich ziehen sie weiterhin die ganze Gemeinschaft dazu heran, ihre Aufgaben wahrzunehmen (Kriege, öffentliche Arbeiten...), sowohl in Form persönlicher Leistung als auch in Abpressung von Mehrarbeit durch Steuern, Abgaben, Wegegeld, Frondienste, usw.."
Der von Hegel eingebrachte Begriff der Entäußerung wird von Marx im Sinne von Verdinglichung und Entfremdung verwendet (WIKIPEDIA, 'Entäußerung, Marx'). Zur Verdinglichung und Entfremdung kommt es bereits im Verlauf und auch als Folge erster Spezialisierung und betriebswirtschaftlicher Organisationvon Staatsfunktionen.
"Der Prozeß der Usurpation [in Besitz nehmen, widerrechtlich die Macht an sich reißen] ergibt sich daraus, daß die Träger der politischen Macht sich als Vertreter des allgemeinen Interesses darzustellen und damit ihre Herrschaft und ihre Macht zu rechtfertigen suchen...(BASSO 1975, S. 17)"
Bezüglich des Prozesses der Klassenunterdrückung, der bereits in den Anfangsstadien des Territorialstaates, der scheinbar naturgesetzlich und ganz zwangläufig auftritt, kann man von folgendem Schema von Marx ausgehen, der auf den elementaren Umstand hinweist, dass die Klassengesellschaft im Wesentlichen dichotom ist und heute seit jeher aus den oppositionellen Interessengemeinschaften Herrschern und Beherrschten besteht (vgl. WIKIPEDIA, 'Soziale Klasse').
Ob die für die Entstehungsphasen von Staaten charakteristischen Kriege geführt werden, entscheidet in Staaten mit deren hierarchisch aufgebauten Gesellschaften eine herrschende, häufig transnationale Klasse, und stellt die dafür nötigen Mittel bereit, die sie durch monetäre und substanzielle Abschöpfung aus dem Volkseigentum und dem psychischen Apparat des Volkes generiert. – Den mittelalterlichen Adel führt MANN (1998, S. 47) als Beispiel einer herrschenden, transnationalen Klasse an:
"Beispiel für eine transnationale Klasse ist der mittelalterliche Adel, dessen Verwandtschaftsverbände sich über ganz Europa erstreckten und der nicht nur seine eigene Klassendiplomatie betrieb, sondern auch viele Kriege führte."
REINHARD (2007, S. 78) beschreibt die abendländische Kriegskultur, ausgehend von der Antike, und unterscheidet dabei vier Punkte:
"[E]rstens die Disziplin geschlossener Infanterieformationen, zweitens der Wille zur Vernichtung der gegnerischen Kampfkraft (was nicht unbedingt auf die Tötung der Feinde hinauslaufen musste), drittens das Streben nach technischer Überlegenheit..., viertens die wirtschaftliche und politische Fähigkeit, dafür die nötigen Ressourcen zu mobilisieren."
Spätestens ab dem Mittelalter, in dem es nur den Begüterten möglich war, die persönlichen Rüstungen zu finanzieren, kämpft später in den Fürstentümern, Reichen und Staaten das gemeine Fußvolk, allen voran die Männer, zum Beispiel in den ersten Reihen der Infanterie. Davon abgehoben, die Ritter und später allgemein die Kommandierenden, entstammen nicht dem Fußvolk (vgl. WIKIPEDIA, 'Geschichte der militärischen Taktiken, Mittelalter'), sondern einer ökonomisch besser gestellten Klasse.
Besonders bei vormodernen Staaten, aber auch später durchwegs beobachtbar, ist bei der Kriegsführung in erster Linie die ganze männliche Bevölkerung involviert.
Bei modernen Staaten verändert sich zumindest ein Teil der Kriege zu Cyberkriegen, bei welchen die feindliche Staatsmacht, deren militärische wie zivilstaatliche Einheiten per Technologie von außerhalb der territorialen Staatsgrenzen lahmgelegt werden und in Folge für den bekämpften Staat selbst nicht mehr nutz- und einsetzbar ist (vgl. WIKIPEDIA, 'Cyberkrieg').
Der nationalstaatlich (oder der von einer, dem Nationalstaat zurechenbaren, transnationalen Klasse) durchgeführte militärische Angriff auf das fremde Staatsterritorium und dessen Eigentum wird dabei nur mittels informationstechnischer Infrastruktur und ohne Land- und Luftstreitkräfte, etc. umgesetzt.
Dieses Beispiel zeigt die Durchlässigkeit der geographisch und politisch manifesten Territorialstaatsgrenze im 21. Jahrhundert und die Macht der digitalen, militärischen Steuerung von zunächst virtuellen, aber dann de facto grenzüberschreitenden Handlungen. Die Kategorien Staatsgebiet, Staatsgewalt und Staatsvolk weiten sich dabei auf die Gebiete des fremden Staatsterritoriums aus.
Andererseits zeigt die Coronakrise 2020/21 wie sehr die nationalstaatlichen Grenzen wieder an Bedeutung gewinnen können.
Psychologische Bedingungsvoraussetzungen des Kriegsführens
Für sämtliche Kriegshandlungen kommt eine spezifische psychische Identität zum Tragen: Bei diesem Thema sollte das empirische ForscherInneninteresse sich auch auf eine relevante Mikroebene begeben und das in der Geschichte konstante, kollektiv gegebene Männerbild untersuchen als sozialpsy-chologisch permanent virulent gegebene Voraussetzung und Begleiterscheinung des Krieg-Umsetzens. Das ursprünglich auch von unten und hinten durch die mütterlichen, die Männer (komplizenhaft) unterstützenden Handlungsvektoren bespeist wurden und werden.
Das individuelle Phänomen eines bestimmten Männer- und Frauenbildes ist insofern auch auf einer Mesoebene beobachtbar, als es sich dabei um ein kollektives Phänomen handelt, das über die Größenordnung von Gruppen hinaus auch auf der Ebene von Klassen und Nationen zumindest als Teilphänomen isolierbar ist.
Das, was in den Geschichtsbüchern über das Kriegführen steht, ist das Schema einer auf einer Makroebene lokalisierbaren, das die von starken Männern geleitete kriegslüsterne Machtgehabe zum Thema auserkoren hat.
Wenn bei dieser historischen 'Analyse' der Aspekt des zugefügten, massenindividuell erfahrbaren Leides in den Hintergrund tritt, ist diese Form der 'Analyse' sui generis als männerdominert und durch die die Männer konstituierenden und durch sie konstituierten und wirksamen Machthierarchien und deren willfährig gemachten und/oder bereitwillig zur Verfügung stehenden und jederzeit ausbeutbaren ExekutorInnen gekennzeichnet und getragen: Krieg bedeutet immer, wie auch in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts, Zerstörung, Besitzverlust, Flucht, ständige Todesangst, Verzweiflung, permanente Schlaflosigkeit, Hungersnöte, Krankheit und Tod der vielen Unteren, die nicht nur im Außen eines Staates, sondern auch im Innen Platz greifen.
1.2 Der Nationalstaat
Der Nationalstaat ist ein komplexes und sehr widersprüchliches Konstrukt, das neben geschichtlichen Prozessen zur Erklärung für dessen Zusammensetzung und Konstitution eine Reihe von möglichst multikausalen Definitionsnotwendigkeiten aufweist und aufweisen muss, will das Ziel einer politischen Theoriebildung verfolgt werden, den Realitätsbestand dieses Phänomens nachzuzeichnen. Mehrere Definitionen können dann als Grundlage einer weiteren Modellbildung für eine Theorie herangezogen werden. Im Folgenden soll versucht werden, die erste Stufe einer multiplexen und multikausalen Definitionsbildung und -zusammenstellung, zu zeichnen.
Von der Konstitution des Staatsvolkes ausgehend kann auf einer psychologischen Ebene konstatiert werden, dass mehrere Einzelne, die Großfamilie, soziale Klassen, lokale Initiativen, Verbände, Wirtschaftsunternehmen, regionale Verbände, Kooperationen und Zusammenschlüsse auf höherer organisationaler (und entwicklungsgeschichtlich später: der völkerrechtlichen) Ebene zum Staatsvolk werden, das die Basis einer Nation darstellt.
Die Entstehung des modernen Nationalstaates,
"...zunächst in England und Frankreich, dann auch in modifizierter Form als Territorialstaat im Bereich des deutschen Reiches...(BERG-SCHLOSSER/STAMMEN 2013, S. 17)"
setzt in der Neuzeit ein. WIKIPEDIA setzt die Neuzeit im Zeitraum der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an.
"Der Staat gründet..auf ganz neue Prinzipien wie Souveränität, Staatsräson [der Grundsatz, in bestimmten Situationen die Rechte des Staates über die Rechte der einzelnen BürgerIn zu stellen, was auch der Begriff 'Staatsräson' summarisch umfasst], territoriale Herrschaft, rationale Verwaltung [...und...] Absolutismus (BERG-SCHLOSSER/STAMMEN 2013, S. 17 )".
Vereinfachend betrachtet adressiert der Begriff des Nationalstaats den Aspekt der Bevölkerungsstruktur; der Territorialstaat fokussiert die geographische Lage, eingebettet in fassbar-geographisch lokalisierbare Grenzen. Die beiden Begriffe Territorialstaat und Nationalstaat werden synonym oder zumindest überlappend in der einschlägigen Literatur verwendet und zur Anwendung gebracht.
Das staatliche Gewaltmonopol
Das nationalstaatliche Gewaltmonopol ist die zentral tragende Säule allen staatlichen Gebahrens. Die Grundformen menschlicher Vergemeinschaftung werden durch das staatliche (und das auch im transnationalen Netz gegebene) Gewaltmonopol strukturiert, in Stand gesetzt, aufrechterhalten und nach innen und außen verteidigt und aggressiv und zerstörerisch eingesetzt.
"Von Anfang an schien es zu seinen unvermeidlichen Bestandteilen zu gehören, Gewalt nicht nur gegen andere Staaten, sondern auch gegen das eigene Volk anzuwenden. In der Geschichte der Theorie des Nationalstaates sind, spätestens seit...dem Beginn der Moderne, Gewalt und Zwang stets als seine zentralen Merkmale betrachtet worden (ALBROW 1998, S. 101)."
Gleichermaßen wird das durch Gewaltmonopol vergemeinschaftete Staatsvolk durch eben dieses fragmentiert und systematisch – nach den jeweiligen rechtlichen Bedingungen hin – zugerichtet und damit in seiner Existenz teilweise zerstört, zerstückelt und gewaltintensiv geformt.
Es dient der Einzementierung, Absicherung und Verteidigung des sich kontinuierlich als normal herauskristallisierenden, genormten Bereichs historisch-gesellschaftlicher Lebensweisen. Je moderner, desto fluider ist der Aspekt des zu Stabilisierenden in Abstimmung zum permanenten Veränderungsmodus, der ermöglicht werden muss, um einen fortlaufenden Bestand sichern zu können.
Weber spricht von dem staatlichen
"Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit (WEBER 1968, S. 34)"
und referenziert damit auch die Ebene in modernen Staaten, auf der von physischer bis zu symbolischer Gewalt, die zum Beispiel bei Polizeihandlungen, Gerichtsexekutionen und anderen Kontrollmaßnahmen und -handlungen, die sich die Untertanen eines Staates, deren BürgerInnen ständig ausgesetzt sehen müssen.
Mehrere Autoren, die
"Gewalt als die eklatanteste Manifestation von Macht"
definieren, werden von ARENDT (1970, S. 39) zitiert undALBROW (1998, S. 101)beschreibt die Gewalt als Mittel, die es dem Staat ermöglicht, sich gegen andere Staaten, aber auch gegen das eigene Volk (zum Beispiel mittels widerrechtlicher Vorenthaltung kollektiver Rechte) durchzusetzen.
Gewalt und Zwang sind zentrale, den Staat kennzeichnende Mittel und der Staat behält sich rechtlich abgesicherte Gewaltmittel gegen sich selbst, seinem Volk, dabei vor:
"Der Nationalstaat ist wie keine andere Staatsform vor ihm im Volk verwurzelt. Aber seine Wurzeln sind nicht immun gegen Angriffe. Er mußte sich ebenso gegen andere Nationalstaaten wie gegen mit ihm konkurrierende Vereinigungen wie die Familie, die lokale Gemeinschaft, die Kirche oder das Wirtschaftsunternehmen behaupten..."
1.2.1 Nationalstaat als politische Kategorie und Einheit
Der Nationalstaat ist eine künstliche, fast beliebige Einheit. BÜHL (1970, S. 178f) sieht den Nationalstaat nicht als ethnische oder durch die gleiche Kultur oder Sprache gekennzeichnete Abstammungseinheit, das Volkstum ist dabei ein nachträglich zugeordnetes und zuerkanntes Konstrukt:
"[D]ie Nation [ist] weder als ethnische Einheit, als eine durch die gleiche Rasse, die gleiche Sprache oder die gleiche Kultur [oder Religion] gekennzeichnete Abstammungsgemeinschaft(*), noch als...[volkstümliche]...Einheit...zu verstehen."
Die Definition von Bühl ist ausschließend, negativ und schafft Raum für Kriterien, die positiv definierbar sind. Der Begriffsinhalt von `Nation' wird (auch umgangssprachlich betrachtet) sehr wohl mit einem Volk gleichgesetzt, das durch gleiche Abstammung, gleiche Sprache und gleiche Wurzeln gekennzeichnet ist. Das zeigt, dass die negative Definition darauf verweist, dass die positiven Kriterien zumindest auf einer Nicht-Ausschließlichkeit, das heißt, nur 'unter anderem' auf den oben genannten Variablen beruhen.
Zum Teil übereinstimmend mit letzterem Zitat definiert auch WIKIPEDIA ('Nationalstaat') den Nationalstaat als Konstrukt, deren Einzelelemente in keinem Staat vollständig verwirklicht sind, und damit nicht sinnvollerweise als in sich schlüssig-geschlossene Voraussetzung für den Staat herangezogen werden können:
"Ein Nationalstaat(*) ist ein Staatsmodell,... das auf der Idee und Souveränität der Nation beruht. Sprachliche, kulturelle oder ethnische Homogenität wurden zwar im Diskurs um die Nation oft als Voraussetzung des Nationalstaates benannt, sind aber in der Realität nirgends vollständig verwirklicht. Die Ideen der Nation und des Nationalstaats werden auch als Konstrukte bezeichnet."
Eine integrierende Definition könnte und müsste somit davon ausgehen, dass die Zusammensetzung des Nationalstaates im Zufall der Geschichtlichkeit sozialer, territorialer Prozesse begründet liegt, dessen Beschaffenheit also hauptsächlich geschichtlich zu erklären und zu begreifen ist.
Das Ergebnis der Geschichte sind für bestimmte geografische Bevölkerungsverteilungen charakteristische Merkmalskonstellationen: Eine Nation ist durch die Bündelung der Abstammungsgemeinschaft, Sprache und Kultur mehrerer miteinander auf jeweils charakteristische Weise verknüpfter Volksgruppen gekennzeichnet. Die Nation ist also nicht im Singular, sondern im Plural als Zusammenstellung mehrerer Großgruppen zu definieren, Bühls erstes Zitat (1970 S. 178f) befördert ein Plädoyer gegen eine grobe Vereinfachung von Nation(alstaat).
Der historische Werdegang des territorialen Staatswesens zeigt bei vielen heutigen Staaten, dass die räumliche Ausdehnung sich in einem permanenten Wandel aufgrund kriegerisch ausgetragener Herrschaftsprozesse befand und wieder befinden wird können, die sich zwischen den umliegenden Staatsverbänden und dem jeweils betrachteten Staat und dessen Aufkommen territorial sich äußernder Macht- und Geltungsansprüche zeigen.
1.2.2 Völkerrecht als nationalstaatliche Grundlage
Der rechtliche Aspekt, der für die Bildung von Nationen zentral ist, betrifft das und bezieht sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, als ein wichtiges Grundrecht des Völkerrechts und im Völkerrecht.
WIKIPEDIA definiert das im weiteren Verlauf auf nationale Grenzen bezogene Selbstbestimmungsrecht (`Selbstbestimmungsrecht der Völker'), das die Vorrechte von Herrscherdynastien aufbrechenund zugunsten einer durch Krieg und Revolution errungenen Volkssouveränität überwinden konnte:
"Im späten 18. Jahrhundert wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker als 'Volkssouveränität' formuliert und errang in der Französischen Revolution und im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg den Sieg über das bis dahin als gültig anerkannte dynastische Prinzip."
Die politische Definition von 'Volk' grenzt sich dabei nationsbezogen 'vertikal' gegenüber den Herrschaftseliten ab, nicht aber gegenüber anderen Volksgruppen (s.o.):
"'Volk' ist im Zusammenhang der bürgerlichen Revolutionen als politische Kategorie zu verstehen, die sich in 'vertikaler', das heißt zu den klassischen Herrschaftseliten (Adel, König), nicht aber in 'horizontaler' (im Gegensatz zu anderen ethnischen Volksgruppen) Abgrenzung manifestiert. In diesem Zusammenhang finden wir hier bereits den entscheidenden Unterschied zwischen einer ethnischen und einer politischen Definition des Begriffs 'Nation'(*)."
BÜHL (1970, S. 178f) beschreibt unterschiedliche gesellschaftliche und politische Entwicklungsphasen und -formen des Staates:
"Im Hinblick auf die Schichtung bleibt dieser Wandel...im Fortschritt von der Adelsnation(*) zur bürgerlichen Mittelschicht-Nation(*), zur demokratischen und sozialistisch-proletarischen Nation(*) bestehen; im Hinblick auf die Erweiterung des Territoriums bzw. auf die zunehmende Loslösung vom Territorialprinzip stellt er sich als ein Übergang von der Stammes- zur Dorfgemeinschaft und Feudalgesellschaft, vom Stadtstaat zum Nationalstaat und zum übernationalen politischen Verband dar."
Diese oben ausgeführte Logik von (Staats-)Entwicklung geht von kleinen organisationalen Strukturen und Einheiten aus und, unter Loslösung vom territorialen Prinzip, zu immer größer werdenden, übernationalen Vernetzungen.
Einer Nation kommt in diesem Schema eine mittlere Dimension zu, die soziale und politische Schichten und Klassen zu einer größeren geografisch-territorialen Einheit verbindet, die kleinere Regionen und Subeinheiten beinhaltet.
1.2.3 Der Nationalstaat als organisationelle Einheit
HARTMANN (2011, S. 13) bezieht sich auf den Staatsrechtler JELLINEK (1914), wenn er die Qualität des politischen Staatsgebildes nach drei Kriterien bemisst, was sich als 'drei Elementen Lehre' in der Staatslehre und in der politischen Theorie konstitutiert und durchgesetzt hat:
Bestimmung des Staatsgebietes,
Bestimmung des Staatsvolkes und
die Effektivität der Staatsgewalt.
Gemäß dem letzten Kriterium geht es um die Durchsetzung(sfähigkeit) der für das Staatsvolk und -gebiet geltenden Rechtsnormen (HARTMANN 2011, S. 13), die die Regierungsspitze und den Staat permanent am Leben halten und mit neuen Gesetzen zu deren Durchsetzung verhilft.
Der Gegenstand des Staatsorganisationsrechtes umfasst die innere Differenzierung des Staates und den von seinem Organisationsprozess der politischen Willensbildung umrissenen Organisationsprinzip (s.o. S. 14).
Wie sich Territorial- bzw. Nationalstaaten zusammensetzen und wie sie sich mit nationalstaatlicher Willensbildung, Herausbildung des Gewaltmonopols und anderen Faktoren zu einem staatlichen Gebilde hochzüchten und -stilisieren, ist die Frage, die in diesem Kapitel im Zentrum steht.
Dabei wird zumeist implizit von der These ausgegangen, dass das jeweilige Staatsgebilde eine erstrebenswerte hochentwickelte Organisationsform sei, nämlich eine Rechts- und Gesellschaftsform und eine bestimmte Form der Anordnung und Konstellation des Sozialen, das ein attraktives staatliches Organisations- und (Über-)Lebensmodell darstellt.
Und viel seltener wird dabei der Betrachtungsstandpunkt eingenommen, der den staatlichen Werdungsprozess in einer Weise thematisiert, die die Aspekte und Impulse von Unterdrückung und psychologisch ständig wirksamer Abspaltung als Voraussetzung für eine Staatsbildung und -aufrechterhaltung im Mittelpunkt stehen lässt und abbildet.
1.2.4 Gesellschaftsklasse, Ethnie und Staat
Die Verwandtschaftsverbände, die bereits als konstituierend für transnationale Klassen im Mittelalter thematisiert wurden, sieht MANN (1998, S. 48)ausschließlichals nach innen gerichtete Klasse mit vornehmlich nationaler Ausrichtung: Hier treten Klassen bezüglich der Identität des Staates miteinander in Konkurrenz:
"Klassen können sich in innere Kämpfe um die Identität der Nation verstricken, ihr Nationalgefühl bleibt nach innen gerichtet – für internationale Angelegenheiten sind sie und fühlen sie sich nicht zuständig."
Da das innerpolitische Kräftemessen der Klassen um die Einflussnahme auf den Nationalstaat gerichtet ist, bleiben internationale Wirkungsrichtungen ausgespart bzw. nicht in deren primären Interessensbereich. Die nationalstaatlich-historisch zu betrachtende, nach innen gerichtete Selbstbestimmungdes Volkes/der Völker als Ganzes hat sich analog zur Klassenbildung durch einen 'Vergruppungsprozess' ausdifferenziert, bei dem die Völker ihre Souveränität erst mittels Selbstbestimmung erringen mussten.
Das ist ein Argument dafür, dass Nationen historisch auf bestimmten Volks- oder Völkergruppierungen aufbauen, die für jegliche Identitätsbildung der Nation zentral sind. Dem von Bühl zitierten nicht hinreichende Ausschließlichkeit einer ethnischen Betrachtungsweise bezüglich der Bestimmung von Nation ist weiters insofern Recht zu geben, als die Wurzeln einer Nation nicht verallgemeinerbar und daher qualitativ auf tiefere (politisch verortbare) Schichten bezogen analysiert werden müssen.
Anzustreben wäre eine Theoriebildung, die klassenidentitätspolitische und sprachlich-ethnisch-volksbezogene Variablen in einer angemessenen Weise verbindet.
1.2.5 Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung
Aus soziologischer Sicht ist bei der 'Nationwerdung' ein Vorgang der Differenzierung zentral, der sich aus psychologischer Sicht auch als ein Prozess der 'Vergruppung' zeigt. Vergruppung als Ausgangspunkt von Vergesellschaftung einerseits und von Vergemeinschaftung andererseits.
"[Die Nation]...wird zur Grundform menschlicher Vergemeinschaftung," schreibt BÜHL (1970, S. 178). "...[A]n die Stelle eines universellen Gesellschaftsbegriffs tritt ein universeller Gemeinschaftsbegriff(*)."
Der Prozess der Nationwerdung definiert das Gesellschaftsmodell aus Sicht der Struktur des Staatsinneren (in Form von Differenzierung und Integration), während das Gemeinschaftsmodell sich an diesen Prozess von der Großgruppe her annähert (s.o.).
"...Während das Gesellschaftsmodell den Prozeß der Nationwerdung(*) sozusagen von seiner inneren Struktur her definierte, als einen Prozeß der zunehmenden Differenzierung und der gleichlaufenden Integration, ist für das Gemeinschaftsmodell dieser Prozeß der sich verändernden Struktur unproblematisch;...es bleibt der Prozeß einer im Umfang zunehmenden gesellschaftlichen Vergruppung (* ; BÜHL 1970, S. 178)."
Die Kategorien Vergesellschaftung-Vergemeinschaftung-Differenzierung-Vergruppung sind neutral und bilden den ständig wirksamen Ereignis- und Tatbestand von Ausbeutung, der grundlegend für jegliche Organisationsleistung und Nationsbildung ist, nicht ab.
Die anfangs ausgeführten Kategorien fordern das aber als zentrales Grundelement ein. BASSO (1975, S. 16f) isoliert die Faktoren des für die erste Formbildung und Herausbildung einer gleichlaufenden Integra-tion des Staates essentiellen Differenzierungsprozesses mit 'Arbeitsteilung', 'Entäußerung', 'Usurpation' und 'Klassenunterdrückung' (a.a.O.).
Dieser Prozess, der sich als staatlich-gesellschaftliche Differenzierung beschreiben lässt, bedeutet auch, dass sich auf sozial-soziologischer Ebene Klassen bilden und das führt direkt zu den drei Kategorien von Basso.
1.2.6 Nationalismus
Die Identität und das Selbstbewusstsein einer nationszentrierten Weltanschauung, haben Werthaltungen zum Inhalt, die einer vorherrschenden national sich verankernden und -definierenden Bevölkerungsschicht entspricht.
Beim Nationalismus grenzen und heben sich mehrere, zentrale Bevölkerungsteile des Volkes von ihrer Umwelt ab. Eine Nation wird weitgehend von einer gemeinsamen Weltanschauung 'zusammengehalten', der nationalistische Anteil einer Bevölkerung verabsolutiert aber den Nationalstaat und dessen Grenzen (siehe 'Nationalismus', WIKIPEDIA):
"Nationalismus(*) bezeichnet Weltanschauungen und damit verbundene politische Bewegungen, die die Herstellung und Konsolidierung eines souveränen Nationalstaats und eine bewusste Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglieder mit der Nation anstreben."
Für die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts, schreibt ALTER (1985, S. 10), dass bei multinationalen Großstaaten, die beim osmanischen Reich und der Habsburgermonarchie zerschlagen wurden, der Nationalismus wieder zur Triebkraft der Herausbildung neuer Staaten wurde. In den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten bildeten sich Griechenland, Italien, das Deutsche Reich, die Tschechoslowakei und Polen. Nationalistische Interessen waren seit damals Anlass für die koloniale Expansion der europäischen Mächte (s.o.).
Wie ALTER (s.o. S. 11) ausführt, wurde im Zweiten Weltkrieg der Nationalismus zu einem Synonym für Intoleranz, Inhumanität und Gewalt. Im Namen des Nationalismus wurden Eroberungen und Vertreibungen gerechtfertigt:
"Im Namen des Nationalismus wurden Kriege geführt und es geschahen ungeheuerliche Verbrechen. Auf Nationalismus war es einerseits zurückzuführen, daß Menschen gewaltsam aus ihren angestammten Siedlungsgebieten vertrieben und territoriale Eroberungen gerechtfertigt werden konnten."
Das vermehrte Auftreten von Nationalismus innerhalb eines bestehenden Staatsgebildes lässt sich als verdrängte, aufgestaute, sehr instinktbehaftete und -gesteuerte Emotionen darstellen, die Reflexe und Reaktionen sind auf manifeste und latente Bedrohungsformen von territorial meist außerhalb befindlichen Akteuren. Diese Reflexe und Emotionen werden beim Nationalismus in eine sich selbst legitimierende Gewaltbereitschaft eingebettet.
ALTER (1985, S. 11) beschreibt die positiven Seiten des Nationalismus, der für ein Volk eine freie und gerechte Gesellschaftsordnung bewirken kann:
"Mit Nationalismus befanden sich...Hoffnungen auf eine freie und gerechte Gesellschaftsordnung. Nationalismus bedeutete in der Tat für Völker und Individuen vielfach Befreiung von politischer und sozialer Diskriminierung."
Der Nationalismus ist ein zentrales Mittel der Legitimation von (aufkeimender) Herrschaft.
1.3 Der moderne Staat
Den Staat als historisch von politischen Verbänden ausgehend beschreibt WEBER (1966, S. 28) und als ein
"...auf das Mittel der legitimen (das heißt: als legitim angesehenen) Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Damit es bestehe, müssen sich also die beherrschten Menschen der beanspruchten Autorität der jeweils herrschenden fügen."
Zum Verständnis der Motive der eigenen Unterwerfung durch andere Akteure müsse man die äußeren Mittel, auf die sich eine Herrschaft stützt, und die Rechtfertigungsgründe, die die Mächtigen ausweisen, explorieren (s.o.).
MANN (1988, S. 73) unterscheidet vier hoheitsstaatliche Prinzipien, die den modernen Staat kennzeichnen:
"(1) Die ideologischen, ökonomischen und militärischen Ressourcen der Macht des territorialen Staates sind entlang einer innen-außen Relation organisiert, dessen Machtbefugnisse auf ein begrenztes, rechtsverbindliches Gebiet bezogen und zentriert ist. (2) Institutionen, Parteien und andere staatliche Akteure werden aus gesellschaftlichen und politischen Prozessen erzeugt. (3) Staatliche Institutionen sind funktionell für die unterschiedlichen Interessensgruppen, deren innere Konsistenz das Ergebnis des innerstaatlichen Kräftespiels und der unterschiedlich effizienten Machtnetzwerke ist. (4) Staaten sind geopolitisch miteinander vernetzt."
In der ersten Kategorie beschreibt MANN (1998, S. 74) den Widerspruch von einem Innen und Außen und postuliert, dass das Innere sich nur aus einem Außen her organisieren und zentrieren kann.
Je mehr sich das Innere herausbildet, desto mehr muss das Äußere abnehmen. Prozesse der Zentrierung, so man von einem Gebiet der Unbestimmtheit ausgeht, kristallisieren sich heraus, indem sie sich differenzieren und immer wieder abspalten.
So gesehen gibt es in Zeiten eines unbestimmten Übergangs noch kein Innen und Außen. Je mehr sich ein Innen bildet, desto weniger wird ein Außen. Je mehr Machtbefugnisse das Innen ausbildet, desto mehr zieht es diese vom Außen ab und schottet sich davon ab. Das wären die Regeln eines sich (auch) territorial herausbildenden Flächengebildes, das später dann als Staat bezeichnet wird.
1.3.1 Kriterien und Kategorien des modernen Staates
Zu den Kriterien und Kategorien des modernen Staates führt MANN (s.o.) aus:
Erstens,
"...[d]er Staat ist territorial zentralisiert(*)."
Davon unterschiedlich verortet die ForscherIn
"...seine ideologischen, ökonomischen und militärischen Machtpotentiale(*)...nicht im Staat, sondern außerhalb des Staates...- diese ihm nicht inhärenten Machtressourcen muß er sich erst von außen heranholen... Nichtsdestoweniger verfügt er insofern über eine höchst eigene und höchst spezielle Machtquelle, als nur er 'von Natur aus' auf ein begrenztes Gebiet zentriert ist, über das er rechtsverbindliche Machtbefugnisse besitzt."
Die zugleich wirkenden und wirksamen staatlichen Prinzipien in Zeit und Raum sind bei der zweiten Kategorie von MANN zentral: Politisch-staatliche Machtansprüche und -ausübung werden von Akteuren zentral und über das gesamte Staatsgebiet hinweg erzeugt, Institutionen und Parteibeziehungen bewirken politische Prozesse, die auf die auch gesellschaftlich determinierten Institutionsformen zurückwirken:
Zweitens,