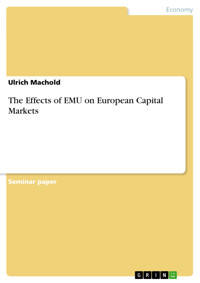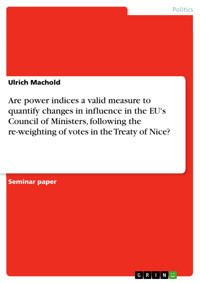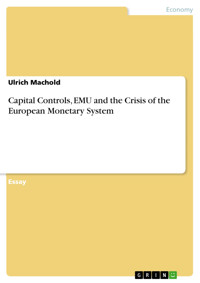Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Land ist müde, und seine Mitte ist es auch: Die Institutionen des 20. Jahrhunderts sind mit den Herausforderungen des 21. überfordert. Sie sind ausgelegt für das Verhandeln von Verteilungsfragen und die Verlangsamung von Neuem. Heute aber durchläuft die Gesellschaft wieder eine Phase des radikalen Wandels. Von Infrastruktur über Geopolitik, demokratische Teilhabe oder die Umwälzungen durch technologischen Fortschritt - überall muss gebaut, verändert, neu gedacht werden. Stattdessen wird die Asymmetrie zwischen den Herausforderungen und den angebotenen Lösungen immer größer. Die staatstragenden politischen Parteien des Zentrums stehen für immer mehr Menschen vor allem für Stillstand. Wenn die Mitte die Demokratie verteidigen will, muss sie den Bürgern deshalb das Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Problemlösung zurückgeben. Sie muss radikal werden - oder zumindest radikal anders, größer, denken, in Ergebnissen statt Stellschrauben. Dieser Debattenband sammelt Ideen, wie das gelingen kann. Die Beiträge fragen nach neuer staatlicher Handlungsfähigkeit, liberalem Fortschritt, gesellschaftlichem Zusammenhalt und entwickeln Ideen für eine die Zeit nach der Zeitenwende Mit Beiträgen von Ulrich Machold, Wolf Lotter, Michael Fabricius, Dr. Alexander Görlach, Tiaji Sio, Sven Gerst und Dr. Isabella Hermann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Machold (Hrsg.)
Die radikale Mitte
Ideen für eine Zukunft der demokratischen Marktwirtschaft
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Für den Inhalt abgedruckter und verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
1. Auflage 2026
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstraße 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-046759-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-046760-6
epub: ISBN 978-3-17-046761-3
Inhalt
Cover
Ideen für eine Politik der Mitte nach der Zeitenwende
Warum das Zentrum nicht mehr funktioniert
Vom Ende des Neoliberalismus
Here comes everybody
Der Rahmen fällt weg
Alles dauert zu lange, nichts geht mehr voran – Verwaltungsblockade und Fortschrittsversagen
Die Idee einer radikalen Mitte
Warum wir dieses Buch schreiben
I. Woher die Mitte kommt, was sie ist und was sie sein könnte
Unterwegs
Die Mitte und die Erfindung der Demokratie
Die Mechanik der Mitte
Hitler und die Mitte als Volksgemeinschaft
Die Industriegesellschaft: Das Maß der Mitte
Die verpasste Transformation
Wohlstand für Alle
Die Mitte als soziale Kompaktklasse
Die Krisen der Mitte: Transformation Teil II
Die neue Neue Mitte
Rechter und linker Populismus als Ersatzreligion
Vom betreuten zum aktiven Bürger
Kühnheit heißt: Können
II. Warum die Demokratie einen handlungsfähigen Staat braucht, und wie er aussehen kann
Von Amphibien und unerfüllbaren Bedingungen
Zwischen Wohnungsnot und Klageflut
Der handlungsunfähige Staat – Stillstand aus Angst vor dem Risiko
Behörden am Limit
Es gibt nicht zu wenig Personal, es gibt zu viele Vorschriften
„Peak Risk Avoiding“
Bauen mit 20.000 Regeln
Wie konnte es so weit kommen?
In der Falle des „Wünsch dir was“
Wenn der gute Wille in Systemversagen mündet
Der Staat als „Möglich-Macher”
Vorbilder im Norden
Eine Utopie
III. Warum digitale Selbstbestimmung und eigene KI Kernaufgaben der Mitte sind
Die Macht des Abschaltens
Von 25 Jahren Politikversagen
Souveränität im digitalen Zeitalter
Das private Ökosystem
Regulierung und Finanzierung
Innovation ist (auch) eine Frage des Geldes
Social Media
Der Netzwerk-Effekt als Systemhürde
Der Digitale Staat
Wie die Mitte denken muss
IV. Wie die Mitte die Frustration mit der Demokratie bekämpfen kann
Wozu ein Gesellschaftsvertrag?
Der Gesellschaftsvertrag und seine Gegner
Freiheit, Bildung, Aufstieg: das große Versprechen der Demokratie
Warum das Narrativ der Demokratie obsolet und ihr Gesellschaftsvertag zerbrochen ist
Das Ende des alten Wirtschaftsparadigmas ist das Ende des demokratischen Wohlstandsversprechens
Kollaboration und Miteinander oder Isolation und Ausgrenzung?
Verantwortung
Verteilungsgerechtigkeit
Fairness
V. Wie Staat und Verwaltung von einem Hindernis zu einer Plattform und Kultur werden
Mit der Abrissbirne durch die Verwaltung
Deutschland im Legacy-Modus
Neue Methoden, aber kein neues Staatsverständnis
Wir brauchen ein neues Betriebssystem
Die profane Realität
Das verlorene „Wir“
Beteiligung im Systemdesign
Verwaltung vom Menschen her
Der demütige Staat
Ein Aufruf zur Verantwortung
VI. Warum Veränderung Narrative braucht, und welche Geschichte die fortschrittliche Mitte erzählen kann
Erzählungen vom Untergang
Wer erzählt die Zukunft?
Warum der Mensch Geschichten braucht
Von Geschichten zu Missionen
Was wir vom Moonshot lernen können
Neue Visionen und Narrative
Die Zukunft aus der Mitte neu erzählen
Geschichten, die gut ausgehen
VII. Warum ein neuer Liberalismus die Ideologie einer neuen Mitte sein sollte
Bekenntnis eines Liberalen
Der intellektuelle Aufstieg der Neuen Rechten
Die Erschöpfung des Gegenwartsliberalismus
Die Entmoralisierung der Freiheit
Angst statt Möglichkeiten
Warum wir eine liberale Utopie brauchen
Abundance Liberalism: Die Fülle der Freiheit
State Capacity Liberalism: Freiheit, die liefert
Dark Liberalism: Die Freiheit der Konfrontation
Thick Liberalism: Tugend und Authentizität
Die Utopie einer liberalen Utopie
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Ideen für eine Politik der Mitte nach der Zeitenwende
von Ulrich Machold
Bildquelle: Jose Luis Magana / AP / picture alliance
Man hat sich ziemlich daran gewöhnt, dass alles aus den Fugen ist. Aber nehmen Sie sich bitte trotzdem zwei Minuten Zeit und lesen Sie die folgenden Schlagzeilen:
AfD erreicht in Umfrage Höchstwert und ist stärkste Kraft
[1]
Eskalation in US-Städten: Trump setzt Nationalgarde ein
[2]
Katar schenkt Donald Trump Boeing 747 für 400 Millionen Dollar
[3]
Ungarns Regierungspartei verbietet LQBTG-Paraden
[4]
Seien Sie ehrlich: Hätten Sie jemandem geglaubt, der Ihnen das vor zehn Jahren erzählt hätte?
Viel ist darüber diskutiert worden, woran das liegen könnte. Warum Populisten, ihre Parteien oder ihr Gedankengut, scheinbar weltweit auf dem Vormarsch sind. Warum bis vor kurzem unvorstellbare politische Volten oft nur noch Schulterzucken hervorrufen. Welches Menschenbild dahinter steckt, welche historische Kurzsichtigkeit, welche Frustration mit der Demokratie. Warum geben immer mehr Menschen die Errungenschaften der liberalen Moderne preis? Und warum sind manche offenbar bereit, einem neuen Autoritarismus den Weg zu bereiten?
Was immer die Antworten im Einzelnen sind, und einige werden in den folgenden Kapiteln diskutiert, eines ist sicher: Das Erstarken des (überwiegend rechten) Populismus ist ein Symptom einer tektonischen Verschiebung. Die politische Mitte hat die Deutungshoheit über den Kurs verloren. Sie definiert nicht nur die Grenzen des im gesellschaftlichen Diskurs Sagbaren nicht mehr, sondern auch die Leitplanken der akzeptablen politischen Alternativen.
Dabei stellt sich natürlich zuerst die Frage:
Was ist eigentlich „die Mitte”?
Darüber ließe sich ohne Weiteres ein eigenes Buch schreiben. Für dieses aber orientieren wir uns der Einfachheit halber an einer pragmatischen Arbeitsdefinition: Die politische Mitte ist eine politisch-philosophische Grundverortung, die Rationalität, Humanität und Fortschrittsglauben vereint. Sie strebt pragmatische, vernunftbasierte Lösungen an, die das Gemeinwohl fördern und Kompromisse zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen herstellen. Sie betont die Würde des Menschen, soziale Gerechtigkeit und nachhaltigen Fortschritt. Die Mitte ist dabei weniger eine feste Position, sondern eher ein dynamischer Raum für vernünftige, vermittelnde, zukunftsgewandte Politik.
Die Mitte wohnt auch nicht fix bestimmten Parteien inne; das hängt, natürlich, maßgeblich vom handelnden politischen Personal ab. Aber meist sind es bestimmte Parteien, die die Mitte verkörpern. Je nach Land und Sichtweise sind die Details mannigfaltig, aber im Großen und Ganzen bestimmten in den vergangenen 80 Jahren fast überall im zivilisatorischen Westen Spielarten von Sozial- und Christdemokratie die Grundlagen der Politik. An den Regierungen wechselte man sich halbwegs ab, manche Parteien bildeten Abspaltungen in die eine Richtung aus, andere in die andere, ab und zu gab es Ausreißer und Besonderheiten, aber de facto war die Mitte die Politik. Nach den ideologischen Kataklysmen des 20. Jahrhunderts war Anderes schlicht nicht mehrheitsfähig.
Gerade für Deutschland gilt das natürlich ganz besonders. Aber auch hierzulande ist es offensichtlich vorbei. Der Weg der Mitte wird nicht mehr akzeptiert als der einzig mögliche Weg. Die populistische Herausforderung ist Ausdruck einer fundamentalen Erosion des politischen Zentrums.
Was ist passiert?
Warum das Zentrum nicht mehr funktioniert
Dieses Buch wird argumentieren, dass die Krise der demokratischen Mitte nicht hauptsächlich das Ergebnis einer irgendwie gearteten metaphysischen Verschiebung ist, eines großen Rechtsrucks oder der Missachtung von Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüssen. Sondern vor allem das Resultat einer immer größer werdenden Kluft zwischen den Erwartungen von Gesellschaft an Politik und den Ergebnissen, die diese Politik am Ende abliefert. Mit anderen Worten: Dass die Methoden der Mitte, mit der diese gute 80 Jahre verlässlich Politik machte, bei gleich einer Reihe von Themen, vom Handwerklichen bis zu den großen Linien der Weltpolitik, nicht mehr zu den Herausforderungen der Gegenwart passen. Und dass sie deshalb neue braucht.
Spätestens seit der jüngsten Bundestagswahl ist das kaum noch zu übersehen. Die Parteien des demokratischen Zentrums, CDU, SPD, FDP und Grüne, kamen da zusammen auf 54,9 Prozent der Stimmen, ein historisch schlechtes Ergebnis. Die FDP flog ganz aus dem Parlament, und bei der SPD muss man bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um eine ähnlich katastrophale Niederlage zu finden. Auch das Ergebnis der CDU war das zweitschlechteste ihrer Geschichte.
Ohne böswillig werden zu müssen, findet der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, könne man die Mitte im Jahr 2025 als ein „Kartell der Verlierer” bezeichnen.[5] „Die Parteien der Mitte”, schreibt Merkel, „zeigen eklatante Repräsentationsschwächen, wirken verbraucht, ideenarm und vertreten vor allem die alten Menschen und Besitzstandswahrer in unserer Gesellschaft”. Gerade junge Wählerinnen und Wähler entscheiden sich zunehmend für die Ränder – AfD oder Linke –, und das vor allem aus einem Gefühl der inhaltlichen Vernachlässigung: „Mit den niedergehenden Volksparteien hat diese Generation kaum mehr etwas gemeinsam: nicht im Lebensstil, nicht im Habitus, nicht in der Kommunikation oder der Arbeitsethik.”
Was Merkel meint: Viele Menschen, vor allem jüngere, sehen ihre Leben und Probleme in den Ideen, Projekten und Ergebnissen des politischen Betriebs nicht abgebildet. Womöglich ist das auch in staatsphilosophischer Hinsicht so, aber so weit muss man gar nicht gehen, es reicht ein Blick auf ganz handfeste Dinge: Züge fahren spät oder gar nicht. Seit zehn Jahren diskutiert die Politik über Migration, ohne angemessene Lösungen anzubieten. Gegen explodierende Mieten wurde jahrelang Neubau im großen Stil versprochen und nicht geliefert. In der Digitalisierung klafft eine immer größere Lücke zwischen dem, was Menschen aus ihrem Alltag gewohnt sind, und dem analogen Beharrungsvermögen staatlicher Prozesse: Faxgeräte, Briefpost, Formulare im PDF-Druckformat. Der Bau einer Windkraftanlage dauert bis zu acht Jahre, in Berlin brauchen sie allein für die Aufstellung eines Bebauungsplans manchmal neun.
Das sind plakative Beispiele. Aber sie stehen für ein strukturelles Muster: Die Asymmetrie zwischen der Größe der Herausforderungen und der gefühlten Substanz der angebotenen Lösungen nimmt zu. Die politische Mitte, de facto die staatstragenden Parteien und gesellschaftlichen Kräfte der (alten) Bundesrepublik, steht für immer mehr Menschen vor allem für Stillstand und den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das Land scheint wie festgeschraubt, eingerostet in Prozessen, die sich selbst genügen. Und das nagt an der Legitimation derjenigen, die es anders machen könnten. „Sichtbarer Verfall”, schreibt der britische Economist, „zersetzt die Politik.”[6]
Wobei das meiste im Land natürlich doch funktioniert, insofern darf man auch nicht apokalyptisch werden oder sich zu spießbürgerlichem Gemecker hinreißen lassen. Aber vieles funktioniert eben nicht mehr so gut wie früher, und die Rumpelrepublik ist eine greifbare Metapher dafür. Die Menschen merken das, und sie nehmen es übel.
„Regierungen können nicht auf diesen oder jenen Knopf drücken und die Probleme sind gelöst”, umschreibt das der ehemalige Bremer Bürgermeister und Grünen-Politiker Ralf Fücks, der jetzt den Berliner Thinktank „Zentrum Liberale Moderne” leitet. „Aber die Leute erwarten zurecht, dass demokratische Politik ‚liefert‘, statt Probleme bloß zu verwalten. Legitimation entsteht nicht nur durch Wahlen, sondern durch tatkräftiges Handeln.”[7] „Diese Zeiten brauchen Politiker, die verstehen, was los ist mit diesem Land, und Lösungen für die Probleme finden, brauchen Könner, Profis”, schreibt SPIEGEL-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit.[8] Die Mitte hat eine Output-Schwäche, und mittlerweile ist sie eklatant.
Das wäre zu jeder Zeit ein Problem. Gerade jetzt aber durchläuft die Gesellschaft wieder eine Phase des radikalen Wandels. Von Klimakrise und Energiewende über Infrastruktur, Geopolitik, Generationengerechtigkeit, demokratische Teilhabe oder die anstehenden Umwälzungen durch noch mehr, noch schnelleren technologischen Fortschritt – überall muss gebaut, verändert, angepasst, neu gedacht werden. Davon aber ist wenig zu sehen. Nochmal Wolfgang Merkel: „Die etablierten Parteien reagieren defensiv, sich an staatliche Ressourcen klammernd, der Zukunft nicht zugewandt. Versuche, die Demokratie zu demokratisieren, sind spärlich, Ideen für Politiken, die in das 21. Jahrhundert hineinführen, fehlen.”[9]
Warum ist das so? Auf der Hand läge es, die Ursache für die Lieferschwierigkeiten der Mitte vor allem in Phlegma zu suchen, in Inkompetenz, und vielleicht einer gewissen schulterzuckend-preußischen Beamtenhaftigkeit; alles streng nach Vorschrift, und in vier Jahren ist eh wieder Wahl. Ganz falsch ist das sicher nicht, und praktisch wäre es auch: Wer nichts kann, wird abgewählt.
Aber diese Erklärung greift zu kurz. Denn mittlerweile haben sich alle Parteien des gemäßigten politischen Spektrums in diversen Regierungskonstellationen ohne durchschlagenden Erfolg an den Problemen versucht – was der Hauptgrund dafür ist, dass sie alle zusammen so miserabel in Wahlen und Umfragen abschneiden. Nicht nur in Deutschland ist das so. Es bräuchte schon eine sagenhafte Zusammenballung von Unvermögen, um allein damit die andauernde politische Ergebnislosigkeit erklären zu können.
Tatsächlich haben sich in den vergangenen Jahrzehnten einige Rahmenbedingungen grundlegend verschoben und die Problemlösungsmethoden der liberalen Mitte stark in Mitleidenschaft gezogen. Ihr eigenes Versäumnis liegt darin, darauf zu zaghaft reagiert zu haben und zu versuchen, eine veränderte Welt weiter mit den alten, administrativen Mitteln zu gestalten.
Vom Ende des Neoliberalismus
Am schwersten wiegt, kleiner geht es leider nicht, die Krise des Liberalismus selbst. Ob „Neoliberalismus”, „Washington-Konsens” oder ein anderes Schlagwort, die wirtschaftspolitische Mehrheitsmeinung seit den 1980er-Jahren besser trifft, ist nicht so wichtig. Gemeint ist in jedem Fall das seither fast allgemeingültige Übereinkommen, mindestens in der politischen Mitte, dass Wirtschaftswachstum eine gute Sache ist und dafür im Großen und Ganzen ein paar Hauptfaktoren am dienlichsten sind: Demokratie, Marktwirtschaft, (halbwegs) niedrige Steuern, (möglichst) wenig staatliche Regulierung und freie Handelsbeziehungen.
Diese Prinzipien trugen die Globalisierung, und damit einen beispiellosen Anstieg von Wohlstand und Warenaustausch: Die weltweite Wirtschaftsleistung hat sich seit 1990 vervierfacht, die globalen Handelsströme haben sich versechsfacht, und die Auslandsinvestitionen sind sogar um den Faktor 13 gewachsen.[10] Der Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen sank laut der Weltbank zwischen 1990 und 2015 von 36 auf zehn Prozent.[11] Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass nichts in der Weltgeschichte die Leben so vieler Menschen so schnell so viel besser machte, wie die Ära der weltweiten wirtschaftlichen Vernetzung dies tat.
Für den amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama war dies schon 1989 so einleuchtend, dass er in einem später weltberühmten Artikel das „Ende der Geschichte” ausrief: Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks würden sich liberale Demokratie und Marktwirtschaft überall auf der Welt durchsetzen, weil etwas anderes angesichts der offenkundigen Überlegenheit des westlichen Modells schlicht keinen Sinn mache (ganz so undifferenziert drückte Fukuyama sich nicht aus, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, aber diese vereinfachte Lesart ist auch nicht ganz falsch).
Allerdings produzierte das neoliberale Dogma im weiteren Verlauf bekannterweise nicht nur Gewinner, sondern legte auch den Keim der Probleme, die die Populisten heute bewirtschaften. Die Globalisierung verwandelte mitnichten überall Diktaturen in Demokratien: das prominenteste Beispiel ist China, das zwar spektakuläre Wohlstandszuwächse hinlegte, am Ende aber eher noch autokratischer statt liberaler wurde. Zum anderen scheitert die marktwirtschaftliche Ordnung bis heute daran, eine Lösung für die Bewältigung des menschengemachten Klimawandels zu finden: Statt den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zu begrenzen, wie es das Klimaabkommen von Paris vorsieht, befürchtet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen aktuell eine Erwärmung von bis zu 3,1 Grad, mit potenziell katastrophalen Folgen.[12]
Dazu schufen die Begleiterscheinungen der kapitalistisch-kosmopolitischen Moderne in der Wahrnehmung vieler Menschen neue Probleme: Enorme wirtschaftliche Ungleichheit, vor allem in den USA, wo gleichzeitig Industriearbeitsplätze nach China abwanderten, während Aktionäre multinationaler Konzerne fantastisch reich wurden. Die Finanzkrise von 2008/2009. Internationale Migration in ungekanntem Ausmaß. Digitale Mono- oder Oligopole in Branchen, die es vor 30 Jahren nicht einmal gab. Und die Ära der identitären Kulturkämpfe, während der das, teils krass übersteigerte, Bestreben nach Diversität und der Wiedergutmachung historischer Benachteiligung von Minderheiten dazu führte, dass sich nun Mitglieder der weißen, autochthonen Mittel- und Unterschichten ausgegrenzt und zurückgesetzt fühlen.
Wie es der britische Historiker Timothy Garton Ash ausdrückt: „Wir kämpfen gleichzeitig an zwei Fronten; gegen die Feinde des Liberalismus und gegen die Probleme, die der Liberalismus erst geschaffen hat.”[13] Zugespitzer könnte man sagen: Die Ära des liberalen Universalismus, mindestens in der Ausprägung der 1990er-Jahre, ist wahrscheinlich zu Ende.[14] Das Modell hat die Gefolgschaft großer Teile der Bevölkerung verloren. Auch seine Grundannahme, dass es eine einzige, überwölbende Definition des „guten Lebens” geben könne, die alle noch so verschiedenen Teile der Gesellschaft eint, scheint von der Realität der Kulturkämpfe fürs Erste widerlegt.
Gerade für die demokratische Mitte ist das ein Riesenproblem, denn sie hat kein Alternativmodell anzubieten. In Deutschland wäre dafür zuerst die FDP zuständig gewesen. Das ganze Ausmaß ihres historischen Versagens zeigt sich auch darin, dass ihr dazu viele Jahre lang absolut gar nichts einfiel; selbst in den Wahlkampf 2024/25 zog die Partei noch mit den Hauptforderungen Steuersenkungen und Schuldenbremse. 90er-Jahre-Politik, wie sie im Buche steht.
Solange es keinen an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepassten Liberalismus gibt, wird das Vakuum mit Ideen von vorgestern gefüllt: Donald Trumps irrwitziger Handelskrieg oder das völkische Staatsverständnis der AfD. Beides sind nicht nur keine neuen Ansätze. Sie sind auch in der Vergangenheit vielfach ausprobiert, bewertet und verworfen worden. In der Politik ist offenbar nichts unumstößlich – nicht einmal unumstößlicher Unsinn.
Here comes everybody
Der zweite große Paradigmenwechsel betrifft den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Mit der Gründung von Facebook (2004) und Twitter (2006; nach der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2023 heißt das Unternehmen heute „X”) begann eine der maßgeblichsten Verschiebungen politisch-gesellschaftlicher Macht seit 100 Jahren. Für die demokratische Mitte sollte sie sich als verheerend erweisen.
Die fundamentalste Veränderung durch den Siegeszug der sozialen Medien war, ganz getreu ihrer Bezeichnung, eine unüberschaubare Zunahme der Anzahl potenzieller „Sender”: Facebook etwa hatte im Jahr 2005 weltweit geschätzte fünf Millionen Nutzer. Im Sommer 2010 waren es schon 500 Millionen.[15] Die allermeisten dieser Menschen hätten ihre Meinungen, ihr Wissen und ihre Gefühle bis dahin nur im eigenen Umfeld kundtun können. Nun konnten sie sie veröffentlichen. Das brachte eine neue, horizontale Dynamik mit sich, die sehr andere Formen der Meinungsbildung entfaltete als das bisherige Modell einiger weniger professioneller Medienmarken. Die alten Medien mit ihrer Filter- und Strukturierungsfunktion verloren ihre Deutungsmacht.
Jetzt kam ihnen diese Macht abhanden. Das Internet zerbrach den Informationsraum in Abermillionen Scherben. Das machte ihn auch demokratischer und diverser. Aber im Gegensatz zu den Visionen der Väter des Internets, die sich grenzenlose, völkerverbindende Kommunikation ausgemalt hatten, ist das Ergebnis keine Utopie der Schwarmintelligenz und des Bürgerjournalismus. Stattdessen vergrößert Social Media wie durch ein Brennglas Unterschiede, verkleinert Gemeinsamkeiten und produziert fragmentierte Gruppenidentitäten.
In der ersten Welle, ab etwa 2010, richtete sich dies gegen eher klassisch antiautoritäre Ziele: Im „arabischen Frühling” fegten über WhatsApp und Twitter gesteuerte Protestbewegungen die diktatorischen Regime in Tunesien, Ägypten, Libyen und anderen Ländern des Nahen Ostens hinweg (leider in den meisten Fällen nur, um wenig später durch andere diktatorische Regime ersetzt zu werden). Kurz darauf besetzten die Aktivisten von „Occupy Wall Street”, ebenfalls organisiert via Social Media, den Zuccotti Park im New Yorker Finanzdistrikt, um gegen die Folgen der globalen Finanzkrise von 2008 zu demonstrieren – diese hatte die Steuerzahler weltweit mehrere Billionen Dollar gekostet, während die meisten ihrer Verursacher relativ schadlos aus ihr hervorgegangen waren.[16] Diese Wahl der Themen der Mobilisierung, wenngleich organisch entstanden und damit ein Stück weit auch zufällig, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die „early adopter” der sozialen Medien oft jung, meist gebildet und damit eher politisch links waren.
Ein paar Jahre später waren Millionen älterer und weniger gebildeter Nutzer hinzugekommen. Sie brachten eigene Themen mit, und sie kämpften ihre eigenen Kämpfe: Sowohl der Volksentscheid zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) im Sommer 2016 wie auch die erste Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten am 8. November desselben Jahres wären ohne das Mobilisierungspotenzial der sozialen Medien nicht möglich gewesen.[17] Etwas früher, im Oktober 2014, entstand in Dresden die rechtspopulistische Bewegung Pegida („Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“), die ebenfalls fast ausschließlich über soziale Medien kommunizierte und Propaganda betrieb, und schon im Januar 2015 mehr Follower hatte als alle politischen Parteien in Deutschland.[18]
Marshall McLuhan, Gottvater der Medientheorie, hatte es kommen sehen: Wenn sich die Medien ändern, ändert sich auch die Wirklichkeit. Gerade die Massenmedien der Moderne haben Realität schon immer mindestens ein Stück weit so konstruiert, wie sie neutral darüber berichtet haben. Und so wie die Welt ab den 1960er-Jahren durch das Fernsehen umgewälzt wurde, so passt sich die Gesellschaft jetzt wieder an ein Leitmedium an, das nicht weniger große Verwerfungen auslöst.
Die sozialen Medien sind dabei nicht die Ursache des populistischen Aufstands gegen die Politik von Maß und Mitte, oder was dafür gehalten wird. Aber sie sind eine der wichtigsten Zutaten, sozusagen der Turbolader der Geschehnisse. Die Themensetzung des öffentlichen Diskurses geschieht nun ungesteuerter, getrieben durch die (mehr oder minder) rohen Ansichten der Menschen, die früher „das Publikum” waren. Gegennarrative, wenn sie ausreichend populär sind, werden sichtbar und wirksam.
Und in den vergangenen 15 Jahren sind dies vor allem Narrative zunehmender Unzufriedenheit gewesen. Mit dem Ausmaß von Migration, mit dem belehrenden Tonfall angeblich abgehobener Eliten, mit dem politischen Umgang mit Themen wie Sexismus oder Rassismus. Die Unzufriedenen vernetzten und organisierten sich. Sie wurden lauter, fordernder. Politische Bewegungen entstanden, um ihnen Plattformen zu geben. Auch den Aufstieg der AfD hätte es ohne Facebook und Twitter nicht gegeben. Alle Versuche des politischen und medialen Establishments, die Diskussion in Form wie Inhalt in den tradierten Korridor der Werte und Haltungen der liberalen Mitte zurückzuführen, die Leute gleichsam bei der Stange zu halten, sind gescheitert.
Dazu kommt: die sozialen Medien dienen hauptsächlich nicht der Information, sondern der Selbstdarstellung ihrer Nutzer. Es geht um Ausdruck von Persönlichkeit, Identität Zugehörigkeit, Sichtbarkeit und Eigenwahrnehmung und es finanziert sich über Anzeigen. Im Ergebnis geben die Algorithmen der Netzwerke vor allem den Äußerungen Reichweite, die bei ihren Nutzern viele und heftige Reaktionen auslösen. Oft sind dies Emotionen, Empörung und Streit.
Heraus kommt eine Welt häufig unerbittlicher Polarisierung, in die Weltanschauungen hineingezogen und ebenso unsachlich verhandelt werden. Wie Zeitungen den Nationalismus möglich machten, so erzeugen die sozialen Medien eine Gesellschaft voller Rigorismus und unversöhnlicher Debatten. Wir wählen Informationsquellen zunehmend danach aus, ob sie zu unserer Weltsicht passen und unsere Vorurteile bestätigen. Längst sind auch viele traditionelle Medien auf diesen Zug aufgesprungen, weil dort Geld und Abonnements zu holen sind. Und dahinter stecken weder der böse Wille der digitalen Plattformbetreiber, noch Fake News oder russische Desinformation. Es ist schlicht eine strukturelle Folge des neuen Medienumfelds.
Wie erfolgreiche Politik in diesem Umfeld aussieht, erleben wir auch – wiewohl meist nur deren hässliche Seite. Als Reaktion auf das neue Leitmedium ist der „Social Politician“ entstanden, wie der amerikanische Autor Jamie Bartlett ihn nennt. Meist ist er ein Mann und ein Populist, immer aber denkt er in Gut und Böse, in Zugehörigkeit und Identitäten, definiert sich gegen „die Anderen”, bedient Emotionen statt Fakten und kann Fakten sogar ignorieren, wenn sie nicht zur gewünschten Emotion passen. Donald Trump ist das bislang erfolgreichste Exemplar dieser Spezies.
In dieser Welt sind die Kräfte der politischen Mitte klar im Nachteil. Sie sind nicht laut genug, nicht krass genug, zu wenig apodiktisch, zu wenig identitär. Der Frust vieler Menschen über die Dysfunktionalitäten der Gegenwart bricht ungefiltert über sie herein – ganz davon abgesehen, dass Politik bei kaum einem Thema so schnell reagieren kann, wie identitäre Aktivisten das für nötig halten. Auch die Demokratie als solche basiert auf kleinsten gemeinsamen Nennern, die die Minderheit vonseiten der Mehrheit akzeptieren muss. Wer das Puritanertum der digitalen Medien als Folie auf die Welt legt, muss diese fast zwingend schrecklich unzureichend finden. Oder beginnen, „das System“ zu verachten.
Wenn Unmut und erfolglose Politik nicht mehr wegmoderierbar sind, braucht es eine neue Substanz. Die hat die Mitte nicht geschaffen. Stattdessen hat sie sich zu oft hinter Floskeln, Vertrösten und dem Versuch versteckt, die neue Medienwelt und ihre Auswüchse als Verirrung und Verrohung zu ächten.
Der Rahmen fällt weg
Auch Deutschlands außenpolitisches Koordinatensystem, über Jahrzehnte eine Grundlage seiner Identität, ist in den vergangenen Jahren praktisch implodiert. Die Selbstverständlichkeiten der Nachkriegsordnung – transatlantische Sicherheit unter US-Führung, europäische Integration als Friedens- und Wohlstandsmotor, die NATO als militärischer Schutzschild und eine relative Geschlossenheit des Westens – sind brüchig geworden. Was bleibt ist ein Vakuum, das Berlin nun unter Hochdruck und mit spürbarer Nervosität zu füllen versucht. Der Begriff der „Zeitenwende” von Ex-Kanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung vom 27. Februar 2022 ausgerufen, markiert den Bruch mit einer Ära, in der sich die Bundesrepublik im Windschatten geopolitischer Stabilität auf ihre wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren konnte. Diese Nische gibt es nicht mehr.
All dies begann schleichend, beschleunigte sich aber dramatisch. Die Vereinigten Staaten, einst Garant deutscher Sicherheit, signalisierten schon vor der ersten Präsidentschaft Donald Trumps eine Verlagerung ihrer Prioritäten; weg von Europa, hin zu Asien. Trumps „America First“-Politik stellte die transatlantischen Beziehungen dann offen in Frage und hinterließ auch nach seinem ersten Abgang ein nachhaltig erschüttertes Vertrauen. Die amerikanische Erwartung, dass Deutschland und Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit und die Stabilität ihrer Nachbarschaft übernehmen sollen, ist heute eine unumstößliche Konstante.
Doch gerade die Europäische Union, das zweite Fundament deutscher Nachkriegspolitik, war oft uneins. Der Austritt Großbritanniens, endlose Debatten über Rechtsstaatlichkeit und Solidarität in der Migrations- und Fiskalpolitik sowie unterschiedliche strategische Kulturen und Bedrohungswahrnehmungen stellten die Handlungsfähigkeit der EU immer wieder auf die Probe. Sie tun das bis heute. Zwar demonstrierte die Union angesichts der russischen Invasion der Ukraine seit 2022 eine bemerkenswerte Einigkeit bei Sanktionen und der Unterstützung Kiews. Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass Deutschlands oft zögerliche Haltung und seine schiere Größe und Wirtschaftskraft eine Führungsrolle erfordern, die es weder im Alleingang ausfüllen kann noch will. Eine wirkmächtige deutsche Geopolitik ist untrennbar mit der Fähigkeit verbunden, innerhalb der EU gemeinsame Positionen zu definieren und die oft unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten auszugleichen – eine Herkulesaufgabe, die oft scheitert.
Gravierender noch sind die Risse im Fundament des deutschen Wirtschaftsmodells, das lange von günstiger Energie, Exportüberschüssen und einer stabilen Weltordnung profitierte. Der Wegfall russischer Gasimporte als Folge des Ukraine-Krieges traf die energieintensive deutsche Industrie hart und beschleunigte die Notwendigkeit einer ohnehin anstehenden, aber nun ungleich teureren und dringlicheren Transformation hin zu erneuerbaren Energien. Parallel dazu erodiert die einstige Dominanz deutscher Schlüsselindustrien auf wichtigen Märkten. Insbesondere im Verhältnis zu China, dem lange wichtigsten Handelspartner und Absatzmarkt für Autos und Maschinen, kehren sich die Vorzeichen um: China entwickelt sich vom Kunden zum Konkurrenten, auch in Hochtechnologiebranchen. Die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten und Rohstoffen bei gleichzeitig wachsenden geopolitischen Spannungen und Pekings zunehmend muskulöses Auftreten gegenüber seinen Nachbarn zwingen zu einer völligen Neubewertung.
Diese tektonischen Verschiebungen im äußeren Rahmen wie im Inneren des eigenen Erfolgsmodells erzeugen tiefe Verunsicherung. Die „Zeitenwende“ bedeutet eben nicht nur die Aufstockung der Verteidigungsausgaben, sondern den fundamentalen Wandel eines Denkmodells: weg von der Annahme naturgegebener Stabilität, hin zur Akzeptanz dauerhafter Unsicherheit und der Notwendigkeit, aktiv für eigene Interessen und die Sicherheit Europas einzustehen.[19] Das erfordert nicht nur Geld, sondern vor allem einen Mentalitätswandel.
Die Suche nach der Verortung Deutschlands in dieser neuen Welt ist voller Widersprüche. Die Erwartungen der Partner an eine Führungsrolle stehen oft im Kontrast zu innenpolitischen Beharrungskräften und einer traditionell sehr zurückhaltenden außenpolitischen Kultur. Deutschlands erste „Nationale Sicherheitsstrategie” von 2023 versuchte, diesen Herausforderungen mit einem integrierten Ansatz zu begegnen, der militärische, wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Resilienz zusammendenkt.[20] Aber Strategiepapiere allein schaffen gar nichts. Der Weg Deutschlands zu einer außenpolitisch handlungsfähigen, strategisch bewussten, aber schon angesichts der Geschichte vor allem verantwortungsvollen Mittelmacht ist mindestens wolkig. Es braucht viel Kraft, um sich in der neuen Welt zu behaupten. Die alte Sicherheit ist verloren, eine neue noch nicht gefunden.
Und wo Sicherheit fehlt, wächst die Nervosität. Es ist ziemlich wohlfeil, angesichts der Größe der Herausforderung den Mangel an Lösungsansätzen zu bekritteln. Fakt ist aber wohl doch, dass die Mitte durch ihren fast offensiven Unwillen, den Wandel zur Kenntnis zu nehmen, zur Nervosität ein gutes Stück beigetragen hat. Trump 2 etwa, oder Chinas Aufstieg, waren lange mindestens zu befürchten, die Vorbereitungen geschahen in aller Öffentlichkeit. Darauf vorbereitet haben wir uns trotzdem nicht so sehr. In Deutschland hat dieses Versäumnis mit dem „Bündnis Sarah Wagenknecht” sogar eine ganz neue populistische Partei geschaffen, deren Alleinstellungsmerkmal die Fantasie des Friedens mit Russland und des Rückzugs ins wohlige Gehäuse der frühen Bundesrepublik ist.
Alles dauert zu lange, nichts geht mehr voran – Verwaltungsblockade und Fortschrittsversagen
Der letzte Faktor ist ebenso historisch wie die anderen, aber er basiert weniger auf den ganz großen Weltläufen. Dafür ist er umso relevanter. Es ist die Geschichte einer Selbstfesselung.
Zusammengefasst: Die Institutionen des 20. Jahrhunderts sind den Herausforderungen des 21. nicht gewachsen. Sie sind ausgelegt für das Verhandeln von Verteilungsfragen und die explizite Verlangsamung von Neuem. Das ist so, weil sie gleichsam die kristallinen Prioritäten der 1970er-Jahre abbilden: Umweltschutz, Bürgerbeteiligung, das Ausstatten von oft latent wachstumskritischen Partikularinteressen mit Einspruchs- und Vetorechten. Staat und Gesellschaft haben sich aus freien Stücken – und einst nachvollziehbaren Gründen – in ihrer Handlungsfähigkeit beschnitten, die uns heute im Weg steht.
Dahinter steht eine grundsätzliche Verschiebung des Fortschrittsbegriffs: Knappe 300 Jahre lang waren vor allem die Gesellschaften des Westens in dem Glauben vereint, dass alles immer besser wird. Dass Schwierigkeiten zeitweilige Herausforderungen sind, die durch Forschung, Technik und Moral schlussendlich überwunden werden. Das amerikanische Mondprogramm der 1960er-Jahre ist das letzte große Beispiel für diese Haltung.[21]
Doch in den 1970ern, so scheint es von heute aus betrachtet, wurde das anders. Ab dann beherrschten zunehmend Erzählungen über eine Zuspitzung von Problemen den Zukunftsdiskurs: Hunger, Umweltverschmutzung, nukleare Bedrohung. Plötzlich lebten die Protagonisten der Science-Fiction-Filme und -Romane nicht mehr in Utopien oder im ewigen, kosmopolitischen Frieden, wie zum Beispiel in Star Trek. Sondern in den dystopischen Nachwehen verschiedener Klima-, Alien- oder Zombie-Apokalypsen.
In den 90ern, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, flackerte der Optimismus kurz wieder auf. Aber heute blicken wieder zwei Drittel der Deutschen „sorgenvoll“ oder „mit sehr großer Angst“ nach vorn.[22] „Die Selbstbeschreibung der Gesellschaft als Fortschrittsgesellschaft (wich) vermehrt der Beschreibung als Krisengesellschaft“, umschreibt das der Würzburger Soziologe Sebastian Suttner.[23]
Das ist erst einmal verständlich: In den 70er-Jahren ging in Deutschland eine Epoche rasanten Wachstums zu Ende.[24] Es herrschte Vollbeschäftigung, die Staatsverschuldung war stabil und niedrig.[25] Die Natur hingegen war in einem beklagenswerten Zustand, auch, weil vielerorts die Überzeugung vorherrschte, Naturschutz „hemme den Wiederaufbau“.[26]
Erst 1969 „erfand” die sozial-liberale Koalition von Bundeskanzler Willy Brandt den Umweltschutz überhaupt als Politikfeld. Nach drei Jahrzehnten Wirtschaftswunder breitete sich das Gefühl aus, dass man sich ein bisschen weniger Wohlstand im Tausch für mehr Lebensqualität und den Schutz des Planeten durchaus leisten könne. Das war übrigens nicht nur in Deutschland so.
Im Zusammenspiel mit der Anti-Atomkraft- und der Friedensbewegung, kapitalismuskritischen Werken wie den „Grenzen des Wachstums” (dem Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit von 1972) sowie diverser anderer Krisen- und Untergangsprophezeiungen kippte der Diskurs in eine Richtung, die zum einen die Zukunft weniger als Verheißung denn als Bedrohung verstand. Und die, zum anderen, mindestens in ihren subkulturellen Ausprägungen die Wirtschaft und den Menschen per se als im Gegensatz zur Natur und dem Wohl des Planeten stehend ansah.
Platt gesagt: Andere Dinge wurden wichtiger als Autobahnen; Folgen, Risiken, Auswirkungen auf Menschen, Tiere und vieles andere. In den folgenden Jahrzehnten hat dies diverse Gestaltwandlungen durchlaufen. Grundlegend geändert hat es sich aber nicht. Alle Aspekte des Lebens sind heute von einer gewaltigen Menge an Regeln und Vorsichtsmaßnahmen durchdrungen, die zum Ziel haben, unerwünschte oder nur unerwartete Nebenwirkungen möglichst gar nicht entstehen zu lassen.
Das Ergebnis liegt auf der Hand: weniger Dynamik. Vieles dauert heute sehr lange, und einiges geht gar mehr voran. Das Einhegen von Entscheidungen durch die nachdenklichen, das Gemeinwohl betonenden Prioritäten der 70er führte vor allem dazu, dass bürokratistische Denkweisen wichtiger wurden. Bei denen aber geht es zuvorderst um Prozesse, nicht um Resultate: Wenn beim Bau eines Windrades zunächst zwingend alle Betroffenen angehört, alle Kröten umgesiedelt, alle Ausschreibungen gemacht werden, dann sind andere Aspekte notwendigerweise zweitrangig. Dann dauert es am Ende so lange, wie es eben dauert. Und es funktioniert auch, solange man die Windräder nicht dringend braucht.