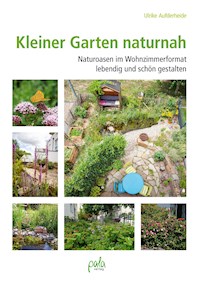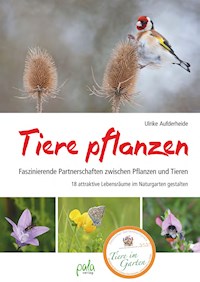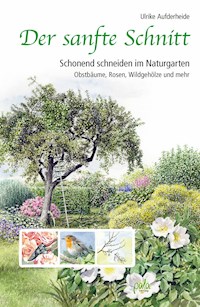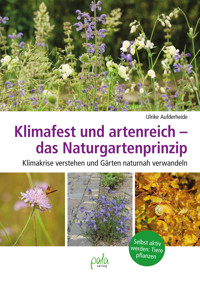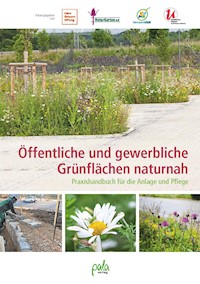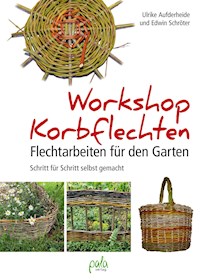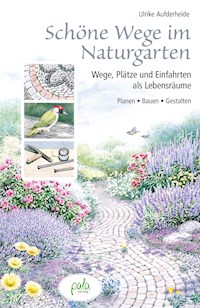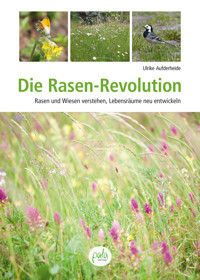
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: pala
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit Rasen die Artenvielfalt fördern und das Klima schützen - dieser Vorschlag der Naturgartenplanerin Ulrike Aufderheide überrascht. Gilt der sattgrüne Grasteppich doch oft als Inbegriff naturfeindlichen Gärtnerns. Doch dieses Buch macht schnell klar: Rasenflächen sind besser als ihr Ruf. Werden sie naturnah angelegt und biodiversitätsfördernd gepflegt, gewinnen wir eine Vielzahl von Naturerlebnissen und zudem Flächen, die in der Klimakrise gut funktionieren. Kurzrasige, blütenreiche Flächen gehören seit Jahrmillionen zu unserer Natur und viele Pflanzen und Tiere sind genau an diesen Lebensraum angepasst. Gut verständlich skizziert die Diplom-Biologin die naturwissenschaftlichen und kulturhistorischen Zusammenhänge. Ihr Fazit ist ermutigend: Gärten ähneln in ihren Grundzügen diesen Naturlandschaften. Direkt vor unserer Haustür haben wir also eine große Chance, die Artenvielfalt zu fördern. Das Buch ist unentbehrlich für die naturnahe Neuanlage oder Umgestaltung und die biodiversitätsfördernde Pflege von blütenreichen Rasen und Wiesen. Passende Listen mit heimischen Pflanzen für attraktive Wiesenbeete und Porträts faszinierender Partnerschaften von Pflanzen und Tieren machen Mut, aktiv zu werden. Neue Rasen und Wiesen braucht das Land!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Aufderheide
Die Rasen-Revolution
Rasen und Wiesen verstehen, Lebensräume neu entwickeln
Inhalt
Cover
Titel
Mit Rasen die biologische Vielfalt fördern?
Überall blüht’s – jede Blüte zählt?
Auf der Suche nach den echten Blumenwiesen
Blumenwiesen sind Heuwiesen
Von der Heuwiese zur Blumenwiese im Garten
Artenreiche Weiderasen
Rasen auf Extremstandorten
»Weidefläche« im Garten – Blumenkräuterrasen
Streuobstwiesen – fast schon ein Garten
Niemandsland als letzter Rückzugsraum – Säume
Biodiversitätsförderung und Wiesenmahd – ein Widerspruch in sich?
Ohne Pflege geht es nicht
Auswirkungen des Schnitts
Von der Wiese zum grünen Teppich
Grasmonokulturen im Garten
Das Ideal vom grünen Teppich
Ein Rätsel und seine Lösung – die Geschichte der Wiesen und Weiden
Das Rätsel
Im Wald von Fontainebleau
Trennung von Wald und Feld
Hotspots der Biodiversität – Bäume, Sträucher und Grasland an einem Ort
Naturgeschichte der Graslandökosysteme
Europäische Savannen
Die Kulturgeschichte der Grasfluren
Die Allmendeweide – Savanne aus Menschenhand
Kulturgeschichte der Blumenwiesen
Wissenschaftliche Erkenntnisse haben eine Geschichte
Unsere Chance – Naturgärten im besiedelten Raum
Warum gehört der Rasen ins Gartenparadies?
Arkadische Landschaften – paradise lost
Der Paradiesgarten
Der Rasen vor der Erfindung des Rasenmähers
»Urweiden« im Park?
Warum fällt alles so wunderbar ineinander?
Rasen sind unentbehrlich in der Klimakrise
Gärten mit Rasen und Wiesen gestalten
Der Rasen als Funktionsfläche
Übergänge gestalten und Grenzen setzen – Alternativen zur Rasenkante
Rasen und Wiesen anlegen
Umwandlung oder Neuanlage?
Die Neuanlage durch Aussaat
Pflege im ersten Jahr
Umwandlung mit Initialpflanzungen
Rasen und Wiesen pflegen
Naturnah schneiden – nur so viel wie nötig
Am besten ohne Motor mähen
Keine Mähroboter im Naturgarten
Mähen mit der Sichel
Mähen mit der Sense
Heckenschere und Balkenmäher für die biodiversitätsfördernde Pflege
Der richtige Zeitpunkt für die Mahd
Kein Trinkwasser für den Rasen
Spontanbesiedler tolerieren und fördern
Veränderung der Artenzusammensetzung besser verstehen und steuern
Moos bekämpfen oder willkommen heißen?
Umgang mit Staunässe
Ungebetene Wühler – Maulwürfe und Wühlmäuse
Kahle Stellen schätzen lernen
Es geht auch ohne – Alternativen zum Rasen
Offene Böden
Holz und Rinde
Bodendecker statt Rasen
Das Beste aus zwei Welten
Wildstaudenbeete einfach planen und biodiversitätsfördernd pflegen
Wiesenbeete für sonnige Standorte
■ Sumpf-Dotterblumenwiesenbeet
■ Pfeifengraswiesenbeet
■ Noch mehr Pflanzen für Feuchtwiesenbeete
■ Bergwiesenbeet
■ Flachlandwiesenbeet, mäßig trocken und kalkhaltig
■ Noch mehr Pflanzen für Wiesenbeete auf normalem Gartenboden
■ Magerwiesenbeet, kalkreich
■ Magerwiesenbeet, kalkarm
■ Noch mehr Pflanzen für magere Standorte
Zum guten Schluss – Garten-Natur
Die Autorin
Dank
Anhang
Zum Weiterlesen
Weiterführende Informationen
Impressum
Mit Rasen die biologische Vielfalt fördern?
Rasen kann bunt und lebendig sein. Hier blüht der zarte Knollige Hahnenfuß, eine Art, die in unserer Landschaft immer seltener wird.
Mit Rasenflächen können wir die biologische Vielfalt fördern! Kann das sein? Wenn wir in unserem Garten oder auf Grünflächen etwas für die Natur und gegen den Verlust an biologischer Vielfalt tun wollen und mit der Umgestaltung beginnen möchten, dann fallen uns doch als Erstes die Rasenflächen ins Auge: langweilige grüne Teppiche, »englischer Rasen«. Dort könnte doch etwas Lebendigeres entstehen! Den Rasen in eine Wiese umzuwandeln, ist oft die erste Idee, wenn Menschen sich auf den Weg machen, im besiedelten Raum etwas gegen die größte Krise unserer Zeit, die Biodiversitätskrise, zu tun. Als Planerin von biodiversitätsfördernden Gärten habe ich aus diesem Grund lange Zeit Rasenflächen für einen Kompromiss gehalten, weil die Kinder einen Platz zum Fußball- oder Federballspielen brauchen oder jemand in der Familie einfach sehr gerne seinen Rasen mäht. Bis ich anfing, mich damit zu beschäftigen, wie die Landschaften wohl ausgesehen haben, in denen unsere Pflanzen und Tiere entstanden sind, weil ich verstehen wollte, wie wir unsere Natur am besten fördern können –, und bis mir dabei der Rasen begegnete.
Dieses Buch möchte Sie einladen, den vermeintlich überflüssigen (vielleicht sogar bösen?) »englischen Rasen« neu zu verstehen, das Feindbild über Bord zu werfen und zu entdecken, wie wichtig kurzrasige Flächen für die Förderung der biologischen Vielfalt sind. So ist die »Rasen-Revolution« zwar wie jede Revolution mit einer Umwandlung der Werte verbunden, damit das, was gering geschätzt wurde, künftig hoch geachtet wird. Aber sie ist eine friedliche Revolution, weil wir aus einem hässlichen Feind einen wunderschönen Freund machen werden. Wir verwandeln den toten grünen Teppich wieder in das, was er sehr lange Zeit war: die blütenbestickte Grundlage jedes Paradiesgärtleins und der arkadischen Landschaften unserer Träume.
Denn wir brauchen Rasenflächen: einmal wieder auf der Erde liegen und den Wolken nachschauen oder Krabbeltiere aus nächster Nähe betrachten, für Ballspiele, die Sommer-Kaffeetafel, den Kindergeburtstag oder das Familienfest. Auch gestalterisch haben Rasenflächen eine Menge Vorteile. Ähnlich wie Wasserflächen bieten sie weite, eher homogene Flächen, die Staudenbeete, Bäume und Gebüsche wie auf einer Bühne präsentieren. Dieses Buch soll zeigen, dass Rasenflächen ebenso unverzichtbar zu Gärten und Grünflächen gehören, auf denen zusätzlich zu allen anderen Funktionen, die die Flächen haben, auch noch wilde Pflanzen und Tiere gefördert und erlebt werden sollen.
Kurzrasige, eher lückige, aber blütenreiche Flächen gehören seit Jahrmillionen zu unserer Natur und viele Pflanzen und Tiere sind genau an diesen Lebensraum angepasst. In einer Welt voll üppig hoher Blumenwiesen und dichter Wälder würden Stare, Dohlen oder Grünspechte, die ihre Nahrung auf kurzrasigen Flächen suchen, kaum Nahrung finden, würden Wildbienen ohne Erfolg offene Bodenstellen zum Nisten suchen, Eidechsen könnten am schattigen Wiesenboden die wärmende Sonne und ihr Futter, die blütenbesuchenden Insekten, nicht mehr erreichen.
Aber ist der Rasen nicht geradezu die Verkörperung naturfeindlichen Gärtnerns? Da werden Grasmonokulturen mit viel Aufwand gedüngt, mit den verschiedenen Giften gegen Moos, »Unkräuter«, Pilze, Insekten und Regenwürmer behandelt, mit Unmengen an Trinkwasser versorgt, mit lärmenden und stinkenden Maschinen gemäht und produzieren dafür nur – Abfall.
Die Rolle rückwärts, von einer besonders die Natur und Umwelt belastenden Fläche hin zu einer Fläche, auf der wir der Natur gerade das bieten können, was aus unserer Landschaft immer mehr verschwindet, ist beim Rasen besonders einfach. Wir verlieren keine der Funktionen, die die naturfeindlichen Graswüsten erfüllten, und gewinnen eine Vielzahl von Naturerlebnissen und dazu noch Flächen, die auch in der Klimakrise gut funktionieren. Denn viele der Pflanzen der mageren, kurzrasigen Lebensräume sind gut an heiße und trockene Standorte angepasst. Sie werden in Hitzeperioden nicht braun, sondern bleiben grün. Manche Arten blühen sogar unbeirrt weiter. Es lohnt sich also, Rasen und Wiesen neu zu denken.
Extensive Weiden sind ein blütenreicher Lebensraum
Im Sommer leuchtet dieser hoch aufgewachsene Blumenkräuterrasen labkrautgelb
Dieses Buch ist eine Einladung, eine spannende Zeitreise in die Geschichte unserer Landschaft zu machen. Auch wenn Forschende seit über hundert Jahren davon ausgegangen sind, dass Mitteleuropa eigentlich ein Waldland ist, so wird inzwischen immer deutlicher, dass kurzrasiges Grünland auch in Mitteleuropa ein uralter Lebensraum ist (siehe Seite 53). Die als so natürlich empfundene Blumenwiese wiederum existiert, wenn wir die lange Geschichte unserer Tier- und Pflanzenwelt betrachten, erst seit sehr kurzer Zeit. Zudem können Blumenwiesen, wenn sie mit modernen Maschinen gepflegt werden, sogar zu einer ökologischen Falle werden, also mehr schaden als nützen (siehe Seite 31).
Im Garten können wir aber das Beste aus zwei Welten, aus der Rasenwelt und aus der Wiesenwelt, auf einer Fläche kombinieren: die durchgehende Blüte der Weiderasen und die Blütenpracht einer Blumenwiese kurz vor dem Schnitt.
Nach unserer Zeitreise werden wir mit Erstaunen feststellen, dass wir ausgerechnet mit Blumenbeeten, die Rasenflächen und Wiesen nachempfunden werden, im Garten, also weit weg von der vermeintlich »richtigen Natur«, die biologische Vielfalt besonders schön fördern können.
Überall blüht’s – jede Blüte zählt?
Eine Einsaat exotischer Sommerblumen bietet nur wenigen Arten einen Lebensraum
Unter Fachleuten war es schon seit Langem bekannt, dass unser Planet ein Artensterben erlebt, wie es zuletzt vor 65 Millionen Jahren stattfand, als ein Asteroid mit der Erde kollidierte. Nur diesmal sind wir der »Asteroid«. Es besteht kein Zweifel, dass die großen Veränderungen, die unser Wirtschaften und unsere Art, das Land zu nutzen und zu verändern, die Ursachen für das große Artensterben unserer Zeit sind. Aber erst die Aktionen und Volksbegehren unter dem Motto »Rettet die Bienen« haben es geschafft, in weiten Teilen der Bevölkerung Aufmerksamkeit zu erregen. Honigbienen brauchen Blüten, also gibt es jetzt überall Flächen nach dem Motto »Jede Blüte zählt«. Oft werden dort Samenmischungen mit einjährigen Sommerblumen aus aller Welt ausgesät. Das sieht schön aus und es summt und brummt über den Blüten, weil zahlreiche Honigbienen, Hummeln und auch der eine oder andere Schmetterling dort Nektar suchen und finden.
Aber reicht es, Honigbienen, Hummeln und einige Falter mit Nektar zu versorgen? Bunte Sommerblumenmischungen sind im besten Falle ein erster Schritt auf einem längeren Weg. Unsere biologische Vielfalt beschränkt sich ja nicht auf einige eher unspezialisierte Bestäuber. Schätzungen der Zahl der Insektenarten in Deutschland liegen bei ungefähr 38 000 Arten, auch für die Schweiz und Österreich gehen die dortigen Umweltbundesämter von ungefähr 40 000 Arten aus. Ein Viertel davon, also ungefähr 10 000 Arten, sind Fliegen und Mücken, ein weiteres Viertel Hautflügler (darunter 600 bis 700 Wildbienenarten), ein weiteres knappes Viertel sind Käfer. Die Hälfte aller Insekten ernährt sich zumindest einen Teil ihres Lebens nicht von Pollen und Nektar, sondern von lebendem Pflanzengewebe.
Im Laufe der Evolution haben die Pflanzen natürlich zahlreiche Strategien entwickelt, um die vielen Pflanzenfresser abzuwehren. Dies wiederum hat dazu geführt, dass sich viele Pflanzennutzer auf bestimmte Nahrungspflanzen spezialisiert haben. Pflanzen und Tiere passen also zusammen wie Schlüssel und Schloss.
Zu den spezialisierten Tierarten gehören übrigens auch zahlreiche der relativ unspezialisierten Bestäuber, die in den Sommerblumenmischungen zu beobachten sind, aber nicht als bunte Fliege, schillernder Käfer oder bunter Schmetterling, sondern in ihren Larvenstadien. So knabbern die Larven der Bunten Erzschwebfliege (Cheilosia illustrata) ausschließlich in den Wurzeln von Pastinake (Pastinaca sativa) oder Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium). Die Raupen des Aurorafalters (Anthocharis cardamines) fressen die Früchte und Blätter von Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) und einigen wenigen verwandten Pflanzenarten. Wer Insekten »ernten« , sie also nicht nur beobachten, sondern auch ihre Vermehrung fördern möchte, muss allen Lebensstadien Futter bieten, also auch Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen säen oder pflanzen. Und das sind aufgrund der langen gemeinsamen Anpassung aneinander hauptsächlich heimische Arten. Exotische Pflanzenarten bieten nur wenigen Insektenarten Futter.
Genau deshalb können Sommerblumenmischungen, egal, welchen fantasievollen Namen sie auch tragen, in eine Sackgasse führen. Weil wir artenreiche Weiden und Wiesen aus unseren Landschaften verloren haben und nicht mehr wissen, was eine Blumenwiese eigentlich ist – nämlich eine Fläche, auf der Heu gemacht wird –, denken viele Menschen inzwischen, diese einjährigen Mischungen seien Blumenwiesen. Wenn aber niemand mehr den Wert der letzten artenreichen Grünlandflächen erkennen kann, dann fällt auch nicht mehr auf, wenn sie verschwinden, und mit ihnen viele seltene Pflanzen und Tiere.
Blütenreiche Weiden und Wiesen wurden nicht gesät, sie sind entstanden, weil dort Tiere weideten oder Heu gemacht wurde. Flächen mit Sommerblumen, die jedes Jahr neu gesät werden und nach wenigen Wochen blühen, können schon deshalb den meisten Insekten der Wiesen und Weiden nicht helfen, weil unsere Tiere an die Pflanzenarten der Wiesen und Weiden angepasst sind und exotische Arten nicht oder kaum nutzen. Außerdem kommen die meisten mehrjährigen Kräuter, die für die Insekten wichtig sind, im ersten Jahr nach einer Einsaat noch gar nicht zur Blüte. Und fast alle Insekten brauchen für ihren Lebenszyklus mehr als wenige Wochen. Sie müssen ja oft den Winter als Larven oder Puppen in oder an ihren Futterpflanzen überdauern. Wer Insekten fördern möchte, veranstaltet nicht jedes Jahr ein kurzes Blütenfeuerwerk, sondern arbeitet mit langem Atem und auf Dauer. Damit ersparen wir uns auch das jährliche Umbrechen und die Neueinsaat der Flächen.
Gefüllt blühende exotische Blumen bieten nicht einmal Nektarsammlern Nahrung
Im Grunde sind diese einjährigen Blühflächen ja eine Form von Ackerbau, gewissermaßen Sommerblumenäcker, und so fördern sie auch die auf einjährige Kulturen spezialisierten Wildpflanzen: Acker-Kratzdistel, Acker-Schachtelhalm, Melden und Quecken. Schon nach wenigen Jahren sind solche Flächen oft so stark mit diesen Arten bewachsen, dass sie aufgegeben werden müssen.
Pflanzen und ihre Tiere
Wilde Engelwurz & Pelzige Erzschwebfliege
Menschenhoch ragen die weißen Blütendolden der Engelwurz im Spätsommer in feuchten Wiesen und Säumen in die Höhe. Der Sage nach soll der Erzengel Raphael die Engelwurz als Heilpflanze auf die Erde gebracht haben. Sie ist eine kurzlebige Pflanze, sät sich aber gut aus. Wenn Sämlinge an unerwünschten Stellen im Garten erscheinen, jäten wir sie einfach. Die hohen abgestorbenen Stängel sind ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Insektenlarven und schmücken unsere Beete auch noch im Winter. Sie sollten als »Puppenstuben« so lange wie möglich stehen bleiben, damit die Insekten schlüpfen können, wir also die Tiere, die wir mit den Engelwurzsamen »gesät« haben, auch »ernten«.
Und unser Beet-Engel duftet! Alle Pflanzenteile haben ein einzigartiges, warmes, entspannend und gleichzeitig anregend wirkendes Aroma und werden deshalb gerne in der Wildkräuterküche verwendet.
Pelzige Erzschwebfliege
Auf den Dolden wuseln zahlreiche Blütenbesucher, vor allem die auffällig gefärbten Schwebfliegen, aber auch viele Käfer, denn der Pollen liegt offen und kann auch von Insekten mit kurzen Mundwerkzeugen erreicht werden. Paul Westrich beobachtete acht verschiedene Wildbienenarten, die hier Pollen sammeln. Andere Forschende fanden in und an den Blüten, Samen, Stängeln, Blättern und Wurzeln die Raupen von 29 Schmetterlingsarten und Larven von 18 Fliegenarten.
Die Larven von Schwebfliegen leben ja oft räuberisch, zum Beispiel von Blattläusen, und sind beliebte »Nützlinge« im Nutzgarten. Es gibt aber auch vegetarisch lebende Arten, so ernähren sich die Larven der Erzschwebfliegen (Cheilosia) von Pflanzengewebe, und zwar gut geschützt von Feinden im Innern der Pflanzen. Einige Erzschwebfliegenarten entgehen auch als erwachsene Tiere ihren Feinden, indem sie wehrhaften Bienen oder Wespen ähnlich sehen. Dazu gehört die Pelzige Erzschwebfliege (Cheilosia chrysocoma), die nur sehr schwer von der Rotpelzigen Sandbiene (Andrena fulva) zu unterscheiden ist. Die Larven der Pelzigen Erzschwebfliege wurden bisher nur an der Wilden Engelwurz beobachtet. Wenn wir beide Insekten-Arten unterscheiden wollen, müssen wir pelzigen Wildbienen auf den Blüten von Doldenblütlern etwas tiefer in die Augen schauen. Die Augen der Schwebfliegen sind sehr groß, bei Männchen berühren sie sich sogar. Bei Wildbienen liegen die Augen als schmale »Mondsicheln« außen am Kopf.
Wilde Engelwurz ist ein Insektenmagnet
Auf der Suche nach den echten Blumenwiesen
Mähen, schleppen, walzen: Wo früher Schafe auf artenreichen Deichen weideten, wächst heute nur noch Gras (oben). Heuwiesen gab es früher überall, jede Landschaft hatte ihre eigenen Wiesenfarben (unten).
Blumenwiesen sind Heuwiesen
Heuwiesen sind entstanden, weil Vieh auch im Winter Futter braucht. So lange diese Flächen nicht oder kaum gedüngt und nicht zu oft gemäht werden, können hier etliche bunt blühende Kräuter wachsen, nämlich die Arten, die damit zurechtkommen, dass sie ein-, zwei- oder dreimal im Jahr abgeschnitten werden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war unsere Landschaft voll bunt blühender Heuwiesen, heute müssen wir sie lange suchen, denn die industrialisierte Landwirtschaft muss so viel Vieh wie möglich von einer Fläche ernähren. Es wird zwar noch Grünfutter produziert, aber kaum noch Heu gemacht, stattdessen pressen die Landwirte das Gras zu Silageballen. Um möglichst viel zu ernten, werden die Wiesengräser mit Gülle und mineralischem Dünger zur Hochleistung angetrieben. Bis zu sechsmal kann so geerntet werden. Wenn das Gras mit einem der seit 2023 auf den Markt gebrachten Ernteroboter geerntet und direkt verfüttert wird, sogar bis zu neunmal. Den besten Ertrag bringt dabei das Deutsche Weidelgras. Sobald die Fläche »verunkrautet«, also das eine oder andere blühende Kräutchen auftaucht, wird nachgesät oder der Bestand mit Herbiziden behandelt und das Weidelgras neu eingesät. Konventionelles Grünland ist meist eine Grasmonokultur.
Blühende Kräuter können in Wiesen nur überleben, wenn sie nicht von konkurrenzstarken Gräsern verdrängt werden. Da Düngung aber vor allem die Gräser fördert, dürfen blütenreiche Wiesen gar nicht oder nur selten gedüngt werden. Sie bringen deshalb weniger Ertrag, werden seltener geschnitten. Für die blühenden Kräuter hat das den Vorteil, dass die Pflanzen noch zur Blüte kommen und Samen bilden können.
Es lohnt sich, vor allem Anfang Juni, wenn die Heuwiesen in ihrer Hochblüte stehen, sie zu suchen und dort zu entdecken, wie verschieden Blumenwiesen aussehen können. Denn jede Landschaft hat ihre eigenen Blumenwiesen mit eigenen Farbklängen und Düften. Machen wir also eine kleine Entdeckungsreise.
Feuchtwiesen
In der Nähe von Flüssen und Seen sind Wiesen von Natur aus im Vorteil, denn für Ackerfrüchte ist der Boden oft zu nass. Feuchte Böden sind Grünlandstandorte. Traditionell werden die Feuchtwiesen ein- oder zweimal im Jahr gemäht. An besonders feuchten Stellen blüht im frühen Frühjahr die Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), gefolgt von den weißen Wogen des Wiesen-Schaumkrauts und den rosa Feldern der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi). Trollblume (Trollius europaeus) und Hahnenfußarten fügen leuchtend goldgelbe Farbaspekte hinzu. Tiefblau blühen die Gruppen der Wiesen-Iris, auch als Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) bekannt, zumeist zusammen mit den rosa Kerzen des Wiesen-Knöterichs (Bistorta officinalis).
Auf zweimal im Jahr gemähten feuchten Wirtschaftswiesen ist der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) die dominierende Grasart. Wenn der Boden noch nasser und sumpfig ist, dominieren Pfeifengras, Binsen oder Seggen. Pfeifengraswiesen und Seggenriede bringen wenig Ertrag, der kaum als Futter taugt. Traditionell wurden sie einmal, relativ spät im Jahr gemäht und das Mahdgut wurde als Einstreu genutzt, daher werden diese Wiesen auch als Streuwiesen bezeichnet.
Hier leuchten auf einer feuchten Wiese Wald-Storchschnabel und Wiesen-Knöterich
Glatthaferwiesen
Glatthaferwiesen sind die Wiesen der guten Böden im Tiefland, in den Talböden und im unteren Bereich der Hänge. Hier steht der Glatthafer Anfang Juni fast menschenhoch. Wenn sie nicht gedüngt werden, sind die Wiesen voller Blumen. Wiesen-Margeriten (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Witwenblumen (Knautia arvensis), Wiesen-Flockenblumen (Centaurea jacea), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) und Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa) bieten Insekten reichlich Nahrung. Glatthaferwiesen werden zweimal, höchstens dreimal im Jahr gemäht. Wird häufiger geschnitten, dann verschwindet der schnittempfindliche Glatthafer und es entsteht eine Weidelgras-Weißklee-Weide, auch wenn nicht gedüngt wird. In höheren Lagen wachsen auf gut mit Feuchtigkeit versorgten Böden die Goldhaferwiesen, die wie artenreiche Glatthaferwiesen durch ihre Blütenpracht bezaubern.
Trespenwiesen
An trockeneren, mageren Standorten finden wir die niedrigeren, weniger ertragreichen Trespenwiesen. Sie können nur einmal im Jahr gemäht werden und zwischen den schütteren Gräsern fallen die bunt blühenden Kräuter besonders gut auf: Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata), Sonnenröschen (Helianthemum nummularium), Echte Schlüsselblume (Primula veris) und Skabiosen-Flockenblume sind Beispiele für die kräftigen Blütenfarben, die auf Trespenwiesen und anderen Halbtrockenrasen leuchten.
Magere Wiesen sind besonders blütenreich
Von der Heuwiese zur Blumenwiese im Garten
Haben Sie einen Rasen, der eigentlich nur »da« ist, einmal in der Woche mit dem Rasenmäher befahren wird und ab und zu vertikutiert und gedüngt wird? Solche funktionslosen Rasenflächen sind dazu prädestiniert, in eine Blumenwiese umgewandelt zu werden, denn auch Blumenwiesen werden nur zur Pflege betreten. Voraussetzungen sind, dass wir hier ähnliche Bedingungen wie auf einer Heuwiese vorfinden und die Fläche dann auch wie eine Heuwiese pflegen. Unsere Blumenwiese sollte also in der vollen Sonne liegen und nicht zu klein sein. Denn der Bewuchs der klassischen Heuwiese wird, vor allem wenn Glatthafer enthalten ist, recht hoch und würde sich bei einseitigem Sonneneinfall unschön dem Licht entgegenlegen. Sie sollten die Wiese dann nur noch zum Mähen und kurz nach dem Schnitt betreten, denn einige Wiesenarten sind darauf angewiesen, dass sie sich regelmäßig aus dem Heu heraus wieder aussäen. Dafür muss der Boden offen sein und es darf sich keine dicht geschlossene Grasnarbe ausbilden. Die Blumenwiesen-Saatgutmischungen für den Garten enthalten oft Arten sowohl der feuchten als auch der trockeneren Standorte. Auf jeder Fläche setzen sich dann die jeweils passenden Arten durch.
Blumenwiesen und Blumenkräuterrasen im Garten zeigen ihre ganze Pracht
Artenreiche Weiderasen
Blumenwiesen sind oft gleichförmig, vor allem wenn der Boden auf der ganzen Fläche dieselben Eigenschaften hat. Alle Pflanzen erfahren ja gleichzeitig dieselbe Behandlung, so entstehen mehr oder weniger bunte und homogene Flächen.
Weiden wirken dagegen unruhiger, weil hier ein Maulwurfshaufen ist, dort die Tiere das Futter haben stehen lassen. An anderer Stelle ist vielleicht der Boden vegetationsfrei, weil die Tiere dort oft stehen, liegen oder sich wälzen. Dieser Strukturreichtum der Weiden schafft viele verschiedene unterschiedliche Bedingungen, mal ist es schattiger oder feuchter, mal trockner und magerer. Auf Weiden gibt es also viele unterschiedliche kleine Lebensräume, vor allem wenn auch Gehölze auf den Weiden wachsen dürfen. Auf einer Wiese sind Strauchgruppen oder Einzelbäume den Mähgeräten im Weg, für Weidetiere ist das kein Problem, und alle Tiere lieben ja auch den Schatten unter einem ausladenden Baum in der Mittagshitze. Und dann gibt es da auch noch die Kuhfladen, Pferdeäpfel oder andere tierische Ausscheidungen. Sie bieten, soweit sie frei von Tiermedikamenten sind, einen sehr wichtigen Lebensraum für die zahlreichen Arten, die von ihnen leben. Und je mehr Kleinlebensräume es auf einer Fläche gilt, desto höher ist die biologische Vielfalt. Weiden sind deshalb oft besonders artenreich.
Auf extensiven Weiden halten die Tiere die Pflanzen kurz und trotzdem blüht es dort reichlich
Hier blühen im Frühjahr Schlüsselblumen, später Wiesen-Margeriten, Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea) und Wiesen-Salbei, dann folgen Wiesen-Flockenblumen und Dornige Hauhechel (Ononis spinosa). Moschus-Malven (Malva moschata) können hinzutreten, im Herbst auch Herbstzeitlose (Colchicum autumnale). Einige Pflanzen der Magerweiden werden nur ungern vom Vieh gefressen und haben deshalb einen Konkurrenzvorteil, dazu gehören auch Pflanzen, die ätherische Öle enthalten wie Arznei-Thymian (Thymus pulegioides) und Oregano (Origanum vulgare).
Ähnlich wie bei den Wiesen sind auch Weiden arten- und blütenreich, wenn sie nicht oder kaum gedüngt werden. Es entstehen Magerweiden. Sie sind die Vorbilder für den artenreichen Blumenkräuterrasen (siehe Seite 24).
Während früher das Vieh nur im Winter mit Heu gefüttert wurde, werden viele Kühe heute jahrein, jahraus mit Silage und anderem Kraftfutter ernährt. Wir behandeln unsere Nutztiere, als seien sie Nutzpflanzen: Eingepfercht in einem engen Raum bekommen sie genau definiertes Futter und Medikamente, um einen maximalen Ertrag zu erbringen. Ihre Vorfahren durften noch vom Frühjahr bis in den Herbst über weite Weiden wandern und selbst entscheiden, wann und was sie fraßen. So wussten sie auch, welche Pflanzen ihnen gut tun, wenn es im Bauch oder sonst wo drückt, sie konnten sich selbst mit Heilpflanzen versorgen. Nutztiere, die auf artenreichen Weiden leben dürfen, wurden zum Beispiel dabei beobachtet, wie sie medizinisch wirksame Pflanzen fraßen, wie Farne, die gegen Würmer wirken.
Rasen auf Extremstandorten
Trockenrasen
Es gibt einige Extremstandorte, auf denen der Boden so mager und trocken ist, dass hier eine Wiesenmahd nicht mehr möglich ist. Auf Felsköpfen, auf Schotterfeldern und auf Sandflächen wachsen die Trockenrasen. Hier ist der Boden oft nur schütter von Pflanzen bedeckt. Ihre Triebe und Blätter sind vor starker Sonnenstrahlung und Austrocknung durch dichte Behaarung, reflektierende Wachsschichten oder dadurch, dass die Blätter eine eher nadelförmige Gestalt haben, geschützt. Die Blätter können aber auch zur Wasserspeicherung verdickt sein, wie bei den Fetthennen.
Die Blüten der niedrigen Trockenrasenpflanzen wirken oft überproportional groß. Dazu gehören die Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) und niedrige Disteln wie die Silber-Distel (Carlina acaulis). Bei den Trockenrasen unterscheiden sich solche auf kalkhaltigen Böden stark von denen auf sauren Böden, wobei die Kalkmagerrasen zu dem Schönsten gehören, was unsere Natur zu bieten hat. Auf sandigen und kalkfreien Böden wachsen die farbenfrohen Heideflächen. Leider sind magere Lebensräume hochgradig bedroht, denn schon der Stickstoffeintrag aus der normalen Luftverschmutzung in Mitteleuropa düngt sie so weit auf, dass die Hungerkünstler von wüchsigeren Pflanzen überwachsen werden.
Die meisten Trockenrasen bleiben nur erhalten, wenn aufkommende Gehölze regelmäßig verbissen werden. Früher wurden diese Flächen gelegentlich beweidet. Heute ist der Erhalt dieser Biotope nur möglich, wenn die Beweidung durch Naturschutzgelder finanziert werden kann.
Auf Trockenrasen duftet der Thymian
Felsbandrasen
In Felswänden und auf Schotterfeldern gibt es manche Ritzen und Vorsprünge, in denen die Hungerkünstler unserer Flora Fuß fassen können: Wimper-Perlgras (Melica ciliata), Fetthennen und Dachwurz (Sempervivum tectorum), bekommen genügend Licht, auch ohne dass eine Mahd oder Beweidung die Gehölze zurückdrängt. Hier wachsen nur noch wenige und dann auch sehr niedrige Gehölze. Mit den Arten der Felsbandrasen können zum Beispiel Dachbegrünungen angelegt werden.
Alpine Rasen
Auf den Bergen der Alpen gibt es ebenfalls Rasen, die auch ohne Beweidung offen bleiben. Denn hier können Bäume aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht wachsen. Wenn wir wissen wollen, wie die Landschaft hierzulande in den langen Kaltzeiten unseres Erdzeitalters ausgesehen hat, bekommen wir hier, über der Baumgrenze, eine Ahnung davon. Oft sind wir begeistert von den leuchtenden Farben der Blüten und wünschen uns solche Pflanzen in unseren Gärten. Das hat schon manchen dazu verleitet, Pflanzen auszugraben und im eigenen Garten einzupflanzen. Abgesehen davon, dass das bei den meisten Alpenpflanzen ein Verstoß gegen die Naturschutzgesetze ist: Im Tiefland fehlt diesen Pflanzen die kühle, feuchte Luft und die hohe Sonneneinstrahlung der Berggipfel, sie kommen mit der »Klimaerwärmung«, die sie an ihrem neuen Standort aushalten müssen, nicht zurecht und verkümmern rasch.
»Weidefläche« im Garten – Blumenkräuterrasen
Wenn wir eine der inzwischen sehr selten gewordenen bunten Blumenwiesen in der Feldflur entdecken, dann kommt bei vielen der Wunsch auf, diese Blütenpracht auch im eigenen Garten erleben zu können. Rasenflächen, die wenig oder kaum genutzt werden, bieten sich dafür geradezu an (siehe Seite 21).
Auf sauren Böden entstehen Heiden (links). Küchenschellen wachsen nur auf mageren Standorten (rechts).
Blumenkräuterrasen bringen die Blüten der Weiden in den Garten