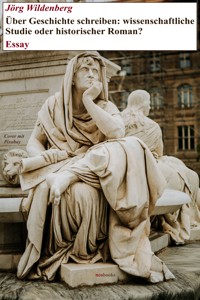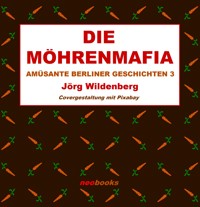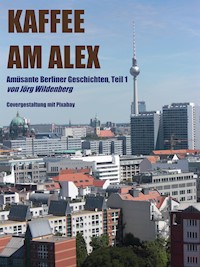4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Als Erster hast du mich umfahren." Diese Worte zieren ein Wappen, das Kaiser Karl V. dem spanischen Seefahrer Juan Sebastián Elcano nach der ersten Weltumseglung der Geschichte überreichte. Von ursprünglich dem portugiesischen Überläufer Magellan unterstellten 5 Schiffen kehrte nur Elcanos Victoria heim, vollbeladen mit kostbaren Muskatnüssen und Gewürznelken. Der Baske trotzte Stürmen, Skorbut, Intrigen und Verfolgungsjagden. Denn er segelte im Zeichen des Weltgegensatzes zwischen Portugal und Spanien. Mit dem Vertrag von Tordesillas hatten beide Länder den Globus unter sich aufgeteilt, dabei jedoch eine zentrale Frage nicht lösen können: In welcher Welthälfte liegen die Molukkeninseln mit ihren heißbegehrten Gewürzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jörg Wildenberg
Die Reisen des Elcano
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
0. Geleitwort
1. Prolog
2. Ein König
3. Sevilla
4. Pigafetta
5. Ein Brief
6. Königliche Weisungen
7. Knapp verfehlt
8. Diplomatie
9. Die Machtfrage
10. Unverhoffte Freuden
11. Die Nöte eines Kaisers
12. Ein Trugbild
13. Ein Aufstand
14. Feuer
15. Ein Prinz
16. Launen eines Ozeans
17. Hoffen und Bangen
18. Die Wende
19. Eine Falle
20. Vesta
21. Ziel in Sicht
22. Doppelter Schock
23. Ein Wiedersehen
24. Ein Thronwechsel
25. Begehrte Früchte
26. Ein Brand
27. Ein Geständnis
28. Eine Audienz
29. Tag und Nacht
30. Abschied
31. Hoher Besuch
32. Halmahera
33. Mann über Bord!
34. Timor
35. María
36. Gefahren
37. Machtspiele
38. Das Kap
39. Schmach und Schande
40. Tückische Heimkehr
41. Ein Fanatiker
42. Grausige Szenen
43. Ein vermeintlich genialer Trick
44. Geschäfte
45. Eine Erscheinung
46. Unbequeme Fragen
47. Unbequeme Antworten
48. Eine Provokation
49. Die Verstoßene
50. Gefährliche Suche
51. Ein letzter Brief
52. Schreckliche Kunde
53. Die Verschwörung
54. Die Wahrheit
55. Verleugnung
Impressum neobooks
0. Geleitwort
Im folgenden Roman geht es nicht um Religion, sondern um falsche oder tatsächliche Gewissheiten. Nun spielt er im 16. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als Gewissheiten und die Suche nach der Wahrheit eng mit Theologie verwoben waren. Nicht nur rangen Anhänger derselben Religion um eindeutige Antworten und bekämpften sich dabei bis aufs Blut, das galt natürlich auch für den Zusammenprall verschiedener Weltanschauungen. Wenn der Erzähler z.B. die abfällige Sicht einzelner Figuren auf gegnerische Bekenntnisse beleuchtet, entspricht dies ausdrücklich nicht meiner Meinung. Ich achte und respektiere alle Religionen, die in den folgenden Seiten eine Rolle spielen. Trotz der Konflikte, die sie ausgelöst haben, leisteten und leisten sie alle auch Großartiges, sei es in der Kunst, in der Wissenschaft oder in ihrer Forderung nach Wertschätzung des Nächsten. Dass sie gerade im letzten Punkt oft gescheitert sind, macht ihre guten Werke nicht ungeschehen.
Die Covergestaltung des hier vorliegenden E-Books bedient sich eines Bildes auf Pixabay (https://pixabay.com/de/photos/segelschiff-mast-boot-meer-2663381/ aufgerufen am 3.12.2022). Das dargestellte Schiff entspricht zwar nicht in allen Einzelheiten Elcanos Victoria, versetzt aber in seine Zeit und – noch wichtiger – lässt ebenjenen Wagemut erahnen, mit dem der Baske den Globus umrundete.
Das Thematisieren von Wahrheit und falschen Gewissheiten in einem stark fiktionalen historischen Roman entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Doch Romane sind keine wissenschaftlichen Studien. Bei einigen Persönlichkeiten habe ich mir besonders große Freiheiten erlaubt, z.B. bei dem zum Antagonisten stilisierten Bischof von Évora. Manches ist frei erfunden, so etwa Elcanos Liebschaft mit einer fernen Inselkönigin. Die dem Text (hoffentlich) innewohnende Wahrheit besteht weniger aus den teils ganz bewusst verdrehten historischen Fakten. Sie gründet vornehmlich in dem, was Sie, lieber Leser, womöglich als Grundgedanken heraushören; was Sie vielleicht gar anhand eigener Betrachtungen in einer Welt voller Fake News und „alternativer Fakten“ bestätigen können, obgleich die Epochen ganz verschieden sind. Und wenn nicht, lieber Leser, wenn Sie also nichts aus den Zwischenzeilen teilen können, vielleicht erfreuen Sie sich dann an Elcanos weltumspannenden Reisen, auf die Sie der Erzähler mitnehmen wird.
Seien Sie gewarnt. Sie erwarten wechselvolle Jahre auf hoher See, mannigfache politische Intrigen, heimtückische Attentate, blutige Schlachten, freilich auch prächtige Paläste, exotische Inseln und berauschende Abenteuer unter Palmen.
Jörg Wildenberg im Dezember 2022
1. Prolog
Festen Schritts kämpfte sich eine in Lumpen gehüllte Gestalt durch eisige Windstöße. Einsamer Kerzenschein aus den Fenstern einer schmucklosen Kirche wies dem armen Tropf den Weg, obgleich das Flackern schwach ausfiel. Erst die grellen Blitze in nicht allzu weiter Ferne schlugen Breschen in die nächtliche Finsternis. Bis zur Kirche am Ende des schmalen Pfades hatte er noch ein beachtliches Stück Fußmarsch zu bewältigen. Gewöhnlich fürchtete er sich nicht vor Gewittern. Das Wüten und Donnern wertete er stets als Ausdruck göttlicher Größe. Dabei dachte er natürlich nicht an den Blitze schleudernden Zeus der Alten Griechen. Nein, er glaubte an den ebenso gerechten wie unerbittlich strafenden Gott der Bibel, so wie er sie verstand. Doch seine Selbstgewissheit war ins Wanken geraten. Somit besaß das himmlische Tosen jetzt auch für ihn etwas Bedrohliches. Aus schwarzen Wolken prasselte erbarmungsloser Regen auf ihn ein. Das Wasser sickerte in die tiefste Pore seiner Kleider, doch er gäbe nicht auf. Seine ganze Energie verwendete er auf das eine Ziel, seine Schuld zu tilgen. So nahm er kaum Notiz von den mächtigen Baumkronen am Horizont, die das Blitzlicht für Sekundenbruchteile erahnen ließ. Nach mühsamen, kräftezehrenden Schritten durch Wind, Regen, Schlamm und Dreck gewann er das Kirchenportal. Vor Betreten der heiligen Halle klopfte er sich gewissenhaft den Matsch von seinen zerbeulten Schuhen. Erst dann stieß er die schwere Eichentür auf. Er trat ein. Drinnen herrschte eine seltsame Stille, welch Kontrast zum Unwetter draußen! Auf einem schmucklosen Altar brannten ein paar karge Kerzen.
Im Halbdunkel erspähte Raimund plötzlich einen Mann im Mönchsgewand. Der Mönch legte eine eiserne Schale mit frischen Oblaten auf den Altar. Raimund zögerte nicht länger und ging auf ihn zu. Der Mönch war noch sehr jung und trotzdem so dürr wie ein ausgemergelter Greis. Seine Askese hatte weit über den Ort hinaus von sich reden gemacht. Er faltete die Hände, verharrte einige Augenblicke in stummem Gebet und blickte dann endlich auf.
„Was begehrst du, mein Sohn?“, fragte er Raimund. „Die Messe halte ich in einer knappen Stunde.“ Das pastorale Tremolo in seiner Stimme hallte in jeden Winkel der Kirche.
Sofort fuhr Raimund auf die Knie, um ehrerbietigst zu antworten: „Pater, ich möchte beichten.“
Sein Gegenüber lächelte gütig, nahm seine Hände und erwiderte sanft:
„Knie nicht, nicht vor mir. Vor dem Kreuz sollst du es tun“, der Pater deutete auf das riesige Kruzifix über dem Altar, „jedoch nicht vor mir.“
Raimund erhob sich, woraufhin ihn der Priester in den Beichtstuhl geleitete.
„Was also bedrückt dich?“, wollte er vom Beichtling wissen.
Raimund begann von seinem Diebstahl zu erzählen, von seinem wiederholten Diebstahl in den letzten Wochen. Mehrfach hatte er, durch einige Geschicklichkeit vor neugierigen Blicken gut geschützt, auf dem Markt hier einen Apfel stibitzt, dort einen Laib Brot entwendet, aber niemals eines der teuren Gewürze. Er vergaß nicht von seinen Seelenqualen zu erzählen, die ihn darüber zermürbten. Aber – und damit wolle er sich nicht rechtfertigen, sondern nur seine Bedrängnis schildern – er sei ein armer Tagelöhner, der um diese Jahreszeit einfach kein Auskommen finde. Würde er nicht stehlen, müsste er verhungern. Dann stieß er noch ein „Das ist, die Wahrheit, amen!“ aus, ehe er schwieg.
Der Mönch hatte sich seinen Bericht geduldig angehört. Er schwieg ebenfalls. Schließlich verkündete er:
„Raub ist eine schwere Sünde. Daran ändert auch deine Not nichts. Doch deine Reue ist aufrichtig. Deswegen hege ich Zuversicht, dass Gott dir deine Schuld erlassen wird. Jetzt geh und such dir Arbeit. Wenn du nur fest genug betest, wird der Höchste dich erhören.“
„Ich danke Euch“, entgegnete Raimund, noch nicht ganz erleichtert. „Aber was ist mit meiner Sündenstrafe?“
Trotz des schweren Gitters zwischen sich und seinem Beichtvater erkannte Raimund, wie der Mönch eine Augenbraue hob.
„Was soll damit sein?“
Mit dieser Reaktion hatte Raimund nicht gerechnet. „Na, ich möchte zahlen“, gab er zur Antwort.
„Wofür willst du zahlen?“, setzte der Mönch nach. Er sprach lauter: „Wie willst du zahlen, wenn du dir kein Essen leisten kannst?!“
„Nein, tadelt mich nicht, Allerdgnädigster, das verkrafte ich nicht“, flehte Raimund, „ich habe ein paar Groschen zusammengespart, so bescheiden sie sein mögen. Ich will mich vor dem bewahren, was einen Sünder wie mich nach dem letzten Atemzug erwartet.“
„Meinst du etwa das Purgatorium?“
„Ja, Gnädigster, das Fegefeuer. Mit meinem Geld möchte ich mich soweit wie möglich davon freikaufen.“
Die Antwort des Mönchs erschütterte Raimunds Weltbild vollends.
„Mein Sohn“, erwiderte sein Gegenüber wieder gefasst, „du begehst wieder eine Sünde, und das im Moment deiner Beichte. Doch dafür will ich dich nicht länger rügen. Denn offenbar bist du dir deiner Untat nicht bewusst. Darum werde ich sie dir darlegen. Gott, der oberste Richter, lässt sich durch uns armselige Kreaturen nicht überlisten. Wenn er es für gerecht erachtet, uns aufs Schlimmste zu strafen, wird er es tun. Dagegen besitzen wir Sterblichen nicht die geringste Macht. Behalte also deine Münzen. Verwende sie, um dir etwas zu kaufen, damit du nicht abermals gegen das siebte Gebot verstößt. Nun gehe oder bleibe bis zur Messe, bloß verschone mich mit deinem Geld.“
So gerne Raimund auch dem Gottesdienst beigewohnt hätte, konnte er nicht länger an diesem Ort verweilen. Die Ansichten des Mönchs hatten ihn zu sehr aufgewühlt. Mechanisch verabschiedete er sich und ging ins Freie. Die soeben gehörten Worte ließen ihn nicht mehr los. Leider warfen sie mehr Fragen auf, als welche zu lösen.
2. Ein König
Trotz vielen Schwankens beim Ritt auf diesem Ungetüm fühlte er sich vollkommen sicher. Die Frühlingssonne lachte verschwenderisch über ihm und seinem zahlreichen Gefolge. Kein Wölkchen trübte den Himmel. Die Messe in der prächtigen Kathedrale seiner Hauptstadt Lissabon hatte er ehrfurchtsvoll verfolgt, als wäre er nicht der Herrscher über ein Weltreich, sondern ein gewöhnlicher Sterblicher. Doch seinen immensen Reichtum wertete er als Zeichen göttlichen Wohlgefallens an ihm, König Manuel von Portugal. Wie sonst sollte es zu erklären sein, dass aus einem bescheidenen Landstrich am Rande Europas ein ganzes Imperium erwuchs? Hatte nicht auch Christus, der Erlöser, als bescheidener Zimmermann angefangen?
Mit unermüdlichem Lächeln empfing Manuel bereits in der Kirche die Viva-Rufe seiner Untertanen. In Scharen säumten sie nun seinen Weg von der Kathedrale bis zur Baustelle. Seine indischen Sklaven hatten alle Mühe, den Elefanten – ein Mitbringsel seiner Entdecker – durch straffe Zügel und gelegentliche Stockhiebe von Ausbrüchen abzuhalten. Notgedrungen ließ das Tier alles über sich ergehen, während der König auf ihm thronte. Er konnte die Ankunft bei seinem seit etlichen Jahren im Bau befindlichen Hieronymiten-Kloster kaum abwarten, repräsentierte es doch das größte, schönste und teuerste Projekt, welches seinen Namen verewigen sollte. Auch unvollendet entfaltete es bereits viel von seiner Pracht. Über seine reichverzierten Fenster und Portale verband es die Verspieltheit italienischer Baukunst mit der monumentalen Wucht iberischer Frömmigkeit.
Endlich hatte Manuel das Kloster erreicht. Die Inder stellten ein Podest bereit, über das der König geschickt zu Boden glitt. Noch während er auf sein Lieblingsprojekt zuschritt, enthüllte er den herbeigeeilten Architekten seine neuesten Pläne für den Kreuzgang, das Refektorium und das südliche Portal. Die Baumeister wirkten leicht gequält. Sie wagten indes kein einziges Widerwort, wiewohl sie das ein oder andere gern geäußert hätten. Gerade, als der Monarch sich in einer wahren Hochphase seines künstlerischen Genius wähnte, störte ein Berater seine Kreise.
„Majestät, verzeiht, wenn ich ungelegen komme, doch eine Sache von höchster Dringlichkeit lässt mir keine Wahl“, sprach Afonso de Portugal, der greise Bischof von Évora.
Nur missmutig wandte sich Manuel ihm zu. „Was wollt Ihr?“
Afonso reichte ihm einen wachsversiegelten Brief. Der König erkannte sogleich den Absender, seinen Spion in Valladolid.
„Kann das nicht warten?“, knurrte Manuel.
„Glaubt mir, Hoheit, wenn Ihr bereits wüsstet, was dort geschrieben steht, hättet Ihr es noch früher erfahren wollen“, versicherte der Bischof von Évora. „Doch solltet Ihr, wenn ich mir diesen Rat erlauben darf, den Brief im stillen Kämmerlein öffnen.“
Der Herrscher wandte die Augen zum Himmel und drückte unwillig seine beringten Finger auf den Brief.
„Nun gut“, sagte er.
Manuel ließ sich auf seinen Elefanten helfen und schwankte auf demselben zu seinem Palast am Tejo.
Wie recht der Bischof hatte! Portugals König zeigte sich heilfroh, nicht weiter abgewartet zu haben, auch wenn er gerne seinen Klosterbau noch ein Weilchen bewundert hätte. Der Brief aus Valladolid barg eine Ungeheuerlichkeit, eine veritable Katastrophe!
„Verräter!“, empörte sich der Monarch, „Verräter! Wie kann dieser Magellan es wagen, zum Feind überzulaufen!“
„Ich erinnere Euch nur ungern daran“, entgegnete Bischof Afonso, „doch Ihr habt ihm, nach allen Seereisen und Schlachten, die er für Euch überstand, wie einen Verbrecher behandelt.“
„Ja, ihm wurde wegen Geschäften mit Ungläubigen der Prozess gemacht“, zürnte Manuel. „Wie konnte er sich nur mit Muslimen einlassen, unseren schlimmsten Feinden!“
„Sämtliche Anklagen wegen angeblicher Kontrakte mit Mohammedanern in Nordafrika erwiesen sich als haltlos“, bemerkte sein oberster Berater mit Engelszunge.
„Und wenn schon! Ein guter Christ darf gar nicht erst in den Verdacht eines derartigen Frevels geraten! Was Magellan jetzt vorhat, rechtfertigt nur mein Misstrauen. Er bietet meinem Neffen Karl von Spanien an, über den Westen nach den Gewürzinseln zu segeln. Er will sie für die kastilische Krone in Besitz nehmen. Das ist ungeheuerlich!“
Mit seiner Empörung spielte der König auf den Vertrag von Tordesillas an. Laut jenem – nach heutigem Ermessen größenwahnsinnigen – Abkommen aus dem Jahr 1494 gehörte der westliche Atlantik mit allen seit Kolumbus neu entdeckten Ländern, ja die gesamte westliche Hemisphäre den Spaniern. Im Gegenzug bekamen die Portugiesen den unerforschten Teil der östlichen Welthälfte zugesprochen. Dazu zählte auch die östliche Seeroute über Afrika nach Indien und zum Molukken-Archipel mit den damals heißbegehrten Gewürzen. Magellans Suche nach einer Westpassage durch die amerikanische Landbarriere, hin zu jener Inselgruppe zielte auf nichts Geringeres, als Portugals einträgliches Monopol auf den Seehandel mit den horrend teuren Speisezutaten zu brechen.
„Ungeheuerlich“, wiederholte Manuel.
Nur unter äußerster Mühsal rang sich der Bischof zu einem weiteren Widerwort durch:
„Majestät, bei allem Respekt muss ich Euch darauf hinweisen, dass Karls Ansprüche auf die Molukken nicht völlig unbegründet sind. Auch wenn unsere Kenntnisse von den Ausmaßen der Erde genauer sind als die all unserer Feinde, wissen wir nicht mit Sicherheit, ob die Gewürzinseln in unserer oder der spanischen Welthälfte liegen. Doch selbst wenn letzteres der Fall sein sollte, bliebe Euch immer noch der lukrative Handel mit indischem Pfeffer.“
„Schweigt still!“, herrschte der König seinen Berater an.
Manuel hatte zahlreiche Karten vor sich liegen. Mit geballten Fäusten stützte er sich gegen sie. Die Zugehörigkeit der begehrten Inseln bildete in der Tat den Kern eines vertrackten Disputs mit der kastilischen Krone. Besonders drehte er sich um zwei auf den Karten zunächst unscheinbare, winzige Eilande namens Ternate und Tidore. Auf ihnen – und nach damaligem Kenntnisstand nur auf ihnen! – wuchsen jene Schätze, die ihrem Besitzer unermesslichen Reichtum verhießen: Muskatnüsse und Gewürznelken. Bei den gutbetuchten Kaufleuten sowie im Kreise der hohen Würdenträger des Adels und der Kirche waren diese Gewürze so begehrt, dass sie zu fast jedem Preis feilgeboten werden konnten. Noch viel mehr denn als simple Speisezutat galten sie als Statussymbol, ja als Wundermittel gegen allerlei Gebrechen. Manche erhofften sich von ihnen sogar Wunder gegen die Pest.
Da Kastilien jedes Anrecht auf die indischen Pfeffersträucher verwirkt hatte, wollte Karl im Gegenzug an die Kostbarkeiten der Gewürzinseln gelangen. Trotz der ungeklärten Besitzverhältnisse ließ Manuel seine Seeleute am anderen Ende der Welt mit dem Bau eines Forts auf Ternate befreits Tatsachen schaffen. Sein Statthalter Francisco Serrão unterhielt sogar beste Beziehungen zum dortigen Sultan. Nein, nichts und niemand würde ihm, Manuel, die wertvollen Eilande wegnehmen. Seine Macht, ein Großteil seines Vermögens und damit auch die Fertigstellung des Hieronymiten-Klosters hingen von diesen beiden Vulkaninseln mit ihren fruchtbaren Böden ab. Sie wogen nicht weniger als der gesamte Handel mit Indien und der Besitz aller seiner Festungen sowie Faktoreien von Afrika bis Malakka.
Der arme Bischof Afonso spürte wohl, wie entsetzlich die Wut in seinem Monarchen loderte. Er fragte sich, wie er Manuel wohl beibringen sollte, dass außer Magellan noch weitere Portugiesen in die Dienste des Königs von Kastilien, León und Aragón getreten waren. Wenn Karls Kandidatur auf Europas begehrtesten Herrschertitel Erfolg haben würde – wovon Afonso ausging –, wäre Manuels Rivale bald auch römisch-deutscher König und damit praktisch Kaiser.
„Karl“, hörte Afonso seinen Herrn laut sinnieren, „mein lieber Neffe Karl, du forderst mich direkt heraus. Nun gut, so sei es.“
Manuel wandte sich um. „Ich habe entschieden. Wir dürfen nicht zusehen, wie Magellan den Westweg findet. Sendet Karavellen aus, so viele wie nötig, um den Verräter aufzuhalten. Auf allen Weltmeeren sollen sie ihn jagen. Die Kanonen unserer Karavellen sollen seine Schiffe in Stücke schießen!“
„Aber, Majestät“, stammelte der erbleichte Bischof von Évora, „das bedeutet Krieg mit Kastilien!“
„Unfug! Karl erhebt Anspruch auf Inseln, die längst mir gehören. Nein, Karl hat mich herausgefordert. Außerdem…“ – Manuel machte eine wegwerfende Geste mit der Hand – „…kann ich mir nicht vorstellen, dass spanische Seeleute einem Portugiesen gehorchen. Ehe Fernão de Magalhães, dieser Halunke, Böses ahnt, werden sie meutern. Pah! Fernando de Magallanes, wie ihn die Kastilier nennen, muss scheitern. Wir erledigen nur den Rest.“
Afonso de Portugal teilte Manuels Zuversicht bei der vermeintlichen Aussichtslosigkeit vom Kommando desjenigen Mannes nicht ganz, den die meisten Völker schlicht als Magellan kennen. Der König indes, dank seiner persönlichen Gewissheit von neuem gefestigt, schob die Weltkarten beiseite und entfaltete einen Plan seines geliebten Klosters, das er als ruhmreicher Monarch und guter Christ zu vollenden trachtete.
3. Sevilla
Hier stand er nun, am überlaufenen Hafen von Sevilla. Aus allen Winkeln rollten Seemänner, Schiffsjungen und Tagelöhner schwere Karren mit Säcken oder Fässern voller Zwieback, Bohnen, Oliven, Stockfisch, Trinkwasser und Wein wie auch mit diversen Gerätschaften, so etwa Taue, Netze und Flickzeug herbei, um alles auf schwankenden Planken in gewaltige Schiffsbäuche zu verfrachten. Dort wurden die Waren verstaut, ehe die Packer die Karacken für die nächste Ladung verließen.
Sein Blick wanderte von den Schiffen zum Häusermeer hinter dem Hafenbecken. Das maurische Erbe der stolzen Stadt stach – aller Gegnerschaft mit den Muslimen zum Trotz – deutlich hervor. Bunt gebrannte Kacheln an jeder Hauswand, geschwungene Türbogen, zu Kirchen umgewidmete ehemalige Moscheen, muslimische Lehnwörter auf den Zungen der Andalusier und nicht zuletzt der vergnügte Trubel in den engen Gassen, das ihn sehr an arabische Jahrmärkte in Nordafrika erinnerte, all dies zeugte noch von der muslimischen Herrschaft. Dabei lag Sevillas Rückeroberung durch die Christen schon Jahrhunderte zurück.
Er kam nicht umhin, den Mauren innerlich einen gewissen Respekt zu zollen. Das muslimische Spanien hatte ausgezeichnete Gelehrte, architektonische Meisterwerke und mancherlei kulinarische Köstlichkeiten hervorgebracht, nicht zuletzt dank des Handels mit jenen Gewürzen, denen seine Reise galt. Er, Juan Sebastián Elcano, stammte aus dem äußersten Norden Spaniens, der nie in den maurischen Machtbereich geraten war. Bisher konnte sein Werdegang kaum Nennenswertes vorweisen. Für seinen noch sehr jungen König hatte er mehr schlecht als recht gegen die Muslime auf der anderen Seite des Mittelmeers gekämpft, ehe er sich privaten Geschäften zuwandte. Zuletzt verdingte er sich als Kapitän eines nicht weiter erwähnenswerten Handelsschiffs. Am Ende schrieb er nur Verluste. Die Schuldenfalle schnappte zu und er musste sein Schiff verkaufen. Interessenten gab es wenige. Er dachte sich nichts dabei, als er es einem Investor aus Genua verhökerte.
Nun befanden sich die mit den Osmanen Handel treibenden Italiener auf Kriegsfuß mit den Portugiesen. Denn deren Seefahrten nach Indien – dem Herkunftsland der bei Christen so heißbegehrten Gewürze – störten Genuas und Venedigs Geschäfte mit den muslimischen Zwischenhändlern. Genau diesem lukrativen Ziel, dem Umfahren des landgestützten italienischen Handels mit Ungläubigen, eiferten die Spanier nach. Deswegen bedeutete der Verkauf einer noch so geringen Schaluppe an einen Genuesen Landesverrat. Elcano hatte ihn nicht beabsichtigt. Doch seine Unbekümmertheit wog den Verrat nicht auf. Eine Zelle im finstersten Kerker war bereits für ihn reserviert, da hörte er von der Möglichkeit, seine Schuld durch ein waghalsiges Unterfangen zu tilgen. Es ging um nichts weniger, als Spaniens verhassten Nachbarn Portugal herauszufordern, die derzeit stärkste Macht auf den Weltmeeren. Der Portugiese Vasco da Gama hatte die ersten Gewürze auf dem Seeweg nach Europa gebracht, und zwar aus dem eindeutig in der portugiesischen Welthälfte liegenden Indien. Später machte der geniale Stratege Afonso de Albuquerque den Indischen Ozean zu einem portugiesischen Binnenmeer. Im Schutze seiner überlegenen Karavellen installierte er in einem weiten Bogen von Südostafrika über die Arabische Halbinsel und Indien bis weiter nach Malakka eine ganze Kette aus gewaltigen Festungen. Nichts und niemand hatte der Artillerie auf seinen Schiffen etwas entgegenzusetzen. Mit Malakka an der gleichnamigen Meerenge war den Portugiesen der Schlüssel für die Weiterfahrt nach China wie auch zu den Gewürzinseln in die Hände gefallen. Vor wenigen Jahren verstarb der große Albuquerque. Das von ihm errichtete Imperium lebte fort. Auf der Landkarte sah es nicht sonderlich mächtig aus. Erst ein genauer Blick auf die ganze Kontinente verbindende Perlenschnur aus Festungen und Faktoreien verriet die wahre Dimension seines gewaltigen Reichs in Übersee, nicht zuletzt wenn man die portugiesischen Forts an den Küsten von Westafrika mitberücksichtigt.
Für einen königstreuen Basken wie Elcano verkörperte ein Portugiese einen fast noch größeren Feind als ein Muslim – und das obwohl der einzig wahre Gott der Christen auch an den westlichen Gestaden des Tajo oder Tejo verehrt wurde.
Kolumbus’ Reisen stellten Spaniens ersten Versuch dar, an die Reichtümer aus dem Gewürzhandel zu gelangen; ein Versuch, der den spanischen Königen zwar neues Land, nicht aber die ersehnten Schätze beschert hatte. Wenn schon nicht indischen Pfeffer, wollten die Kastilier zumindest die teuren Gewürznelken und Muskatnüsse der Molukken an sich raffen. Spaniens Antwort auf da Gama war ausgerechnet dessen Landsmann Magellan.
Er, Elcano aus dem engen Baskenland, wurde Teil dieses gewaltigen Abenteuers. Jetzt besaß er die ersehnte Gelegenheit, nicht nur seine Untat zu sühnen, sondern seinem Leben einen Sinn zu verleihen, fühlte er sich doch seit frühen Kindertagen zu Höherem berufen. Er zählte schon über dreißig Jahre und hatte – außer Landesverrat infolge schändlicher Achtlosigkeit – nichts Außergewöhnliches zustande gebracht. Auf seinem Rücken drückte ein Sack mit den allernötigsten Habseligkeiten, nautischen Geräten und jeder Menge Karten. Letztere würden ihm ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts mehr nutzen, da sie durch unbekannte Gewässer kreuzen würden. Hierin bestand ein wesentlicher Unterschied zwischen Magellans Expedition und den portugiesischen Gewürzfahrten. Letztere bildeten das Ergebnis eines jahrzehntelangen, gut vorbereiteten Tastens die westafrikanischen Küsten entlang, bis Bartolomeu Dias mit dem Kap der Guten Hoffnung das Tor zum Indischen Ozean entdeckte und dessen Landsmann da Gama die Route bis nach Kalikut in Indien vervollständigte. So üppig das Geschwader in Sevilla auch ausgerüstet wurde, im Vergleich mit da Gamas bereits unberechenbarer Reise glich Magellans Auftrag einem Himmelfahrtskommando. Doch das schreckte Elcano keineswegs. Den Kurs bestimmte ohnehin nicht er, sondern allein Generalkapitän Magellan. Das hatte der abtrünnige Portugiese lange vor der Abfahrt jedem Beteiligten eingeschärft.
Auch wenn Elcano im Angesicht der riesigen Concepción, des Schiffs, das er gleich bestieg, winzig wie eine Ameise wirkte, musste er schmunzeln. Er weilte hier, um sich von seinem Landesverrat reinzuwaschen; doch sein oberster Befehlshaber Magellan beging einen noch viel größeren Verrat an seinem König. Und das nur, weil der Portugiese es sich in den Kopf gesetzt hatte, die Westroute nach den Gewürzinseln zu finden! Aber gut, das musste Magellan mit seinem eigenen Gewissen ausfechten. Ihm, Elcano, konnte es nur recht sein, wenn er dem selbstverliebten, Elefanten reitenden Monarchen in Lissabon mit einem noch so bescheidenen Beitrag zu dieser Expedition schadete.
Elcanos direkter Vorgesetzter, der Andalusier Gaspar de Quesada, zeigte sich weniger entspannt. Der Kapitän der Concepción ließ kaum eine Minute verstreichen, sich hinter vorgehaltener Hand über das Oberkommando eines scheinbar gebrechlichen Portugiesen zu ereifern. Denn seit einer in Nordafrika erlittenen Kriegsverletzung hinkte Magellan. – Dieser Kontinent brachte ihm einfach kein Glück, vielleicht wollte er auch deshalb so weit wie möglich von ihm wegsegeln. – Offene Ohren fanden Quesadas Beschwerden naturgemäß bei den anderen Spaniern der Expedition, insbesondere beim Kastilier Juan de Cartagena, Kapitän der San Antonio. Als Generalinspektor der gesamten Flotte besaß Cartagena nach Magellan die zweitgrößte Machtfülle bei diesem Unternehmen. Außerdem war Cartagena kein Geringerer als der Neffe – laut üblen Gerüchten sogar der Sohn – des gefürchteten Erzbischofs von Burgos und engen Vertrauten von König Karl: Juan Rodríguez de Fonseca. Niemand anderes als Fonseca hatte dem jungen König geraten, dass wenn er schon einem hinkenden Portugiesen Spaniens Schicksal im Kampf um die Weltherrschaft anvertraute, er ebenjenen Edelmann Cartagena mit auf die Reise schicken möge. Fonsecas Neffe beziehungsweise Sohn repräsentierte sozusagen das wachende Auge auf den Fremdling.
Elcano ließ seinen Blick auf die anderen vier Schiffe schweifen: Magellans Flaggschiff Trinidad, Cartagenas San Antonio, die Victoria und die Santiago. Einige dem Basken bereits flüchtig bekannte Offiziere der Armada waren Magellans Landsleute Estêvão Gomes auf der Trinidad und João Lopes Carvalho an Bord der Concepción. Gomes zählte den Generalkapitän zu seinen engen Freunden.
Ferner befanden sich der Italiener Giovanni Battista de Punzorol – wie Gomes direkt beim Oberbefehlshaber auf der Trinidad eingesetzt – nebst den Spaniern Luis de Mendoza und Vasco Gallego, beide auf der Victoria, im Offizierscorps; zudem der familiäre Bande zu Portugal unterhaltende Spanier Juan Serrano als Kapitän der Santiago mit dem wortkargen Schiffsmeister Balthasar, den alle nur den „Genuesen“ nannten. Ob er wirklich von dort stammte, wusste niemand. Er schwieg beharrlich über seine Vergangenheit.
Mit von der Partie war außerdem ein Bruder von Magellans Frau Beatriz, Duarte Barbosa. Er besaß keine leitende Funktion. Doch weil Magellan die arme Beatriz mit einem kaum geborenen Jungen und einem weiteren Kind im Bauch zurückließ, gewährte der Flottenkommandant seinem Schwager jede Annehmlichkeit, die eine solch gefährliche Reise überhaupt bieten konnte.
Elcano selbst diente als Schiffsmeister der Concepción, ein wichtiger, aber kein prestigeträchtiger Posten.
Die fünf mit königlicher Erlaubnis von Händlern beschlagnahmten Karacken waren mühselig zu hochseetauglichen Naos umgerüstet worden. Ihre jeweilige Mannstärke und Beladung unterschieden sich stark von einem Schiff zum nächsten. Die am zahlreichsten besetzten Karacken waren – natürlich – Magellans Trinidad und Cartagenas San Antonio. Dann erst folgte Quesadas Concepción. Trotz aller Umbaumaßnahmen fragten sich alle Beteiligten, ob die vollbeladenen Dreimaster auf den wellenpeitschenden Weltmeeren nichts als tödliche Nussschalen darstellen würden; besonders im Vergleich mit den wendigen Karavellen der Portugiesen. Doch etwas Besseres stand Magellans Truppe nicht zur Verfügung und er wollte endlich in See stechen.
Am Hafen von Sevilla stand die Trinidad vorübergehend unter dem Kommando von Estêvão Gomes. Denn Magellan weilte trotz seiner Eile noch beim Notar. Manch einer munkelte, er träfe sich mit einem portugiesischen Spion, um ihm einen Brief für König Manuel mit Details seiner Mission zu überreichen. Obgleich Elcano ebenfalls wenig Vertrauen in Magellan und die anderen Portugiesen auf den Karacken setzte, unterstellte er dem Generalkapitän keine so große Torheit, sein eigenes Unternehmen zu sabotieren. Der Baske seufzte. Er verstand nicht viel von großer Politik. Letztlich lag es in der Macht Gottes, wer am Ende die Meere beherrschte, ob Portugiesen, Spanier oder welches Volk auch immer. Das ständige Rempeln gegen seine Schultern durch die Seeleute und Diener am Kai mahnte ihn, endlich an Bord zu gehen und die Instruktionen seines Kapitäns Quesada zu empfangen. Also betrat auch er die Planke zur Concepción. Mit Sorge spähte er zu den Ratten, die ebenfalls an Bord kamen. Er wusste nur zu gut, dass diese blinden Passagiere zu ziemlich jeder Schiffsreise dazugehörten, erst recht in solch einem Gewusel. Die Unbekümmertheit, mit der seine Kameraden jene Plage ignorierten, beunruhigte ihn gleichwohl. Er war jedoch spät dran. Quesada wollte seine Besatzung inspizieren. Elcano blieb kaum Zeit, sich ein Schlaflager auf Deck zu sichern. Nur die Kapitäne besaßen Kajüten.
„Männer! Hier stehen wir nun; stolze Spanier, die Wind und Wetter trotzen werden, damit wir den Ruhm ernten, der unserer würdig ist!“, sprach Quesada zur unter ihm aufgereihten Besatzung der Concepción.
Der Kapitän weilte breitbeinig, seine klobigen Hände gegen die Hüften gestemmt, auf dem Oberdeck. Hinter ihm erhob sich ein mehrstöckiges Schiffskastell. Diese hölzerne Burg war durchaus imposant. Das tröstete die rund 45 Männer auf der Concepción wenig. Sie drängten sich wie Sardinen auf den Planken des unteren Decks und reckten ihre Hälse, um zu Quesada hochzuschauen. Zu den oftmals kaum Vertrauen erweckenden Gestalten – manche hatten eine Gefängnisstrafe gegen die Teilnahme an der halsbrecherischen Reise eingetauscht – gehörten keineswegs nur Spanier, sondern auch die erwähnten Portugiesen; ebenso Franzosen, Italiener, Deutsche und noch weiter entfernt geborene Spießgesellen, oft zu erkennen an ihrem hellen Teint und den kuriosesten Akzenten. Doch der vor Stolz und Selbstüberschätzung nur so strotzende Quesada scherte sich nicht um kulturelle Vielfalt. Für ihn zählten allein die Spanier, die anderen waren ungeliebtes Beiwerk, selbst Magellan. Mit süffiger Ironie fuhr Quesada fort:
„Es ist an der Zeit, dass der Löwe von Kastilien dem Elefanten von Lissabon zeigt, wer in Wahrheit ausersehen ist, neue Länder zu entdecken, zu erobern und den Wilden die Segnungen der Christenheit zu überbringen!“
Bei diesen Worten geriet Elcano ins Grübeln. Die Segnungen der Christenheit? Unweigerlich dachte er an diverse Gemetzel, die der Christ Christoph Kolumbus unter den Ureinwohnern der Neuen Welt angerichtet hatte. Er, Elcano, glaubte durchaus an die Erlösung durch Jesus von Nazareth, jedoch nicht an die Schandtaten, die zahlreiche Entdecker und Konquistadoren in seinem Namen begingen. Elcano hatte selbst gegen Ungläubige gekämpft. Und je mehr arabische Leiber er mit seinem Schwert durchbohrte, umso stärker wuchsen seine Zweifel, ob Jesus solche Gräuel mit der anderen Backe gemeint hatte, die ein Geschlagener hinhalten solle. Aber – wie erwähnt – er, Elcano, verstand nicht viel von großer Politik. Die Macht der Muslime betrachtete er als echte Plage, gegen die sich die Christen nicht allein mit der Bibel verteidigen könnten.
Quesadas Monolog zog sich endlos hin. Er sprach viel und sagte nichts. Elcano achtete ohnehin mehr auf das Getuschel hinter und neben sich. Viele seiner Schiffskameraden lebten nach wie vor in der Furcht, vom Rand der Erde zu fallen, wenn sie zu weit hinaussegelten. Allerlei Ungeheuer würden sie am vermeintlichen Ende der Erdscheibe erwarten. Elcano teilte seit langem die Überzeugung von der Kugelgestalt der Erde, obschon der letzte Beweis fehlte. Doch wenn die Portugiesen in den Tagen von Prinz Heinrich dem Seefahrer, dem großen Förderer ihrer ersten Entdeckungen, unbeschadet das damals gefürchtete Kap Bojador in Westafrika umsegelt hatten, warum sollten die Spanier dann nicht ihrerseits die Meere befahren können? Nein, die Furcht vor der flachen Erde stellte für Elcano einen beinahe genauso lächerlichen Irrglauben dar wie derjenige der Muslime.
Quesadas Ansprache nahm ihr ersehntes Ende. Die Männer bezogen ihre Posten. Sie hissten die Segel, holten die Leinen ein und machten sich durch ausgelassene Späße Mut. Eine noch so fragliche Aussicht auf ihren Anteil an den Reichtümern der Gewürzinseln überdeckte fürs Erste ihre Sorgen. Salutschüsse aus Kanonen aller fünf Karacken verkündeten das Auslaufen dieser Armada, die in die Geschichte eingehen sollte. Am Kai jubelten Schaulustige und weinten Angehörige der Besatzung. Um Elcano trauerte niemand. Er besaß keine Familie. Umso mehr verband er sein Schicksal mit der Reise. Unbeschadet aller Widersprüchlichkeiten der Mission fühlte sich Elcano in seinen Überzeugungen gefestigter als je zuvor: Er tat das Richtige und stand auf der richtigen Seite. So fühlte sich für ihn die Welt an jenem Morgen an, kurz nach Anbruch des geschichtsträchtigen 10. August im Jahre 1519.
4. Pigafetta
Wer hätte je gedacht, dass er, Antonio Pigafetta, Spross einer Adelsfamilie aus Vicenza, an Bord von Magellans Trinidad gehen durfte! Dabei kämpfte Magellan wegen seiner portugiesischen Herkunft ohnehin bereits mit Problemen beim Anheuern einer Besatzung. Nichtsdestoweniger war es Pigafetta gelungen, den Generalkapitän solange zu beknien, bis er zustimmte, ihn – einen unbekannten Jungspund aus dem Machtbereich des mit Spanien verfeindeten Venedig – mitzunehmen, und das nicht etwa als beliebigen Deckschrubber, sondern als Chronisten dieser unglaublichen Reise. Er verfügte über keinerlei Erfahrung irgendwelcher Art, die ihm auf hoher See nützlich sein könnte. Sein einziger Antrieb bestand in seiner Abenteuerlust, genauer: in seinem unbändigen Verlangen, beim Entdecken fremder Länder und neuer Routen Zeuge zu werden. Die rauen Seemänner um ihn herum spotteten über seinen feinen Anzug, in dem er an Deck auftauchte; mit einem Notizbuch unterm Arm.
„Eh Junge, die Meeresungeheuer werden dich als ersten fressen, wenn dich nicht vorher die Haie erwischen“, hatten sie gegiftet.
Er scherte sich nicht um ihren Hohn. Er befand sich an Bord der Trinidad, allein das zählte.
Von Magellans Expedition hatte er in Valladolid gehört, am Hofe von König Karl. Pigafetta begleitete seinerzeit den Vertreter Seiner Heiligkeit in Rom, Nuntius Chieregati, nach Kastilien. Während – wie Pigafettas wachsame Ohren spitzbekamen – Erzbischof Fonseca zunächst kühl auf Magellans Vorsprache beim spanischen Monarchen reagierte, fing der junge Italiener sofort Feuer. Mit rastloser Neugier erhaschte er jede Einzelheit, die er als kleines Rädchen im diplomatischen Getriebe über die Gespräche zwischen Karl und Magellan in Erfahrung bringen konnte. Kaum hatten Fonseca und damit auch der junge Karl ihr Widerstreben gegen den Portugiesen aufgegeben, kündigte Pigafetta seine Stelle als Sekretär bei Monsignore Chieregati, um seine Schreiberdienste dem kühnen Seefahrer anzubieten. Der Nuntius verfasste sogar einen Empfehlungsbrief für Pigafetta.
Das erste Treffen mit Magellan verlief wenig verheißungsvoll. Der von seiner Suche nach einer Westpassage zu den Molukken geradezu besessene Portugiese steckte gerade in gehörigen Schwierigkeiten. König Karl hatte die versprochenen Gelder zum Erwerb tauglicher Schiffe und des nötigen Proviants eingefroren. Seine Kandidatur auf den römisch-deutschen Kaiserthron verschlang Unsummen. Denn wer Kaiser werden wollte, benötigte bare Münze. Doch wie es Karl am Ende gelang, seinen durchtriebenen Widersacher König Franz von Frankreich auszustechen und den begehrten Titel zu erwerben – obgleich noch nicht vom Papst gekrönt –, so hatte Magellan schließlich einen neuen Investor gefunden. Bei Pigafettas besagtem Zusammentreffen mit ihm sah es indes noch nicht so aus. Der Oberbefehlshaber überprüfte gerade am Kai von Sevilla, ob die Schiffsplanken fest genug mit Baumwollsträngen und Pech abgedichtet waren; hing doch das Überleben seiner Mannschaft von der Robustheit der Dreimaster ab. Er zeigte sich nie zufrieden und herrschte die Truppe an, gründlicher zu Werke zu gehen. In dieser denkbar schlechten Stimmung stellte sich also Pigafetta dem Generalkapitän vor:
„Edler Herr, Euer Wagemut strahlt weit über Sevilla hinaus. Ich habe gehört, dass Ihr jeden Mann benötigt, aber nur wenige Freiwillige auftreiben könnt. Nun denn, hier stehe ich, Antonio Pigafetta aus Vicenza, und möchte mich Euch anvertrauen.“
Magellan nahm zunächst keine Notiz von ihm. Wortlos inspizierte er den Bug der Trinidad. Erst nachdem Pigafetta seine Worte wiederholt hatte, drehte sich der Flottenkapitän um, als hätte er noch begreifen müssen, dass sie tatsächlich ihm galten. Der Portugiese war nicht sonderlich groß. Überhaupt verriet sein Äußeres nichts Ungewöhnliches – außer der Entschlossenheit in seinem Blick. Sein Hinken, das nicht zuletzt die Kastilier so genüsslich betonten, fiel weit geringer aus, als Pigafetta es sich ausgemalt hatte. Es blieb kein Zweifel: Magellan wollte sein Ziel erreichen, koste es, was es wolle. Mit einer Mischung aus Skepsis und Ungläubigkeit musterte er den Jüngling vor sich. Treffsicher bemerkte der Portugiese sofort:
„Ihr seht nicht wie ein Seemann aus, schon eher wie ein verwöhnter Adliger mit allerlei Flausen im Kopf. Eure Hände zeigen keinerlei Schlieren oder Narben. Es sind die Hände eines wohlbehüteten Burschen aus vornehmem Hause. Wenn Ihr glaubt, die Reise würde eine Spazierfahrt, dann täuscht Ihr Euch. Viele werden nicht lebend zurückkehren. Nicht einmal ein Quartier könnte ich Euch zuteilen. Also, werter Antonio Pigafetta, stillt Euren Abenteuerdurst woanders. Ich habe zu tun!“
„Nein, nein, Ihr versteht nicht, ich kann Euch nützlich sein“, beeilte sich Pigafetta zu beteuern und überreichte ihm den Brief Chieregatis. Magellan las ihn. Die Falten auf seiner Stirn verrieten indes weiteres Misstrauen. Denn er fragte sich, wenn der Junge doch so unverzichtbare Dienste leistete, weshalb entband ihn dann der apostolische Nuntius so eilfertig von seinen Pflichten? Pigafetta bemerkte sofort, dass das Papier sein Ziel zu verfehlen drohte und erklärte schnell:
„Ich möchte Euch als Schreiber dienen. Oder wollt Ihr nicht, dass jemand Eure ruhmreichen Taten, von denen Ihr sicher reichlich vollbringen werdet, festhält?“
Da bedachte Magellan sein Gegenüber mit etwas weniger Skepsis:
„Das muss ich Euch lassen: Ihr wisst mir zu schmeicheln. Dennoch kann ich Eurer Bitte nicht stattgeben. Ich darf die Geduld der Spanier nicht noch weiter reizen. Eben erst habe ich die Aufnahme weiterer Portugiesen in meine Mannschaft durchgesetzt. Wenn ich mir jetzt noch einen Untertanen des Dogen von Venedig als Chronisten hinzuhole, werden Cartagena und Quesada Zeter und Mordio speien. Außerdem verfüge ich bereits über einen Gehilfen, meinen malaiischen Sklaven Enrique.“
„Von Eurem Übersetzer aus dem fernen Orient habe ich gehört“, versicherte Pigafetta. „Im Übrigen beherrsche auch ich mehrere Sprachen, nur eben keine fernöstliche. Aber kann Euer Konvertit auch die Feder führen? Ist er in der Lage, Eure zu erwartenden Ruhmestaten in wohlgeformte Sätze zu kleiden? Und außerdem: Befinden sich nicht bereits einige Italiener unter Euren Matrosen? Wird dann ein unbescholtener Adliger mehr den Ausschlag für eine Revolte geben? Setzt Ihr so wenig Vertrauen In Eure Führung?“
Der Portugiese musste herzlich lachen. Das Gespräch mit dem jungen Heißsporn bedeutete ihm eine willkommene Abwechslung von seinen Sorgen. Daher befand er schließlich:
„Nun gut, Ihr habt mich überzeugt. Ihr dürft an Bord der Trinidad kommen. Nur beklagt Euch nicht, wenn Ihr unterwegs Euer Leben lasst.“
„Ich danke Euch zutiefst, Capitano generale. Wenn ich auf der Reise sterbe, dann wenigstens für eine große Sache.“
Magellan lachte nochmals und verschwand kopfschüttelnd zu den Knechten, die sein Schiff beluden.
Diese Szene lag nun mehrere Monate zurück. Die Abreise aus dem Hafen in Sevilla war ihrerseits schon einige Wochen alt. Die Trinidad, San Antonio, Concepcíon, Victoria und Santiago mit den knapp 240 Männern an Bord waren seitdem den Río Guadalquivir hinabgefahren und lagen nun im Hafenstädtchen Sanlúcar de Barrameda vor Anker. Hier, in tieferem Gewässer, erfolgte die restliche Beladung mit dem nötigen Proviant, während Magellan noch immer nicht hinzugestoßen war. Gab es denn so viel mit seinem Notar zu besprechen? Vielleicht holte Magellan letzte Instruktionen aus Valladolid ein. Seine Männer wussten es nicht. Mindestens traf er sich, wie Pigafetta vernommen hatte, ein weiteres Mal mit seinem Kartographen Rui Faleiro, auch er ein portugiesischer Überläufer.
Magellan und Faleiro teilten die Überzeugung von der Existenz einer Westroute. Letzterer hätte gerne an der Expedition teilgenommen. Er wurde sogar zu einem der fünf Kapitäne auserkoren. Der Portugiese wäre nach Magellan das zweitmächtigste Mitglied des Unternehmens gewesen. Doch die argwöhnischen Spanier sperrten sich erfolgreich gegen dieses Ansinnen. Faleiro musste in Europa bleiben. Böse Zungen behaupteten, er hätte freiwillig auf seine Teilnahme an der Reise verzichtet, weil er seinen eigenen Karten nicht traue.
Genaueres konnte Pigafetta nicht über Magellans Verspätung auf seiner eigenen Reise herausfinden. Das machtlose Spekulieren quälte ihn geradezu. Sein ungemein wacher Verstand duldete keine Ratlosigkeit. Diesmal jedoch musste er sich damit begnügen, kaum mehr zu wissen als die anderen. Er tröstete sich mit dem Gedanken, unterwegs ganz neue Welten zu Gesicht zu bekommen und alles über sie zu notieren, bis seine Finger streiken würden.
5. Ein Brief
Was also trieb der Generalkapitän, während sich seine fünf Karacken im Hafen von Sevilla ratternd und knarzend in Bewegung setzten? Er befand sich zum Zwecke des besagten Notartermins ganz in der Nähe. Magellan traf sich tatsächlich nicht nur mit dem Sachwalter seiner persönlichen Geschäfte und privaten Nachlässe, Pablo de Ayamonte, sondern auch mit dem erwähnten Rui Faleiro und einem gewissen Cristóbal de Haro. Die Anwesenheit von letzteren beiden sollte eigentlich geheim bleiben. Dass – wie das Beispiel Pigafettas zeigt – zumindest die Teilnahme von Faleiro durchsickerte, bewies den mäßigen Erfolg der vereinbarten Verschwiegenheit. Indes wusste niemand etwas von de Haros Präsenz. Ebenso verborgen blieb der eigentliche Anlass für die Viererrunde. Und darauf kam es an.
De Haro war ein spanischer Kaufmann, der in Lissabon einige Zeit am Überseehandel der Portugiesen mitverdient hatte. Das Versklaven zahlloser Menschen in Übersee gehörte ebenso zu seinem Portfolio wie der An- und Verkauf von glutroten Hölzern aus Brasilien. In Lissabon steckte er sich mit einem Fieber an, das auch Magellan befallen hatte: dem Fiebern nach einer Westpassage zu den Gewürzinseln. Damals hörte de Haro von den Reisen des Seefahrers Solís, welcher für Spanien bereits nach einer solchen Passage gesucht hatte. An einer Flussmündung war der Unglücksrabe von feindseligen Ureinwohnern getötet worden. Nachgeborene bezeichneten diesen Fluss später als Río de la Plata: „Silberfluss“.
Fasziniert von der Möglichkeit, dass der Westweg zu den Molukken vielleicht kürzer ausfiele als die Ostroute, hatte de Haro eigene Späher losgeschickt. Sie berichteten ihm, tatsächlich eine Passage gefunden zu haben. Einen Beweis blieben sie leider schuldig. Doch sie schworen, unweit vom Silberfluss die ersehnte Durchfahrt gesichtet zu haben – und verlangten ihre Prämie. Als der skeptische de Haro sie ihnen nicht in voller Höhe gewährte, begannen die Komplikationen. Andere Geschäftsleute nutzten die Gunst der Stunde, den unliebsamen Konkurrenten aus Nordspanien beim portugiesischen König anzuschwärzen. Erschwerend trat hinzu, dass Manuel kein Interesse an der Entdeckung einer Westpassage besaß, weil er – wie wir sahen – fürchtete, dass die Spanier ihm dann die begehrten Gewürzinseln streitig machten. Also musste de Haro Portugal verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon Magellan und Faleiro getroffen. Faleiro bemühte mannigfache Berechnungen über den Erdumfang, laut denen die Molukken in der spanischen Welthälfte lägen. Wer das Gegenteil behaupte, sei ein einfältiger Narr. Und Magellan verfügte über streng vertrauliche Briefe eines alten Freundes, der nicht den Dunst einer Ahnung besaß, mit welchen Hintergedanken sie sein einstiger Weggefährte studierte: Francisco Serrão, Manuels Statthalter auf Ternate. Ebendiese Schreiben bildeten den eigentlichen Anlass für das Tête-à-Tête zwischen Magellan, de Haro, Faleiro und Magellans Notar Ayamonte. Kaum hatten die vier die Türen hinter sich verschlossen, holte Ayamonte die Briefe aus einer wohlgehüteten Kiste. Er überreichte sie Magellan. Sofort begann der Generalkapitän zu blättern, bis er ein offenbar besonders wichtiges Papier herausfischte. Der Notar nahm es wieder an sich und las vor:
Ternate, am 23. März im Jahre des Herrn 1514
Mein lieber Freund,
wie weit liegen unsere Ruhmestaten nun schon zurück? Wie lange ist es her, dass wir auf einem unserer Kriegszüge die Stadt Malakka den Musulmanen entrissen und damit die Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße zwischen Sumatra und der malaiischen Halbinsel für König Manuel errungen haben? Ich weiß es bereits nicht mehr. Noch klarer als die besondere Bedeutung dieses Sieges auf halber Strecke zwischen Indien und den Gewürzinseln steht mir ein früherer Beutezug vor Augen, bei dem Ihr mich vor den tödlichen Hieben eines feindlichen Schwerts bewahrt habt. Dass ich hier auf der sonnenverwöhnten Insel Ternate ein fast unbeschwertes Leben genießen darf, verdanke ich Euch. Weil ich Euch das nie vergessen werde, möchte ich nochmals hervorkehren, wie herrlich das Dasein hier ist. Nennenswerte Städte wie in Europa gibt es an diesem Flecken Erde zwar nicht, somit aber auch kein ekelerregendes Gewühle in rattenverseuchten Gassen. Ternate besteht – nicht anders als die anderen Eilande hier – aus immergrünen Wäldern, pittoresken Buchten und Siedlungen mit luftigen Bambushütten unter Dächern aus Palmblättern. Ich unterhalte beste Kontakte zum hiesigen Sultan. Sein Palast ist der einzige Steinbau auf der Insel. Er hält keinem Vergleich mit den Palästen aus unserer Heimat stand. Trotzdem vermag ich nicht zu behaupten, dass die Ternater unglücklicher wären als wir – im Gegenteil. Auch sie haben ihre alltäglichen Sorgen. Doch sie helfen einander, weil sie andernfalls auf ihrem begrenzten Territorium kaum überleben könnten. Überhaupt besteht die gesamte Region aus einer Vielzahl größerer und kleinerer Inseln mit noch mehr Mikrostaaten auf ihnen. Die mit Abstand mächtigsten Herrschaften sind Ternate und sein Rivale Tidore, gleich nebenan. Sie haben mehrere Nachbargebiete unterworfen. Das nächste vergleichbare Staatswesen ist das Sultanat Brunei auf Borneo.
Doch was langweile ich Euch mit politischen Gegebenheiten, wenn ich Euch auch einfach die Süße des Lebens hier schildern könnte! Denn das Beste habe ich noch gar nicht erwähnt: die Frauen! Ach, Kamerad, die Frauen an diesen Gestaden sind von solch erlesener Schönheit, dass man sich schon im Paradies wähnen könnte! Aber nein, ich möchte meinen Brief nicht mit nahezu frevlerischen Zeilen beenden, sondern erlaube mir einen Rat: Kommt her. Als Statthalter Seiner Majestät werde ich Euch einträgliche Geschäfte zuweisen können. Ihr findet die Gewürzinseln viel weiter im Osten, als wir damals vor Malakka angenommen hatten. Wenn Ihr die Straße von Malakka also passiert, versorgt Euch mit reichlich Proviant. Holt am besten auch ortskundige Lotsen an Bord. Ich möchte nicht erfahren müssen, dass Ihr unterwegs gesunken seid.
Mit besten Empfehlungen
Francisco Serrão, Gouverneur Seiner Majestät König Manuels von Portugal auf Ternate
Alle Anwesenden kannten den Brief längst. Für Magellan diente Serrãos Angabe zur Entfernung zwischen Malakka und Ternate als Argument dafür, dass die Molukken in der spanischen Welthälfte lägen, unterstützt von Faleiro. Denn der sah seine Berechnungen bestätigt. Der Brief spielte auch für de Haro eine eminente Rolle. Dieser Händler war es, der Magellan mit Dukaten versorgt hatte, als Karl seine Zahlungen einstellte. Würden Serrão und Faleiro irren – wenn also die Gewürzinseln doch zur portugiesischen Hemisphäre gehörten –, könnte Manuel Spaniens Ansprüche auf die Molukken und damit auch de Haros erhoffte Erlöse aus dem Gewürzhandel anfechten. Ternate mochte zwar bereits in portugiesischer Hand sein, aber noch nicht das benachbarte Tidore. Und wenn die von Magellan zurückgelegte Strecke über die Westroute bewies, dass die Portugiesen mit dem Bau eines Forts auf den Gewürzinseln gegen den Vertrag von Tordesillas verstießen, könnten sie vielleicht gezwungen werden, die Region ganz zu räumen. Das hoffte zumindest der findige de Haro.
Für Magellan spielte der Brief eine noch grundsätzlichere Rolle: Er sollte als eine Art Lebensversicherung für den Fall dienen, dass sein Geschwader in den Gewässern vor den Molukken von portugiesischen Karavellen aufgebracht würde. Mit jenem Schreiben konnte er argumentieren, dass Manuels eigener Statthalter ungewollt Karls Griff nach Ternate und Tidore bestätigt habe und er, Magellan, mit gutem Recht dorthin segle. Ob die Portugiesen sich davon beeindrucken ließen, mochte auf einem anderen Blatt stehen. Doch der Generalkapitän wollte seine ohnehin schon gefährliche Reise so weit wie irgend möglich absichern. Ob Magellan indes, wie von Serrão intendiert, ernsthaft daran dachte, sich auf Ternate niederzulassen, dieses Geheimnis hat er mit in den Tod genommen. Seiner Gemahlin musste er jedenfalls das Gegenteil schwören.
Vor den Augen der ebenfalls an Serrãos Brief überaus interessierten Männer Faleiro und de Haro legte Magellan eine Abschrift des Schreibens vor. Ayamonte bezeugte mit seinem Sigel die Übereinstimmung mit dem Original, händigte letzteres dem Besitzer ein weiteres Mal aus und legte die beglaubigte Kopie sorgfältig in die Kiste. Magellan steckte den echten Brief ein, die Abschrift verblieb sicher in Sevilla. Die vier gaben sich die Hand, hofften das Beste und gingen ihrer Wege.
Am nächsten Tag traf Magellan endlich in Sanlúcar ein, gefolgt von seinem Sklaven Enrique. Er stammte aus ebenjener Stadt, deren Eroberung Serrão so weihevoll betont hatte, daher sein Name Melaka. Er führte mehrere Rollen von Faleiros Kartenmaterial mit sich, wie Pigafetta sofort feststellte. Der Flottenkommandant wurde herzlich von seinem Landsmann Estêvão Gomes an Bord der Trinidad empfangen; einem Feldherrn gleich, der siegreich von der Schlacht zurückkehrt. Dabei lag das Unterfangen noch vor der bunt zusammengewürfelten Truppe.
„Fernão!“, rief Gomes dem Generalkapitän in ihrer Muttersprache entgegen, „welche Freude, dich endlich auf deinem Flaggschiff begrüßen zu dürfen! Hiermit unterstelle ich es deinem Befehl.“
„Besten Dank, alter Freund“, erwiderte Magellan die herzlichen Worte in derselben tatenhungrigen Heiterkeit. „Nun sind alle Vorkehrungen abgeschlossen. Beweisen wir König Manuel seine Torheit, mich wie einen Verbrecher behandelt zu haben!“
Pigafetta verfolgte die Szene von der zweiten Reihe aus. Das stille Murren der Spanier an Deck über die Plauderei der beiden Portugiesen entging ihm keineswegs. Sie waren bei weitem nicht so sehr vom Gelingen ihrer Mission überzeugt. Außerdem missfiel es ihnen, wie sie in jenem Geplänkel zu bloßen Handlangern von Magellans verletztem Stolz degradiert wurden. Dabei ging es dem Generalkapitän um weit mehr als Revanchegelüste; das Finden einer Westroute zu den Gewürzinseln hatte sich ihm ins Hirn gebrannt, seitdem er durch frühere Entdecker von der Inselwelt hinter Indien gehört hatte. Auf mehreren Kriegszügen hatte er einige von ihnen selbst betreten, damals freilich noch auf dem Ostweg im Auftrag der portugiesischen Krone. Der belesene und hyperneugierige Pigafetta wusste davon. Raue Seebären hielten sich eher selten mit derlei Details auf. Für viele von ihnen repräsentierte die Westroute nach wie vor eine fixe Idee. Ihr Antrieb für die Reise waren versprochene Reichtümer oder schlicht kaum Alternativen, sich ein Auskommen zu sichern. Bei einem der Abfahrt vorangehenden Gebet Magellans mit seinen Männern wünschte ihm manch einer sogar den Tod.
An diesem 20. September 1519 lichteten die fünf Karacken endlich die Anker. Die Reise hatte begonnen.
6. Königliche Weisungen
Der Bischof von Évora seufzte. König Manuel tat ohnehin, was er wollte! Wozu hatte er ihn dann zu seinem Berater ernannt? Seit Monaten war Afonso nicht mehr in seiner Diözese gewesen. Stattdessen saß er hier an seinem Tisch, irgendwo im königlichen Palast am Tejo-Ufer – noch so ein Prachtbau seines prunksüchtigen Herrn – und beugte sich über das jüngste Schreiben Seiner Majestät. Alle Welt bewunderte oder beneidete Erzbischof Fonseca für seinen Einfluss auf den spanischen Monarchen. Afonso de Portugal schnaubte verächtlich. Denn er kannte die Irren und Wirren einer solch hohen Stellung bei Hofe. Er war über die Mühen des Erzbischofs bestens unterrichtet, den zwar noch jungen, aber überaus eigensinnigen Karl in die eine oder andere Richtung zu lenken. Beim weit älteren Manuel verhielt es sich nicht anders. Und natürlich wollte Manuel seinen eigenen Fonseca haben. In nichts gedachte Portugals Souverän dem mächtigen Neffen nachzustehen, in dessen Reich die Sonne nie unterging. Für die nur auf den ersten Blick glückliche Beraterrolle hatte Manuel ausgerechnet ihn, Afonso, ausersehen. Er seufzte erneut. In dem Schriftstück vor ihm hieß es:
Die Armada des Verräters Magellan hat den Golf von Cádiz erreicht. Wie genau seine Route auch verlaufen mag, scheint es mehr als wahrscheinlich, dass er in Brasilien vor Anker gehen wird, um seine Leute mit frischem Obst und Trinkwasser zu versorgen. Natürlich ist ihm das strengstens verboten, weil Brasilien mir gehört. Der Übeltäter wird sich darum jedoch kaum scheren. Hiermit erlasse ich folgende Befehle:
1.) Vom Hafen von Funchal aus sollen kanonenbestückte Karavellen aufbrechen, sei es um sein Geschwader abzupassen und gleich zu versenken, sei es für eine Verfolgungsjagd, bis Magellan in Reichweite ist. Seine Schiffe müssen so oder so zerstört werden.
2.) Für den Fall, dass Magellan tatsächlich die Ankunft in Brasilien gelingt, müssen die dort stationierten Truppen alles Nötige in Bewegung setzen, um seiner habhaft zu werden.
3.) Zur Sicherheit sollen sich Karavellen vor dem Kap der Guten Hoffnung bereithalten, wenn er sich so weit in meine Gewässer vorwagt.
4.) Ich will, dass meine Schiffe ihn auch beim Passieren der Tordesillas-Linie verfolgen. Gott möge eine solche Eventualität verhindern.
5.) Begebt Euch auf dem schnellsten Weg selbst nach Brasilien, um vor Ort alles vorzubereiten.
Mit zittrigen Fingern legte Afonso den Brief mit dem königlichen Siegel beiseite. Er hatte nun das achtzigste Lebensjahr überschritten und sollte trotz seines Alters in eine abgeschiedene, glutheiße, erst vor zwei Dekaden in Besitz genommene Region am Rande der bekannten Welt segeln und dort eine Flotte zusammenziehen. Nur existierte sie im erhofften Ausmaß noch nicht, von den erwähnten Karavellen in Funchal ganz zu schweigen. Die portugiesischen Streitkräfte konzentrierten sich derzeit auf die Küsten Afrikas und den Indischen Ozean. Hier hatten sie durchaus beachtliche Siege errungen; hier wurden sie weiterhin gebraucht, um Portugals neues Handelsmonopol mit den Gewürz-Völkern aufrecht zu erhalten. Brasilien repräsentierte im Moment kaum mehr als eine entfernte Zwischenstation auf dem Weg von Europa nach Afrika und Indien, wenn starke Winde die Karavellen zu weit nach Westen trieben. Nur wenige Siedler hatten sich bisher in Südamerika niedergelassen. Vielleicht würde sich das eines Tages ändern. Noch sah es nicht danach aus. Jedenfalls würde König Karl einen Angriff auf Magellan mit einer Invasion Portugals beantworten. Manuel besaß nicht die Mittel, die afrikanischen und orientalischen Araber, feindlich gesinnte Maharadschas in Indien und die Spanier gleichzeitig zu bekriegen. Doch es wäre zwecklos, ihm das begreiflich machen zu wollen. Er fühlte sich von Gott auserkoren, die Weltmeere zu beherrschen, die Muslime vom Erdenrund zu tilgen und nebenbei alle irdischen Reichtümer in seiner Schatzkammer zu vereinen. Mit einer solchen Selbstgewissheit ließen sich die tollkühnsten Abenteuer rechtfertigen.
Doch was regte er, Afonso, sich auf! Er ahnte: Als Kleriker würde er nicht mehr erreichen als die Verantwortung für das Bistum Évora. Für diese ehrenvolle, wenngleich nicht sonderlich prestigeträchtige Aufgabe empfand er demütige Dankbarkeit. Widerstrebend hatte er sich zu Manuels Berater bestimmen lassen, jedoch nur, weil kaum jemand diesem Querkopf dienen wollte.
Afonso erhob sich. Sofort waren Lakaien zur Stelle, um ihm Stock und Mantel zu reichen.
„Bereitet meine Abreise vor“, verfügte er. „Ich werde mich für einige Monate nach Amerika begeben.“
Er überlegte, ob es für einen Abstecher nach Funchal nicht zu spät wäre. Ehe er dort einträfe, könnte Magellan schon mitten auf dem Atlantik segeln.
Der Bischof von Évora war nicht im Mindesten vom Sinn oder gar von der Richtigkeit seines Auftrags überzeugt. So rüde, wie sein König Magellan behandelt hatte, hegte er innerlich Verständnis dafür, dass dieser stolze Seemann aus niederem Adel sein Glück woanders suchte. Trotzdem wollte Afonso die Befehle seines Herrn so gewissenhaft wie möglich in die Tat umsetzen. Das betrachtete er als seine Pflicht, zumal er hoffte, anschließend nach Évora zurückkehren zu dürfen. Auf wessen Seite Gott sich stellte, ob er überhaupt auf der Seite Manuels oder Karls stand, darüber wollte der hochbetagte Bischof nicht spekulieren.
7. Knapp verfehlt
Trotz seiner Zweifel reiste Afonso de Portugal zuerst nach Funchal auf der Vulkaninsel Madeira. Neben der Imaculada, also der Karavelle, welche ihn von Lissabon dorthin brachte, nahm er eine zweite für sein Geleit in Beschlag. Denn beide verfügten über zahlreiche Kanonen in bestem Zustand. Er wollte Magellan unbedingt schon im östlichen Atlantik, also im eigenen Hoheitsgebiet aufbringen. Denn dann besäße König Manuel bessere Argumente gegenüber einem erbosten Karl von Spanien und Österreich. Außerdem herrschte auf dem immergrünen Madeira ein mildes Klima, das Afonsos müden Knochen guttäte. Mit etwas Glück bräuchte er gar nicht nach Brasilien zu segeln. Dazu müsste er nur das feindliche Geschwader rechtzeitig abfangen. Seine Karavellen könnten es leicht mit Magellans Karacken aufnehmen, mit diesen umgerüsteten alten Handelsschiffen, mochten sie auch in der Überzahl sein.
Während der Bischof von Évora das Madeira-Archipel ansteuerte, ankerte Magellan nur wenige Seemeilen weiter südlich vor Teneriffa. Obgleich in der östlichen Hemisphäre gelegen, gehörten die Kanaren zum spanischen Machtbereich. Hier holten Magellans Leute letzte Vorräte für die Überfahrt nach Brasilien an Bord. Zudem kamen ein paar weitere Besatzungsmitglieder hinzu, so dass die Mannschaft nun aus insgesamt 242 Personen verschiedenster Provenienz und mit den unterschiedlichsten Absichten bestand. Auch vor Teneriffa ließ Magellan kaum eine Gelegenheit verstreichen, seiner bunten Truppe zu verdeutlichen, dass er sein Oberkommando von König Karl persönlich erhalten hatte. Ein Missachten seiner Befehle käme Gehorsamsverweigerung gegenüber dem höchsten Souverän gleich.
Der junge Pigafetta stand an der Reling der Trinidad und bewunderte das Gewusel an Land unter ihm. Sein in feines Leder gebundenes, noch fast leeres Reisejournal drückte er fest an sich. Beim versonnenen Betrachten fiel ihm ein Mann mittleren Alters auf, der immer neue Fässer auf ein Nachbarschiff beorderte. Dabei löste sich ein Fass von einem Karren, rollte auf den Kerl zu und hätte ihn fast weggerissen. Gerade noch rechtzeitig sprang er zur Seite. Dafür plumpste das Fass auf Nimmerwiedersehen ins Wasser. Schimpfwörter der schlimmsten Sorte schossen aus dem Mund des Seemanns.
„Bah, wie ungehobelt!“, entfuhr es Pigafetta.
Der Mann am Kai schaute plötzlich zu ihm hoch. Er taxierte mit Argwohn Pigafettas teure Kleidung.
„Anstatt Bella Figura zu machen und Euch über ein Missgeschick zu amüsieren, das uns in der Not noch teuer zu stehen kommen kann, solltet Ihr mit anpacken“, erboste sich der Unhold.
„Wer seid Ihr?“, fragte Pigafetta den Fremden, der es wagte, so frei mit ihm zu reden.
„Mein Name ist Juan Sebastián Elcano. Ich bin Schiffsmeister auf der Concepción. Und mit wem habe ich die Ehre?“
„Antonio Pigafetta, persönlicher Sekretär des Generalkapitäns!“
„Ach so“, lachte dieser Elcano, „ich dachte, Magellan hätte schon einen Sklaven!“
Ehe Pigafetta zu einer gepfefferten Antwort ausholen konnte, näherte sich ihm der gerade erwähnte Enrique.
„Bitte keinen Streit, nicht meinetwegen“, beschwichtigte er den jungen Edelmann.
Der wissbegierige Italiener nahm die Gelegenheit wahr, sich beim Diener über dessen exotische Heimat zu erkundigen. Jenem ungehobelten Elcano drehte Pigafetta demonstrativ den Rücken zu, wie man es mit gewöhnlichem Gesinde zu tun pflegte. Durch Enrique lernte der Italiener viel über seltsame Bräuche der fernen Inselvölker, merkwürdige Rituale und unbekannte Pflanzen. Er schwor sich, all das erst in sein Tagebuch zu notieren, wenn er es mit eigenen Augen sähe.
Auf Madeira, einem in allen Farben blühenden Flecken im Atlantik, wo er unter anderen Umständen gerne verweilt wäre, erfuhr Afonso de Portugal von mehreren Fischern, dass erst am Vortag eine Armada aus fünf Schiffen in südlicher Richtung an der Insel vorbeigesegelt sei. Angeblich handelte es sich nicht um portugiesische Karavellen, sondern um spanische Karacken. Das konnte nur Magellan gewesen sein! Ein fahles Grinsen huschte über Afonsos dünne Lippen. Vielleicht blieb ihm Brasilien tatsächlich erspart. Er speiste gerade am Frühstückstisch eines gewissen João da Silva Andrade, des Insel-Gouverneurs. Obwohl sich beide Männer direkt gegenübersaßen, beachtete Afonso ihn kaum. Stattdessen ließ er sich von einem afrikanischen Sklaven eine Karte der Region bringen, schob seinen Teller beiseite und befahl dem Sklaven, die Karte auszubreiten.
„Wollen doch mal sehen“, murmelte der Bischof, „wir haben meine beiden seetauglichen Karavallen im Hafen von Funchal liegen; hinzukommen noch …“ Er schaute auf. „Wie viele Kampfschiffe könnt Ihr entbehren, Silva?“
„Eines, Hochwürden, es befindet sich allerdings nicht in bestem Zustand“, bekam er zur Antwort.
„Dann wird es reichen müssen“, erwiderte Afonso und vertiefte sich wieder in die Karte.
Sein knöcherner Zeigefinger mit dem bischöflichen Siegelring wanderte von Madeira über die „Wilden Inseln“, einsame Ozeanfelsen, hinunter zu den Kanaren.
„Wir haben eine Chance“, befand er, „sie ist nicht groß, aber vorhanden: Mit unseren Karavellen können wir die Kanaren an drei Seiten blockieren. Magellan wird von dort kaum zurück nach Norden segeln; ebenso wenig nach Osten, sonst würde er direkt auf Afrika zusteuern. Wenn wir doch nur wüssten, auf welcher Kanareninsel genau Magellan Station macht! Wir sollten – angesichts der Ausdehnung des Archipels – unsere Schiffe hier, hier und da positionieren.“
Afonsos Finger tippte auf drei verschiedene Stellen vor der Inselgruppe. Dem Gouverneur erteilte er den Auftrag, einen Boten in die nächste von Portugiesen besetzte Stadt in Westafrika, Safi, zu entsenden. Vielleicht ankerte dort oder in der Nähe gerade eine vierte Karavelle, die man gut gebrauchen konnte. Doch die Zeit drängte; auf eine Antwort aus Safi zu warten, verbot sich von selbst. Dennoch wollte Afonso die Schlinge um Magellan so eng wie möglich ziehen. Der Bischof von Évora hatte sich geschworen, keinen Versuch auszusparen, die ihm aufgezwungene Jagd so rasch wie möglich abzuschließen.
Gaspar de Quesada hatte wieder einmal die Besatzung seiner Concepción vollzählig antreten lassen. Dabei brannte die Mittagshitze, die Männer hatten die letzten Stunden Säcke geschleppt, Kisten gehievt, Taue ausgebessert und Segel geflickt. Eine Pause wäre durchaus angebracht gewesen. Sich irgendwohin zurückziehen konnten sie auf dem Schiff nicht. Dafür gab es schlicht keinen Platz.
Wie ein Gockel stolzierte der beleibte Andalusier vor seinen Untergebenen auf und ab. Während er sprach, dreht er sich stets aufs Neue theatralisch um. Elcano stand als sein Schiffsmeister reglos daneben. Er hielt die Hände hinter dem Rücken gekreuzt und sah in wenig beglückte Gesichter. Gold! Dieses Wort fiel immer wieder in Quesadas Monolog. Ganz gleich, ob die Seefahrer glänzende Schätze fänden oder den „primitiven Völkern“ auf der anderen Seite der Erde Gewürze abnähmen, reich würden sie in jedem Fall, versicherte der Kapitän seinen Leuten. Denn wieder in Europa würden die Gewürze mit Gold aufgewogen. Dank Gottes Hilfe könnten die meisten Männer unter seinem Kommando überleben und reicher als Krösus in die Heimat zurückkehren. Elcano kam nicht umhin, die Augen zu verdrehen. Nun also auch noch der sagenhafte König Krösus! Es hätte ihn nicht gewundert, wenn Quesada außerdem den ebenso legendären Midas bemühte, der angeblich alles zu Gold verwandelte, was er berührte.
Quesadas Worte, so einfältig sie auch sein mochten, verfingen bei den Seeleuten. Das erkannte Elcano sofort. Die Gesichter der Männer vor ihm begannen zu leuchten. Vergessen war offenbar der Frust übers Strammstehen nach all der Plackerei. Das Wecken von Gier schien Flügel zu verleihen. So brauchte der Kapitän der Truppe nur noch entgegenzurufen:
„Jetzt macht euch wieder ans Werk! Wenn wir keine Mühen scheuen, und kosten sie uns noch so viel Kraft, werdet ihr alle unermesslich reich!“
Schon zerstob die Menge wie von Zauberhand. Ein jeder begab sich erneut an seine Arbeit, freilich mit mehr Elan als zuvor.
Quesada lachte selbstzufrieden. Er sah zu Elcano hinüber und schritt grinsend auf ihn zu.
„Da siehst du, mein lieber Juan, wie man mit Tölpeln redet. Solche Typen muss es geben, damit wir leben können, wie wir es verdienen.“
Ohne Elcanos Reaktion abzuwarten, verschwand der Kapitän in seine Kajüte. Dorthin hatte er sich sein ganz persönliches Fässchen Wein bringen lassen. Elcano, in dessen baskischer Heimat das Holz für die Concepción und die anderen Schiffe geschlagen worden war und der harte körperliche Arbeit von Kindesbein an kannte, kam nicht dazu, seinen Vorgesetzten insgeheim zu verwünschen, weil plötzlich Kanonen donnerten. Was war los? Der Donner stammte von Magellans Trinidad. Er hatte das Zeichen zum Aufbruch erteilt. Wieso das denn? Es war doch noch gar nicht aller Proviant an Bord. Quesada stürzte an Deck zurück.
„Was ist passiert?“, wollte er aufgeregt wissen.
„Wir müssen sofort auslaufen“, antwortete Elcano.
Er wusste auch nicht mehr, ehe sein Blick den Horizont traf. Dort entdeckte er die Masten einer sich nähernden portugiesischen Karavelle.
„Kapitän!“, schrie der Mann vom Ausguck herunter, „vier Karavellen halten auf uns zu!“
Und tatsächlich! Als Elcano zur anderen Deckseite stürmte, erkannte er drei weitere der gefürchteten Kriegsschiffe vom König in Lissabon. Der Baske vergeudete keine Zeit mehr und gab im disharmonischen Kanon mit den Offizieren Befehle zum schnellen Ankerlichten.