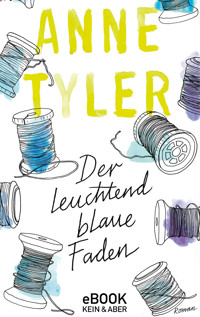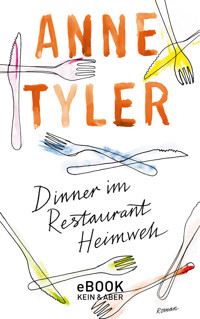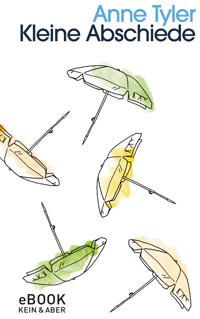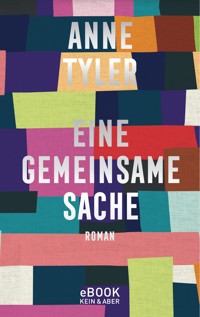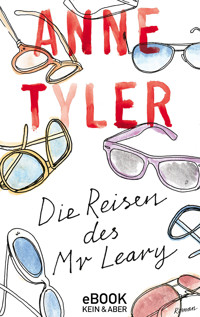
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der kauzige, aber durchaus reizende Mr Leary schreibt Reiseführer für Leute, die geschäftlich unterwegs sein müssen, das Reisen aber hassen – ganz wie er selbst! In sein höchst organisiertes Leben platzt Muriel, eine junge Frau, die eigentlich seinen Hund erziehen soll,
aber plötzlich Mr Leary selbst als faszinierende pädagogische Aufgabe begreift. Und Mr Leary steht mit einem Mal zwischen Muriel und seiner Ehefrau Sarah, die ihn eigentlich verlassen wollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Anne Tyler
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anne Tyler wurde 1941 in Minneapolis, Minnesota, geboren und ist »eine der erfolgreichsten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur« (ZEITmagazin). Sie ist Preisträgerin des Pulitzerpreises und des Sunday Times Awards für ihr Lebenswerk. Bei Kein&Aber erschienen bislang ihre Romane Verlorene Stunden (2010), Abschied für Anfänger (2012), Dinner im Restaurant Heimweh, Im Krieg und in der Liebe (beide 2014) und Der leuchtend blaue Faden (2015). Anne Tyler lebt in Baltimore.
ÜBER DAS BUCH
Der kauzige, aber durchaus reizende Mr Leary schreibt Reiseführer für Leute, die geschäftlich unterwegs sein müssen, das Reisen aber hassen – ganz wie er selbst! In sein höchst organisiertes Leben platzt Muriel, eine junge Frau, die eigentlich seinen Hund erziehen soll, aber plötzlich Mr Leary selbst als faszinierende pädagogische Aufgabe begreift. Und Mr Leary steht mit einem Mal zwischen Muriel und seiner Ehefrau Sarah, die ihn eigentlich verlassen wollte.
1
Eigentlich hatten sie vorgehabt, eine Woche am Strand zu bleiben, aber sie hielten es beide nicht aus und fuhren nun kurz entschlossen früher heim. Macon lenkte. Sarah saß neben ihm, den Kopf ans Seitenfenster gelehnt. Zwischen ihren zerzausten braunen Locken zeigten sich Sprenkel des wolkenverhangenen Himmels.
Macon trug einen korrekten Sommeranzug, seinen Reiseanzug – viel vernünftiger für Reisezwecke als Jeans, behauptete er immer; Jeans hätten lauter harte, steife Nähte und dann diese Nieten. Sarah trug ein trägerloses Strandkleid aus Frottee. Man hätte meinen können, die beiden kehrten von zwei grundverschiedenen Reisen zurück. Sarah war braungebrannt, Macon nicht. Er war ein hochgewachsener, blasser, grauäugiger Mann mit glattem, kurzgeschnittenem Blondhaar und jenem Typ von empfindlicher Haut, die leicht Sonnenbrand bekommt. Er hatte sich während der mittleren Tageszeit immer der Sonne ferngehalten.
Kaum waren sie auf der Schnellstraße, wurde der Himmel fast schwarz, und einige dicke Tropfen klatschten auf die Windschutzscheibe. Sarah richtete sich auf. »Hoffentlich regnet es nicht«, sagte sie.
»Mir macht ein bisschen Regen nichts aus«, sagte Macon.
Sarah lehnte sich wieder zurück, behielt jedoch die Straße im Auge.
Es war ein Donnerstagmorgen. Es gab kaum Verkehr. Sie überholten einen Lieferwagen, dann einen Kleinbus, der über und über mit Aufklebern von Attraktionen aus aller Welt bepflastert war. Die Tropfen auf der Windschutzscheibe wurden immer dichter. Macon schaltete die Scheibenwischer ein. Wisch-wasch machten sie – ein einlullendes Geräusch; und aufs Dach begann es sacht zu plätschern. Ab und zu fauchte ein Windstoß. Regen drückte das hohe, fahle Gras am Straßenrand flach, fiel in schrägen Schnüren über Bootsliegeplätze, Holzlager und Möbel-Discount-Märkte, die bereits nachgedunkelt aussahen, als hätte es hier schon längere Zeit geregnet.
»Siehst du denn überhaupt etwas?«, fragte Sarah.
»Klar«, sagte Macon. »Das ist doch gar nichts.«
Sie schlossen zu einem Lastzug auf, dessen Hinterräder sprühenden Gischt aufwirbelten. Macon scherte links aus und überholte ihn. Sekundenlang, bevor der Lastzug zurückblieb, war vor lauter Wasser die Sicht gleich null. Sarah griff mit einer Hand nach dem Armaturenbrett und hielt sich fest.
»Ich versteh nicht, wie du genug zum Fahren siehst«, sagte sie.
»Vielleicht solltest du deine Brille aufsetzen.«
»Wenn ich meine Brille aufsetze, siehst du besser?«
»Ich nicht; du«, gab Macon zurück. »Du konzentrierst dich auf die Windschutzscheibe statt auf die Fahrbahn.«
Sarah hielt sich noch immer am Armaturenbrett fest. Sie hatte ein breites, glattes Gesicht, das ruhig wirkte, doch bei näherem Hinsehen wäre einem die nervöse Spannung um ihre Augenwinkel nicht entgangen.
Der Wagen wurde ihnen ungemütlich eng. Ihr Atem trübte die Fenster. Zuvor war die Klimaanlage gelaufen, und schon bald wurde der verbliebene Rest künstlicher Kühle klamm und roch nach Moder. Sie zischten in eine Unterführung hinein. Der Regen hörte schlagartig auf. Sarah stieß erleichtert einen kleinen Seufzer aus, aber noch bevor er ganz heraus war, begann es wieder, aufs Dach zu prasseln. Sie drehte sich um und schaute verlangend der Unterführung nach. Macon raste weiter, die Hände locker und ruhig auf dem Steuer.
»Hast du den Jungen mit dem Motorrad gesehen?«, fragte Sarah. Sie musste laut sprechen; der Wagen war in ein fortwährendes, penetrantes Brausen eingebettet.
»Welchen Jungen?«
»Der in der Unterführung geparkt hat.«
»Heller Wahnsinn, bei diesem Wetter Motorrad zu fahren«, fand Macon. »Heller Wahnsinn bei jedem Wetter. So ganz den Elementen ausgeliefert.«
»Das könnten wir doch auch«, meinte Sarah. »Anhalten und warten, bis es aufhört.«
»Sarah, wenn ich es irgendwie gefährlich fände, weiterzufahren, dann wäre ich längst rechts rangefahren.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte Sarah.
Sie fuhren an einem Feld vorbei, wo der Regen wasserfallgleich herabströmte, Guss um Guss die Getreidehalme niedermähte und das rissige Erdreich überschwemmte. Gewaltige Sturzfluten schlugen gegen die Windschutzscheibe. Macon schaltete die Wischer auf die höchste Geschwindigkeit.
»Ich weiß nicht, ob es dir im Grunde nicht ziemlich egal ist«, sagte Sarah. »Oder?«
Macon wiederholte: »Egal?«
»Neulich habe ich doch zu dir gesagt: ›Macon, seit Ethan tot ist, frage ich mich manchmal, ob das Leben noch einen Sinn hat.‹ Weißt du noch, was du geantwortet hast?«
»Im Moment nicht.«
»Du hast gesagt: ›Schatz, ehrlich gestanden, hatte ich nie den Eindruck, dass es überhaupt je viel Sinn gehabt hätte.‹ Wörtlich.«
»Hm …«
»Und du merkst nicht einmal, was da nicht stimmt.«
»Durchaus möglich«, erwiderte Macon.
Er fuhr an einer Schlange von Autos vorbei, die am Straßenrand parkten; ihre Fenster waren beschlagen, von den spiegelnden Außenflächen spritzte der Regen in flachen Fontänen auf. Einer der Wagen hatte leichte Schlagseite, als wäre er drauf und dran, in die schlammige Flut zu kippen, die im Straßengraben schäumend und brodelnd dahinschoss. Macon fuhr in gleichbleibendem Tempo weiter.
»Du bist mir kein Trost, Macon«, sagte Sarah.
»Schatz, ich tue mein Möglichstes.«
»Du machst einfach genauso weiter wie gehabt. Deine kleinen Routinen und Rituale, diese deprimierenden Gewohnheiten. Tag für Tag. Überhaupt kein Trost.«
»Brauche ich etwa keinen Trost?«, fragte Macon. »Du bist nicht die Einzige, Sarah. Ich weiß nicht, wieso du dir einbildest, nur du hättest einen Verlust erlitten.«
»So kommt es mir aber vor, manchmal.«
Sie schwiegen eine Weile. Ein großer See, allem Anschein nach mitten auf der Straße, schwappte krachend gegen die Unterseite des Wagens und schleuderte ihn nach rechts. Macon trat ein paarmal kurz auf die Bremse und fuhr weiter.
»Dieser Regen zum Beispiel«, sagte Sarah. »Du weißt, er macht mich nervös. Was wäre schon dabei, wenn wir abwarten, bis er aufhört? Dann hätte ich das Gefühl, dass ich dir nicht egal bin. Dass wir beide in einem Boot sitzen.«
Macon spähte durch die Windschutzscheibe, an der das Wasser so herunterrann, dass sie marmoriert aussah. Er sagte: »Ich habe ein System, Sarah. Du weißt doch, dass ich nach einem System fahre.«
»Du mit deinen Systemen!«
»Außerdem«, fuhr er fort, »wenn das Leben für dich keinen Sinn hat, dann ist es mir schleierhaft, wieso ein Wolkenbruch dich so nervös macht.«
Sarah sank gegen die Lehne zurück.
»Sieh dir das an!«, bemerkte er. »Da hat es ein Wohnmobil glatt über den ganzen Campingplatz gespült!«
»Macon, ich möchte mich scheiden lassen«, tat Sarah kund.
Macon bremste und warf ihr einen Seitenblick zu. »Was?« Der Wagen schlingerte. Macon musste wieder geradeaus schauen. »Was habe ich denn gesagt?«, fragte er. »Was soll das heißen?«
»Ich kann einfach nicht mehr mit dir zusammenleben.«
Macon starrte weiterhin auf die Straße, aber seine Nase wirkte spitzer und weißer, als hätte seine Gesichtshaut sich gestrafft. Er räusperte sich. Er sagte: »Liebes. Hör zu. Wir haben ein schweres Jahr hinter uns. Wenn Leute ein Kind verlieren, dann geht es ihnen oft so. Alle sagen das. Alle sagen, es ist eine schreckliche Zerreißprobe für die Ehe.«
»Ich möchte mir eine eigene Wohnung suchen.«
»Eigene Wohnung«, wiederholte Macon; er sprach aber so leise, und der Regen hämmerte so laut aufs Dach, dass er nur die Lippen zu bewegen schien. »Nun ja«, sagte er. »Also gut. Wenn du unbedingt willst.«
»Du kannst das Haus behalten«, sagte Sarah. »Du bist noch nie gern umgezogen.«
Aus irgendeinem Grund war es gerade das, was ihr den Rest gab. Sie wandte sich jäh ab. Macon betätigte den rechten Blinker. Er bog in eine Texaco-Tankstelle ein, parkte unter dem Schutzdach und schaltete den Motor ab. Dann begann er, sich mit den Handflächen die Knie zu reiben. Sarah drückte sich in ihre Ecke. Außer dem Trommeln des Regens auf das Schutzdach hoch über ihnen war nichts zu hören.
2
Nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, dachte Macon zunächst, das Haus würde ihm größer erscheinen. Stattdessen fühlte er sich beengter. Die Fenster schrumpften. Die Zimmerdecken senkten sich. Die Möbel hatten etwas Aufdringliches an sich, schienen ihn zu umzingeln.
Natürlich war Sarahs Privateigentum – kleine Dinge wie Kleider und Schmuck – nicht mehr da. Es stellte sich jedoch heraus, dass einige der großen Dinge privater waren, als er geahnt hatte. Da war der Schreibsekretär im Wohnzimmer, die Fächer vollgestopft mit ihrem Sammelsurium aufgerissener Kuverts und unbeantworteter Briefe. Da war das Radio in der Küche, auf den Sender »98 Rock« eingestellt. (Sie wolle den Kontakt zu ihren Schülern aufrechterhalten, hatte sie früher immer gesagt, wenn sie summend und rhythmisch zuckend um den Frühstückstisch herumtänzelte.) Da war die Liege hinter dem Haus, wo sie sich gesonnt hatte, postiert an der einzigen Stelle, die überhaupt Sonne abbekam. Er betrachtete die geblümten Kissen und staunte, wie ein leerer Raum so von einer Person erfüllt sein konnte – ihr schwacher Duft nach Kokosnussöl, der immer den Wunsch nach einer piña colada in ihm weckte; ihr breites, glänzendes Gesicht, unergründlich hinter der Sonnenbrille; ihr fester Körper in dem Badeanzug mit Schürzcheneffekt, auf den sie sich nach ihrem vierzigsten Geburtstag unter Tränen kapriziert hatte. Ein paar Kräusel ihres prachtvollen Haares waren auf dem Grund des Waschbeckens zurückgeblieben. Ihr Bord im Badezimmerschränkchen war noch mit Tropfen einer flüssigen, eigentümlich pflaumenblaustichigen Schminke besprenkelt, die sein Gedächtnis augenblicklich auffrischte. Er hatte sich über ihre Nachlässigkeit immer geärgert, doch jetzt rührten ihn diese Spritzer. Sie wirkten wie buntes Spielzeug, verstreut auf dem Boden zurückgelassen, nachdem ein Kind zu Bett gegangen ist.
Das Haus selbst war mittelgroß, nicht ungewöhnlich anzusehen, und stand an einer von ähnlichen Häusern gesäumten Straße in einem älteren Teil von Baltimore. Mächtige Eichen überragten es, schützten es vor der glühenden Sommersonne, hielten aber auch kühlende Brisen ab. Die Räume im Innern waren quadratisch und dämmerig. In Sarahs Kleiderschrank hing nur noch ein braunes Seidentuch an einem Haken; die Schubladen ihrer Kommode enthielten nichts außer Fusseln und leeren Parfümflakons. Das ehemalige Zimmer ihres gemeinsamen Sohnes war sauber aufgeräumt und unpersönlich wie ein Motelzimmer. An manchen Stellen warfen die Wände schier ein Echo zurück. Dennoch ertappte Macon sich des Öfteren dabei, wie er die Arme dicht am Körper hielt, sich seitwärts an den Möbeln vorbeischob, so als passe er kaum noch in dieses Haus. Er kam sich zu groß vor. Seine langen, tapsigen Füße schienen ihm ungewohnt entfernt zu sein. Ging er durch eine Tür, zog er jedes Mal den Kopf ein.
Jetzt bot sich ihm die Gelegenheit, alles zu reorganisieren, redete er sich ein. Unvermuteter Ehrgeiz begann sich in ihm zu regen. Auch Haushaltsführung erforderte schließlich irgendein System; Sarah hatte das nie begriffen. Sie gehörte zu den Frauen, die das Essbesteck unsortiert aufbewahren. Bedenkenlos ließ sie die Geschirrspülmaschine auch dann laufen, wenn sie nur mit einer Handvoll Gabeln beschickt war. Macon tat so etwas weh. Er war überhaupt gegen Geschirrspülmaschinen; seiner Meinung nach waren sie Energieverschwender. Energieeinsparung war sein Hobby, gelinde gesagt.
Er gewöhnte sich an, im Spülbecken stets Wasser bereitzuhalten, das er zwecks Desinfektion mit Chlorbleiche versetzte. Was immer er gerade benützt hatte, versenkte er einfach darin. Jeden zweiten Tag zog er den Stöpsel und sprühte alles mit kochend heißem Wasser ab. Dann stapelte er das so gereinigte Geschirr in der Geschirrspülmaschine auf, die seinem neuen System entsprechend als gewaltiges Depot diente.
Wenn er sich über das Spülbecken beugte und die Sprühvorrichtung laufen ließ, beschlich ihn öfter das Gefühl, Sarah beobachte ihn. Er brauchte wohl nur ein bisschen nach links zu schielen und würde sie dastehen sehen – die Arme über der Brust verschränkt, den Kopf zur Seite geneigt, die vollen, geschwungenen Lippen nachdenklich gespitzt. Auf den ersten Blick betrachtete sie sich nur die Prozedur; auf den zweiten Blick (wusste er) amüsierte sie sich über ihn. In ihren Augen nistete ein verstohlenes Funkeln, das er nur allzu gut kannte. »Aha«, hatte sie oft genug gesagt und zu seinen langatmigen Erklärungen genickt; dann, beim Aufblicken, hatte er das Funkeln und die verräterische Vertiefung eines ihrer Mundwinkel erhascht.
Wenn sie ihm erschien – falls man das so nennen kann in Anbetracht der Tatsache, dass er niemals zu ihr hinüberschielte –, trug sie ein leuchtend blaues Kleid aus den Anfängen ihrer Ehe. Er hatte keine Ahnung, wann sie das Kleid ausrangiert hatte, aber es musste viele Jahre her sein. Es kam ihm fast so vor, als sei Sarah ein Geist – als lebte sie nicht mehr. In gewisser Weise, dachte er, während er den Wasserhahn zudrehte, lebte sie wirklich nicht mehr, die junge, impulsive Sarah aus der ersten gemeinsamen, von Hochgefühl durchwehten Wohnung in der Cold Spring Lane. Sobald er versuchte, sich an diese Zeit zu erinnern, wurde jedes Bild von Sarah durch die Tatsache verzerrt, dass sie ihn verlassen hatte. Wenn er sich die erste Begegnung mit ihr vergegenwärtigte – sie waren noch halbe Kinder zu der Zeit –, dann schien ihm, dass sich schon damals die Trennung angebahnt hatte. Als sie an dem bewussten Abend zu ihm aufgeblickt und mit den Eiswürfeln in ihrem Pappbecher geklappert hatte, waren sie schon auf das letzte gemeinsame Jahr voller Reizbarkeit und Elend zugesteuert, auf die Monate, da jedes Wort, das einer von ihnen äußerte, falsch war, auf die Einsicht, dass sie aneinander vorbeilebten. Sie ähnelten Menschen, die mit ausgebreiteten Armen aufeinander zu laufen, sich aber verkalkulieren, einander verfehlen und weiterlaufen. Alles war umsonst gewesen, letzten Endes. Er starrte ins Spülbecken, und die vom Geschirr aufsteigende Wärme umfächelte sanft sein Gesicht.
Tja, man muss einfach durchhalten. Durchhalten. Er beschloss, sein Duschbad vom Morgen auf den Abend zu verlegen. Das zeugte von Anpassungsvermögen – fand er –, von einer gewissen Geistesfrische. Während er duschte, ließ er das Wasser in der Wanne nicht abfließen und schwenkte dann, kreisförmig planschend, seine tagsüber getragenen Sachen mit den Füßen durch. Später wrang er alles aus und hängte es zum Trocknen auf Kleiderbügel. Dann schlüpfte er in die Unterwäsche für den nächsten Tag, damit er keine Schlafanzüge waschen musste. An eigentlicher Wäsche fiel einmal pro Woche nur ein Berg Handtücher und Bettlaken an – Handtücher bloß zwei, dafür umso mehr Laken. Er hatte nämlich ein System entwickelt, das ihm ermöglichte, allnächtlich in sauberen Laken zu schlafen, ohne das Bettzeug wechseln zu müssen. Dieses System hatte er Sarah jahrelang schmackhaft zu machen versucht, aber sie war ja so unflexibel. Er ging so vor, dass er von der Matratze jedwedes Linnen abzog und es durch eine riesige Hülle ersetzte, die aus einem der sieben Laken bestand, welche er gefaltet und mit der Nähmaschine zusammengesteppt hatte. Diese Erfindung nannte er im Geiste den Macon-Leary-Leibsack. Ein Leibsack erforderte kein Zurechtzupfen, verrutschte nicht, war leicht zu wechseln und vom Gewicht her ideal für Sommernächte. Im Winter würde er sich etwas Wärmeres zulegen müssen, aber noch konnte er nicht an den Winter denken. Schaffte er es zurzeit doch kaum von einem Tag zum anderen.
Gelegentlich – während er auf der malträtierten Wäsche in der Badewanne umherschlitterte oder sich auf der nackten, rostfleckigen Matratze in seinen Leibsack hineinwurstelte – war ihm durchaus klar, dass er übertreiben mochte. Warum, das wusste er freilich selbst nicht. Er hatte zwar seit jeher eine Vorliebe für Methode bekundet, doch war sie nie in Manie ausgeartet. Wenn er an Sarahs Schlendrian dachte, fragte er sich, ob auch dieser jetzt überhandgenommen hatte. Vielleicht hatten sie all die Jahre nur durch gegenseitiges Dazutun einen passablen Mittelweg eingehalten. Getrennt, sozusagen entmagnetisiert, mussten sie vom Kurs abweichen. Er malte sich im Geiste Sarahs neue Wohnung, die er nie gesehen hatte, so chaotisch aus wie ein Tollhaus: Turnschuhe in der Backröhre, das Sofa mit Porzellan überhäuft. Allein schon der Gedanke regte ihn auf. Anerkennend betrachtete er seine eigene Umgebung.
Er verrichtete den Großteil seiner Arbeit zu Hause; sonst hätten ihn Haushaltsabläufe wohl kaum so sehr beschäftigt. Er hatte sich in der Kammer hinter der Küche ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet. Auf einem Bürostuhl platziert, hämmerte er auf eine Schreibmaschine ein, die ihm schon während seiner vier College-Jahre gute Dienste geleistet hatte: Er verfasste Reiseführer – Ratgeber für Leute, die von Berufs wegen gezwungen waren, viel zu reisen. Absurd, im Grunde genommen – Macon konnte Reisen nicht ausstehen. Fremdes Terrain nahm er sozusagen mit dem Mut der Verzweiflung in Angriff – die Augen zusammengekniffen, den Atem angehalten, um Haaresbreite am Tod vorbei, wie er sich manchmal einbildete – und machte sich dann, wieder daheim, mit einem Seufzer der Erleichterung an die Produktion seiner kompakten Paperbacks im Reisepassformat. Tourist wider Willen in Frankreich. Tourist wider Willen in Deutschland. In Belgien. Kein Verfassername, lediglich ein Signet: ein geflügelter Lehnsessel auf dem Einband.
In diesen Reiseführern gab es nur Auskünfte über große Städte, denn Geschäftsreisende erreichten und verließen große Städte auf dem Luftweg und bekamen von der Landschaft überhaupt nichts zu sehen. Von den Städten übrigens auch nicht. Sie wollten sich vor allem in dem Glauben wiegen, sie wären niemals von zu Hause weg gewesen. Welche Hotels in Madrid hatten amerikanische Beautyrest-Matratzen zu bieten? Welche Restaurants in Tokio servierten amerikanische kalorienarme Sweet’n’Low-Limonade? Gab es in Amsterdam ein McDonald’s? Gab es in Mexico-Stadt Taco-Bell-Imbissstuben, wo man die amerikanische Version gefüllter Tortillas bekam? Waren in irgendeinem römischen Lokal Ravioli der amerikanischen Konservenfirma Chef Boyardee zu haben? Andere Reisende mochten sich erhoffen, typisch bodenständige Weine zu entdecken; Macons Leser aber forschten nach pasteurisierter und homogenisierter Milch.
Genauso, wie er das Reisen hasste, liebte er das Schreiben – das rechtschaffene Vergnügen, ein desorganisiertes Land zu organisieren, das Unwichtige und Zweitklassige wegzulassen und den Rest in übersichtliche, knappe Abschnitte zu gliedern. Er schrieb aus anderen Reiseführern ab, pickte aber nur wertvolle Körnchen heraus und verschmähte die Spreu. Er grübelte vergnügliche Stunden lang über Interpunktionsprobleme nach. Gerecht und unbarmherzig merzte er das Passivum aus. Die Anstrengung des Tippens zog ihm die Mundwinkel herab, sodass kein Mensch vermutet hätte, wie gut er sich dabei unterhielt. Ich freue mich, mitteilen zu können, tippte er, sein Gesicht blieb jedoch finster und bärbeißig. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass es in Stockholm neuerdings Kentucky Fried Chicken zu kaufen gibt. Desgleichen Pita-Brot, fügte er hinzu, weil es ihm gerade einfiel. Er wusste nicht, wie es geschehen war, aber in letzter Zeit hatte dieser Fladen sich allem Anschein nach zu etwas so Amerikanischem entwickelt wie Hotdogs.
»Natürlich kommst du zurecht«, sagte seine Schwester übers Telefon zu ihm. »Habe ich etwas anderes behauptet? Aber du hättest uns wenigstens verständigen können. Seit drei Wochen! Sarah ist seit drei Wochen weg, und ich erfahre es erst heute. Und auch noch rein zufällig. Hättest du uns jemals gesagt, dass sie dich verlassen hat, wenn ich nicht eben nach ihr gefragt hätte?«
»Sie hat mich nicht verlassen«, sagte Macon. »Das heißt, es war nicht so, wie du es hinstellst. Wir haben wie vernünftige Leute darüber gesprochen und beschlossen, uns zu trennen, das ist alles. Es hätte mir gerade noch gefehlt, dass meine Familie sich um mich schart und jammert: ›Ach, du armer Macon, wie konnte Sarah dir das nur antun –‹«
»Wie käme ich dazu?«, fragte Rose. »Alle wissen, dass man mit den Leary-Männern kein leichtes Leben hat.«
»Oh.«
»Wo ist sie?«
»Sie hat eine Wohnung in der Stadt«, sagte Macon. »Und übrigens«, setzte er hinzu, »brauchst du dich jetzt nicht gleich zu überschlagen und sie zum Dinner einzuladen oder so. Sie hat ihre eigene Verwandtschaft. Du solltest für mich Partei ergreifen.«
»Du hast doch immer gewollt, dass wir unparteiisch bleiben.«
»Schon, schon. Ich meine nur, du sollst nicht für sie Partei ergreifen, das wollte ich damit sagen.«
»Wir haben doch auch die Frau von Charles noch nach der Scheidung zum Weihnachtsdinner eingeladen, genau wie immer. Weißt du noch?«
»Sicher weiß ich das«, antwortete Macon erschöpft. Charles war der älteste Bruder.
»Ich glaube, sie käme auch jetzt noch, wenn sie nicht einen Mann geheiratet hätte, der so weit weg wohnt.«
»Was? Wenn ihr Mann ein Einheimischer wäre, hättest du sie dann womöglich beide eingeladen?«
»Wenn sie und Porters Frau und Sarah in der Küche zusammensaßen – das war, bevor Porters Frau sich von ihm scheiden ließ –, da hat das Gerede über die Leary-Männer kein Ende genommen! In einem fort: die Leary-Männer dies, die Leary-Männer das, in allem so pingelig, immer müssen sie gründlich vorausplanen, ständig auf der Welt herumhacken, als glaubten sie wirklich, sie könnten sie zur Räson bringen. Die Leary-Männer! Ich höre es jetzt noch. Es war zum Lachen: Einmal, am Erntedanktag, wollten June und Porter gerade gehen – damals waren ihre Kinder noch klein –, und June, das Baby auf dem Arm, Danny im Schlepptau und beladen mit einem Haufen Spielsachen und Zeugs, strebt schon zur Tür, da ruft Porter ›Halt!‹ und beginnt, von einem dieser Kassenzettelstreifen, auf die er immer seine Listen schreibt, abzulesen: Decken, Flaschen, Fläschchen aus dem Kühlschrank, Windelsack … June hat die beiden anderen nur angesehen und die Augen verdreht.«
»Gar keine so schlechte Idee«, fand Macon, »wenn man June kennt.«
»Eben, und alphabetisch angeordnet war es auch«, sagte Rose. »Ich finde allerdings auch, dass alphabetische Anordnung die Übersicht erleichtert.«
Rose’ Küche war so total durchalphabetisiert, dass das Allgewürz neben dem Ameisenvernichtungsmittel stand. Sie hatte es gerade nötig, über die Leary-Männer herzuziehen!
»Wie auch immer«, sagte sie. »Hat Sarah sich gemeldet, seit sie weg ist?«
»Sie hat ein paarmal vorbeigeschaut. Eigentlich nur einmal«, erwiderte Macon. »Um Sachen zu holen, die sie braucht.«
»Was für Sachen?«
»Also – einen Doppelkocher. Solche Sachen.«
»Dann war es ein Vorwand«, sagte Rose prompt. »Einen Doppelkocher bekommt sie in jedem Kaufhaus.«
»Sie hängt angeblich an unserem.«
»Sie wollte nur herauskriegen, wie du zurechtkommst. Sie mag dich noch immer. Habt ihr überhaupt miteinander geredet?«
»Nein«, sagte Macon. »Ich habe ihr bloß den Doppelkocher gegeben. Und das Ding, mit dem man Flaschendeckel aufschraubt.«
»Ach Macon. Du hättest sie hereinbitten sollen.«
»Ich wollte keine Abfuhr riskieren.«
Schweigen.
»Nun ja. Immerhin«, sagte Rose schließlich.
»Aber ich komme zurecht!«
»Ja, natürlich«, stimmte sie zu.
Dann erklärte sie, sie habe etwas in der Backröhre, und legte auf.
Macon ging und stellte sich vors Fenster seines Arbeitszimmers. Es war ein heißer Tag Anfang Juli mit einem Himmel so blau, dass ihm die Augen schmerzten. Er lehnte die Stirn an die Scheibe und starrte in den Garten hinaus, die Hände tief in den Gesäßtaschen seiner Kakihose vergraben. Hoch oben in einer der Eichen sang ein Vogel etwas Ähnliches wie die ersten drei Töne von My little Gypsy Sweetheart, »mein kleines Zigeunerherz« – »Schlumm … re … sanft …«, sang der kleine Vogel. Macon fragte sich, ob auch dieser Moment eines Tages zu seinen wehmütigen Erinnerungen gehören würde. Er hielt es für unwahrscheinlich; soweit er sich entsann, hatte es in seinem ganzen Leben noch nie ein so düsteres Tief gegeben; es war ihm aber nicht entgangen, dass die Zeit es irgendwie fertigbrachte, allem Farbe zu verleihen. Dieser Vogel da zum Beispiel hatte eine so reine, süße, durchdringende Stimme …
Er wandte sich vom Fenster ab, deckte die Schreibmaschine zu und verließ das Zimmer.
Er aß nichts Ordentliches mehr. Wenn er Hunger hatte, trank er ein Glas Milch oder löffelte ein bisschen Eiscreme direkt aus der Packung. Nach dem kleinsten Imbiss fühlte er sich voll und schwer, aber morgens beim Ankleiden merkte er, dass er offenbar dünner wurde. Der Hemdkragen stand ihm vom Hals ab. Die vertikale Kerbe zwischen Nase und Oberlippe hatte sich so vertieft, dass er sie nur mühsam ausrasieren konnte. Sein Haar, früher immer von Sarah gestutzt, ragte über der Stirn vor wie ein Sims. Und seine unteren Augenlider waren unerklärlicherweise erschlafft. Früher hatte er schmale Schlitzaugen gehabt; jetzt waren sie wie vor Schreck geweitet. Sollte das auf Unterernährung hindeuten?
Frühstück: Frühstück war doch die wichtigste Mahlzeit. Er schloss die Kaffeemaschine und die elektrische Bratpfanne an den Radiowecker auf dem Fensterbrett seines Schlafzimmers an. Natürlich beschwor er eine Lebensmittelvergiftung herauf, wenn er zwei rohe, aufgeschlagene Eier bei Zimmertemperatur die ganze Nacht warten ließ, doch sobald er den Speisezettel geändert hatte, war das Problem gelöst. In diesen Dingen musste man flexibel sein. Nun weckte ihn der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und heißem Popcorn mit Butter, und er konnte sich an beidem gütlich tun, ohne das Bett verlassen zu müssen. Oh, er kam bestens zurande, bestens. Den Umständen entsprechend.
Aber seine Nächte waren fürchterlich.
Er litt nicht etwa an Einschlafschwierigkeiten. Die überwand er leicht. Er saß so lange vor dem Fernsehgerät, bis ihm die Augen brannten; dann ging er ins Obergeschoss. Er drehte die Dusche auf und breitete sein Anziehzeug in der Wanne aus. Gelegentlich erwog er, diesen Teil zu überspringen, aber dadurch wäre das System ins Wanken geraten. Deshalb hielt er sich streng an die Reihenfolge: Wäsche aufhängen, Frühstückssachen bereitstellen, die Zähne mit Zahnseide säubern. Über Letzteres hatte Sarah sich aus unerfindlichem Grund immer aufgeregt. Wenn Macon zum Tode verurteilt wäre, hatte sie einmal gesagt, und im Morgengrauen vors Erschießungspeloton treten müsste, würde er abends zuvor noch unbedingt sein Zahnseidenritual absolvieren. Macon hatte das nach einigem Überlegen bestätigt. Ja, natürlich. Hatte er nicht auch während seiner Lungenentzündung daran festgehalten? Im Krankenhaus mit Gallensteinen? Nachts in einem Motel nach der Ermordung seines Sohnes? Prüfend betrachtete er seine Zähne im Spiegel. Sie waren nie ganz weiß, trotz all der Pflege. Und jetzt schien auch seine Haut eine gelbliche Färbung anzunehmen.
Er knipste die Lampe aus, schob die Katze beiseite, half dem Hund aufs Bett. Der Hund war ein Welsh Corgie, sehr kurzbeinig, aber er schlief gar zu gern im Bett, und so stellte er sich allabendlich auf die Hinterbeine, die Vorderpfoten auf die Matratze gestützt, und sah Macon erwartungsvoll an, bis Macon ihn von hinten hochschubste. Dann machten es sich alle drei bequem. Macon schlüpfte in seine Hülle, die Katze schmiegte sich in die warme Höhlung unter seinem Arm, der Hund plumpste zu seinen Füßen nieder. Dann schloss Macon die Augen und döste ein.
Nach einiger Zeit merkte er jedoch, dass er sich seiner Träume bewusst war, denen er sich keineswegs wohlig hingab, nein, die er, an Einzelheiten tüftelnd, langwierig konstruierte. Dämmerte ihm, dass er wach war, dann öffnete er die Augen und warf einen schnellen Blick auf den Radiowecker. Erst ein Uhr. Höchstens zwei. Noch so viele Stunden zu überdauern.
Kleine Sorgen huschten ihm durch den Kopf. Hatte er nicht vergessen, die Hintertür abzuschließen? Die Milch einzuräumen? Hatte er auf dem Scheck nicht sein Bankguthaben eingesetzt statt der Summe der Gasrechnung? Siedend heiß fiel ihm ein, dass er eine angebrochene Dose V-8-Saft in den Kühlschrank gestellt hatte. Oxidation der Metallfalze! Endergebnis Bleivergiftung!
Die Sorgen wechselten, wogen schwerer. Er fragte sich, woran seine Ehe gescheitert war. Sarah war seine erste und einzige Freundin gewesen; jetzt war er der Ansicht, er hätte sich vorher an einer anderen Frau erproben sollen. Während der zwanzig Ehejahre hatte es Momente gegeben – sogar Monate –, da er gar nicht den Eindruck hatte, dass er und Sarah wirklich eine Einheit bildeten, wie es Ehepaaren ansteht. Nein, sie waren zwei Einzelpersonen geblieben, zwischen denen mitunter nicht einmal Freundschaft herrschte. Manchmal hatten sie sich wie Rivalen gebärdet, hatten einander mit unlauteren Mitteln auszustechen versucht im Konkurrenzkampf um den Status der besseren Art Mensch. War es Sarah, impulsiv und sprunghaft? Oder aber Macon, methodisch und unerschütterlich?
Nach Ethans Geburt war die Verschiedenheit seiner Eltern noch krasser zutage getreten. Dinge, die jeder am anderen zu übersehen gelernt hatte, machten sich wieder bemerkbar. Sarah versorgte ihren Sohn nie nach irgendeinem Stundenplan, war nachlässig und unbekümmert. Und Macon (oh, er wusste es, er gab es ja zu) war so darauf erpicht, ihn auf jede Eventualität vorzubereiten, dass ihm gar keine Zeit blieb, sich an dem Jungen zu erfreuen. Ethan mit zwei, mit vier Jahren erschien vor seinem geistigen Auge so deutlich wie ein Farbfilm, auf die Schlafzimmerdecke projiziert. Ein fröhlich glucksendes, sonniges Bübchen, damals, von der vorgebeugten Silhouette eines händeringenden Macon überragt. Macon hatte dem Sechsjährigen unerbittlich beigebracht, wie man einen Baseballschläger schwingt; es hätte ihm in der Seele wehgetan, wenn Ethan für das Schulteam erst als Letzter infrage gekommen wäre. »Wieso?«, hatte Sarah gesagt. »Und wenn schon! So kommt er eben als Letzter dran. Nun lass es schon gut sein!« Lass es gut sein! Im Leben gab es so vieles, an dem sich nichts ändern ließ, da musste man doch so gut vorsorgen, wie man konnte. Sie hatte nur gelacht, als Macon einen ganzen Herbst hindurch Wacky Packs sammelte, Kaugummipäckchen mit witzigen Aufklebern, die Ethan gern an seine Schlafzimmertür pappte. Er sollte mehr davon haben als irgendjemand sonst in der dritten Klasse, hatte Macon sich gelobt. Auch als Ethan längst das Interesse daran verloren hatte, kam Macon verbissen damit zu Hause an. Er fand es selbst absurd, aber da war doch noch der eine letzte Aufkleber, dessen sie noch nicht habhaft geworden waren …
Ethan fuhr ins Ferienlager, als er zwölf war – vor fast genau einem Jahr. Die meisten Jungen durften das schon früher, aber Macon hatte es immer wieder hinausgezögert. Wozu schafft man sich überhaupt ein Kind an, hatte er Sarah gefragt, wenn man es bloß an irgendeinen gottverlassenen Ort in Virginia verfrachten will? Als er endlich nachgab, war Ethan schon in der obersten Altersklasse – ein lang aufgeschossener, blonder Bengel mit einem offenen, freundlichen Gesicht und der liebenswerten Angewohnheit, auf den Fußballen zu wippen, wenn er nervös war.
Nicht daran denken.
Am zweiten Abend seiner Ferien wurde er in einer Burger-Bonanza-Imbissstube ermordet. Es war ein sinnloser, unbegreiflicher Mord – einer jener Fälle, in denen der Bandit das Geld schon eingesteckt hat und ungehindert gehen konnte, sich stattdessen aber entschließt, zuerst jeden einzelnen Anwesenden durch einen Genickschuss zu töten.
Ethan hätte gar nicht dort sein dürfen. Er war heimlich aus dem Lager ausgerissen, gemeinsam mit einem Kumpel aus seiner Blockhütte, der vor dem Lokal aufpasste.
Schuld war die Lagerverwaltung wegen mangelnder Aufsicht. Schuld war Burger Bonanza wegen unzureichender Sicherheitsvorkehrungen. Schuld war der andere Junge, weil er nicht mit hineingegangen war und am Geschehen – womöglich – noch etwas geändert hatte. (Worauf hatte er denn aufgepasst, um Himmels willen?) Schuld war Sarah, weil sie Ethan von zu Hause weggelassen hatte; schuld war Macon, weil er damit einverstanden gewesen war; schuld war (jawohl, auch) Ethan. Schuld war Ethan, weil er in dieses Lager gewollt hatte, weil er von dort ausgerissen war und weil er stur wie ein Bock das Lokal betreten hatte, während der Überfall stattfand. Schuld war er, weil er mit den anderen so folgsam in die Küche ging, die Hände flach an die Wand legte, wie ihm befohlen wurde, und zweifellos leicht auf den Fußballen wippte …
Nicht daran denken.
Der Direktor des Ferienlagers, der sich scheute, die Eltern telefonisch zu benachrichtigen, war nach Baltimore gekommen, um es ihnen persönlich mitzuteilen. Dann hatte er sie in seinem Wagen nach Virginia mitgenommen. Macon entsann sich dieses Direktors noch oft. Jim hatte er geheißen, Jim Robinson oder vielleicht Robertson – ein stämmiger Mann mit weißem Schnurrbart und Bürstenhaarschnitt, der über seinem T-Shirt gleichsam anstandshalber ein Anzugjackett trug. Schweigen schien ihm Unbehagen zu bereiten, und er tat sein Bestes, es mit unzusammenhängenden Belanglosigkeiten aufzufüllen. Macon hatte nicht zugehört oder hatte es sich zumindest eingebildet, doch jetzt fiel ihm alles wieder ein. Dass Jims Mutter ebenfalls aus Baltimore stammte. Dass Jims Tomatenstauden sich höchst kurios benommen hatten, weil sie nur winzige grüne Kügelchen hervorgebracht hatten, die abfielen, bevor sie heranreifen konnten. Dass Jims Frau sich vor dem Fahren im Rückwärtsgang ängstigte und jede Situation vermied, die das erforderte. Macon dachte jetzt oft darüber nach, nachts im Bett. Konnte man wirklich einen Wagen fahren, ohne den Rückwärtsgang zu benutzen? Was tat man an einer Kreuzung, wenn ein Busfahrer den Kopf zu seinem Seitenfenster herausstreckte und einen aufforderte, ein Stück zurückzusetzen, damit er mit dem Bus vorbeikonnte? Hätte sie sich geweigert? Macon stellte sich die Frau vor, wie sie, bieder und trotzig, geradeaus starrte und unbeteiligt tat. Er hörte den Busfahrer in Gefluche ausbrechen, ein Hupkonzert, andere Fahrer schreien: »Na, Lady!« Eine nette Szene. Er prägte sie seinem Gedächtnis ein.
Schließlich setzte er sich dann auf und schälte sich aus seinem Laken. Der Hund rappelte sich seufzend hoch, hopste vom Bett und folgte ihm trappelnd treppab. Die Dielenbretter unter Macons Sohlen waren kühl, das Küchenlinoleum noch kühler; vom Eisschrank ging ein Leuchten aus, während er sich ein Glas Milch eingoss. Er ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Um diese Zeit lief für gewöhnlich ein Schwarz-Weiß-Film – Männer in komplettem Anzug, Filzhut auf dem Kopf, Frauen mit wattierten Schultern. Er bemühte sich erst gar nicht, der Handlung zu folgen. Er trank die Milch in kleinen, gleichmäßigen Schlucken und spürte, wie das Kalzium sich auf seine Knochen verteilte. Hatte er nicht gelesen, dass Kalzium Schlaflosigkeit kurierte? Geistesabwesend streichelte er die Katze, die sich irgendwie auf seinem Schoß eingefunden hatte. Es war viel zu heiß dafür, eine Katze auf dem Schoß zu haben, besonders dieses Exemplar hier – eine phlegmatische, grau gesprenkelte Katzendame, die aus einer ungewöhnlich dichten Substanz zu bestehen schien. Und der Hund lag meist quer über Macons Füßen. »Jetzt sind wir ganz unter uns, alte Kameraden«, sagte er dann wohl. Die Katze verursachte auf seinen nackten Schenkeln ein Komma aus Schweiß.
Endlich wand er sich dann unter den Tieren hervor und schaltete das Fernsehgerät aus. Das benützte Glas versenkte er in der Chlorlösung im Spülbecken. Er stieg die Treppe hinauf. Stellte sich ans Schlafzimmerfenster und betrachtete die Nachbarschaft – schwarze Äste, auf den violetten Nachthimmel gestrichelt, da und dort das Schimmern der weißen Bretterverschalung eines Hauses, gelegentlich ein Licht. Da konnte noch jemand nicht schlafen, nahm er an. Andere Möglichkeiten zog er ungern in Betracht – etwa eine Party oder ein vertrauliches Gespräch unter Freunden. Er wollte lieber glauben, dass da noch jemand auf sich allein gestellt war, hellwach dasaß und sich seiner Gedanken zu erwehren suchte. Dadurch fühlte er sich gleich viel wohler. Er kehrte zu seinem Bett zurück. Er legte sich nieder. Er schloss die Augen und schlief, ganz ohne Nachhilfe, sofort ein.
3
Sarah rief Macon an und fragte, ob sie kommen und den marineblauen Teppich aus dem Esszimmer holen könnte.
»Den marineblauen Teppich«, wiederholte Macon. (Er musste Zeit gewinnen.)
»Ich hätte ja gar nicht davon angefangen, aber du hast ihn nie gemocht«, machte Sarah geltend. »Du hast gesagt, wo man isst, soll kein Teppich liegen.«
Ja, das hatte er gesagt. Ein Krümelfänger, hatte er gesagt. Unhygienisch. Warum überfiel ihn dann dieses jähe, brennende Verlangen, den Teppich zu behalten?
»Macon, bist du noch da?«
»Ja, ich bin noch da.«
»Hast du also etwas dagegen, wenn ich ihn mir hole?«
»Nein, warum denn?«
»Gut! Die Böden in meiner Wohnung sind so kahl, und du kannst dir nicht vorstellen, wie –«
Wenn sie den Teppich holen kam, würde er sie hereinbitten. Ihr ein Glas Sherry anbieten. Saßen sie dann mit dem Sherry zu zweit auf der Couch, würde er sagen:
»Sarah, habe ich dir gefehlt?« Halt, nein, er würde sagen: »Du hast mir gefehlt, Sarah.«
Darauf würde sie sagen …
Sie sagte: »Ich könnte am Samstagvormittag bei dir vorbeischauen, wenn es dir passt.«
Am Vormittag trinkt man aber keinen Sherry …
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!