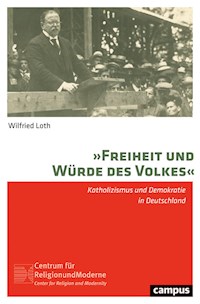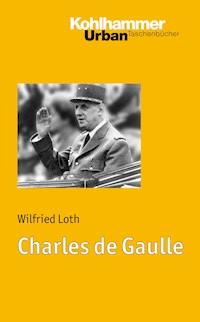Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wurden die Deutschen zu Europäern? Wilfried Loth zeichnet in einer Langzeitstudie die Entwicklung des europapolitischen Denkens der Deutschen in den weltpolitischen und gesellschaftlichen Umbrüchen nach – vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis zum Bruch der »Ampel«-Koalition. Dabei werden Kontinuitäten deutlich, aber auch Brüche und Lernprozesse. Wichtige Europapolitiker, die in der Bundesrepublik Deutschland dazu beigetragen haben, werden auf ihre Konzeptionen und Leistungen hin befragt: Konrad Adenauer und Walter Hallstein, Willy Brandt und Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble und Angela Merkel. Eine erste Bilanz der Europapolitik der »Ampel«-Koalition führt abschließend zur Skizzierung der Herausforderungen, vor denen die deutsche Europapolitik im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts steht. Insgesamt macht Loth, einer der besten Kenner der Geschichte der europäischen Einigung, deutlich, wie wichtig das Europa-Projekt für das Gelingen der deutschen Demokratie und für die Sicherung des Friedens in Europa war. Gleichzeitig wird dem Leser bewusst, wie groß die Verantwortung ist, die Deutschland als großes Land mitten in Europa für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Europäischen Union trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried Loth
Mitten in Europa
Die Deutschen und die europäische Einigung
Campus VerlagFrankfurt / New York
Über das Buch
Wie wurden die Deutschen zu Europäern? Wilfried Loth zeichnet in einer Langzeitstudie die Entwicklung des europapolitischen Denkens der Deutschen in den weltpolitischen und gesellschaftlichen Umbrüchen nach – vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis zum Bruch der »Ampel«-Koalition. Dabei werden Kontinuitäten deutlich, aber auch Brüche und Lernprozesse. Wichtige Europapolitiker, die in der Bundesrepublik Deutschland dazu beigetragen haben, werden auf ihre Konzeptionen und Leistungen hin befragt: Konrad Adenauer und Walter Hallstein, Willy Brandt und Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble und Angela Merkel. Eine erste Bilanz der Europapolitik der »Ampel«-Koalition führt abschließend zur Skizzierung der Herausforderungen, vor denen die deutsche Europapolitik im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts steht. Insgesamt macht Loth, einer der besten Kenner der Geschichte der europäischen Einigung, deutlich, wie wichtig das Europa-Projekt für das Gelingen der deutschen Demokratie und für die Sicherung des Friedens in Europa war. Gleichzeitig wird dem Leser bewusst, wie groß die Verantwortung ist, die Deutschland als großes Land mitten in Europa für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Europäischen Union trägt.
Vita
Wilfried Loth ist emeritierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeiten zur Geschichte des Kalten Krieges (»Die Rettung der Welt. Entspannungspolitik im Kalten Krieg 1950-1991«, 2016; »Frieden schaffen. Die Alliierten und die Neuordnung Europas (1940–1945)«, 2023) und der europäischen Einigung (»Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte«, 32025) wurden mehrfach ausgezeichnet.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einleitung
1.
Die Deutschen und das Projekt der europäischen Einigung
Vom Kaiserreich zum Widerstand
Demokratischer Neuanfang
Entscheidung für die Westintegration
Rettungsanker EWG
Charles de Gaulle und Willy Brandt
Pragmatische Selbstbehauptung
Binnenmarkt und Währungsunion
Konsens im vereinten Deutschland
Neue Herausforderungen
2.
Die Europa-Idee im deutschen Widerstand
Der konservative Widerstand
Die sozialistische Linke
Der Kreisauer Kreis
Andere Stimmen
Konvergenzen und Rückschläge
3.
Deutsche Europa-Konzeptionen in der Eskalation des Ost-West-Konflikts 1945-1949
Die Vision der »Dritten Kraft«
Westeuropa-Pläne
Provisorische Entscheidungen
Option für den Westen
4.
Von Heidelberg nach Godesberg: Europa-Konzepte der deutschen Sozialdemokratie zwischen Utopie und Politik
In der Weimarer Republik
Widerstand und Exil
Zwischen »Dritter Kraft« und Westintegration
Opposition gegen Adenauer
Für die Römischen Verträge
Bilanz
5.
Konrad Adenauer und die europäische Einigung
Europa im Westen
Partner der Westintegration
Vater der Römischen Verträge
Für ein politisches Europa
Begrenzter Erfolg
6.
Walter Hallstein, der Gründungspräsident
Weltoffener Jurist
Mit Adenauer für Europa
Die Bildung der Kommission
Die Schaffung des Gemeinsamen Marktes
Die Krise des »leeren Stuhls«
De Gaulle gegen Hallstein
Programm aus Erfahrung
7.
Das Europa der Verbände: Die Europa-Union im europäischen Integrationsprozess 1949-1969
Kraftvoller Aufbruch
Im Zeichen der Westintegration
Friedlaender und Oppenheim
Für den Ausbau der EWG
Kampf gegen de Gaulle
8.
Deutsche Europa-Konzeptionen in der Gründungsphase der EWG
Abklingende Europa-Begeisterung
Opposition gegen die Wirtschaftsgemeinschaft
Resignierte Zustimmung
9.
Abschied vom Nationalstaat? Willy Brandt und die europäische Einigung
Frühe Einsichten
Die Option für die Westintegration
Die Große Koalition
Brandt und Pompidou
Ergebnisse
10.
Deutsche Europapolitik von Helmut Schmidt bis Helmut Kohl
EWS und Sicherheitsgemeinschaft
Institutionelle Enthaltsamkeit
Vom Status quo zur Rélance
11.
Helmut Kohl und die Währungsunion
Das Projekt der Währungsunion
Die Entscheidung für die Währungsunion
Die Politische Union
Die Gestaltung der Währungsunion
Bilanz
12.
Das Institut für Europäische Politik im europäischen Integrationsprozess
EWG und Ostpolitik
Wege aus der Krise
Im vereinten Deutschland
Differenzierte Integration
13.
Wolfgang Schäuble und die europäische Einigung
Das Schäuble-Lamers-Papier
Die Euro-Krise
Die Griechenland-Krise
Für eine europäische Verteidigungsunion
14.
Die Europapolitik der »Ampel« und die Herausforderungen der Zukunft
Zwei Paukenschläge
Unterstützung für die Ukraine
Kein großes Design
Herausforderung durch Trump
Quellen und Literatur
Archive
Periodika
Programmschriften, Memoiren, Editionen
Darstellungen
Nachweis der Erstveröffentlichungen
1.
Die Deutschen und das Projekt der Europäischen Einigung
2.
Die Europa-Idee im deutschen Widerstand
3.
Deutsche Europa-Konzeptionen in der Eskalation des Ost-West-Konflikts 1945-1949
4.
Von Heidelberg nach Godesberg: Europa-Konzepte der deutschen Sozialdemokratie zwischen Utopie und Politik
5.
Konrad Adenauer und die europäische Einigung
6.
Walter Hallstein, der Gründungspräsident
7.
Das Europa der Verbände. Die Europa-Union im europäischen Integrationsprozess 1949-1969
8.
Deutsche Europa-Konzeptionen in der Gründungsphase der EWG
9.
Abschied vom Nationalstaat? Willy Brandt und die europäische Einigung
10.
Deutsche Europapolitik von Helmut Schmidt bis Helmut Kohl
11.
Helmut Kohl und die Währungsunion
12.
Das Institut für Europäische Politik im europäischen Integrationsprozess
13.
Wolfgang Schäuble und die europäische Einigung
14.
Die Europapolitik der »Ampel« und die Herausforderungen der Zukunft
Personenregister
Einleitung
Dass die Bundesrepublik Deutschland zu Europa gehört und in der Europäischen Union eine wichtige Rolle spielen soll, gehört zum Grundkonsens der demokratischen Parteien in Deutschland. Weniger Übereinstimmung herrscht allerdings in der Frage, ob und wie die Europäische Union ausgebaut werden soll. Was ist vordringlich? Und wie soll man vorgehen? Hier gehen die Auffassungen auseinander – weniger zwischen den Parteien als innerparteilich und in der veröffentlichten Meinung. Das erneute Auftreten von Donald Trump mit einem disruptiven Programm, das die Gewissheiten des westlichen Bündnisses in Frage stellt, hat vielfach den Ruf nach einem stärkeren Europa aufkommen lassen, stärker und effektiver in seiner militärischen Verteidigung, in der Behauptung seiner Wettbewerbsfähigkeit, in der Festigung der demokratischen Werte. Die nationalistische Rechte in der AfD hält es unterdessen für angebracht, den Austritt Deutschlands aus der EU in ihr Wahlprogramm zu schreiben. Und das bei der Bundestagswahl von 2025 sehr knapp gescheiterte (aber weiterhin aktive) Bündnis Sahra Wagenknecht agiert, als ob es die EU überhaupt nicht geben würde.
In dieser Situation kann ein Rückblick auf die Haltung der Deutschen zum Projekt der europäischen Einigung zur Orientierung beitragen. Was waren die Motive, die Deutsche bewogen haben, an diesem Projekt mitzuwirken? Welche Rolle haben sie bei der Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union bis zur heutigen EU mit 27 Mitgliedsstaaten gespielt? Und vor welchen Herausforderungen stehen die deutschen Demokraten jetzt, angesichts der dreifachen Herausforderung durch den russischen Imperialismus, die disruptiven Attacken des amerikanischen Präsidenten und die europafeindlichen Populisten in den europäischen Ländern? Die Studien in diesem Band wollen diese Fragen beantworten.
Der Band beginnt mit einer Langzeitstudie, die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Verhältnis der Deutschen zum Projekt der europäischen Einigung vom späten Kaiserreich bis zur Gegenwart aufzeigt. Durchgehend, soviel wird dabei deutlich, waren deutsche Europakonzeptionen vom Streben nach größeren Wirtschaftsräumen geprägt, die den Wohlstand sichern sollten, und ebenso von dem Bemühen um eine dauerhafte Sicherung des Friedens. Aufgrund der geographischen Lage Deutschlands in der Mitte Europas und der wirtschaftlichen Stärke der deutschen Industrienation hatten die Deutschen dabei auch immer eine besondere Verantwortung zu tragen. Die Diskontinuitäten ergaben sich aus den großen weltpolitischen Umbrüchen. Sie wurden aber auch durch individuelle und kollektive Lernprozesse geprägt, ganz besonders durch die demokratische Neuorientierung nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches.
Der Überblick über den Weg vom Kaiserreich (1871) bis zum Bruch der »Ampel«-Koalition (2024) wird zunächst durch Studien zu zwei besonders markanten Abschnitten der deutschen Europa-Diskussion vertieft. Ein Beitrag zu den Europaplänen des deutschen Widerstands im Zweiten Weltkrieg zeigt, wie das Europa-Projekt mit der Sicherung der Demokratie und der Lösung der »deutschen Frage« verbunden wurde. Daran schließt sich ein Kapitel zur Europa-Diskussion der Nachkriegszeit an, in der die Einsichten des Widerstands auf die Realität des Kalten Krieges stießen. Parallel dazu behandelt ein weiteres Kapitel die Entwicklung der Europa-Diskussion in der SPD »von Heidelberg bis Godesberg«: Hier ist zu erklären, wie eine Pionierrolle in der Propagierung der Europa-Idee zu einer Opposition gegen die ersten europäischen Institutionen (EGKS und EVG) führen konnte.
Auf die Nachzeichnung der Europa-Diskussionen vom Kaiserreich bis zu den ersten Jahren der Bundesrepublik folgen Studien zu den frühen Architekten der bundesdeutschen Europapolitik. In erster Linie ist hier natürlich Konrad Adenauer zu nennen. Wichtig (und im zeitgenössischen wie im heutigen Bewusstsein wenig verankert) ist aber auch die Rolle von Walter Hallstein, dem ersten Präsidenten der Europäischen Kommission. Weiter wird die Rolle der pro-europäischen Verbände und hier insbesondere der Europa-Union gewürdigt. Schließlich zeigt ein Beitrag zur deutschen Europa-Diskussion in der Gründungsphase von EWG und EURATOM den unterdessen erreichten europapolitischen Konsens der Bundesrepublik auf.
Der Teil über die »zweite Generation« deutscher Europapolitik beginnt mit einer Studie zu Willy Brandt, dessen europapolitische Rolle zu Unrecht im Schatten seiner Verdienste um die Ost- und Entspannungspolitik steht. Es folgen eine Skizze zur Europapolitik von Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Sie wird vertieft mit einer Spezialstudie zur Rolle von Helmut Kohl bei der Entstehung der Europäischen Währungsunion, die den Zusammenhang von europäischer Einigung und deutscher Wiedervereinigung differenziert analysiert. Eine Studie zur Arbeit des Instituts für Europäische Politik beleuchtet die dazu parallel verlaufende Diskussion in der Wissenschaft und in der interessierten Öffentlichkeit; sie führt damit auch die Studie zur Rolle der Europa-Union in der Gründungsphase der Europäischen Gemeinschaften fort.
Der fünfte, stärker gegenwartsbezogene Teil des Buches beleuchtet zunächst die Rolle von Wolfgang Schäuble in der Ära von Angela Merkel. Es wird erstmals deutlich, dass Schäuble und Merkel ein europapolitisches Führungsduo bildeten, in dem Schäuble fortwährend Initiativen ergriff, während Merkel eher auf Konsens bedacht war – innerparteilich, innenpolitisch und auf europäischer Ebene – und daher manche Initiativen abbremste. Es folgen eine erste Analyse der Europapolitik der »Ampel«-Koalition. Sie war, wie hier deutlich wird, durch eine eigentümliche Mischung von richtigen Grundsatzentscheidungen und Halbheiten in der Operationalisierung gekennzeichnet. Daraus ergeben sich Schlussfolgerungen zu den Herausforderungen, vor denen die deutsche Europapolitik nach dem Ende der »Ampel«-Koalition steht.
Die einzelnen Studien fügen sich damit zu einem Gesamtbild, das sowohl die unterdessen erreichte Verankerung des Europa-Projekts in der deutschen Politik wie in der Gesellschaft aufzeigt als auch die Verantwortung für Europa herausstellt, die Deutschland notwendigerweise übernommen hat. Ob die Deutschen dieser Verantwortung gerecht werden, darüber kann und muss politisch diskutiert werden. Wichtig ist aber, dass sie sich diese Verantwortung bewusst machen. Dazu kann dieses Buch beitragen.
Die einzelnen Beiträge dieses Bandes sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Sie wurden aber für diese Veröffentlichung durchgehend aktualisiert und aufeinander abgestimmt. Einzelne Wiederholungen ließen sich dabei nicht vermeiden; sie ermöglichen es, die einzelnen Beiträge auch unabhängig voneinander zu lesen. Gleichzeitig ergibt sich aus den unterschiedlichen Blickrichtungen, Schwerpunktsetzungen und exemplarischen Verdichtungen eine differenzierte Sicht auf den deutschen Weg nach Europa, die seine Dynamik deutlicher hervortreten lässt, als es historische Abrisse in politikwissenschaftlichen Studien zur deutschen Europapolitik zu leisten vermögen.
Mein Dank gilt einmal mehr meinem Lektor Jürgen Hotz. Er hat mich ermutigt, auch diese Veröffentlichung in Angriff zu nehmen, und er hat ihr Entstehen wie immer mit gutem Rat und großer Sorgfalt unterstützt.
1.Die Deutschen und das Projekt der europäischen Einigung
Vom Kaiserreich zum Widerstand
Die deutschen Bemühungen um eine Einigung Europas wurden auf weite Strecken von den gleichen Impulsen getragen, die auch bei den übrigen Europäern zur Geltung kamen. Da gab es zunächst, in Deutschland schon seit dem ausgehenden Kaiserreich, das Streben nach Schaffung größerer Wirtschaftsräume, hervorgerufen durch die Fortschritte in der Entwicklung der Produktivkräfte, die die nationalstaatlichen Grenzen allmählich als zu eng für eine rationale Organisation der Produktion erscheinen ließen. Daneben entwickelten sich, besonders seit der Erfahrung des Ersten Weltkrieges mit seiner bislang ungekannten Vernichtungskapazität, Bemühungen um die Schaffung effektiver Friedenssicherungs-Institutionen, die den Nationalstaaten die Verfügung über die militärische Gewalt entzogen. Schließlich gewann auch die Vorstellung an Raum, ein Zusammenschluss der Europäer könne Schutz vor Gefahren von außen bieten: vor der Sowjetunion, deren weltrevolutionärer Anspruch viele Vertreter des vorbürgerlichen wie des bürgerlichen Deutschlands in Schrecken versetzte, und vor den USA, deren spektakulärer ökonomischer Aufstieg die Produzenten in den kleinräumigen europäischen Märkten das Fürchten lehrte.
Zusammen genommen führten diese Impulse schon in der Weimarer Republik zur Konstituierung einer breitgefächerten Einigungsbewegung. Parlamentarier und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beteiligten sich an den Aktivitäten der Paneuropa-Union des österreichischen Grafen Richard Coudenhove-Kalergi, der für eine Erneuerung des alten Kontinents durch einen schrittweisen Zusammenschluss aller Staaten »von Polen bis Portugal« warb.1 Ein Verband für europäische Verständigung, 1926 unter dem Vorsitz des DDP-Abgeordneten Wilhelm Heile gegründet, engagierte sich in der Tradition des liberalen Pazifismus für eine Stärkung der Kompetenzen des Völkerbunds. Er fand vorwiegend bei der DDP und bei der SPD Unterstützung; es gab aber auch Verbindungen zum Zentrum und zur DVP. Die SPD schrieb das Eintreten für die »Vereinigten Staaten von Europa« 1925 in ihr Heidelberger Parteiprogramm. Wirtschaftsführer und Ökonomen, die sich gegen die Vermehrung der Zollgrenzen nach dem Weltkrieg wandten und für eine Rückkehr zum Freihandel plädierten, sammelten sich in einer deutschen Sektion des International Committee for a European Union. Alfred Weber analysierte Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa«; Edgar Stern-Rubarth plädierte für eine europäische Zollunion.
Was die deutsche Europa-Bewegung von anderen Ländern unterschied, war zum einen eine sehr spezifische Gewichtung der Motive. Das pazifistische Grundmotiv hatte hier nicht eine solche Breitenwirkung wie in Frankreich, wo die Schrecken des Stellungskrieges auf französischem Boden die Idee der Friedenssicherung durch einen mächtigen Völkerbund populär gemacht hatten. Den Deutschen, die den Krieg meist nur aus den Berichten der »im Felde unbesiegten« Frontkämpfer kannten, erschien der Völkerbund viel eher als ein Element des Systems von Versailles und dieses als eine Fessel, die abzustreifen vordringlichstes Ziel deutscher Politik sein musste. Dafür waren in Deutschland die Stimmen zahlreicher, die die Schaffung eines größeren Wirtschaftsraumes forderten. Die außerordentliche wirtschaftliche Dynamik, die das Deutsche Reich in der Phase der Hochindustrialisierung entwickelt hatte, ließ die nationalen Grenzen hier eher und häufiger als Produktionshemmnis erscheinen als anderswo.
Zum anderen verbanden sich Europa-Vorstellungen in Deutschland bedingt durch die geographische Lage und die Größe des Reiches häufiger als anderswo mit hegemonialen Ambitionen. Das gilt insbesondere für die diversen Mitteleuropa-Konzeptionen, die die europäische Integration von der deutschen Mitte her in Angriff nehmen wollten und folglich notwendigerweise bei einem Übergewicht des deutschen Partners im Integrationsverbund landeten. Besonders populär waren sie im Zeichen der deutsch-österreichischen Blockbildung vor und im Ersten Weltkrieg: Pläne zur Schaffung eines mitteleuropäischen Staatenverbandes häuften sich in der internen Kriegszieldiskussion; und Friedrich Naumanns Schrift Mitteleuropa, 1915 veröffentlicht, entfaltete eine gewaltige Breitenwirkung.
Nach der Niederlage von 1918 fehlte für solche ehrgeizigen Pläne zunächst einmal der Ansatzpunkt. Latent blieben sie aber eine Möglichkeit deutscher Europapolitik, und in der Praxis gingen integrative und hegemoniale Einigungsvorstellungen häufig eine nur schwer zu entwirrende Verbindung ein. So gründete etwa Gustav Stresemann seine außenpolitische Strategie auf eine »Verständigung« mit Frankreich, die in bemerkenswertem Kontrast zum bislang dominierenden »Erbfeind«-Denken stand. Darüber hinaus strebte er, wenn auch flexibel in den Methoden und behutsam im Vorgehen, durchaus eine wirtschaftliche Integration Europas an. Dabei ging es ihm jedoch nicht um eine Festschreibung des Status quo, wie sie den Europa-Initiativen seines französischen Partners Aristide Briand zugrunde lag, sondern im Gegenteil um die Schaffung einer Situation, in der Deutschland seine wirtschaftliche Potenz voll ausspielen konnte.
Im Dritten Reich gingen die Integrationshoffnungen dann ganz in den Hegemonialplänen auf. Die positive Resonanz, die Hitlers Politik der »Neuen Ordnung« bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein erfuhr, beruhte nicht nur auf der Erfüllung der Revisionsforderungen und dem Ausleben nationaler Frustrationen; in ihr schwang auch ein Bewusstsein vom Ungenügen der nationalstaatlichen Ordnung mit, das in der Hoffnung auf eine Neuordnung unter deutscher Führung einen Fluchtpunkt fand. Im Windschatten von Hitlers Anstrengungen, ein »Großdeutsches Reich« zu schaffen, das »minderwertige Rassen« als Hilfsvölker kolonisierte, konnten daher allerlei Europa-Vorstellungen gedeihen, die auf eine mehr oder weniger »freiwillige« Kooperation der europäischen Nachbarn mit den deutschen Siegern setzten.
Wissenschaftler wie Alfred Six und Werner Daitz entwickelten europäische Raumordnungsvorstellungen; Wirtschaftsführer plädierten für eine volkswirtschaftliche Planung auf europäischer Ebene; Beamte des Auswärtigen Amtes bastelten an Plänen für eine »europäische Konföderation«. Da Hitler freiwilliger Zuarbeit besiegter Nationen grundsätzlich misstraute, verliefen sich alle diese Initiativen im Sand. Gleichwohl hatten sie zeitweilig beträchtliche Resonanz – besonders in den Monaten nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, als die nationalsozialistische Propaganda den Krieg als antibolschewistischen Feldzug zur Verteidigung Europas darstellen konnte. Ribbentrop machte sich den Konföderationsgedanken im Frühjahr 1943 vorübergehend zu eigen, und Goebbels war zumindest um die Glaubwürdigkeit seiner Europa-Propaganda besorgt.
Auch die Vertreter des konservativen Widerstands bewegten sich anfangs meist in den Bahnen des liberalen Imperialismus. So ventilierte Carl Goerdeler 1940/41 die Idee einer »europäischen Konföderation unter deutscher Führung«, zu erreichen über fortschreitende freiwillige Vereinbarungen der beteiligten Nationen. An ihrem Anfang sollten Zollsenkungen, wirtschaftliche Koordinierungen und rechtliche Harmonisierungen stehen; mittelfristig waren »regionale Assoziationen« und »Zollunionen« vorgesehen; und schließlich sollte »fortschreitende Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet« zu »gemeinsamen Institutionen« der Verteidigung führen. Wie Preußen im 19. Jahrhundert bei der deutschen Einigung sollte das Deutsche Reich dazu die Initiative ergreifen und sich damit die Führung in Europa sichern.2
Daneben gab es aber auch Widerstandsgruppen, die die Bildung einer europäischen Föderation vorsahen, ohne dabei an eine besondere Führungsrolle Deutschlands zu denken. Manche Autoren – so Helmuth von Moltke in seinen Ausarbeitungen für den Kreisauer Kreis – verbanden das Bekenntnis zu einer föderativen Neuordnung mit einer expliziten Absage an Machtpolitik und Nationalismus. Als sich die Kriegswende abzeichnete, gab auch Goerdeler den Führungsanspruch für Deutschland auf; gleichzeitig forderte er weit energischere Schritte zur Errichtung einer europäischen Föderation, als er sie zunächst vorgesehen hatte. Angehörige des Kreisauer Kreises wiesen die Alliierten darauf hin, dass nur die Aussicht auf eine föderative Neuordnung Europas dem Diktat der Siegermächte die Bitterkeit nehmen und einen abermaligen deutschen Revanchismus verhindern könne.
Demokratischer Neuanfang
Nach der bedingungslosen Kapitulation war dieses Argument verständlicherweise noch weit öfter zu hören. Von einem Führungsanspruch der Deutschen konnte jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr die Rede sein; stattdessen mussten sie erst einmal darum kämpfen, die absolute Verfügungsgewalt der Siegermächte über die deutschen Angelegenheiten schrittweise zu lockern. Umso näher lag jetzt aber die Hinwendung zum Ziel der europäischen Integration: Es stellte die einzige Möglichkeit dar, den europäischen Nachbarn Sicherheit zu offerieren, ohne langfristige Diskriminierungen in Kauf zu nehmen und auf Selbstachtung zu verzichten. Der Preis, der für den verlorenen Krieg gezahlt werden musste, war umso geringer zu halten, der Weg zur Überwindung des Status des besiegten Kriegsgegners umso kürzer, die Gefahr erneuter revisionistischer Verhärtung umso eher zu bannen, je rascher ein integrierter Verbund europäischer Staaten zustande kam, der alle Mitglieder kontrollierte und damit eine einseitige Diskriminierung der Deutschen vermied. Entsprechend gewann das Projekt der europäischen Einigung jetzt für viele Deutsche an Dringlichkeit; und groß war auch die Zahl derjenigen, die es aus taktischen Gründen oder aus Sorge um das Gelingen der Demokratisierungs-Aufgabe erstmals für sich entdeckten.
Hinzu kam, dass deutscher Nationalismus und deutsches Machtstaatsdenken durch ihre Übersteigerung und die Bindung an den Führer ziemlich diskreditiert waren und der Zusammenbruch die tradierte Identität in vielfacher Hinsicht in Frage stellte. Hier bot sich das Zielbild eines vereinten Europas als geradezu ideales Identifikationsmuster an, und es wurde dankbar angenommen – besonders von der jungen Generation, die nach dem Zusammenbruch des Reiches vor den größten Orientierungsproblemen stand, aber auch von den Vertretern eines bürgerlichen Idealismus und den Überlebenden der alten Arbeiterbewegung, die nach der Katastrophenerfahrung auf der Suche nach einem Neuansatz waren. Der breiten Hinwendung zur Europa-Thematik, die damit einsetzte, hafteten unübersehbar kompensatorische Züge und Momente der Verdrängung an. Auffallend häufig und auffällig unbekümmert forderten viele Deutsche über alle politisch-ideologischen Trennlinien hinweg gleich »Gleichberechtigung« für die deutsche Nation im vereinten Europa. Sie bot aber auch Gelegenheit zu einem produktiven Lernprozess: zu der Einsicht, dass Sicherheit in Europa nicht mehr durch trotzige Selbstbehauptung, sondern nur noch durch Selbstbindung in einer größeren Gemeinschaft zu gewinnen war.
Wie immer es um diesen Lernprozess im Einzelnen bestellt war: Die Fülle der Impulse, die bei Kriegsende in die »europäische« Richtung wirkten, führte dazu, dass das Zielbild eines vereinten Europas nun über traditionelle Milieugrenzen hinweg konsensfähig wurde. Der Schweizer Publizist Ernst von Schenck berichtete nach einer Deutschlandreise im Dezember 1946, das deutsche Volk sei nationalstaatlicher Traditionen müde und grundsätzlich pazifistisch geworden. Unter denjenigen, die über diese allgemeinen Haltungen hinaus über positive Zukunftsaussichten für die Deutschen nachdachten, gebe es »nicht allzuviele, die ganz bewußt die Abhängigkeit von einer der Siegermächte als Ausweg postulierten«; vielmehr sei er »in ihren Reihen immer wieder dem Begriff Europa« begegnet.3 In der Tat wurde kein anderer Begriff häufiger artikuliert. Sieht man einmal von den Kommunisten ab, die Deutschlands Zukunft unzweideutig an der Seite der siegreichen Sowjetunion sahen, gab es in den Besatzungszonen keine politische Formation, die die außenpolitische Zukunft der Deutschen nicht im Kontext eines Zusammenwachsens der europäischen Nationen gesehen hätte.
Dabei überwogen anfangs – daran muss gegen das spätere Vergessen nachdrücklich erinnert werden – die Vorstellung, ein vereintes Europa werde als »Dritte Kraft« zwischen den neuen Weltmächten USA und UdSSR wirken. Nachfahren des traditionellen Gleichgewichtsdenkens sahen in einem Zusammenschluss der europäischen Staaten ein Gegenmittel zur Vereinnahmung durch den expandierenden amerikanischen Kapitalismus und/oder die ins Zentrum des alten Kontinents vorgerückte sowjetische Militärmacht; Kritiker der überkommenen gesellschaftlichen Verhältnisse hofften auf einen »dritten Weg« zwischen kapitalistischer Demokratie und diktatorischem Sozialismus; und beide Gruppen waren davon überzeugt, allein ein solches Zusammenschluss der Europäer könne einen Bruch zwischen den beiden Haupt-Siegermächten verhindern und so die Gefahr eines dritten Weltkrieges bannen. Auch hier war die Entwicklung unter den Deutschen wieder Teil eines allgemeineren Phänomens: Nach der Kompromittierung der Rechten durch die Kollaboration mit dem Faschismus erfolgte überall in Europa ein gesellschaftspolitischer Linksruck; und die Gefahren für die Autonomie der Europäer wie für den Frieden, die sich aus dem Aufstieg der ungleichen neuen Weltmächte ergaben, wurden ebenfalls nicht nur im besetzten Deutschland gesehen. Aus der Präsenz der ungleichen Siegermächte als Besatzungsmächte ergaben sich allerdings zwei zusätzliche Motive für ein Europa der »Dritten Kraft«: Es war noch am ehesten in der Lage, eine ordnungspolitische Entwicklung zu garantieren, die allen Besatzungsmächten genehm war; und es schien auch geeignet, die Spaltung der Nation in Ost und West zu verhindern, die aus einem Bruch der Anti-Hitler-Koalition unweigerlich zu folgen drohte.
Entsprechend häufig war die Forderung nach einem einigen und vermittelnden Europa unter denjenigen anzutreffen, die sich nach dem Zusammenbruch im Vier-Zonen-Deutschland politisch artikulierten. Walter Dirks und Eugen Kogon propagierten in den Frankfurter Heften eine sozialistisch orientierte europäische Föderation als Grundbedingung für das Gelingen der »zweiten Republik«. Martin Niemöller forderte ein »Vereinigtes Europa« als »Brücke zwischen Ost und West«, die allein einen dritten Weltkrieg verhindern könne. Hans-Werner Richter plädierte im Ruf für ein sozialistisches Europa zur Verhinderung der Blockbildung. Richard Löwenthal schöpfte aus einer Analyse der ordnungs- und machtpolitischen Entwicklungen in der Nachkriegs-Staatenwelt sogar die Hoffnung, dass die Entwicklung zu einem Dritte-Kraft-Europa »jenseits des Kapitalismus« nicht mehr aufzuhalten war.
Die wesentlichen Elemente des Dritte-Kraft-Konzepts waren darüber hinaus auch bei Politikern zu finden, die noch stärker in nationalstaatlichen Kategorien dachten und darum die Notwendigkeit einer Föderierung Europas nicht mit der gleichen Dringlichkeit betonten. So besaß Jakob Kaiser wohl wenig Sympathie für den Föderalismus und auch wenig Gespür für die Sicherheitsbedürfnisse Frankreichs, die eine föderative Integration auch unabhängig von der Ost-West-Spannung nahelegten. Dass Vermittlung im Ost-West-Konflikt im Interesse der Deutschen geboten sei, empfand er dafür umso nachdrücklicher; und ebenso fundamental war er von der Notwendigkeit geprägt, dass allein ein freiheitlicher Sozialismus in der Lage sein würde, die notwendige Vermittlung zu leisten. Bei aller Betonung der »Brücken«-Funktion Deutschlands ging es ihm über die Wahrung der Reichseinheit hinaus auch um eine Friedensordnung im Rahmen der Vereinten Nationen und um eine enge Solidargemeinschaft der europäischen Völker, für die er den Terminus »Vereinigte Staaten von Europa« durchaus für angemessen hielt. Ähnlich wie Kaiser dachten Unionsführer wie Ernst Lemmer oder Josef Müller und prominente Sozialdemokaten wie Paul Löbe und Ernst Reuter; und auch ein so idealistischer, mit den machtpolitischen Realitäten der Nachkriegsära wenig vertrauter Publizist wie der Würzburger Historiker Ulrich Noack bewegte sich mit seiner Vision eines »Bundes« der kontinentaleuropäischen Völker mit Vermittlungsmission zunächst in den gleichen Bahnen.
Die Deutschen konnten das Europa der »Dritten Kraft« freilich nicht aus eigener Kraft verwirklichen, und so geriet die Europa-Bewegung in den Besatzungszonen bald in eine tiefe Krise. Spätestens mit der sowjetischen Absage an den Marshall-Plan im Sommer 1947 war jede Chance geschwunden, sich an Integrationsmaßnahmen zu beteiligen, ohne zugleich zur Blockbildung in Europa beizutragen und damit die Ost-West-Teilung Deutschlands zu bekräftigen. Es spricht für die Faszination, die die Dritte-Kraft-Idee unter den Deutschen ausgeübt hatte, dass sie sich keineswegs begeistert auf die Möglichkeiten zum Wideraufstieg an der Seite der Westmächte stürzten, die ihnen die Einbeziehung der westlichen Besatzungszonen in den Marshall-Plan bot. Stattdessen überwogen bis in die Berlin-Krise hinein Ratlosigkeit und vorsichtiges Abwarten; zu den Konsequenzen der verschämten Staatsgründung im Westen wollte sich zunächst kaum jemand bekennen. Carlo Schmid plädierte im Herbst 1947 für eine westeuropäische »Dritte Kraft« ohne deutsche Beteiligung, die die Spaltung Europas überwinden sollte. Bis sie zu dem erhofften Erfolg führte, wollte er den Deutschen nur provisorische »Übergangsregelungen« zugestehen. Als sich nach dem Beginn der Berlin-Blockade auch diese Position nicht mehr halten ließ, verfügten die Deutschen im Westen über kein mehrheitsfähiges außenpolitisches Konzept mehr.
Entscheidung für die Westintegration
Dies war die Stunde der Verfechter der Westintegration. Sie unterschieden sich vom Mainstream der europapolitischen Diskussion der ersten Nachkriegsjahre dadurch, dass sie den totalitären Zugriff der Sowjetunion auf ihre Besatzungszone von Anfang an als gegeben betrachteten und daher einer Integration der westlichen Besatzungszonen in das westliche Europa das Wort redeten. Meist waren sie auch davon überzeugt, dass die Sowjetunion ihren Machtbereich ohne entsprechende Gegenwehr weiter nach Westen ausdehnen würde. Das führte sie dazu, in einer europäischen Gemeinschaft weniger ein Instrument der Vermittlung zwischen Ost und West zu sehen als ein Mittel der Selbstbehauptung der westlichen Europäer gegenüber den Gefahren der sowjetischen Expansion. Dass eine solche Gemeinschaft fürs Erste notwendigerweise auf das westliche Europa beschränkt sein würde, nahmen sie billigend in Kauf – in der mehr oder weniger sicheren Erwartung, dass sie mit der Zeit auch auf das östliche Europa ausstrahlen und so die Sowjetunion zum Rückzug zwingen würde.
Sehr bald erschien ihnen darüber hinaus die dauernde Präsenz der USA in Europa nötig, um das sowjetische Gewicht auszugleichen. Damit wurde die europäische Integration in ihrer Sicht zu einem notwendigen Instrument westlicher Gemeinschafsbildung: Sie sollte den latenten Gegensatz zwischen dem westlichen Deutschland und seinen westlichen Nachbarn überwinden, die Prosperität der westeuropäischen Region garantieren und die Deutschen der Westzonen auf Dauer an den Westen binden. Die Selbstbehauptung gegenüber amerikanischer Übermacht rückte demgegenüber ins zweite Glied, ebenso die Rückversicherung für den Fall, dass sich die amerikanische Sicherheitsgarantie als brüchig erwies.
Solange noch Hoffnungen auf eine Verständigung der Siegermächte bestanden, konnten sich nur Wenige mit einer solchen Konzeption anfreunden, die die Integration der östlichen Hälfte Deutschlands und Europas in eine unbestimmbare Zukunft verschob und zugleich das Risiko fortwährender Konflikteskalation barg. Konrad Adenauer ist hier zu nennen, für den sich alte Einsichten in die Sicherheitsbedürfnisse der westlichen Nachbarn und neue Furcht vor sowjetischem Expansionismus zu einem in sich stimmigen Konzept verbanden, das zudem den Vorteil hatte, den Wiederaufstieg der Deutschen im Westen erheblich zu beschleunigen. Ähnliches gilt für die Föderalisten um den Rheinischen Merkur, die sich bei ihren Bemühungen um eine föderalistisch-christliche Neugestaltung Europas ganz auf die Kernregionen des alten Abendlandes konzentrierten. Und auch Kurt Schumacher gehört in diese Reihe, der wohl ein sozialistisches Europa im Blick hatte, zugleich aber von der Gefahr, »daß Eurasien Europa verschluckt«,4 so gebannt war, dass er noch früher und entschiedener auf die Integration der Westzonen in ein westliches, mit den USA verbündetes Europa hinarbeitete als sein späterer christdemokratischer Gegenspieler.
Der Einfluss der Westintegrations-Befürworter reichte freilich vorerst nur hin, eine offensive Artikulation der Deutschen im Sinne des »Dritte-Kraft«-Konzepts zu verhindern. Im sozialdemokratischen Lager lenkte Schumachers leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der SED die Masse der Anhänger von einem sorgfältigen Nachdenken über die deutsche Situation ab und gerieten auf diese Weise Anwälte der »Dritten Kraft« allmählich in die Isolation. Bei den Christdemokraten verlor Jakob Kaiser allein schon durch die Angriffe aus den Reihen der SPD an Gewicht und hatten dann Adenauers Bemühungen um Sammlung der bürgerlichen und antipreußischen Kräfte wenigstes soweit Erfolg, dass Kaiser seinen Führungsanspruch nicht durchsetzen konnte. Initiativen zur Bildung einer zonenübergreifenden Repräsentation der Deutschen scheiterten regelmäßig an der Furcht der Westintegrations-Verfechter vor sowjetischer Einflussnahme.
Mit dem Übergang zur offenen Austragung des Kalten Krieges gewann das Konzept der Westintegration dann rasch an Plausibilität, für viele auch an Dringlichkeit und Attraktivität. Manche ursprünglichen Anhänger des »Dritte-Kraft«-Gedankens schlossen sich ihm mehr oder weniger resigniert an – davon überzeugt, dass die Mitwirkung an der Westintegration immer noch besser war als ohnmächtiges Abseitsstehen. Beachtlich war auch die Zahl derjenigen, die überhaupt erst jetzt, unter dem Eindruck der vermeintlichen totalitären Bedrohung aus dem Osten, die Bereitschaft zu integrativem Zusammenschluss entwickelten. Die Gründung der Bundesrepublik wurde unter dem doppelten Eindruck der Währungsreform und der Berliner Blockade von einem breiten Konsens der Deutschen mitgetragen; und Adenauer konnte sich, nachdem er sich der Unterstützung Ludwig Erhards versichert hatte, an die Spitze des neuen Staates stellen.
Die grundsätzliche Option für den Westen, die die Westdeutschen damit vollzogen, bedeutete aber noch nicht, dass sie in ihrer Mehrheit schon bereit gewesen wären, sich aktiv am westeuropäischen Integrationsprozess zu beteiligen. Adenauer hatte schon Schwierigkeiten, den Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat und zur Montanunion durchzusetzen. Als er im Sommer 1950 deutsche Truppen im Rahmen einer integrierten Verteidigungsgemeinschaft des Westens anbot, reichte der Widerstand bis ins Kabinett und den Vorstand seiner eigenen Partei hinein. Schumacher zog sich als Oppositionsführer auf Maximalforderungen an die Adresse der Westmächte zurück, die es ihm erlaubten, die Widersprüche in seiner Konzeption zu verdrängen. Nicht mehr als 40 Prozent der Bundesbürger stimmten der Idee einer »Europa-Armee mit deutschem Beitrag« in Meinungsumfragen grundsätzlich zu; der Anteil derjenigen, die sich »im großen und ganzen« mit der Politik Adenauers einverstanden erklärten, sank im Herbst 1950 unter ein Viertel.5 Trotz der augenscheinlichen Aggressivität sowjetischer Politik blieb das Unbehagen an der westlichen Blockbildung groß.
Dass sich Adenauer dennoch behaupten und schließlich sogar Mehrheiten für seine Politik gewinnen konnte, war wohl in erster Linie dem beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung zu verdanken, der die »langen 50 Jahre« charakterisierte. Die ersten Anzeichen des Wirtschaftswunders machten sich, nach einer empfindlichen Durststrecke zu Beginn des Jahrzehnts, noch eben rechtzeitig bemerkbar, um einen gesamtdeutschen Neuanfang mit dem Risiko der Preisgabe des bereits Erreichten zu behaften; und dann gewöhnte man sich allmählich daran, dass dieser Wohlstand durch die westliche Gemeinschaft garantiert wurde. Daneben spielte sowjetische Ungeschicklichkeit eine wichtige Rolle: Stalin zögerte viel zu lange, ehe er die Trumpfkarte seines Wiedervereinigungsangebotes ausspielte. Als er es im März 1952 schließlich tat, hatten sich die Westdeutschen schon zu sehr in ihrem neuen Staat eingerichtet. Von Bedeutung war auch Adenauers persönlicher Einsatz: sein offensives Vorpreschen, seine Bereitschaft zu dosierten Vorleistungen, seine Flexibilität hinsichtlich der Integrationsmethoden, seine eindringliche Sicherheitspädagogik, sein gezieltes Hintertreiben von Verhandlungsinitiativen östlicher wie westlicher Provenienz.
Voll verständlich wird die Durchsetzung der Westintegration aber erst, wenn man sieht, dass ihre Gegner keineswegs, wie Adenauer wohl annahm und seither häufig geglaubt wird, durchgängig Verfechter traditioneller nationalstaatlicher Politik waren. Wohl war in ihren Reihen auch machtstaatliches Denken virulent, doch unterschieden sie sich damit nicht grundsätzlich vom gegnerischen Lager, in dem diese Tradition nun in antikommunistisch-westlicher Verkleidung auftrat. Bei weitem nicht alle Gegner der Westintegration waren bereit, den Preis einer Neutralisierung Deutschlands zu zahlen, den die Sowjetunion für den Verzicht auf ihre exklusive Verfügung über die DDR forderte. Diejenigen, die zum Risiko der Neutralisierung bereit waren – Gustav Heinemann etwa oder Ulrich Noack -, begriffen sie in der Regel nicht als nationalen Sonderweg, sondern als Auftakt zur Errichtung eines europäischen Sicherheitssystems. Das alte Ziel einer europäischen Friedensordnung zeigte sich hier in einem neuen Gewand: auf die Bedingungen der Ost-West-Konfrontation zugeschnitten, präzise hinsichtlich der ersten Schritte eines Interessenausgleichs und notwendigerweise vage, was die spätere Ausgestaltung einer solchen Ordnung betraf.
Adenauer profitierte von beidem: Sowohl von der Widersprüchlichkeit derjenigen, die sich der Westintegration verweigerten, ohne zu Kompromissen mit der Sowjetunion bereit zu sein, als auch von der europäischen Fundierung der meisten Neutralisten. Eine breite nationale Widerstandsbewegung, wie sie etwa Rudolf Augstein forderte, stellte sich ihm nicht entgegen; vielmehr akzeptierten seine Gegner mit der Zeit faute de mieux die von Adenauer durchgesetzten Bindungen an den Westen. In dem gleichen Jahr 1950, in dem höchstens 40 Prozent der Bundesbürger einer deutschen Beteiligung an einer europäischen Armee zustimmen wollten, befürworteten immerhin schon 55 Prozent »die Idee einer Westeuropäischen Union«. Ende 1956 erklärten 75 Prozent der Befragten, bei einer entsprechenden Abstimmung »für die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa stimmen« zu wollen. 36 Prozent hielten es aber noch Anfang 1958 für »sehr wichtig«, die Bundesrepublik »los[zu]lösen von allen militärischen Bündnissen«, und 32 Prozent bezeichneten es als deutsche Aufgabe, »Brücke zwischen Ost und West zu sein.«6
Zwei Entwicklungen unterstützten den zögerlichen inneren Nachvollzug der Westintegration, der aus diesen Zahlen abzulesen ist: die zunehmende Verflechtung der exportorientierten bundesdeutschen Wirtschaft mit den Ländern der OEEC und die allmähliche Öffnung für die Werte der westlichen Zivilisation. Letztere ließ wohl, weil mit schmerzlicher Aufarbeitung des nach 1945 Verdrängten verbunden, etwas länger auf sich warten; sie war eher das Werk der nachwachsenden Intellektuellen-Generation als der etablierten gesellschaftlichen Autoritäten und der breiten Bevölkerung und ging darum auch nicht ohne Erschütterungen vonstatten. Doch engagierten sich bei der kulturellen Verwestlichung häufig gerade diejenigen an vorderster Front, die der politischen Westorientierung skeptisch gegenübergestanden hatten, und war folglich im Ergebnis eine umso solidere Bindung an den Westen zu verzeichnen.
Rettungsanker EWG
Die wachsende Akzeptanz der Bindung an den Westen ging freilich mit einem Verlust an Integrationsdynamik einher. Darin spiegelt sich zum einen wider, dass wesentliche Funktionen, die man ursprünglich der europäischen Gemeinschaft zugedacht hatte, unterdessen von der NATO wahrgenommen wurden: der Schutz vor sowjetischer Bedrohung, der im Zeitalter der atomaren Abschreckung nur noch global organisiert werden konnte, die Einhegung der Deutschen und, damit verbunden, ihr Aufstieg zu Bündnispartnern. Zum anderen wurde Europa auch immer weniger als Ersatz für nationale Bindungen gebraucht: Zunehmender Abstand von der Katastrophe von 1945 und wachsender wirtschaftlicher und politischer Erfolg der neuen Republik ließen eine europäische Neuorientierung zunehmend unnötiger und unwirklicher erscheinen. Dass ein vereintes Westeuropa eine eigenständige Rolle in der Weltpolitik oder doch zumindest innerhalb des westlichen Bündnisses spielen konnte, wurde von den Einen nicht recht gewollt und von den Anderen kaum gesehen; die westeuropäische Gemeinschaft erschien, ganz wie es Adenauers Vorstellungen entsprach, vorwiegend als Element der Stärkung des westlichen Lagers und damit keiner besonderen Pflege bedürftig.
Unter diesen Umständen war es besonders fatal, dass die Integration der Sechs, die 1950/51 mit der Montanunion begonnen hatte, nach dem Scheitern des EVG-Projekts 1954 noch am ehesten mit einer Wirtschaftsgemeinschaft fortzusetzen war. Als der Vorschlag einer Wirtschaftsgemeinschaft der Sechs von den niederländischen Partnern lanciert wurde, gingen 75 Prozent des bundesdeutschen Exports in Länder außerhalb des projektierten Gemeinsamen Marktes, und 72 Prozent der Einfuhren kamen von dort. Das ließ bei zahlreichen Vertretern der Industrie und des Handels Zweifel aufkommen, ob die Vorteile einer Liberalisierung des Binnenmarktes der Sechs nicht mehr als aufgewogen würden durch die Errichtung eines gemeinschaftlichen Außenzolls, dessen Tarife deutlich über den bisherigen Tarifen des Exportlandes Bundesrepublik lagen. Und je deutlicher in den Vertragsverhandlungen wurde, dass Frankreich auf einer Reihe von Maßnahmen zum Schutz seiner wenig konkurrenzfähigen Industrie und zur Sicherung des Niveaus seiner Sozialleistungen bestehen würde, desto mehr fürchteten sie, das Instrumentarium des Gemeinsamen Marktes werde zu Wettbewerbsverzerrungen auf Kosten der leistungsfähigen deutschen Industrie führen. Insbesondere die Industrie- und Handelskammern und weite Kreise der exportorientierten chemischen und verarbeitenden Industrie verfochten statt der engeren Integration die Schaffung einer möglichst breiten Freihandelszone
Unterstützt wurden sie dabei von den neoliberalen Theoretikern, die das Konzept der »Sozialen Marktwirtschaft« durchgesetzt hatten. Alfred Müller-Armack und Wilhelm Röpke bekämpften das EWG-Projekt als empfindlichen Rückschlag auf dem Weg zu weltweitem Freihandel auf der Grundlage freier Währungskonvertibilität. Ludwig Erhard sprach von »volkswirtschaftlichem Unsinn«7 und engagierte sich stattdessen für den britischen Vorschlag einer europäischen Freihandelszone im OEEC-Rahmen. Die Verhandlungen über die Wirtschaftsgemeinschaft torpedierte er nach Kräften; und selbst nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge im März 1957 machte er sich noch geraume Zeit dafür stark, sie in der größeren Freihandelszone ohne gestaltende Gemeinschaftsorgane aufgehen zu lassen.
Auch die deutsche Landwirtschaft wollte von der Sechser-Gemeinschaft nichts wissen: Während sie im nationalen Rahmen bislang noch auf Jahrzehnte hinaus auf Zuwachsraten rechnen konnte, da die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten weit über die nationale Produktion hinausging, drohten ihr bei einer Öffnung des Marktes die Konfrontation mit der niederländischen und französischen Billigkonkurrenz und bei manchen Produkten wohl auch ein Überangebot. Preisverfall und schrumpfende Marktanteile waren danach nicht mehr abzuwenden. Außerdem wurden mit der Schaffung eines Gemeinsamen Marktes die Instrumente zur Sicherung der privilegierten Stellung der Landwirtschaft in Frage gestellt, die mit dem Landwirtschaftsgesetz von 1955 gerade erst festgeschrieben worden waren. Entsprechend machte der Deutsche Bauernverband gegen die Agrarintegration im Sechser-Rahmen Front und sekundierte das Landwirtschaftsministerium dem Wirtschaftsministerium bei seinen vielfältigen Störmanövern gegen das EWG-Projekt.
Es bedurfte einmal mehr der ganzen Energie Adenauers (und seiner unterdessen erworbenen Autorität), um die Verhandlungen über EWG und EURATOM überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Dabei ging es ihm nicht um die wirtschaftliche Integration; seine Zielsetzung war vielmehr nach wie vor eine politische: Er hielt die Bindungen der Westdeutschen an den Westen immer noch für zu gering, die Gefahr einer Verständigung Frankreichs mit der Sowjetunion für zu groß und den Westen insgesamt immer noch für zu schwach. Seit dem Beginn der Diskussion über eine Verminderung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa ging es ihm darüber hinaus um die Schaffung einer europäischen Auffangposition für nachlassendes amerikanisches Engagement. Sein Ziel war folglich eine politische Gemeinschaft mit sicherheitspolitischer Dimension. Auf die Wirtschaftsgemeinschaft griff er – nach einigem Zögern – nur zurück, weil sich im Kreis der Sechs kein anderes konsensfähiges Projekt anbot.
In der Öffentlichkeit sprach Adenauer freilich kaum über seine eigentlichen Motive. Bewusst vermied er eine öffentliche Debatte über das Vertragsprojekt. Die Vertragsverhandlungen vollzogen sich im Halbdunkel der Regierungsdiplomatie; Parteien und Verbände wurden in keiner Weise einbezogen. Damit ließen sich die Differenzen im Kabinett herunterspielen und die Resonanz auf die kritischen Stimmen in engen Grenzen halten; Erhard lief mit seinen Gegenoffensiven ins Leere. Es unterblieb aber auch jene Wiederbelebung der europäischen Idee, die sich Jean Monnet, Paul-Henri Spaak und andere Förderer von dem Projekt erhofft hatten. Erst recht kam keine Verständigung über die Ziele des Unternehmens und den weiteren Fortgang der europäischen Integration zustande.
Das Vertragswerk, in seiner komplizierten Technizität ohnehin schwer vermittelbar und in mancher Hinsicht noch für künftige Entscheidungen offen, gab weder zu euphorischer Begeisterung noch zu dramatischen Befürchtungen Anlass. Es fand folglich nur mäßiges Interesse und wurde schließlich, nachdem man lange nichts Konkretes über den Fortgang der Verhandlungen erfahren hatte, als ein Schritt akzeptiert, der mehr oder weniger im Trend der eigenen Zukunftserwartungen lag, ohne sie sonderlich zu beeinflussen. FDP und BHE, die als Regierungsparteien alle bisherigen Schritte der Westintegration mitgetragen hatten, leisteten sich in der Opposition den Luxus eines »Nein zu Spaakistan«,8 das die verbreiteten Vorbehalte gegen eine Vertiefung der Ost-West-Spaltung zum Ausdruck brachte. Die SPD nutzte dagegen die Chance, mit einer Zustimmung zu den Römischen Verträgen das nationalistische Image abzustreifen, das ihr im Verlauf des Kampfes gegen die militärische Westintegration zugewachsen war. Ein vorbehaltloses Bekenntnis zur Westintegration war mit diesem Votum freilich noch nicht verbunden; vielmehr begründete Heinrich Deist die Zustimmung der Fraktionsmehrheit im Bundestag ausdrücklich mit der Feststellung, dass mit diesem Vertragswerk die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa von der militärischen und machtpolitischen Blockbildung abgekoppelt worden sei.
Der Konsens, der die deutsche Beteiligung an der Gründung von EWG und EURATOM trug, war ziemlich oberflächlicher Natur. Unklar blieb, ob nach der Unterzeichnung der Verträge der Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion oder der Integration der Sechser-Gemeinschaft in eine europäische Freihandelszone Vorrang eingeräumt werden sollte. Die SPD propagierte Beides zugleich und überbrückte damit unterschiedliche Akzentsetzungen innerhalb der Partei; und im Regierungslager stand Walter Hallsteins Programm für eine konsequente Stärkung der Gemeinschaftsorgane ziemlich unvermittelt neben Erhards Kampagne für die größere Freihandelszone. Ebenso unklar und kontrovers war, ob der Beginn der Gesamtintegration im wirtschaftlichen Bereich auf den politischen Bereich übergreifen sollte, wie es die bei den Gründungsvätern der EWG populäre »funktionalistische« Theorie versprach. Und völlig offen, in den unterschiedlichen Denkschulen auch selten bis zu Ende reflektiert, war die Frage, welche Funktion einem solchen politischen Europa innerhalb des westlichen Bündnisses und im Ost-West-Verhältnis zukommen sollte.
Charles de Gaulle und Willy Brandt
Die bundesdeutsche Politik war darum denkbar schlecht gerüstet, als General de Gaulle seine EWG-Partner mit dem Projekt einer Politischen Union konfrontierte. Wohl gab es in der Auseinandersetzung, die de Gaulles Initiativen auslösten, eine Minderheit deutscher »Gaullisten«. Ihre Protagonisten hatten aber sehr unterschiedliche Dinge im Auge, die mit de Gaulles »Grand Design« nur wenig zu tun hatten: Franz-Josef Strauß die gemeinsame deutsch-französische Atomwaffe, Paul Wilhelm Wenger die abendländische Schicksalsgemeinschaft, Paul Sethe die Priorität der Nationen gegenüber den Ideologien. Am meisten kam der alternde Adenauer de Gaulle entgegen: Von der Notwendigkeit einer unauflösbaren Bindung der Deutschen an Frankreich überzeugt, war er bereit, den Fouchet-Plan für eine Politische Union trotz gewisser Bedenken mitzutragen, und regte er dann, als die Fouchet-Verhandlungen scheiterten, den Deutsch-französischen Vertrag von 1963 an. Dahinter stand jedoch weniger das Bemühen um Eigenständigkeit gegenüber der amerikanischen Führungsmacht als die Sorge vor einer französisch-sowjetischen Verständigung. Von sich aus wollte Adenauer nichts tun, um die deutschen Bindungen an die USA zu lockern.
Die Mehrheit der Westdeutschen sah in de Gaulles Bemühungen um Unabhängigkeit nur den Versuch, Frankreich auf Kosten der atlantischen Solidarität und zum Preis einer Zerstörung der europäischen Gemeinschaft als privilegierten Kooperationspartner der Sowjetunion auf dem europäischen Kontinent zu etablieren. Er erschien damit als ein Mann des 19. Jahrhunderts, das man, grundsätzlich europäisch und zumeist auch zutiefst atlantisch, gerade zu überwinden gelernt hatte. Das Problem der europäischen Eigenständigkeit, das de Gaulle angesprochen hatte, nahm man nicht wahr; vielmehr half die Erbitterung über den vermeintlichen reaktionären Nationalismus des Generals, es weiter zu verdrängen. Nicht nur die Mehrheit der Anhänger der Adenauerschen Westintegrationspolitik dachte so – auch die meisten Sozialdemokraten, die 1960 ihren Frieden mit der Westintegration gemacht hatten, sahen in de Gaulle nur einen Störenfried, den man aussitzen musste.
Entsprechend ratifizierte der Deutsche Bundestag den Deutsch-französischen Vertrag nur unter einseitiger Hinzufügung einer Präambel, die all das bekräftigte, was der französische Staatspräsident verhindert wissen wollte: die atlantischen Bindungen, den Ausbau der Brüsseler Institutionen und (dies bei der proamerikanischen Haltung der Briten ein besonderer Affront) die Bemühungen um einen EWG-Beitritt Großbritanniens. Das war ein Vorgang, der in der Diplomatiegeschichte ohne Beispiel war, für de Gaulle eine schallende Ohrfeige. Statt den deutsch-französischen Dialog über eine politische Gemeinschaft zu befördern, wie es Sinn der im Vertrag vorgesehenen regelmäßigen Konsultationen war, begann so mit der Ratifizierung eine deutsch-französische Eiszeit, in der auch die Reflexion über die politische Finalität der europäischen Gemeinschaft blockiert war. De Gaulle reagierte mit einem nationalen Alleingang, der ihn zur »Politik des leeren Stuhls« in Brüssel und zum Austritt aus der nordatlantischen Militärorganisation führte. Die Deutschen aber begnügten sich damit, entweder auf bessere Tage für den supranationalen Ausbau der Brüsseler Institutionen zu warten oder selbst wieder verstärkt in nationalen Kategorien zu denken.
Die Folge davon war, dass bei der Neuorientierung der bundesdeutschen Außenpolitik, die nach der amerikanischen Wende zur Entspannungspolitik unerlässlich war, die Dimension der europäischen Gemeinschaft weitgehend außer Betracht blieb. In der CDI/CSU endete ein heftiger Streit um außenpolitische Positionen, der zugleich ein innerparteilicher Machtkampf um das Erbe Adenauers war, mit einem Sieg der nationalen Realisten um Kurt-Georg Kiesinger, die Selbstbewusstsein gegenüber der amerikanischen Führungsmacht mit der Bereitschaft zu einer vorsichtigen Öffnung gegenüber dem Osten verbanden. Dabei bleib nicht nur Erhards postnationaler Atlantizismus auf der Strecke, sondern auch der europäische Supranationalismus à la Hallstein. Die SPD begann allmählich, die deutschlandpolitischen Möglichkeiten zu entdecken, die in de Gaulles ostpolitischem Ansatz steckten, formulierte dann aber ihre eigene »neue Ostpolitik« als nationale, nicht über Europa vermittelte Verständigungspolitik mit dem Osten. Sie blieb wohl realistisch in das westliche Bündnis eingebunden, ließ aber nicht erkennen, welche besondere Funktion der Europäischen Gemeinschaft bei der Gestaltung der künftigen Friedensordnung zukommen sollte.
Der Beitritt Großbritanniens zu der bisherigen Sechser-Gemeinschaft, von de Gaulle noch kurz vor seinem Rücktritt in die Wege geleitet und zum 1. Januar 1973 realisiert, hat diese Tendenz zur Entpolitisierung der Gemeinschaft im deutschen Bewusstsein noch verstärkt. Dass die britische Regierung vornehmlich die wirtschaftliche Integration und keineswegs eine politische Eigenständigkeit im Sinn hatte, als sie erneut ihren Beitrittsantrag stellte, wurde auf der deutschen Seite kaum diskutiert. Seit jeher aus politischen wie aus wirtschaftlichen Gründen auf einen britischen Beitritt zur Gemeinschaft hoffend, scherten sich die meisten Deutschen nicht um die problematische Seite dieser Erweiterung. Manche taten dies sehr bewusst, weil ihnen neben der politischen Integration in die NATO ohnehin nur eine erweiterte Freihandelszone in Europa vorschwebte; und viele andere ließen sich durch die antigaullistische Frontstellung, in die sie über die Auseinandersetzung mit dem General geraten waren, dazu verführen, über die Abneigung der Briten gegen eine politische Gemeinschaftsbildung hinwegzusehen. Die Regierung Brandt/Scheel wirkte höchst aktiv daran mit, die Verhandlungen über den britischen Beitritt zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, und wusste sich dabei von einem breiten Konsens in der bundesdeutschen Öffentlichkeit getragen.
Hand in Hand mit der schleichenden Entpolitisierung des Gemeinschaftsprojekts ging eine stillschweigende Abkehr von der supranationalen Zielsetzung der Gemeinschaft. Schon gegen den Luxemburger »Kompromiss« vom Januar 1966, mit dem es in das Belieben der Regierungen gestellt wurde, bei Fragen von vitaler Bedeutung von der Verpflichtung zu Mehrheitsentscheidungen abzuweichen, erhob sich in der Bundesrepublik wenig Protest. Als de Gaulle im Frühjahr 1967 die Einführung des Rotationsprinzips bei der Besetzung der Präsidentschaft der EG-Kommission verlangte, machte sich die Regierung Kiesinger/Brandt nicht für eine weitere Amtszeit von Walter Hallstein stark, sodass dieser dann selbst nicht mehr kandidierte und weniger integrationsfreudigen Nachfolgern Platz machte. Ebenso wenig erhob die Regierung Brandt/Scheel Einspruch, als sich der britische Außenminister Heath und der französische Staatspräsident Pompidou im Mai 1971 darauf verständigten, »dass die Identität von Nationalstaaten im Rahmen der sich entwickelnden Gemeinschaft aufrechterhalten werden sollte und dass in der Praxis die Entscheidungen der Gemeinschaft einstimmig getroffen werden sollten, wenn die lebenswichtigen Interessen der Mitgliedsstaaten auf dem Spiel stünden.«9 Stattdessen machten die deutschen Regierungen fortan selbst wiederholt von der Möglichkeit Gebrauch, sich auf »vitale« Interessen zu berufen und so Gemeinschaftsentscheidungen zu blockieren.
Gleichwohl hat insbesondere Willy Brandt am Ziel einer »Politischen Union« festgehalten. In Anknüpfung an die Tradition der »Dritten Kraft« hatte er dabei sogar eine eigenständige Rolle Europas in der Weltpolitik im Auge, die sowohl ein amerikanisch-sowjetisches Kondominium im Zeichen der Entspannung als auch die Vorherrschaft einer der beiden Weltmächte vermied. Gegenüber Kissingers Bemühungen, die EG unzweideutig der Atlantischen Allianz unterzuordnen, beharrte er ausdrücklich auf einer gleichrangigen Partnerschaft. Freilich war auch er nicht bereit, die Bindungen an die USA von sich aus zu lockern. Außerdem bremste Egon Bahr die Tendenz zur Stärkung der deutsch-französischen Achse einer westeuropäischen Union ab, weil sie im Widerspruch zu seinen Hoffnungen auf ein späteres mitteleuropäisches Sicherheitssystem stand, das zur Wiederherstellung der deutschen Einheit und zur Überwindung der Blockbildung in Europa führen sollte.
Das Ergebnis war eine widerspruchsvolle Politik des Vermittelns, die in Washington als Ausdruck deutschen Gaullismus, in Paris aber als Unterlaufen der Bemühungen um europäische Eigenständigkeit gewertet wurde. Der amerikanische Anspruch auf Einbindung, in Kissingers »Jahr Europas« 1973 mit großem Aplomb proklamiert, wurde durch eine Grundsatzerklärung des Kopenhagener EG-Gipfels im Dezember 1973 konterkariert, in der die EG-Staaten ihre Entschlossenheit bekundeten, als »eigenständiges Ganzes« in der Weltpolitik aufzutreten. Vier Monate später setzte Außenminister Walter Scheel aber im Kreis seiner EG-Kollegen eine Vereinbarung durch (»Gymnicher Agreement«), die es jedem Mitgliedsland erlaubte, die Behandlung politischer Themen von einer Konsultation der USA abhängig zu machen. Darüber hinaus gab Bonn seinen Partnern zu verstehen, dass es an der Entwicklung einer europäischen Dimension der Abschreckung nicht interessiert war.
Ihren konsequentesten Ausdruck fand die halbherzige Fortsetzung der politischen Dimension der Gemeinschaftsbildung in der Entwicklung der EPZ und im Übergang zu regelmäßigen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft. An Beidem hatten die Regierungen der sozialliberalen Koalition wesentlichen Anteil. Sie sorgten damit dafür, dass die Idee eines politischen Europas in einer Zeit großer sicherheitspolitischer Umbrüche in vager Form überlebte. Gleichzeitig waren sie aber auch dafür mitverantwortlich, dass sich zwischen europäischem Anspruch und Substanz der Gemeinschaftsbildung eine Kluft auftat, die die Glaubwürdigkeit des Einigungsprojekts zunehmend erschütterte. Die nachwachsendenden Generationen vermochten der Gemeinschaftsbildung folglich nur noch wenig Sinn abzugewinnen, und insbesondere die »Neue Linke« strich sie ganz aus ihrem Programm.
Pragmatische Selbstbehauptung
Unter Brandts Nachfolger Helmut Schmidt wurde das politische Profil europäischer Gemeinschaftsbildung wieder deutlicher. Das hing zum einen damit zusammen, dass Schmidt für Bahrs Vision eines mitteleuropäischen Sicherheitssystems keine Verwendung hatte und seine Version der Entspannungsstrategie stattdessen auf die Überzeugung von der weitgehenden Identität der westeuropäischen Interessen gründete. Zweitens ließen die amerikanischen Rücksichtslosigkeiten in der Finanz- und Währungspolitik tatsächlich gerade jetzt gemeinsame Interessenlagen der westeuropäischen Partner der USA besonders deutlich erkennen. Und drittens fand Schmidt in dem französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing einen kongenialen Partner, der diese Gemeinsamkeiten nur sah, sondern auch dem gleichen pragmatischen Politikstil verpflichtet war, den Schmidt als Verteidigungs- und Finanzminister entwickelt hatte.
Schmidt bemühte sich zunächst einmal um eine Überwindung der Krise, in die die Wirtschaftsgemeinschaft durch die Turbulenzen der Weltwirtschaftskrise von 1973/74 geraten war. Dazu gehörten finanzielle Unterstützungen für Mitgliedsländer, die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten waren, aber auch das Bemühen um eine Begrenzung der Ausgaben der Gemeinschaft, ein restriktiver Kurs in der Frage eines europäischen Regionalfonds, Forderungen nach einer Reform der verschwenderischen EG-Agrarordnung (diese wegen der Rücksichtnahme auf die eigene Agrarlobby weitgehend vergeblich) und der Versuch, die Partner auf einen wirtschafts- und finanzpolitischen Konsolidierungskurs festzulegen. Dazu verständigte er sich 1978 mit Giscard d’Estaing auf die Schaffung des Europäischen Währungssystems, das nicht nur die Abhängigkeit von der internationalen Währungsspekulation verringern, sondern die Teilnehmer auch haushaltspolitisch disziplinieren sollte. Bedenken der Deutschen Bundesbank, ein solches System werde die Bundesrepublik zum Finanzier einer Inflationsgemeinschaft machen, mussten hinter dem politisch motivierten Ziel zurückstecken, die EG als handlungsfähige Einheit zu erhalten.
Gleichzeitig verwandten Schmidt und Giscard d’Estaing erhebliche Anstrengungen auf die Abstimmung ihrer Außenpolitik. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit vereinbarten sie, sich vor bilateralen Kontakten mit Moskau regelmäßig zu konsultieren und regelmäßig über ihr beiderseitiges Verhältnis zu den USA zu sprechen. Dann regten sie die Verstetigung der EG-Gipfeltreffen im »Europäischen Rat« an, ebenso die Einführung des »Weltwirtschaftsgipfels« der führenden Industrienationen, der im November 1975 erstmals zusammentrat. Die regelmäßigen Konsultationen im Rahmen des Deutsch-französischen Vertrags und die EPZ wurden zur Verständigung in zahlreichen Detailfragen genutzt.
Die Bemühungen um eine Vereinheitlichung der Außenpolitik der EG-Partner trugen bald erste Früchte: In der Schlussphase der KSZE stimmten sie sich so weitgehend ab, dass sie von außen vielfach schon als Einheit wahrgenommen wurden und auch ansehnliche Erfolge bei der Formulierung der Prinzipien der Entspannungspolitik erzielen konnten. Der amerikanischen Neigung zu Abkehr vom Entspannungsdialog setzten sie deutlichen Widerstand entgegen. Die Ungeschicklichkeiten der Menschenrechtskampagne von Präsident Carter balancierten sie einigermaßen aus; und in der Frage der Rüstungskontrolle machten sie so viel Druck, dass im Sommer 1979 wenigstens noch die SALT-II-Vereinbarungen zur Begrenzung der strategischen Rüstung unterzeichnet werden konnten.
Als das westliche Europa gleichwohl in eine prekäre sicherheitspolitische Lage geriet und die amerikanische Regierung nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan das Gespräch mit der Sowjetführung ganz abbrechen wollte, gingen Schmidt und Giscard noch einen entscheidenden Schritt weiter: 1980 fassten sie die Bildung einer deutsch-französischen Militärallianz ins Auge, die Kern einer eigenständigen westeuropäischen Streitmacht im Rahmen der westlichen Allianz sein sollte. Die Bundeswehr sollte auf die taktischen Nuklearwaffen der USA verzichten, dafür ihre konventionelle Kapazität deutlich ausweiten und unter ein gemeinsames Oberkommando mit den französischen Streitkräften treten; gleichzeitig sollte Frankreich den Aufgabenbereich der force de frappe (über die es nach wie vor allein entscheiden würde) auf den Schutz der Bundesrepublik ausweiten. Auf diese Weise wollten der deutsche Bundeskanzler wie der französische Staatspräsident verhindern, dass wachsende Beunruhigung über die Gefährlichkeit der amerikanischen Politik die Deutschen an die Seite der Sowjetunion trieb. Außerdem hofften sie, mit einer solchen Stärkung der europäischen Eigenständigkeit im sicherheitspolitischen Bereich die nukleare Schwelle anheben und so die sicherheitspolitische Situation insgesamt entdramatisieren zu können. Die übrigen westeuropäischen Länder würden sich, davon waren sie überzeugt, der Initiative des deutsch-französischen Führungsduos früher oder später anschließen.
Der ehrgeizige Plan blieb unausgeführt (und vorerst auch der Öffentlichkeit verborgen), weil seine Protagonisten nacheinander ihre Ämter verloren. François Mitterrand, der Giscard d’Estaing im April 1981 ablöste, war zunächst um Rückversicherung nach innen wie nach außen bemüht und konzedierte Schmidt daher vorerst nur einen »vertieften Meinungsaustausch« über Sicherheitsfragen. Als dann die sozialliberale Koalition auseinanderbrach und Helmut Kohl neuer Bundeskanzler wurde, fehlte dem Projekt auch von deutscher Seite die treibende Kraft. Schmidt ging zwar nun mit seinem Vorschlag in die Öffentlichkeit, hatte aber weder in Frankreich noch in der Bundesrepublik die erforderliche Resonanz.
Im Übrigen krankte auch Schmidts Europapolitik an ihrer institutionellen Enthaltsamkeit. Die Regierung Schmidt/Genscher sprach sich zwar grundsätzlich für eine Erweiterung der Rechte des Europäischen Parlaments aus und befürwortete auch den Übergang zur Direktwahl der Straßburger Versammlung; im Übrigen konzentrierte sie ihre Europapolitik aber ganz auf die Arbeit im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Damit trug sie zwar zunächst einmal der Realität Rechnung, die dadurch charakterisiert war, dass Frankreich noch wenig Neigung zur Stärkung der Gemeinschaftsorgane zeigte und in Großbritannien sogar über einen Rückzug aus der Gemeinschaft diskutiert wurde. Gleichzeitig steuerte sie aber auch selbst auf eine Gemeinschaft zu, die nur soweit funktionierte, wie es den übereinstimmenden Interessen Frankreichs und der Bundesrepublik entsprach: Die Autonomie des Rates wollte sie weder durch das Parlament noch durch die Brüsseler Kommission beeinträchtigen lassen. Die Eurosklerose in den öffentlichen Meinungen der Gemeinschaft ließ sich auf diese Weise nicht überwinden; und angesichts der Gefahr eines deutsch-französischen Kondominiums blieb auch das Problem des »Nachziehens« der übrigen Mitgliedsländer ungelöst.
Außenminister Hans-Dietrich Genscher suchte die beiden Probleme dadurch in den Griff zu bekommen, dass er 1981 den Abschluss eines »Vertrags über die Europäische Union« vorschlug. Dieser sollte das politische Ziel der europäischen Einigung bekräftigen, die bestehenden Aktivitäten besser aufeinander abstimmen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in einem überschaubaren Rahmen aufzeigen. Helmut Schmidt betrachtete das Vorhaben von vornherein mit großer Skepsis, und in der Tat ließen sowohl die französische als auch die britische Regierung alsbald ihre Zurückhaltung erkennen. Allein die italienische Regierung war bemüht, das Unternehmen zu einem Erfolg zu führen, wodurch aus Genschers Vorstoß dann die »Genscher-Colombo-Initiative« wurde. Schon im Bundeskabinett wurde aus dem Vorschlag eines Vertrages eine Initiative für eine politische Grundsatzerklärung, und diese erfolgte dann auf dem Stuttgarter EG-Gipfel im Juni 1983 in denkbar unverbindlicher Form.
Angesichts der mangelnden Problemlösungskapazität der Gemeinschaft war es kein Wunder, dass sich der vage westeuropäische Konsens, der die Europa-Diskussion in der Bundesrepublik seit dem Ende der 1950er Jahre kennzeichnete, in der Ära Schmidt weiter verflüchtigte. An den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament, zu denen die etablierten Parteien mit vollmundigen Europa-Bekenntnissen aufwarteten, beteiligten sich eben mal 65,9 Prozent der Wahlberechtigten; und in den Meinungsumfragen sank die Zustimmung zur EG 1981 zum ersten Mal unter die 50 Prozent-Marke. In der öffentlichen Diskussion wurde zunehmend Kritik an der »Künstlichkeit« der Europa-Idee laut. Gleichzeitig setzte eine breite Diskussion um die nationale Identität der Deutschen ein.
Dahinter stand in den seltensten Fällen ein Wiederaufleben der alten Wiedervereinigungshoffnungen, wie man sie im westlichen Ausland häufig diagnostizieren zu müssen glaubte. Vielmehr verleitete das Vakuum, das die geringe Präsenz der Europäischen Gemeinschaften hinterließ, die meisten Deutschen nur dazu, sich wieder vorwiegend mit sich selbst zu beschäftigen. Für eine breite konservativ-liberale Mitte bedeutete dies eine Verstärkung der Status-quo-Orientierung, verbunden mit ideologischen Anleihen aus der nationalstaatlichen Tradition und dem Vorsatz, bundesdeutsche »Realpolitik« zu treiben. Die wachsende Zahl derjenigen, die sich von der prekären Sicherheitslage beunruhigen ließen, entdeckte eine besondere Schicksalsgemeinschaft der beiden deutschen Staaten in der neuerlichen Eskalation des Kalten Krieges und setzte dann zumeist auch, von den französischen Partnern de facto alleingelassen, auf eine besondere Friedensmission der Deutschen. Dabei machten sich wohl auch nationalistische Töne bemerkbar, und bisweilen kam es sogar zu bizarren Bündnissen zwischen traditionellen Nationalisten und radikalen Pazifisten. In der Regel hielt die Friedensbewegung aber durchaus an der gesamteuropäischen Perspektive fest; und aus dem Lager der »Realisten« (zu denen es viele Querverbindungen gab), kamen gleichzeitig eindringliche Mahnungen, nur ja nicht an der bestehenden Westintegration zu rütteln.
Binnenmarkt und Währungsunion
Der verstärkten Status-quo-Orientierung entsprach in den Anfangsjahren der konservativ-liberalen Koalition eine noch stärkere Tendenz, sich in der Europapolitik auf die Konsolidierung des bereits erreichten Integrationsstandes zu beschränken. Die Regierung Kohl/Genscher trat noch energischer als ihre Vorgängerin für eine Beschränkung des Wachstums des EG-Haushalts ein; sie kämpfte erneut (und genauso wenig konsequent wie ihre Vorgängerin) für eine Reform der EG-Agrarordnung, die den Anteil der Agrarausgaben am Gesamthaushalt reduzierte; und sie tat erneut wenig zur Stärkung des Ansehens wie des Einflusses von Kommission und Parlament. Das Projekt einer Währungsunion, von Frankreich und anderen EG-Mitgliedern besonders nachdrücklich verfochten, weil sie sich von der einseitigen de-fact-Abhängigkeit von der Deutschen Bundesbank befreien wollten, wurde nicht nur von den einschlägigen Wirtschafts- und Finanzkreisen als »verfrüht« abgelehnt, sondern auch von der Bundesregierung wiederholt verschleppt. Allein an der Süderweiterung der Gemeinschaft (nach Griechenland, das 1981 hinzugekommen war, nun auch Spanien und Portugal) wirkte Bonn höchst aktiv mit. Freilich ging es dabei nicht nur um die politische Stabilisierung der jungen Demokratien, sondern auch um die Wahrnehmung neuer Exportchancen für die deutsche Industrie.
Eine Lockerung des restriktiven Kurses zeichnete sich erst 1988 ab, als das zwei Jahre zuvor mit der Einheitlichen Europäischen Akte beschlossene Binnenmarkt-Projekt schon Wirkung zeigte. Die Bundesregierung besann sich darauf, dass dieses Projekt allein schon im Hinblick auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht scheitern durfte, und machte ihren Partnern folglich einige empfindliche Zugeständnisse: weitere Ausgabensteigerungen bei gleichzeitiger Produktionsbegrenzung (Flächenstilllegungsprogramm) im Agrarbereich; eine Verdoppelung des Strukturfonds in einem Zeitraum von fünf Jahren; die völlige Freigabe des innergemeinschaftlichen Zahlungsverkehrs und die wechselseitige Anerkennung der Hochschuldiplome. Kohl verwandte große Anstrengungen darauf, die zögernde britische Regierungschefin Margaret Thatcher auf konsequentes Festhalten an dem Binnenmarkt-Projekt zu verpflichten, und hatte damit weitgehenden Erfolg.
Zurückhaltend blieb die Bundesregierung allerdings weiterhin in der Frage einer Europäischen Zentralbank. Lediglich Außenminister Genscher war hier zu raschem Entgegenkommen bereit. Kohl beharrte unter dem Einfluss der Bundesbank auf der Erfüllung von immer rigideren Bedingungen, die die Währungsunion letztlich nur noch nach der Überwindung aller strukturellen Unterschiede in den Volkswirtschaften der Mitgliedsländer zuließen. Ebenso kam das Projekt der deutsch-französischen Sicherheitsgemeinschaft und (daran anschließend) der Politischen Union nur langsam voran. Halbheiten, in diesem Fall auf beiden Seiten, führten dazu, dass in der Einheitlichen Europäischen Akte die Entwicklung einer gemeinsamen Außenpolitik nur vage als anzustrebendes »Ziel« formuliert wurde und dass beim 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Deutsch-französischen Vertrags in sicherheitspolitischer Hinsicht nicht mehr herauskam als die Einrichtung eines deutsch-französischen Verteidigungsrates und einer deutsch-französischen Brigade, die in Süddeutschland stationiert wurde. Damit wurde zwar der sicherheitspolitische Dialog zwischen Frankreich und der Bundesrepublik gefördert und so dafür gesorgt, dass das Ziel der Entwicklung einer westeuropäischen Sicherheitsidentität nicht verloren ging. Von einer inhaltlichen Übereinkunft war man aber noch weit entfernt – nicht zuletzt, weil die Diskussion über diese Problematik in beiden Ländern noch kaum entwickelt war.
Immerhin rückten die Bewältigung der Altlasten, die aus der vermehrten Kompromissbereitschaft, der Rückkehr zu Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat und der Vereinfachung der Verfahren resultierte, sowie die zunehmende Europäisierung aller Lebensbereiche infolge des Binnenmarkt-Projekts die Gemeinschaft jetzt wieder stärker ins Bewusstsein der Deutschen. In ihren Zukunftserwartungen nahm die Gemeinschaft jetzt wieder einen deutlich umrissenen Platz ein, und auch das Vertrauen in die Fähigkeit zur Bewältigung der anstehenden Zukunftsaufgaben nahm wieder zu – wenn auch nicht überall. Ein Teil der politischen Linken, der neutralistischen oder pazifistischen Illusionen müde geworden, begann die europäische Dimension des bundesdeutschen Handlungsspielraums jetzt überhaupt erstmals zu entdecken.
Diese – gewiss noch sehr bescheidene – Relance des Europa-Projekts war insofern von entscheidender strategischer Bedeutung, als mit dem Zusammenbruch der DDR im Winter 1989/90 die deutsche Frage mit einem Mal wieder auf der Tagesordnung stand und den Deutschen damit eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Neuordnung des europäischen Kontinents zufiel. An ihnen lag es, ob es wieder einen deutschen Nationalstaat geben würde oder ob man gleich zur Föderierung ganz Europas überging, ob sich dieser Staat von den europäischen Bindungen lösen oder sie verstärken würde, ob er wieder hegemoniale Qualitäten annehmen würde oder diese in einer europäischen Ordnung transzendiert werden könnten.