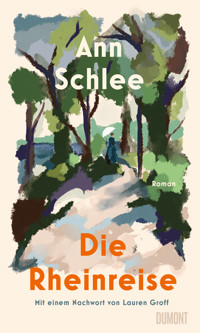
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1851: Nur drei Jahre, nachdem Arbeiterrevolten Europa im Kern erschüttert haben, kehren die ersten englischen Touristen auf den Kontinent zurück. Sie legen in Baden-Baden ab und fahren mit dem Schaufelraddampfer das für seine romantischen Landschaften berühmte Rheintal hinunter. Neben Franzosen und deutschen Familien befinden sich auch Reverend Charles Morrison mit Frau und Tochter sowie seine unverheiratete Schwester an Bord: Charlotte, eine scheinbar sanftmütige Frau mittleren Alters, hat ihr Leben damit verbracht, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Doch wie der Fluss, auf dem die Gesellschaft reist, birgt auch Charlottes Seele verborgene Abgründe. Als sie in Koblenz einem fremden und doch eigentümlich vertrauten Mitreisenden begegnet, wird sie in einen Strudel aus verdrängten Erinnerungen und unterdrücktem Verlangen gestoßen. Ein so zarter wie eindringlicher Roman über Reue und unerfüllte Träume, aber auch über die Hoffnung, entgegen gesellschaftlichen Widerständen selbstbestimmt zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im Sommer 1851 begleitet Charlotte Morrison die Familie ihres Bruders auf einer Dampfschiffsreise von Baden-Baden bis nach Köln. Nach den Unruhen der Revolution von 1848 kommen englische Touristen wie sie wieder in den Genuss der romantischen Landschaften des Rheintals. Erst vor Kurzem ist Charlottes Großonkel verstorben, dessen Haushälterin sie lange Jahre war. Mit dem Geld, das er ihr vermacht hat, steht sie vor einem Neuanfang. Allerdings scheint es nahezu unumgänglich, dass sie als ledige Frau zu ihrem Bruder, einem frommen Reverend, und seiner Familie zieht. Bereits an Bord des Schaufelraddampfers zeigt sich, dass man in ihr vor allem die Kammerzofe und Gouvernante der siebzehnjährigen Ellie sieht, die Charlotte wie ihr eigenes Kind liebt. Dass ihr selbst einst verwehrt wurde, eine eigene Familie zu gründen, wird Charlotte wieder schlagartig bewusst, als sie in Koblenz einen fremden und doch seltsam vertrauten Mann unter den Mitreisenden entdeckt. Und plötzlich werden schmerzhafte Erinnerungen und unterdrückte Sehnsüchte in ihr wach. Denn wie der Fluss, auf dem die Gesellschaft reist, birgt auch Charlottes Seele verborgene Abgründe.
Ein so zarter wie eindringlicher Roman über Reue und unerfüllte Träume, aber auch über die Hoffnung, entgegen gesellschaftlicher Widerstände selbstbestimmt zu leben.
© Jerry Bauer
Ann Schlee wurde 1934 in Connecticut geboren und verbrachte Teile ihrer Kindheit in Ägypten, Eritrea und im Sudan. Sie schrieb Kinderbücher, ehe 1981 mit ›Die Rheinreise‹ ihr erster Roman für Erwachsene erschien. Im selben Jahr stand der Roman auf der Shortlist des Booker Prize. 2023 verstarb Schlee im Alter von 89 Jahren.
Werner Löcher-Lawrence, geboren 1956, ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Er übertrug u. a. Meg Wolitzer, Benjamin Myers, Nathan Hill und Hilary Mantel ins Deutsche.
ANN SCHLEE
Die Rheinreise
Mit einem Nachwort von Lauren Groff
Roman
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Die englische Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel ›Rhine Journey‹ bei Macmillan London Ltd, London. Copyright © Ann Schlee, 1981Nachwort © Lauren Groff, 2024
E-Book Auflage 2025© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected] Rechte vorbehalten.Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44 b UrhG behalten wir uns explizit vor.Übersetzung: Werner Löcher-LawrenceUmschlagabbildung: © Holly OvendenUmschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, KölnSatz: Angelika Kudella, Köln E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN E-Book 978-3-7558-1127-5
www.dumont-buchverlag.de
Für meine Begleiter auf dem Rhein im Sommer 1977
Historische Anmerkung
Besucher des rheinischen Preußen fanden im Sommer 1851 vieles, das sie bezauberte, aber auch etliches, das sie verurteilten. Besonders die Briten, die so sehr auf ihre eigenen nationalen Freiheiten bedacht waren, wetterten gegen die Macht der preußischen Polizei, die Pressezensur und die Beschränkungen, die der protestantischen Kirche auferlegt worden waren.
Viele Bürger im Rheinland hätten ihnen zugestimmt; es war bitter für sie, infolge der Revolution von 1848 jene Freiheiten beschnitten zu sehen, auf deren Erweiterung sie gehofft hatten. Einigen der offeneren Kritiker Friedrich Wilhelms IV. drohte die Verhaftung.
Karl Marx floh 1848 aus Köln und ließ sich in London nieder. Als 1850 einer der Genossen aus dem Bund der Kommunisten aus dem Gefängnis floh, drängte Friedrich Wilhelm seinen Ministerpräsidenten, die Angriffe auf die Arbeiterbewegung zu intensivieren. Es wurden Gerüchte verbreitet, dass internationale revolutionäre Kräfte einen Anschlag auf die Great Exhibition, die erste Weltausstellung 1851 in London, planten. Häfen und Bahnhöfe wurden sorgfältig überwacht. Versuchten umstürzlerische Arbeiter nach England zu entkommen? Im Juni war die Mehrheit des Bundes der Kommunisten verhaftet und wurde im Oktober 1852 in Köln vor Gericht gebracht.
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Vorgänge die Morrisons beunruhigten oder dass sie sich ihrer überhaupt bewusst waren. Sie unternahmen die Reise um Marions willen, die eine Kur in Baden-Baden machte, und um auf dem Rückweg den romantischen Rhein, die Früchte überlegter Lektüre und das Spiel der eigenen Fantasie zu genießen. Die beschriebenen Ereignisse bilden jedoch den Hintergrund ihrer Sommerreise.
Eins
DER ANLEGER VON KOBLENZ
»Das Gepäck ist einfach auf Deck liegen geblieben«, sagte Reverend Charles Morrison. »Ich dachte, du hättest darauf aufgepasst, Charlotte.«
Charlotte, seine Schwester, für deren Sommerurlaub er großzügig aufkam (was ihr in diesem Moment überaus bewusst war), sagte: »Aber du hast mich doch nicht darum gebeten.«
»War es nötig, dich zu bitten? Ich nahm an, als du hinauf an Deck gegangen bist, dass du nach dem Gepäck sehen wolltest, weil du wusstest, dass ich anderweitig beschäftigt war.«
Denn er hatte zur Erbauung der Mitreisenden Traktate verteilt. Sie konnte einem Blick auf die schwarze, über seiner Schulter hängende Samttasche nicht widerstehen und wusste das Gefühl von Erleichterung darüber, dass sie leer war, nicht zu unterdrücken. Über das Gepäck sagte sie: »Ich bin überzeugt, dass es recht sicher ist.«
»Im Gegenteil, du hast keinerlei Anlass, irgendeine Sicherheit zu empfinden. Wir sind oft genug vor den Diebstählen auf dem Rhein gewarnt und Zeuge der extremen Pflichtvergessenheit der Schiffseigner geworden. Ich habe dir bereits erklärt, Charlotte, dass der Kapitän mit den Dieben unter einer Decke stecken könnte. Es ist unsere Pflicht, zu allen Zeiten auf die Besitztümer anderer und auch die eigenen aufzupassen.«
Sie liebte ihn, hatte ihn immer schon geliebt, wusste jedoch, dass er nun einmal wie eine Laterne war, die bewusst hier- und dorthin schwenkte, alles absuchend, und gleich noch ein zweites Mal. Wäre es nicht das Gepäck, wäre es etwas anderes. Bald schon würde er auf den Allmächtigen kommen. Rasch ließ sie den Blick von seinem Gesicht auf die näher kommende Stadt Koblenz gleiten. Solide gelbe, in der späten Abendsonne leuchtende Mauern schienen unsicher auf ihren flimmernden Spiegelbildern zu balancieren. Sie wagte jedoch nicht, lange wegzusehen.
»Schließlich sagt uns der Allmächtige, zuallererst uns selbst zu helfen. Erst wenn wir unsere Unfähigkeit zur Gänze bewiesen haben, kommt Er mit Seiner Huld und Gnade zu Hilfe.«
»Aber was«, fragte sie vorsichtig, »soll ich denn jetzt wegen des Gepäcks unternehmen?«
Nichts konnte Mr Morrisons Argumentation beschleunigen. Das Deck krängte ein wenig unter der Last der Passagiere, die sich an die dem Ufer zugewandte Reling drängten. Einige von ihnen winkten, wie sie sah, mit ihren Traktaten zum heranrückenden Land hinüber. Andere benutzten sie als Fächer, war der Abend doch schwül. Wobei viele der Blätter, so sagte sie sich, sorgsam zusammengefaltet in ein Pompadour oder eine Rockschoßtasche gewandert waren, um erst später ernsthaft studiert zu werden. Sie hoffte inständig, dass er die ein oder zwei nicht gesehen hatte, die an ihnen vorbei über das Deck geweht waren. Aber das hatte er nicht.
Er hielt als Einziger der Stadt den Rücken zugewandt. Graue Haarsträhnen wurden unter der Krempe seines Hutes hervorgeblasen. Sein strenges, einfaches Gesicht war wettergegerbt wie die der Feldarbeiter, um die er sich sorgte, der Blick seiner blauen Augen fest auf einen Ort gerichtet, den niemand, soweit Charlotte wusste, je würde betreten dürfen. Er dozierte weiter über die Gnade Gottes, bis ihr der Gedanke kam, dass er sich vor einer weiteren neuen Stadt fürchten mochte und Trost brauchte.
Sie legte ihm eine Hand auf den Arm und sagte: »Ich werde sehen, ob mit dem Gepäck alles in Ordnung ist. Sag du Marion und Ellie, dass wir angekommen sind.«
Mit einer Aufgabe versehen, ging er gleich los, während sie auf Deck zurückblieb, das zu voll von weiten weißen Röcken der weiblichen Passagiere war, als dass sie sich zu ihrem Gepäck vor dem Mast hätte durchdrängen können. Aber von Natur aus optimistisch und daran gewöhnt, dass Menschen, denen eine Verantwortung übertragen war, sie unfehlbar erfüllten, teilte sie die Bedenken nicht, dass die starken jungen Männer, die mit Stricken um das Gepäck herumstanden, es unsachgemäß an der Bordwand herunterlassen könnten, wo sie es anschließend in Empfang nehmen würden.
Nahe bei ihr wurde ein Platz an der Reling frei. Sie trat vor, legte ihre behandschuhten Hände auf das polierte Holz und sah hinunter auf die Szenerie, die sich ihr dort darbot.
Es war in diesem Moment – als das Pochen und Vibrieren der Maschine verstummte, die Messingglocke ihre Ankunft verkündete und das Dampfschiff gegen den Anleger stieß –, dass Charlotte einen plötzlichen heftigen Schmerz genau da empfand, wo sie, wie man es sie gelehrt hatte, ihr Herz wähnte.
Die Menge an Land starrte herauf zu den Passagieren. Gerade noch waren ihre Gesichter nicht mehr als blasse Umrisse zwischen den weißen Kopftüchern von Landfrauen und einer Ansammlung Pickelhauben gewesen, deren Messingspitzen im letzten Sonnenlicht aufblitzten, schon wurden daraus einzelne nach oben gewandte, suchende Augen und Münder. Der Schmerz trieb ihr Tränen in die Augen, sodass die Szenerie verschwamm und zu zerlaufen begann, als wären unsichtbare Schwaden eines aufflammenden Brandes zwischen sie und das Ufer getreten. All das, weil sie neben dem Bereich, der für die Gangway frei gemacht wurde, zum ersten Mal seit zwanzig Jahren das Gesicht eines Mannes namens Desmond Fermer entdeckt hatte.
Erstaunt über den Schmerz, klammerte sie sich an die Reling. In den letzten Jahren hatte sie in Momenten des Selbstmitleids ob ihres gebrochenen Herzens kaum noch etwas für ihn empfunden, und jetzt wurden ohne Vorwarnung all die langjährig über die Wunde gebreiteten Verbände angesichts des schwarzen Rocks, des hohen Hutes und des schweren, gut aussehenden Gesichts, das, wie es schien, zu ihr heraufsah, aufs Grausamste heruntergerissen.
Natürlich war er es nicht. Das wusste sie gleich. Der Mann dort unten war in ihrem Alter, höchstens Mitte vierzig. Desmond Fermer musste jetzt sechzig sein, alt, beleibt, grau, vielleicht war er sogar schon tot. Da er es nicht war, wusste sie, dass der Mann dort unten auch nicht zu ihr hinaufsah. Dass er, als er den Hut lüftete, lächelte, Dinge rief, die unter den Rufen der die Gangway sichernden Männer verloren gingen, den Blick nur scheinbar auf sie gerichtet hielt, dass es nicht sein konnte, dass er sie ansah.
Schon antwortete eine Frauenstimme direkt neben ihr auf Englisch: »Hier, Edward, hier«, und als Charlotte den Kopf wandte, sah sie eine kräftige, hübsche Person mit zwei großen Söhnen, die ebenfalls winkten. Ihr Mann. Andere Leute. Egal.
Beine bewegten sich auf Kommando, erinnerten sich an die erhöhte Schwelle der Kabinentür, »Oh, entschuldigen Sie bitte«, zu einer Französin, die sie streifte. In der übervollen Kabine beugte sich eine Reihe Damen dem langen Wandspiegel entgegen, der den Raum einfasste. Ihre Röcke hoben sich hinten, und obwohl sie miteinander redeten, waren ihre Gesichter konzentriert, und ihre Hände bemühten sich um unmerkliche Korrekturen. Charlotte trat zwischen sie, und vor ihr im Spiegel erschien, was sie als ihr Gesicht zu akzeptieren gelernt hatte. Sie betrachtete es leidenschaftslos und fragte sich, ob es bereits etwas von der Zerrüttung zeigte, die sie innerlich verspürte. Offenbar nicht. Offenbar sandte sie das gleiche Signal an die Welt, das sie schon an all den letzten Tagen ausgesandt hatte – die dunklen Augen, das glatte Haar, die gerade Nase und die ordentliche Haube sagten faktisch: »Respektiert mich und lasst mich durch.«
Als nun plötzlich das Gesicht ihrer Schwägerin neben ihr im Spiegel erschien, kam es ihr vertrauter als das eigene vor, eingehender betrachtet über all die Jahre.
»Da bist du ja«, sagte Marions Stimme, und Charlotte, sich selbst der geringsten Betonung bewusst, antwortete, ohne ihr den Kopf zuzuwenden: »Ja, ich habe unsere Ankunft beobachtet.«
Sie beobachtete, wie Marion sich musterte, aufmerksam, das Kinn sanft zurückgezogen, während sie automatisch all die sinnlosen Dinge tat (die sich überall um sie herum wiederholten), mit denen man sich auf das Betreten eines neuen Ortes vorbereitete. Ein Zupfen an beiden Seiten des Kragens, das Haar unter dem Rand der Haube glatt streichen, ein schnelles Ziehen an den Fingerenden der Handschuhe, und die ganze Zeit über arbeitete ihr kleiner Mund in ihrem weichen, runden Gesicht.
Die Hotelfassade wirkte recht ansehnlich. Aber war es vielleicht nicht zu laut so nah am Fluss? Und wenn das Haus auch sauber und ordentlich aussah, musste es drinnen nicht unbedingt ebenfalls so sein, oder? Solange es nur nicht wie in Heidelberg war. Sie zog das faltige Kinn ein, wandte den Kopf und presste die Lippen aufeinander. Sie glaubte nicht, dass Charles eine solche Tortur nervlich noch einmal durchstehen würde. Charlotte fühlte sich in ihren Gewissheiten bestärkt. Wie albern von mir, dachte sie und sagte mit weicher Stimme: »Und du, meine Liebe, wie fühlst du dich? Ich hatte noch keine Gelegenheit, dich heute zu fragen.«
»Müde natürlich«, sagte Marion auf ihre reizend resignierte Art. Sie fing Charlottes Blick im Spiegel auf, und ihr kleiner Mund sandte ein strenges kleines Lächeln aus. »Aber es gibt im Moment so viel Wichtigeres als meine Gefühle.«
Darauf gab es natürlich keine Antwort, nur das Bedürfnis weiterzukommen. Auf Reisen muss alles Punkt für Punkt durchgegangen werden. Handschuhe, Schultertuch, Pompadour, Marions karierte Reisedecke, ihr roter Reiseführer, der nicht auf dem roten Plüschsitz liegen bleiben sollte. Sie folgte Marion durch die Kabine. »Denk an die Schwelle«, sagte sie und hob die Hand, um sie leicht an der Schulter zu fassen.
Die ersten Passagiere schoben sich bereits langsam die Gangway hinunter. Gepäck hing an Seilen. Angesichts der Aussicht auf so viel Neues war es unmöglich, nicht zu hoffen und den Hals zu recken, um die großen Buchstaben des Hotels zwischen den Fensterreihen zu betrachten, nicht hinunter zu den wartenden Menschen am Anleger zu blicken, verändert jetzt wie das Muster eines Kaleidoskops, befreit von Geistern.
Vor ihr hob Marion sich auf die Zehenspitzen, um erst über die eine, dann die andere Schulter eines Gentlemans zu blicken. Ihre behandschuhte Hand fuhr hoch über ihren Kopf.
»Siehst du sie?«, fragte Charlotte.
»Ich dachte es. Oh ja, doch, da sind sie.« Marion rief ihren Mann und ihre Tochter, aber mit so zarter Stimme, dass die sie nicht hören konnten: »Charles, Ellie!« Sie waren in gegenläufigen Strömungen gefangen, die an der Gangway zusammentrafen. »Was die Eile soll«, sagte Marion, »werde ich nie begreifen«, stand aber schon wieder auf den Zehenspitzen und reckte die Hand, als könnte sie sich an dem mächtigen schwarzen Hut vorbeidrängen, hinter dem sie feststeckte.
Jetzt konnte Charlotte sie auch sehen, ihren Bruder, dessen Haar im Wind wehte und der in unerfindlichen Gedanken den Mund fest geschlossen hielt, und an seiner Seite, sich reckend, Ellie, ihre Nichte – aber in ihrem Herzen ihr eigenes Kind – mit dem hellen Haar, das unter der Haube hervordrängte, voller Leben, aufgeregt, die Energie aus allen um sich herum heraussaugend. Während sie langsam aufeinander zutrieben, rief sie: »Oh, Charlotte, sieh doch, die Brücke«, und als sie oben an der Gangway zusammentrafen, zog Ellies starke, warme Hand Charlotte zum Bug des Dampfers.
»Charlotte«, sagte sie voller Gefühl ins Ohr ihrer Tante. »Ich fühle mich so merkwürdig.«
»Warum? Was ist?«
»Es ist dieser Ort hier.«
»Aber wir sind doch gerade erst angekommen.«
»Ich weiß. Spürst du es nicht?«
»Nein«, sagte Charlotte. »Alles scheint sich immer mehr anzugleichen.«
»Bist du nicht glücklich? Genießt du es nicht?«
»Doch. Natürlich.«
»Nun, spürst du es dann nicht?«
»Nur, dass dies wieder ein neuer Ort ist.«
»Ich habe das äußerst merkwürdige Gefühl, dass hier etwas mit mir geschehen wird. Ich sollte es nicht mal dir sagen, weil ja doch nie wirklich etwas geschieht und du mich mit Sicherheit auslachen wirst, wenn wir weiterfahren, und es war nichts. Aber es kam so plötzlich, dieses Gefühl, als wir uns dem Anleger näherten, und alle sahen hoch zu uns, das Gefühl, dass sie alle gekommen waren, um mich zu sehen, und ich habe Ausschau gehalten nach einem Gesicht, das es mir erklären würde.« Von der eigenen Torheit überwältigt, verbarg sie ihr Gesicht zwischen Hals und Schulter ihrer Tante.
Aber Charlotte war ernst gestimmt. »Und, hast du solch ein Gesicht gefunden?«
»Nein, natürlich nicht.« Doch dann setzte sie nach. »Sag mir, denkst du je, das jetzt ist der eine Moment? Das bin ich? Das gilt mir?«
»Nicht mehr.«
»Oh, du machst dich so alt.«
Tatsächlich konnte Charlotte sich noch genau daran erinnern, im Zentrum des Universums zu stehen, auf dem Gipfel der Zeit. Mittlerweile schien sie sich ein wenig seitlich zu befinden und ihr Bewusstsein auf keinen bestimmten Zeitpunkt beschränkt. Lichter gingen an in der Stadt und gaben ihr Tiefe, deuteten auf versteckte Gassen und plötzlich im Licht erscheinende Leben, bevor die Vorhänge zugezogen wurden. Früher hätten sie winzige Fäden mit all den Fenstern und all den Leben dahinter verbunden, heute wusste sie, dass die Straßen aus einem dichten Element bestanden, undurchlässig für Geist und Gedanken, einem Element, in das sie eindringen und aus dem sie dankbar wieder hervortreten würde, ohne Einfluss zu nehmen oder beeinflusst worden zu sein. Ellie jedoch musste noch glauben, dass die Stadt auf sie reagierte, sie anzog, von ihr nehmen und ihr geben wollte.
Sie standen ganz vorne am Bug des Dampfers, umgeben von einem kalten, wilden Flussgeruch. Links am Anleger waren einige kleine Boote festgemacht. Dahinter erhoben sich die bleichen weißen Fassaden der Hotels über die gelben Stadtmauern. Und direkt vor ihnen lag das, was Ellie ihr zeigen wollte. Eine Reihe flacher Lastkähne, die einen Übergang auf sich trugen, über den sich zu dieser Abendstunde vom Markt zurückkehrende Bauern drängten. Sie konnten die weißen Tücher der Frauen sehen, die leeren Rucksäcke auf den Rücken der dem anderen Ufer zustrebenden Männer, denen ein Wirbel blauer Uniformen entgegenkam, glitzernde Helme der Offiziere und Männer von der Festung Ehrenbreitstein, die den Abend in der Stadt verbringen wollten.
»Oh, ich wünschte, wir wären aus der anderen Richtung gekommen, dann hätten sie für uns aufmachen müssen.« Und weil sich die Welt in diesem Sommer dazu verschworen hatte, ihr genau das zu bescheren, was sie sich wünschte, fiel am Ufer ein Schuss, der die beiden zusammenfahren und sich noch fester bei den Händen fassen ließ.
»Oh, sieh doch nur, sieh doch«, rief Ellie, denn die Schranken gingen herunter, und der Strom der Menschen wurde hinter ihnen aufgehalten. Die beiden Kähne in der Mitte trennten sich, und gegen die Strömung den Fluss heraufkommend, sahen sie ein kleines Dampfschiff, eines wie ihres, wahrscheinlich aus Köln, wo sie in einer Woche den Höhepunkt ihrer Reise erreichen würden.
So standen sie da und sahen zu, wie der Dampfer vorbeifuhr und die Brücke sich wieder schloss. Und immer noch Hand in Hand gingen sie zurück und die Gangway hinunter in die wartende Stadt.
Zwei
DIE TABLE D’HÔTE
Nicht nötig, nach meinem Namen zu fragen. Nicht nötig, diskret Erkundigungen nach meinen Lebensumständen anzustellen, mit welcher Art von Gesellschaft ich mich umgebe, nach all den wesentlichen Dingen, welche die Welt wissen muss, bevor sie sich entscheiden kann, ob sie jemanden mag oder nicht. Nein, ich bin einfach die Frau dir gegenüber in der Kutsche nach Basel, drei Plätze weiter an der Table d’Hôte in Heidelberg. Du musst mich aus einem Impuls heraus mögen oder nicht mögen, denn morgen bin ich schon wieder weg. Genieße also schnell meine schönen grauen Augen, welche die Leute immer noch bewundern, meine ruhige, bescheidene Natur, die es mir nicht erlaubt, die Stimme zu erheben, danach zu verlangen, das Fenster zu öffnen oder dir meine Meinung über den Ausblick aufzudrängen.
Dafür bitte ich dich, nicht darüber zu spekulieren, ob mein hübsches braunes Seidenkleid ein Geschenk meiner Schwägerin ist, hastig enger gemacht, um es meiner weniger üppigen Figur anzupassen, und auch nicht, ob die Hand in meinem eleganten Handschuh beringt ist oder nicht. Halte mich, wenn du magst, für eine ungezwungene Witwe und das strahlende Gesicht an meiner Seite, das, wie man sagt, meinem ein wenig ähnelt, womöglich für das meiner Tochter. Stell keine Fragen und lass mich vorbei.
So Charlotte Morrison zu ihrem Tagebuch auf einer frühen Station ihrer Reise, als die Frische des Neuen sie noch erfüllte und die Sorgen und Pflichten ihres einstigen Lebens in ihrer Erinnerung immer noch ausreichend gegenwärtig waren, um sich ihres Fehlens genussvoll bewusst zu sein. Jeden Morgen beim Aufwachen spürte sie ihr Gewicht, das sich in ihren Träumen zurückgemeldet haben mochte, nur um zu bemerken, wie es sich hob und wieder verschwand, sodass sie federleicht über dem Bett schwebte, unfähig, sich vorzustellen, was sie während des Tages alles zu Gesicht bekommen würden.
Erst an jenem Abend in Koblenz, als sie sich in einer Ecke des Spiegels sah, der sich ganz den Reizen der sich die Haare bürstenden Ellie hingab, sehnte sie sich plötzlich nach den sicheren Grenzen ihres Zuhauses, den harten Rändern ihrer alten Identität.
Sie saß ein wenig hinter dem Frisiertisch, bei offenem Fenster, und nähte einen stoffbezogenen Knopf an den Bund von Ellies Unterrock. In einer Stunde würde eine Glocke erklingen, und sie mussten dem Gang hinunter zur Table d’Hôte ins Auge sehen. Gesichter würden sich gleichgültig in ihre Richtung wenden, sie nicht kennen und wieder abwenden. An diesem Abend wünschte sie zum ersten Mal, dass man sie gleich als Miss Morrison erkennen würde.
Miss Morrison, deren Bruder der Priester von Melbury war, die dem Reverend und sehr alten Mr Ransome in Ditchbourne vierundzwanzig Jahre als Haushälterin gedient und ihn bis zu seinem Tod gepflegt hatte, den schwachen, sterbenden alten Mann, der seine knochigen Finger um ihre gelegt und sie gefragt hatte, ob sie ihn liebe. »Ja«, hatte Miss Morrison gesagt. »Ich liebe Sie.« Unter den Umständen war es wahr genug gewesen.
Miss Morrison, die mit einem großen Weidenkorb am Arm durch das Dorf lief, die in der Schule unterrichtete, die von den Armen toleriert wurde, weil sie auch in ihr eine Art Armut sahen, und die sich manchmal so vergaß, dass sie laut lachte, wenn sie die Hühner von der Straße vertrieb.
Diese Person, wusste Charlotte, war nicht ganz sie selbst, sondern von Menschen geschaffen, deren Druck sie vermisste. Denn aus einer plötzlichen morbiden Laune heraus schien sie gerade dort, wo sie diesen speziellen Druck verspürte, selbst zu beginnen. So nähte sie ihren Knopf an. In weniger als zwei Wochen würde sie wieder zu Hause sein, aber selbst das Wort war mit Vorsicht zu gebrauchen. Der alte Mr Ransome hatte ihr, wie sich herausstellte, genug hinterlassen, um unabhängig zu sein, ihre Bleibe und ihren Beruf jedoch mit sich genommen. Sie führte den Faden wieder und wieder durch die Ösen des Knopfes. Wer sie sein und wo sie wohnen würde, musste noch beschlossen werden. Sie war nicht sie selbst. Der Anblick dieses Gesichtes auf dem Anleger hatte sie tief erschüttert, denn was war sie für ihn und was war er, ein völlig Fremder, für sie? Jenes Gefühl des Schmerzes, ausgelöst durch die Erinnerung an die körperliche Gewalt gegen etwas Jungfräuliches, Ungelöstes vor zwanzig Jahren, die Trennung in der Stube der Mühle, das Geräusch des Wassers, nichts gesagt, nichts zugegeben. Es schien eine Bestätigung, dass es so gewesen war, wie sie es empfunden hatte. Nicht, wie andere es ihr erklärt hatten. Sodass die Gefahr bestand, dass sie dachte, wenn es so war, dann könnte … Sie beugte den Kopf und biss den Faden ab.
Es ist eine der großen Tröstungen des Familienlebens, dass derartige Gedanken nie bis zu ihren Schlussfolgerungen vordringen. Es gibt immer eine Unterbrechung, und wie schnell die ganze Struktur der Dinge unterminiert wird. Gleich gab es Essen, und sie mussten sich für das Erscheinen an der Table d’Hôte fertig machen.
Da sagte Ellie vom Frisiertisch: »Ich bin müde. Ich mag nicht nach unten gehen.« Also fürchtete auch sie den Gang die Treppe hinunter, die zu ihr hochgewandten Gesichter, die unbekannten Worte. Umso mehr Grund, sich auf dem kleinen goldenen Stuhl vorzubeugen und mit angenehmer Stimme zu sagen: »Aber das hier soll doch ein besonderer Ort für dich sein.«
»Ich wusste, du würdest mich auslachen, wenn ich das sage. Es war nur ein Scherz. Nie geschieht irgendetwas.«
»Fühlst du dich unwohl?« Denn sie sah etwas blass aus.
»Nur Mama darf sich unwohl fühlen.«
»Oh, Ellie. Wie kannst du nur!« Jetzt war sie einfach leidig.
»Dich kümmert sie nicht. Du findest dich mit allem ab. Ich nehme an, das musst du.«
Sie sagte nichts dazu, sondern kam und trat hinter ihre Nichte, legte die Hände auf die Lehne des Stuhls und sah sie an. Ellie fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht und schob das wilde, wollige Haar zurück, das sich schwer über ihre Schultern breitete. »Ich gehe nach unten, wenn ich mir das Haar hochstecken darf. Ja?«, sagte sie, wandte sich um und sah Charlotte trotzig an, die ihr nicht geantwortet hatte.
»Da musst du deine Mama fragen.«
»Ich frage dich. Ich frage dich, was du dazu sagst. Denkst du nicht, es sieht hochgesteckt viel schöner aus?« Und sie drehte sich wieder weg und schmollte zustimmend ihr Spiegelbild an.
»Nein. Ich mag dich, wie du bist.«
Ein geringschätziger Blick traf sie aus dem Spiegel.
»Nun, dann frag deine Mutter.«
»Aber warum?«
»Du willst es nur nicht, weil du weißt, dass sie Nein sagt.«
»Du könntest mir zur Seite stehen.«
»Oh, Ellie, verärgere sie nicht. Verdirb ihr nicht den Abend.«
»Warum sollte es ihr den Abend verderben, mich glücklich zu machen?« Aber ihre Stimme, erst fast leidenschaftlich, verstummte. Sie hörten beide, wie sich die Tür des äußeren Salons öffnete, und einen Moment später sahen sie, wie sich der Messingknauf ihrer Schlafzimmertür drehte. Ellies Mutter kam herein.
Für das Abendessen hatte sie ein dunkles Seidenkleid angezogen. Eine Frau, wie Charlotte wusste, in ihren Fünfzigern, doch wer, der es nicht wusste, würde das annehmen? Ihr wunderschönes Haar war kaum verblichen und besaß immer noch das tiefkupferfarbene Rot, das sie auch ihrer Tochter vermacht hatte. Das Runde, das sie in ihrer Jugend hatte älter wirken lassen, ließ sie heute jünger erscheinen. Die vollen Wangen und das Kinn zeigten kaum ein Absacken oder Falten, nur unter den Augen sammelte sich ihre schöne saubere Haut wie zu einer winzigen Musselingardine, was ihr ein überraschtes, leicht heiteres Aussehen verlieh, das so gar nicht zu ihrem entschlossenen kleinen Mund passen wollte.
»Seid ihr zwei fertig?«
Ihre Anwesenheit im Raum gewährte eine sichere Rückkehr zur rechtmäßigen Machtverteilung. Charlotte zog sich, während Marion sprach, auf ihren Platz am Fenster zurück und nahm wie automatisch den Unterrock in die Hand, obwohl ihre Aufgabe doch erledigt war. Sie sagte: »Ellie hat gefragt, ob sie ihr Haar hochgesteckt tragen darf.«
»Warum gerade heute Abend?« Marion Morrison beugte sich an ihrer Tochter vorbei, um die Dinge auf dem Frisiertisch zurechtzurücken, sah ihre Schwägerin im Spiegel an und sagte: »Du besserst doch hoffentlich nichts für sie aus. Sie ist sehr wohl selbst dazu in der Lage. Du sollst hier nicht die arme Verwandte geben, liebe Charlotte, besonders, wo du es nicht mehr bist.«
»Ich hätte es gern ausnahmsweise mal anders«, sagte Ellie.
»Genügt dir nicht jeden Tag ein anderer Ort? Mir reicht das völlig.«
»Aber dein Haar ist auch oben.«
»Nun, in meinem Alter kann ich es kaum offen tragen.« Ihr Lachen kam leicht und bezaubernd und schloss Charlotte konspirativ mit ein. Marion war eine Frau, die andere Frauen mochten. Charlotte war das oft schon aufgefallen.
Wahrhaftige Tränen stiegen Ellie in die Augen. »Ich bin siebzehn.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, sagte ihre Mutter.
»Sarah Wentworth hat ihr Haar mit siebzehn hochgesteckt getragen. Alle tun es.«
»Alle sind nicht meine Tochter.«
»Ach, egal«, rief Ellie, fegte zornig die Nadeln und Kämme auf dem Tisch vor ihr zur Seite und ließ den Kopf auf die Arme sinken.
»Wie lange ist sie schon so?«, fragte Marion kühl.
Charlotte antwortete aus ihrer Ecke: »Sie ist müde.«
»Ich bin nicht müde.«
»Vielleicht wäre es besser, wenn sie heute Abend nicht mit nach unten käme«, sagte Charlotte. »Ich kann bei ihr bleiben.«
Aber das wollte Ellie auch nicht. Sie drehte den Kopf seitlich auf ihren Arm und sah ihre Mutter vorsichtig an.
»Natürlich wird sie uns begleiten. Sie sagt, sie ist nicht müde, aber selbst wenn sie es wäre, Frauen müssen lernen, ihre kleinen Müdigkeiten und Leiden zu verstecken«, und hier fuhr Marion sich mit den Fingerspitzen über die Stirn, als wiese sie unbewusst auf solch ein Versteck hin. »Vielleicht sollte ich dir erlauben, dein Haar heute Abend hochgesteckt zu tragen, und wenn nur, um dich daran zu erinnern, dass du nicht mehr darauf hoffen kannst, Mitgefühl zu gewinnen, wenn du dich wie ein Kind benimmst. Ich werde dich frisieren und erwarte, dass du dich nicht wie ein kleines zurechtgemachtes Mädchen aufführst.«
Mit geschürzten Lippen, das Kinn zurückgezogen, machte sie sich an ihre Aufgabe, und alle sahen mit ernster Miene zu, wie der Ritus vollzogen, das Haar gebündelt und festgesteckt wurde. Im Spiegel verfolgten sie, wie das kleine Gesicht aus seinem hellen, schützenden Dickicht hervorgeholt wurde. Sie beobachteten, wie es die Reste der Kindheit ablegte, vortrat und einen verhaltenen, abwartenden Ausdruck annahm.
Es erschien Charlotte wie ein grausamer Irrtum, eine Verwandlung von allem, was besonders an Ellie war, in etwas ohne Geheimnis, das jeder mit einem Blick zu erfassen glauben mochte. Marion musste den Versuch jeden Moment abbrechen, doch als sie ihrer Schwägerin ins Gesicht sah, war da kein Missfallen, sondern nur eine verzückte Befriedigung. Als sie fertig war, lächelte sie und klatschte sanft in die Hände. »Dreh dich um«, rief sie erfreut, und da sie Charlotte mit keinem Blick konsultierte, musste es wohl sie selbst sein, zu der sie nachsichtig sagte: »Es kann keinen Schaden anrichten. Es ist nicht so, als würde man uns hier kennen. Komm, dreh dich um und lass uns dich bewundern.«
Ellie, aus ihrer schlechten Laune geholt, wandte sich ihnen schüchtern zu.
»Ah«, sagte ihre Mutter und beugte sich mit einem schnell taxierenden Blick zur einen, dann zur anderen Seite. »Ah.« Aus irgendeinem Grund war sie sehr zufrieden. Sie streckte eine Hand aus und legte sie um Ellies Wange. Die Geste wirkte weniger wie die Berührung eines Menschen, sondern eher eines wohl gelungenen Artefakts, und dem entsprach auch ihr befriedigter Ausdruck. Was Ellie erröten und den Blick senken ließ.
»Nun, Charlotte?«
»Ich mochte sie, wie sie vorher war.«
»Oh, Charlotte, wie verstimmt du bist«, rief Ellie, und vielleicht um sich von etwas im Gesicht ihrer Mutter zu befreien, stand sie auf, lief zu ihrer Tante und warf ihr die Arme um den Hals.
Marion rief: »Oh, du verdirbst es!«
Aber Charlotte wurde weich und vergab. Es war ja nur für heute Abend.
»Was wird Papa sagen?«
»Ich werde es ihm erklären«, sagte Marion gefasst. »Erst lasse ich mich von ihm nach unten bringen. Während des Essens wird er sich zurückhalten müssen und am Ende wahrscheinlich schon daran gewöhnt haben. Zünde das Licht an«, sagte sie beim Hinausgehen zu Charlotte, »es wird dunkel hier drinnen.«





























