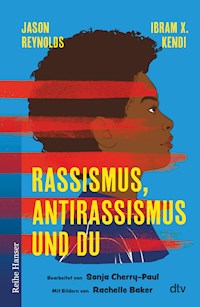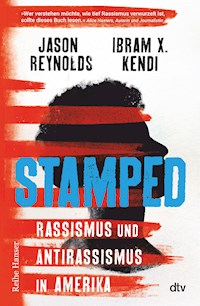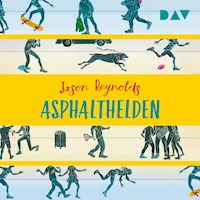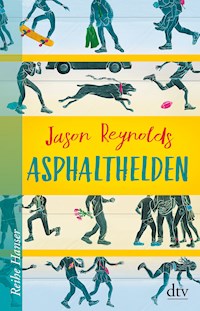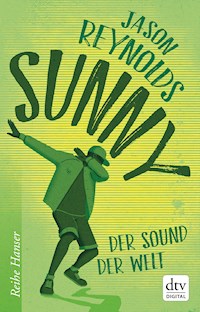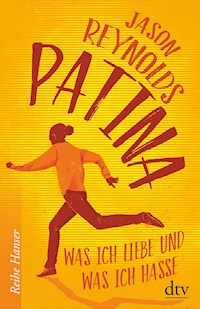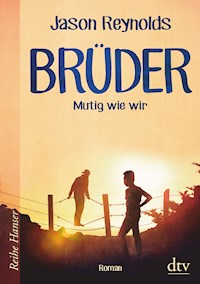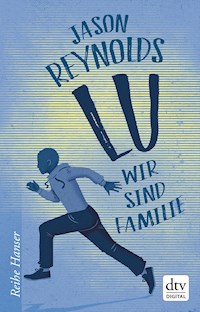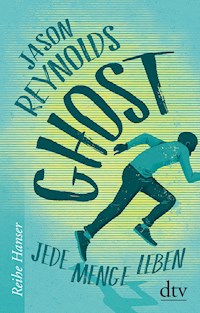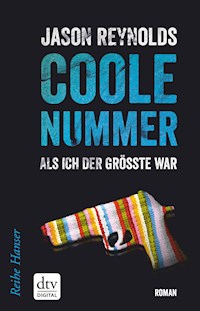8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Reihe Hanser
- Sprache: Deutsch
Die Spielarten der Liebe Matt hat einen gut bezahlten Nebenjob bei einem Beerdigungsinstitut – nicht gerade ein normaler Zeitvertreib für einen 17-jährigen Teenager aus New York. Doch auf einer der Trauerfeiern trifft er Love, genau dann, als sich die schlechten Nachrichten in seinem Leben immer weiter häufen. Sie ist ein außergewöhnliches Mädchen mit seltsamem Namen, so liebenswert, so stark und so geheimnisvoll zugleich. Mit Schicksalsschlägen geht Love ganz anders um als Matt, der den Tod seiner Mutter einfach nicht verkraften kann. »Vergiss die Sache mit dem Glücklichsein ... Und vor allem, vergiss Love!«, sagt er sich schon bald. Doch das ist gar nicht so einfach und vielleicht kann auch nur Love ihn aus seiner Einsamkeit zurück ins Leben holen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Matt trägt jeden Tag einen schwarzen Anzug, nicht, weil seine Mutter gerade gestorben ist, was Matt komplett aus der Bahn geworfen hat, sondern weil er einen gut bezahlten Nachmittagsjob bei einem Beerdigungsinstitut hat. Und er braucht den Job dringend, weil sein Vater weder mit den Krankenhausrechnungen noch mit sich zurande kommt. Alles überhaupt nicht gut. Als er glaubt, eine weitere schlechte Nachricht nicht mehr aushalten zu können, trifft Matt Love. Stimmt, seltsamer Name, und jemand, der mit Schicksalsschlägen ganz anders umgeht als Matt. Was ist ihr Geheimnis? Was macht sie so stark? Kann sie Matt aus seiner Einsamkeit heraus- und ins Leben zurückholen? Matt ist überzeugt, wenn es überhaupt jemand gibt, der das kann, dann ist es Love.
Für Tante BudUnd Onkel Calvin
Und für Walter Dean Myers.Danke, danke, danke.
Hey there, you, looking for a brighter season,
Need to lay your burden down.
Hey there, you, drowning in a helpless feeling
Buried under deeper ground.
LAURA MVULA, »SING TO THE MOON«
1
ALLES LÄUFT RÜCKWÄRTS
Es war der erste Schultag. Eigentlich war es der neunzehnte, aber es war mein erster Schultag, und ich dachte die ganze Zeit, was bin ich froh, dass ich schon drei Wochen verpasst hab und das hier der letzte erste Schultag ist, den ich je erleben werde. Dem Himmel sei Dank. Nicht dass ich die Schule gehasst hätte, versteh mich nicht falsch. Ich war einfach nicht in der Stimmung, Bücher mit mir rumzuschleppen oder Sachen zu lernen, die mir eigentlich nichts bedeuteten, oder, schlimmer noch, mit Leuten zusammen zu sein, denen ich im Grunde nichts bedeutete. Ich weiß, ich weiß – ich hör mich an wie ein erstklassiger Anwärter für schwarze Fingernägel und Emo-Poesie, aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass ich keine große Lust auf Geselligkeit hatte. Streich das – ich hatte überhaupt keine Lust auf Geselligkeit. Knallende Schließfächer, quietschende und quiekende Turnschuhe, als ob man mit großen Nägeln über eine riesige Tafel fahren würde, wenn all die Teenies lachend und schreiend durch die Flure in ihre Klassenzimmer rennen. Sie huschten an mir vorbei, rempelten mich an, während ich durch die Flure glitt wie eine Art Zombie.
Als würde ich in einer anderen Welt leben, in der alles rückwärtslief. Ms. Harris, die Rektorin, die sich ansonsten meist in ihrem Büro vor den Schülern versteckte, bot mir tatsächlich an, mich zu meinem Schließfach zu begleiten. Andererseits waren da die Typen, mit denen ich sonst gut klarkam – zumindest dachte ich das – wie James Skinner, die mich total ignorierten. Verstehst du, was ich meine? Rückwärts.
Das letzte Mal hatte ich James im Sommer gesehen, als wir Zwölftklässler in der Schule zusammenkommen mussten, weil sie unser Klassenfoto machen wollten. James und ich machten uns darüber lustig, weil wir dieses Fotografiertwerden überhaupt nicht ausstehen konnten, während unsere verrückten Mütter absolut versessen auf die Fotos waren. Ich erzählte ihm, dass meine Mutter mich angefleht hatte zu lächeln, aber das würde ich mit Sicherheit nicht machen. Ich konnte nicht. Nicht, weil ich nicht wollte, nein, ich wusste einfach nicht, was ich für ein Gesicht machen sollte, wenn jemand eine Kamera auf mich richtete. Manche Leute können auf Kommando lächeln. Du sagst »lächeln«, und plötzlich grinsen sie über beide Ohren und zeigen dir alle ihre blitzenden Zähne. Und andere Leute … die können das eben nicht. Wie ich zum Beispiel. Also wusste ich, dass ich auf meinem Zwölftklässlerfoto genauso aussehen würde wie auf dem aus der Elften, Zehnten und Neunten – wie ein Roboter. Nur war es diesmal ein Robotergesicht mit Talar und Hut, was es noch schlimmer machte.
Der Punkt ist, ich hatte gerade meinen sogenannten Freund James gesehen – hatte eben noch mit ihm gelacht über diesen spießigen Klassenfotoscheiß –, und jetzt tat er so, als würde er mich überhaupt nicht kennen. Das passiert vermutlich, wenn die Leute erfahren haben, dass deine Mutter gerade gestorben ist. Du wirst unsichtbar. Wenigstens mir ging das so. Für alle unsichtbar. Sagen wir für fast alle.
»Yo, Matt, tut mir leid das mit deiner Mum, Alter.« Chris Hayes, mein bester Freund, hatte sich von hinten an mich rangeschlichen, während ich versuchte, meine Sachen ins Schließfach zu stopfen. Er war einer von diesen obercoolen Typen, lässig drauf, die Mädchen fanden was an seinem rasierten Schädel. Er würde wahrscheinlich zum »bestgekleideten Jungen« gewählt und hätte große Chancen, der Prom King zu werden. Er gab sich alle Mühe, mir sein Mitgefühl zu zeigen, einfach der normale, jetzt ziemlich traurige Freund zu sein. Ich wusste das zu schätzen, obwohl es nichts nützte. Aber wenigstens hatte er den Mumm aufgebracht und war zu mir gekommen und hatte was gesagt, statt mir einfach aus dem Weg zu gehen, als ob der Tod eine Art Krankheit wäre, die sich jeder einfangen könnte, der auch nur mit mir redete. Alle anderen starrten mich entweder an oder versuchten viel zu angestrengt, mich überhaupt nicht anzusehen.
»Weißt du … Mrs. Miller war wie eine zweite Mom für mich, und es tut mir so leid, dass ich nicht zur Beerdigung kommen konnte«, fuhr Chris fort.
Also, das tut mir auch leid. Es tut mir leid, dass ich dort in dieser Kirche sitzen musste – wo übrigens die Klimaanlage kaputt war – und schwitzte und all diesen Leuten zusah, die den Gang runtergingen und in den Sarg meiner Mutter blickten und all diesen Unsinn vor sich hin flüsterten, dass sie ganz wie sie selbst aussah, was nicht stimmte. Es tut mir leid, dass du nicht da warst und mit angehört hast, wie der lahme Chor sich ein Lied nach dem anderen abgerungen hat. Es tut mir leid, dass du nicht da warst, um meinen Dad zu sehen, der sich alle Mühe gab, munter zu wirken, der schlechte Witze riss in seiner Rede, mit erstickter Stimme. Es tut mir leid, dass du nicht dabei warst und gesehen hast, wie ich völlig aus der Fassung geriet und in Tränen ausbrach. Es tut mir leid, dass du nicht für mich da warst, aber es ist egal, denn selbst wenn, du könntest gar nicht das empfinden, was ich empfinde. Niemand kann das. Sogar der Priester hat das gesagt.
Das wollte ich eigentlich sagen, tat es aber nicht, weil ich Chris damit nicht belasten wollte. Ich wusste, er wäre dabei gewesen, wenn er gekonnt hätte. Aber er hat es einfach nicht geschafft. Das versteh ich. Also wandte ich mich um und sah ihn an und sagte: »Schon gut, Alter.« Ich schluckte schwer, bot ihm die Hand zum Abklatschen und hielt meine Tränen zurück. Bloß. Nicht. Heulen. Nicht in der Schule.
Chris packte meine Hand und zog mich in eine Umarmung unter Männern. Und genau in diesem Moment, mit perfektem Highschool-Timing, stürmte Shawn Bowman von hinten auf Chris zu, schlug ihm auf den Arsch und riss einen blöden Witz, von wegen wir seien schwul oder was weiß ich. Und natürlich, nachdem er das gesagt hatte, schlug das Mädchen, mit dem er zusammen war – Michelle oder so –, ihm auf den Arm und schnalzte mit der Zunge. Sie riss Shawn zu sich ran und flüsterte ihm was ins Ohr, und natürlich sagte sie ihm, meine Mom sei gerade gestorben, weil sein Gesicht anlief – besser gesagt, es lief nicht an, sondern blieb blauschwarz, wie es war, aber wenn es rot hätte werden können, dann wäre es eine rote Ampel auf zwei Beinen geworden. Chris hatte sich umgedreht und starrte Shawn böse an. Er hatte die Fäuste geballt, und es war offensichtlich, dass er sauer war.
»Arschloch«, knurrte Chris. Shawn verzog sich einfach, es war ihm peinlich, und nach Chris’ Ton zu schließen, war das eine gute Idee.
Es war, als würde die Highschool schlagartig zur … Highschool. Eine Horde von unreifen, verantwortungslosen Teenies, die sich unbesiegbar fühlten, nur weil sie noch nichts durchgemacht hatten. Die was durchgemacht hatten, führten sich nicht auf wie die anderen. Shante Jansen etwa. Als sie in der Zehnten schwanger geworden war, hatte sie sich stark verändert. Das Baby ließ sie erwachsen werden, und bestimmte Dinge an der Highschool schienen nun um einiges weniger wichtig. Sie wollte einfach nur ihre Arbeit machen und dann nach Hause gehen. Keine Zeit für irgendwelche Albernheiten. So war mir jetzt auch zumute. Als ob ich urplötzlich zu alt für die Highschool geworden wäre, auch wenn das nicht stimmte. Was für ein merkwürdiges Gefühl.
Zum Glück musste ich nicht allzu lange in der Schule bleiben. Weil ich in der neunten, zehnten und elften Klasse ziemlich gut gewesen war, hatte ich einen kleinen Stundenplan und konnte mittags immer nach Hause gehen. Natürlich hing ich ein wenig hinterher, aber Ms. Harris hatte alle Lehrer angewiesen, eigens für mich Aufgaben zu entwickeln, damit ich die Dinge nachholen konnte, die ich verpasst hatte. Schule fiel mir immer ziemlich leicht. Viel leichter als lächeln, glaub mir.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, von Viertel vor neun bis mittags in die Schule zu gehen, dann von eins bis halb sechs mein Praktikum in der Bank zu machen. Ich war nicht allzu scharf darauf, in einer Bank zu arbeiten, einfach weil ich glaubte, es würde mich zu Tode langweilen, hinter Panzerglas zu sitzen und den ganzen Tag das Geld anderer Leute zu zählen. Die Bezahlung allerdings fand ich spitze. Aber weil ich die ersten paar Wochen in der Schule versäumt hatte, verpasste ich auch die ersten Arbeitswochen, und die Bank nahm einen anderen Schüler für meine Stelle. Also hatte ich am Ende keinen Job und nichts zu tun nach der Schule.
Mein Vater und ich sprachen miteinander, als sie mir mitteilten, dass mein Platz vergeben war, und er meinte, ich solle mir deswegen keine Sorgen machen, aber unbedingt versuchen, eine andere Arbeit zu finden, vor allem, da ich so viel freie Zeit haben würde. Als er das sagte, war meine Mutter noch nicht gestorben. Und jetzt, da sie tot war, wollte ich mir wirklich einen Job suchen, nicht nur, damit ich beschäftigt war, sondern auch, um meinem Vater zu helfen, die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Und obwohl ich mich für ziemlich klug hielt, hatte ich keine Arbeitserfahrung, wenigstens keine, die ich in meinen Lebenslauf reinschreiben konnte. Treppe fegen bei Ms. Jones zählte nicht wirklich.
Also tat ich, was jeder in meiner Lage tun würde. Ich versuchte, einen Job in einem Hühnerimbiss zu kriegen. Er heißt Huuhn’s und ist die schmierigste Klitsche in der ganzen Nachbarschaft. Aber sie bezahlten recht gut, wie man so hörte. Zumindest mehr als die anderen Fast-Food-Läden. Man munkelte, der Grund dafür sei, dass Huuhn’s einem reichen Typen gehörte, der meinte, er könne seinen Leuten wenigstens genug zum Überleben bezahlen, wenn er mit seinem Fraß praktisch die ganze Nachbarschaft umbrachte. Wie kann etwas, das so gut schmeckt, so schlecht für dich sein?
Ich hatte unzählige Male dort gegessen. Meine Mutter schickte mich freitagabends immer los, um Brathähnchen zu holen. Wir kochten montags bis donnerstags und nahmen uns das Wochenende frei. Ja, wir kochten. In meiner Kindheit war ich praktisch der Sous-Chef meiner Mutter, was nur ein schicker Ausdruck dafür ist, dass ich ihr Küchenjunge war. Hier ein bisschen schneiden, da ein bisschen klein würfeln. Das hier umrühren, dies dort beträufeln. Kurz gesagt, ich kann mit Topf und Pfanne umgehen. Das ist noch so ein Grund, weshalb mir das Huuhn’s als die natürliche Wahl vorkam. Ich kann braten, und ich mag das Essen dort. Besonders das Gebäck. Meine Mom sagte immer, es erinnere sie an diese süßen Teilchen, die man auf dem Land kriegt. Das kann ich nicht beurteilen, aber die süßen Stückchen bei Huuhn’s waren phänomenal. Eigentlich war dort alles lecker, sogar der Zuckertee.
»Wen darf ich als Nächstes bedienen?«, sagte das Mädchen hinter der Kasse mit ungefähr so viel Begeisterung, wie ich sie im Moment für irgendwas aufbringen konnte – niente. Sie trug ein Haarnetz, das wirkte wie ein Helm, und um den Hals ein goldenes Band, an dem ein Namensschild hing. RENÉE stand da in Schreibschrift.
Ich trat vor, wobei meine Sneakers dieses komische klebrige Geräusch machten.
»Willkommen bei Huuhn’s, möchten Sie ein Combo, ein Special, das Chicken Deluxe, einen Shake oder eine Köstlichkeit von unserer Dessertkarte probieren?«, spulte sie mit verdrehten Augen und abgewandtem Blick herunter.
»Stellt ihr zufällig Leute ein?«, fragte ich ein wenig kleinlaut. Mir war egal, ob jemand erfuhr, dass ich auf Jobsuche war, andererseits wollte ich es auch nicht an die große Glocke hängen.
Renée taxierte mich einen Moment.
»Wart mal kurz«, sagte sie genervt. Sie wandte sich um und rief etwas nach hinten, aber es war, als ob sie die Hühner anschreien würde, die da in diesen großen Vorratsdingern aus Blech auf einem Haufen lagen. »Clara. Stellen wir ein?«
Eine Frau tauchte hinter den Blechbehältern auf. Ihr Hemd war weiß und nicht lila wie das von Renée. Auch sie hatte dieses Haardings auf dem Kopf, aber sie hatte Zöpfe, die aussahen wie Schlangen, die in einem Netz gefangen waren.
»Du suchst einen Job?«, sagte Clara barsch.
»Ja.«
Sie langte unter die Kasse und zog ein Blatt Papier hervor. Einen Bewerbungsbogen.
»Füll das dort drüben aus.« Sie deutete auf die Tische nahe der Tür. »Und bring’s zurück, wenn du fertig bist.«
Clara knallte einen Kuli auf den Tresen und sah mich finster an. »Und klau bloß nicht meinen Kuli.«
Ich setzte mich hin und fing an, die Bewerbung auszufüllen, bemüht, den Geruch von abgestandenem Fett und den Lärm von all dem Tohuwabohu der Leute auszublenden, die riefen und Witze rissen, von den jungen Schulschwänzern, den Bauarbeitern, die Mittagspause machten, den Junkies, die um Süßigkeiten bettelten, und von so ziemlich allen anderen, die du dir nur vorstellen kannst. Andauernd bimmelte die Tür, wenn jemand sie öffnete und auch noch das Gehupe und die Polizeisirenen von draußen reinließ. Überall dieser verfluchte Lärm.
»Was geht, Ma?«, sagte ein junger Typ ungefähr in meinem Alter zu Renée. »Steht dir gut, dieses Ding da auf dem Kopf«, scherzte er. Seine Kumpel lachten.
Ich wollte sehen, wie sie reagierte, doch der Typ stand vor ihr. Aber hören konnte ich sie.
»Was du nicht sagst. Was willst du, Mann?«
Der Typ trat von einem Bein aufs andere und rückte erst seine Kappe zurecht, dann sein Gemächt.
»Wie wär’s mit deiner Telefonnummer?«, sagte er schmierig.
»Vergiss es. Aber wie wär’s mit was zu essen?«, sagte Renée ziemlich gelangweilt. Sicher musste sie sich solchen Mist ständig anhören. Irgendwelche Honks, die vor ihren Freunden auf dicke Hose machten. Ich fragte mich immer, ob solche Spielchen funktionierten. Landet man zum Beispiel mit »Wie wär’s mit deiner Nummer?« wirklich bei den Mädchen? Konnte ich nicht so recht glauben.
»Schon gut, schon gut, was soll’s. Ich krieg dann ’nen Deluxe.«
»Kein Deluxe mehr. Ausverkauft.«
»Mist, okay. Dann eben die Fünf Hähnchenstreifen.«
»Keine mehr da.«
»Echt jetzt? Verarsch mich nicht.«
»Echt.«
»Okay, also, dann das Dreierlei. Ich weiß, dass ihr Hähnchen habt.« Der Typ lachte und schüttelte enttäuscht den Kopf.
In diesem Augenblick trat er zur Seite, und ich konnte Renée nun gerade so sehen. Sie wandte sich um und musterte all die Hähnchen in ihrem Warmhaltecontainer. Da mussten ungefähr sechzig Stück liegen. Dann wandte sie sich wieder dem Typen zu.
»Alle alle.«
»Was?«
»Alles alle. Hähnchen sind aus.«
»Aber da sind sie doch, diese verdammten Hühner! Was redest du denn da?«
»Alles alle.«
Der Junge stand verdutzt da.
Renée hob grinsend die Hand vors Gesicht und markierte mit den Fingern eine Kamera. »Schnappschuss!«, rief sie. Dann schaute sie auf die eingebildete Kamera, als würde sie die Aufnahme prüfen – sollte wohl eine Digitale sein –, und sagte: »Uups, nicht deine Schokoladenseite.«
Die Kumpel des Typen lachten über ihn, und ehe er etwas erwidern konnte, sagte Renée: »Nächster, bitte!«
Da war der Typ plötzlich beleidigt und fing an, Renée zu beschimpfen, warf ihr das übliche »Eingebildete Zicke!« an den Kopf, rempelte beim Hinausgehen gegen Tische und Stühle. Seine Kumpel tapsten ihm hinterher wie ein Rudel Welpen. Ich sah hinunter auf mein Formular, während sie sich verzogen. Solche Typen versuchen immer, sich mit irgendwem anzulegen, um sich besser zu fühlen.
Alle anderen in der Schlange lachten. Vor allem, als der nächste Typ fünfzig Hähnchen wollte und sie ohne weiteres auch kriegte. Offenbar war das der Grund, weshalb sie diesem Hirni wirklich nichts verkaufen konnte. Es war alles schon vorbestellt.
»Vielen Dank, meine Liebe. Ich hab schon bei Clara bezahlt«, sagte der Mann, der all die Hähnchen bestellt hatte.
»Kein Problem, Mr. Ray.«
Mr. Ray? Ich sah auf, und tatsächlich, es war Mr. Willie Ray, der da stand, während Renée die Brathähnchen in die Pappbehälter stopfte.
Mr. Ray ist eine Bohnenstange von Mann, den alle in der Gegend aus zwei Gründen kennen. Erstens ist er im Bestattungsgeschäft. Ein Totengräber. Ihm gehört Rays Letzte Heimstatt, eine Firma, die er von seinem Vater geerbt hatte. Es hört sich merkwürdig an, aber von den Teenagern bis zu den Alten, die hier in der Gegend starben, wurden die meisten durch Willie Rays Tür getragen.
Der andere Grund, weshalb ihn alle hier kennen, ist, wie soll ich sagen, der Krebs. Mr. Ray hat ihn zweimal besiegt, und das weiß deshalb jeder, weil er so eine Art Zeuge Jehovas in Sachen Krebs wurde, der Klinken putzt und Broschüren verteilt. Er schwört, Gott habe ihn einzig und allein deshalb entwischen lassen, damit er die Kunde von der Krankheit verbreiten könne. Als ob keiner je davon gehört hätte. Meine Mutter zog ihn immer damit auf: »Willie, Gott hat dich nur deshalb gerettet, damit du uns bis aufs Blut quälen kannst? Da kann doch was nicht stimmen.« Er war nie böse auf sie. Er lachte dann nur und schüttelte den Kopf und machte sich auf den Weg zum Nachbarn.
»Mr. Ray?«, rief ich.
»Matthew, ich hab dich gar nicht hier sitzen sehen. Wie geht’s dir?«, sagte er und kam mit seinem vertrauten hinkenden Gang auf mich zu.
»Geht so«, sagte ich und schüttelte ihm die Hand. »Was ist mit all den Hähnchen?«
»Junger Mann, die sind für eine Beerdigung. Also, eigentlich für einen Leichenschmaus. Sie hatten niemanden für das Catering, also haben sie mein Unternehmen beauftragt, sich um das Drumherum zu kümmern. Und dann besorgen wir hier immer Hähnchen. Schlicht, aber es schmeckt allen«, erklärte er. »Was treibst du denn?«
»Bin auf Jobsuche.« Ich deutete auf den Bewerbungsbogen, auf dem ich bislang eigentlich nur meinen Namen eingetragen hatte.
»Wo, hier?«
»Ja, Sir.«
Mr. Ray stand einen Moment still und sah mich von oben bis unten an, als ob er sich ärgerte, dass ich bei Huuhn’s Arbeit zu finden versuchte. Aus meiner Sicht war es jedenfalls ein anständiger Job. Zuweilen wohl hart, aber es blieb ein anständiger Job. Zudem hoffte ich, das Geheimnis der einen oder anderen gebratenen Köstlichkeit lüften zu können, um sie bei mir zu Hause nachzukochen. Und vielleicht mal eines Tages für mich und meinen Vater diese süßen Teilchen zu backen.
»Matthew, wenn du hier arbeitest, wirst du hier nie mehr essen können«, witzelte er schließlich.
Ich glaubte nicht so recht, dass das stimmte. Von einigen Dingen kriegst du einfach nie den Hals voll. Huuhn’s gehörte für mich eindeutig dazu. Es ist, als ob man behaupten würde, wenn ich diesen Job bei der Bank gekriegt hätte, würde mich das Geld eines Tages anwidern. Ja, genau. Nicht, dass Mr. Ray falsch gelegen hätte. Ich konnte es mir einfach nur nicht vorstellen. Aber sagen tat ich nichts. Ich zuckte nur die Achseln.
»Hör zu. Ich war ein Freund deiner Mutter. Und ich bin immer noch ein Freund deines Vaters. Wenn du einen Job brauchst, dann zahl ich dir ein paar Dollar, damit du mir in der Letzten Heimstatt hilfst. Ich weiß, sie bezahlen recht gut in diesem Laden hier, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da mithalten kann, und dann stinkst du nicht jede Nacht, wenn du nach Hause kommst, nach ranzigem Fett oder musst dich mit diesen Hohlköpfen rumschlagen. Was meinst du dazu?« Mr. Ray zog den Ärmel seines Jacketts hoch über seine Armbanduhr, die er um das Handgelenk drehte, damit das goldene Zifferblatt nach oben zeigte. »Es sei denn«, sagte er leise, den Blick immer noch auf der Uhr, »du hast ein Faible für Haarnetze.«
Witzig. Echt witzig.
Ich dachte einen Augenblick nach. Mr. Ray war zweifellos ein Freund unserer Familie. Er war es, der mit meiner Mutter über die Chemotherapie gesprochen hatte und wie es ihr dabei gehen würde. Er wisse nicht viel über Brustkrebs, meinte er, aber einen Geheimtipp habe er, wenn es einem von der Behandlung übel wird, sei Eiscreme das beste Gegenmittel. Tatsächlich war Mr. Ray an dem Tag bei uns, als sie Mom ins Krankenhaus brachten, an dem Tag, als sie uns für immer verließ. Er half meinem Vater, sie die Treppe runterzubringen, weil sie absolut nicht wollte, dass die Sanitäter sie auf eine Trage legten.
»Ich bin doch weder eine Prinzessin noch ein Baby, mich muss man doch nicht tragen«, fauchte sie Dad und Mr. Ray an, die sie unter den Armen packten und ihr sachte die Vortreppe hinabhalfen, einen schmerzhaften Schritt nach dem anderen.
Dad witzelte, sie sei eine Königin. »Da hast du verdammt recht!«, schoss sie zurück, und Mr. Ray stimmte ihr geflissentlich zu.
»Die Königin von diesem Haus, von dieser Nachbarschaft, von Bed-Stuy – zum Teufel, Daisy, du bist die Königin von ganz Brooklyn«, scherzte Mr. Ray. »Und weißt du was? Dein Thron wird hier brav auf dich warten, bis du nach Hause kommst.«
Sie kam nie wieder nach Hause, aber wir wussten die aufmunternde Art Mr. Rays zu schätzen. So war er eben – ein guter Kerl. Doch sosehr ich ihm vertraute – wollte ich wirklich in seinem Bestattungsinstitut arbeiten? Nein, ich hatte kein Problem mit ihm. Es war eher diese Sache mit dem Tod und die Aussicht, dass ich den ganzen Tag mit trauernden Leuten zusammen sein musste. Ich hatte schon schwer daran zu knabbern, dass ich meine Mom verloren hatte, und ich fand es eine höllische Vorstellung, mit einem Haufen Fremder zu tun zu haben, die mit ähnlich schlimmen Dingen fertigwerden mussten.
Aber so, wie Mr. Ray sich anhörte, zahlte er nun mal ziemlich gut. Und obwohl ich an diesen ganzen Blödsinn von wegen »Du kannst dann nicht mehr hier essen« nicht glaubte, wusste ich nicht, ob ich es wirklich schaffen würde.
»Danke, Mr. Ray«, sagte ich und trommelte mit dem Kuli auf meine Bewerbung. »Aber ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Es ist einfach … ich hab nun mal …« Ich mühte mich, es zu erklären, aber das war überflüssig, wenn ich seine Miene richtig deutete.
»Du musst es nicht begründen, mein Junge«, sagte er und hob die Hand. »Glaub mir, ich versteh dich.«
Verlegen sah ich hinunter auf das Blatt. Obwohl Mr. Ray meinte, er würde verstehen, was ich durchgemacht hatte, kam ich mir ein wenig bescheuert vor, sein Angebot abzulehnen, wo mir doch dann nichts übrig blieb, als in diesem schmierigen Imbiss zu arbeiten. Aber andererseits schien es keine gute Idee, ausgerechnet dort einen Job anzunehmen, wo ich die Beerdigung meiner Mutter jeden Tag von Neuem durchleben musste. Als ob ich dafür bezahlt würde, den schlimmsten Tag meines Lebens immer und immer wieder abzuspielen.
Mr. Ray legte mir die Hand auf die Schulter. »Lass es mich einfach wissen, falls du es dir anders überlegst.«
Ich blickte nicht auf. Ich nickte nur und fing an, die Adresszeile auszufüllen und mich für die Schufterei bei den Hühnerbratern anzumelden. Aber entweder das oder die Schufterei bei den Totengräbern. Verlieren oder verlieren.
Kaum dass sich Mr. Ray umgedreht hatte und zurück zum Tresen ging, schwang die Tür auf, und ein junges Mädchen kam herein, die Hand auf den Mund gepresst, die Wangen aufgepustet. Und bevor sie es zur Toilette schaffte – verflucht, bevor sie überhaupt richtig drin war –, spuckte sie diesen roten, klumpigen Schleim über den ganzen ohnehin schon klebrigen Boden. Sah aus wie dieser Pudding für alte Damen. Wie heißt der noch mal? Tapioca? Genau. Wie Tapioca. Aber rot. Und wenn es was gibt, das ich überhaupt nicht ausstehen kann, dann ist es Kotze. Alles, was mit Erbrechen zu tun hat, ist krass. Wie es aussieht, wie es riecht, wie es sich anhört. Alles daran. Einfach eklig. Wie auch immer, als dieses Mädchen reinkam und ihr Mittagessen rauswürgte, sprang ich auf und wäre um ein Haar mit Mr. Ray zusammengekracht. Dann hätte ich ihn mit Sicherheit umgestoßen.
»Was zum –« Mr. Ray hatte sich abrupt umgedreht, als er das Würgen und Rülpsen hörte. »Clara!«, rief er. »Clara! Du hast hier draußen ein Problem!«
Ich stand neben Mr. Ray und sah nach Renée und den anderen Kunden, die nicht minder angeekelt waren, während sich Mr. Ray auf das würgende Mädchen konzentrierte.
Renée reckte den Kopf, um zu sehen, was los war, und als sie die Sauerei sah, presste sie nur die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Als ob das normal wäre. »Clara, wir brauchen jemand, der was aufwischt«, sagte sie gelangweilt.
»Clara!«, bellte Mr. Ray.
»Ich komm schon, ich komm schon!«, keuchte Clara. Sie kam durch eine Tür neben der Küche und schob einen gelben Wischeimer auf Rollen vor sich her. Ein Typ folgte ihr mit einer Art Sandsack und einem dieser großen orangenen Absperrkegel.
»Jessas«, rief Clara, als sie an mir vorbeiging. Ich starrte nur auf die Hähnchen. Die Kotze wollte ich mir nicht noch mal ansehen, ansonsten hätten die zwei Tapiocas aufwischen müssen. »Lass das liegen und hol ihr ein Wasser«, sagte Clara zu dem Typen mit dem Sand.
Der Typ lief nach hinten in die Küche und kam im Nu mit einem Becher Wasser zurück.
»Setz dich hin«, sagte Clara zu dem Mädchen.
»Tut mir leid. Tut mir furchtbar leid«, rief das Mädchen immer wieder, und ich hörte, dass sie den Becher zum Mund führte, denn der Klang ihrer Stimme änderte sich. »Tut mir so leid … ich hab’s einfach nicht bis zum Klo geschafft.« Sie klang verlegen, und ehrlich gesagt war ich auch ziemlich peinlich berührt. Ich meine, ich kam mir schon seltsam vor, als ich den Job ablehnte, den Mr. Ray mir anbot, aber jetzt hatte ich auch noch diese Angst vor Erbrochenem, und ich war mir sicher, das Mädchen an der Kasse beobachtete, dass ich mich wie eine Pussy aufführte. Also ja – oberpeinlich.
»Der Nächste!«, rief Renée. Sie achtete also doch nicht auf mich. Die konnte nichts erschüttern. Für sie war das hier nur ein weiterer Tag auf Arbeit. Ich wusste nicht, wie irgendjemand noch Appetit haben konnte, vor allem, weil der ganze Laden jetzt nach nassen alten Socken stank, aber die Leute bestellten weiter.
Mr. Ray wandte sich dem Bestelltresen zu und legte den Arm um mich. »Alles gut, Matthew«, sagte er. »Füll du nur deine Bewerbung aus. Die sollten dich schon allein deswegen einstellen, weil du das aushalten musst, mein Junge!« Er gluckste in sich hinein und ging zur Tür.
»Warten Sie, Mr. Ray.« Ich streckte die Hand aus und packte ihn am Arm. Er wandte sich zu mir um. »Muss ich … ähm … muss ich dann Tote anfassen?« Aufrichtige Frage.
Er verschränkte die Arme. »Möchtest du das?«
»Nee.«
»Dann nicht.«
Ich überlegte hin und her. Beerdigungen ätzen. Aber die Möglichkeit, dass ich irgendwann meinen liebsten Junkfraß nicht mehr ausstehen könnte, mich mit irgendwelchen Durchgeknallten rumschlagen müsste, die reinkamen und Scheiß daherredeten, und dann noch Kotze aufwischen müsste, das war wirklich oberätzend.
»Okay«, sagte ich zu Mr. Ray.
»Okay?«
»Okay.«
Mr. Ray lächelte. »Okay«, nickte er. »Komm mit, du kannst gleich anfangen.«
Ich folgte ihm zur Kasse. Am Tresen gab ich Claras Kuli zurück, während Mr. Ray in sein Jackett langte und ein paar Krebs-Broschüren rausholte und sie vor Renées Kasse liegen ließ, als ob sie so was wie Trinkgeld wären.
»Die gibst du deiner Großmutter«, sagte er, während wir die verpackten Hähnchen einsammelten.
»Mach ich«, sagte Renée freundlich, als wir uns zum Gehen wandten. Ich hielt die Luft an, als wir über den Sandhaufen tapsten, der das Erbrochene bedeckte. Die Bewerbung mit meinem Namen und der Hälfte meiner Adresse hatte ich auf dem Tisch liegen lassen.
***
»Und wessen Begräbnis ist das jetzt da oben?«, fragte ich Mr. Ray, während wir die Hähnchen auf Tellern anrichteten. Der Leichenschmaus (ich wusste tatsächlich nicht, wie man das nannte, aber es ist das Essen nach der Beerdigung) fand im Untergeschoss des Beerdigungsinstituts statt und die eigentliche Trauerfeier dann oben. Ich wusste, dass manche Trauerfeiern bei Ray stattfanden, weil wir öfters schwarz gekleidete und sich umarmende Menschen draußen vor seinem Institut sahen, wie bei den Trauerfeiern in Kirchen. Das Gute an Rays Institut war, dass wenigstens die Klimaanlage funktionierte.
»Kennst du Rhonda Jameson?«, fragte Mr. Ray.
Er legte eine Brust neben eine Keule.
»Ist Ms. Jameson gestorben?«
»Nein. Ms. Jameson geht es gut. Ihr Vater ist letzte Woche von uns gegangen.«
»Oh«, sagte ich. »Also, zumindest hat sie lange Zeit was von ihm gehabt.«
»Tja.« Dennoch schüttelte er den Kopf. »Aber deshalb wird’s auch nicht leichter.«
Mr. Ray stellte diese großen, wirklich hübschen Schüsseln auf den Tisch und löffelte Dosengemüse hinein. Ich muss zugeben, was das Essen anging, sah es hier ziemlich gut aus. Es gab Tischtücher und Blumenschmuck (ich hasse echte Blumen, aber darauf komm ich noch zu sprechen), und sie hatten die gepolsterten Klappstühle statt der üblichen harten aufgestellt.
Als das Essen angerichtet und die Tische gedeckt waren, gab es eigentlich nicht mehr viel zu tun, aber ich wollte trotzdem nicht schon nach Hause gehen. Gleichzeitig hoffte ich, Mr. Ray würde nicht anfangen nachzubohren, wie ich mich fühlte und all das. Ich weiß schon, dass die Leute es gut meinen, wenn sie solche Fragen stellen, aber letztlich sind es blöde Fragen. Wie ich mich fühle? Also, lass mich mal überlegen. Meine Mutter wurde kürzlich beerdigt, also geht es mir verdammt mies.
Zum Glück fragte Mr. Ray nichts dergleichen. Tatsächlich sagte er überhaupt nichts über meine Mutter. Stattdessen fing er an zu erzählen, wie er war, als er so alt war wie ich.
»Junge«, sagte Mr. Ray seufzend, »du bist besser drauf als ich damals. Du übernimmst Verantwortung, ist dir das klar?« Er lehnte sich an die Wand und schlug die Füße über Kreuz.
»Kann sein«, sagte ich, unsicher, worauf diese Unterhaltung hinauslaufen sollte.
»Ehrlich gesagt, ich hab nie an einen Job oder so was gedacht. Ich hab nur an eins gedacht – an Röcke.«
»Sie haben überlegt, Röcke zu tragen?«, fragte ich erschrocken.
»Nein, Junge! Ich meinte nicht« – seine Reibeisenstimme klang noch heiserer, wenn er sich aufregte – »ich meine Mädchen. Röcke. Wir hatten Mädchen im Kopf. Wie dein Kumpel Chris.«
Mr. Ray schien enttäuscht, dass ich mit seiner altmodischen Ausdrucksweise nichts anfangen konnte.
»Oh.« Ich grinste. Chris hatte eindeutig Mädchen im Kopf. »Also, da denk ich auch dran. Oft. Ist nur so, dass ich noch über andere Sachen nachdenke.» Mir war nicht klar, was so großartig daran sein sollte. Mädchen sind toll. Aber toll ist auch, die Highschool abzuschließen und sie hinter sich zu lassen. Für immer. Kam mir ziemlich wichtig vor.
»Und deshalb bist du anders, mein Junge. Ich und mein Bruder Robbie haben so einige Autos zu Schrott gefahren, weil wir immer die Augen verdrehten und die Hinterteile von irgendwelchen Ladys anguckten.«
»Hinterteile?« Ich kicherte, und auch Mr. Ray fing an zu lachen. Er dachte vermutlich, ich würde über ihn und seinen Bruder lachen, aber nein, ich lachte über das Wort Hinterteile. Was für ein Alte-Leute-Wort.
Während wir redeten, hörte ich die Leute oben herumgehen. Stimmen konnte ich nicht ausmachen, aber jeder Schritt kam durch. Ich fragte mich, was die da oben bei Mr. Jamesons’ Beerdigung trieben. Ob sie lachten oder weinten oder beides. Ob jemand seinem Nebenmann blöde Bemerkungen ins Ohr flüsterte, von wegen wie gut Mr. Jameson noch im Tod aussah. Ob Ms. Jameson in Tränen ausbrach. Wie ich.
»Mr. Ray, kann ich Sie was fragen?«
»Natürlich.« Er wechselte das Standbein, und mir war klar, dass er glaubte, ich würde ihn was über Mädchen fragen.
Hatte ich aber nicht vor.
»Kann ich nach oben gehen?«
»Wohin?«, fragte er verdutzt.
Ich deutete nach oben. »Da hoch? Zur Trauerfeier. Nur mal kurz.«
»Wieso?« Er neigte leicht den Kopf.
Ich zuckte nur die Achseln. Ich konnte ihm nicht sagen, warum, weil ich es damals selbst nicht genau wusste. Ich wollte es einfach urplötzlich. Ich musste es tun.
Mr. Ray sah mich sekundenlang an, und zwar streng. Dann schnalzte er mit der Zunge. »Komm her, Matthew«, sagte er und zog sein Jackett aus. »Wenn du nach oben gehst, benimm dich.« Er hielt mir das Jackett hin, damit ich mit den Armen reinschlüpfen konnte. »Und setz dich nach hinten.«
TRAUERFEIERFÜRCLARK »SPEED-O« JAMESON
Oben sah es ziemlich aus wie im Untergeschoss von Mr. Rays Institut, es war nur viel dunkler, und es gab keine Tische, nur Reihen gepolsterter Klappstühle und vorne ein hölzernes Rednerpult. Das Licht war gedämpft, ganz anders als bei der Beerdigung meiner Mutter in der Kirche, wo helle Lichter brannten. Die Dunkelheit ergab eine deutlich ernstere Stimmung. Außerdem verbarg sie dich besser, falls du in Tränen ausbrachst.
Robbie Ray, Mr. Rays jüngerer Bruder, war der MC für die Trauerfeier, so ungefähr wie der Priester, wenn sie in einer Kirche stattfindet. Aber Robbie Ray war kein Priester. Ehrlich gesagt war er immer noch ziemlich genau der Typ von damals, der Autos zu Schrott fuhr, weil er auf »Hinterteile« glotzte, nur dass er jetzt eben älter war. Aber er sah immer noch jung aus. Viel jünger als Mr. Ray. Und er war immer angezogen, als ob er nach einer Verabredung Ausschau halten würde. Schnittige Anzüge, die Hemden halb aufgeknöpft, als ob wir auf irgendeiner Insel oder so leben würden. Ständig trug er Golduhren, Goldkettchen, hatte einen Goldeinsatz im Mund und einen goldenen Ring mit Klunker an seinem kleinen Finger. Meine Mutter machte sich immer über ihn lustig und sagte, er würde irgendwo zwischen 1970 und dem Weltall feststecken.
»Und nun hören wir einige Worte von Mr. Jamesons Freunden«, sagte Robbie, mit tiefer Stimme wie ein Nachtmoderator im Radio. Manchmal dachte ich, er würde das absichtlich machen, einfach weil es zu seinem Stil passte. Aber sicher war ich mir nie.
Er fuhr mit dem Finger über sein Programmblatt, um sicherzugehen, dass er den richtigen Namen ausrief.
»Mr. McCray?«
Ich rutschte auf einen Platz in der hinteren Reihe, wie Mr. Ray mir nahegelegt hatte. Ich kam mir ein wenig albern vor, nicht weil ich mich aufs Geratewohl in eine Trauerfeier gesetzt hatte, sondern weil meine Arme in Mr. Rays riesigem Jackett aussahen wie Tentakeln. Es passte mir ganz gut um die Schultern herum, weil Mr. Ray hager war, aber die Ärmel waren viel zu lang. Ich zog sie dauernd hoch und ließ die Finger gespreizt, damit sie nicht wieder zurückrutschten.
Neben mir war eine alte Dame in einem lila Rock und einer Bluse mit blauen und lila Tupfen. Wer sagt denn, dass man zu einer Trauerfeier ganz in Schwarz gehen muss, dachte ich, während ich auf meine Blue Jeans und meine grünbraunen Nikes hinunterblickte. Ich sah rüber zu ihr und nickte. Sie versetzte mir einen befremdeten Blick. Zuerst dachte ich, vielleicht wusste sie, dass ich nicht hierhergehörte. Aber dann verzog sie andauernd die Nase, als würde sie gleich niesen müssen, also schätzte ich, dass es dieses ganze Kölnischwasser war, das Mr. Rays Jackett entströmte. Meine Mutter sagte immer, wenn Männer älter werden, glauben sie, alles, was schlecht riecht, würde Bakterien besser umbringen als Seife und heißes Wasser, also baden sie entweder in Alkohol oder Kölnischwasser. Ich wollte mich zu der alten Dame hinüberbeugen und ihr sagen, dass mir der Gestank leidtue und dass er ihr hoffentlich nicht noch mehr Kummer bereite, als sie ohnehin schon hatte. Tat ich aber nicht. Ich machte nur so ein Gesicht, von dem ich glaubte, es würde irgendwie zum Ausdruck bringen, dass es mir leidtat, und nickte ihr zu.
»Guten Tag allerseits«, kam es murmelnd durch die Lautsprecher. »Ich bin A. J. McCrary. Nicht McCray. McCrary.« Der gebeugte alte Herr spähte zu Robbie Ray hinüber, weil der seinen Namen verhunzt hatte.
»Also, wisst ihr eigentlich, wie Clark zu seinem Spitznamen Speedy gekommen ist?« A. J. McCrary beugte sich über das Rednerpult und sprach ins Mikrofon. Sein Gesicht sah aus wie Leder, und seine Augen waren groß und glasig. Er hatte nur noch an den Seiten seines Kopfes weiße Haare und sah fast aus, als ob er Ohrenschützer aus reiner Baumwolle tragen würde.
»Ihr wollt es alle wissen?«, fragte er noch mal, mit komisch pfeifender Stimme, als ob sämtliche Zähne in seinem Mund wackelten.
Manche in der Trauergemeinde stöhnten, andere riefen: »Na, dann schieß los!«
»Also, ich werd’s euch erzählen«, sagte der Alte und bog sich das Mikro zurecht. »Es gab mal, vor langer Zeit, als wir noch Kinder waren, diesen alten Doughnut-Laden drüben an der DeKalb, in dem alle Bullen rumhingen. Wir also vor dem Laden, und Clark fängt an mir zu erzählen von den Schweinen hier und den Schweinen da und dass er schwarze Zeitungen liest und nachschaut, was Malcolm X oben in Harlem gesagt hat. Das waren die Sixties, also wisst ihr, wie es war. Afro-Look, man hat seinen Namen geändert und all das.«
Die Älteren im Publikum nickten zustimmend. Ich warf einen Blick auf die Dame neben mir und stellte sie mir mit einem Afro vor. Urghh.
»Also, Clark mit seinem ganzen Revolutionsgedöns, und ich so zu ihm: ›Mann, du bringst es zu nichts. Du hast nur ’ne große Klappe. Aber du wirst nie und nimmer‹ – der alte Mann verkniff sich gerade noch einen Fluch – ›irgendwas zustande bringen.‹«
Einige fingen an zu kichern.
»Er sagte: ›Ach ja? Dann pass mal auf.‹ Und eh ich michs verseh, kommt dieser Narr aus dem Doughnut-Laden gerannt, mit einem Doughnut in der Hand und noch einem im Mund, und ein junger weißer Bulle rennt ihm hinterher und brüllt was, von wegen sein Doughnut sei geklaut worden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bulle, der ›Haltet den Dieb‹ schreit?«
Alle fingen an über diese verrückte Geschichte zu lachen. Sogar ich.
»Ich hab ihn dann ein paar Tage lang nicht mehr gesehen«, fuhr Mr. McCrary fort, »aber als ich ihn wiedergetroffen hab, hat er mir erzählt, dass sie ihn nicht erwischt haben! Und um das zu beweisen, hätte er den anderen Doughnut für mich bei sich zu Hause. Er meinte, Brother Malcolm sage, was immer du für dich tust, das tust du auch für deinen Bruder. Also gehöre der andere Doughnut mir. Ich konnte es nicht fassen – erstens, weil das verrückt ist; zweitens, weil er sein Leben wegen ein paar Doughnuts riskiert hatte; und drittens, weil er tatsächlich der Polizei entwischt war! Ihr wisst, wie schnell man sein muss, um den Bullen zu entkommen … zu Fuß« – wieder lag ihm der Fluch auf der Zunge – »verflixt schnell. Also hab ich ihn Speed-O getauft, und es ist haften geblieben.«
Er lachte und hustete jetzt heiser ins Mikrofon, während er in seiner Hosentasche nach einem Taschentuch stöberte, in das er reinspucken konnte. Robbie Ray bot ihm die Hand, um ihn auf seinen Platz zu führen, doch Mr. McCrary machte nicht den Eindruck, als ob er schon bereit wäre, sich zu setzen. Doch dann erkannte er, dass seine Zeit vorbei war, schaute noch mal ins Publikum und drückte die Lippen aufs Mikro, als ob er es küssen würde.
»Wir werden ihn vermissen, und viel Glück für seine Familie. Danke«, fügte er rasch hinzu, mit jetzt zu lauter Stimme, die durch die Lautsprecher dröhnte.
Alle nickten im Einvernehmen, dass Mr. Jameson genau diese Art von Kerl gewesen war.
Robbie Ray hüpfte wieder zum Mikro, um den nächsten Sprecher anzukündigen. Ich hatte andauernd das Gefühl, mir würde was im Hals stecken, also schob ich die Hand in meine Jacke, um zu sehen, was mich da pikste. Natürlich zog ich gedankenlos mindestens zehn von diesen Krebs-Faltblättern raus. Für einen Moment vergaß ich, wessen Jacke ich anhatte. Die Dame neben mir warf mir einen raschen Blick zu. Ich machte einfach dieses merkwürdige Robotergesicht, das ich aufsetze, wenn man Fotos von mir macht – große Augen, schmale Lippen –, und stopfte die Broschüren so schnell wie möglich wieder in die Tasche. Vor allem, da ich nicht wusste, woran Mr. Jameson gestorben war. Konnte Krebs gewesen sein. Das wäre peinlich.
»Mr. Wallace«, sagte Robbie jetzt mit seiner merkwürdigen pseudo-sexy Stimme.
Ein Riese erhob sich in der zweiten Reihe. Im Ernst, der riesigste Mensch, den ich je im echten Leben gesehen habe. Sein Kopf war so groß wie ein Basketball, und sein Rücken war wie eine Kingsize-Matratze. Aber aus Ziegelsteinen.
»Guten Tag«, sagte der Riese.