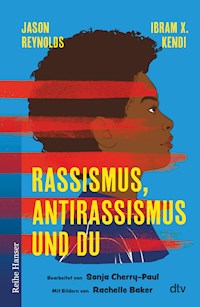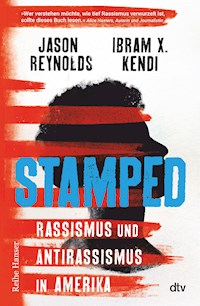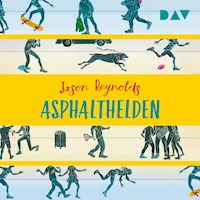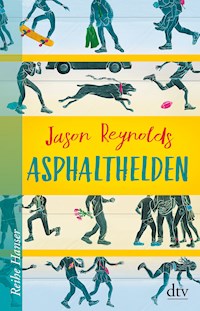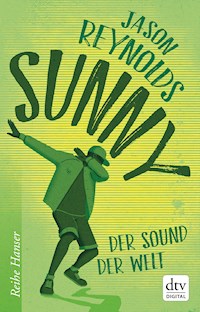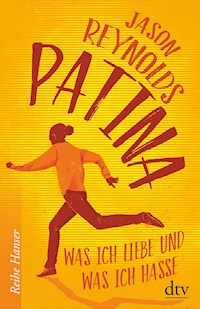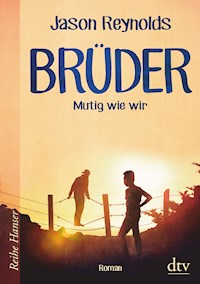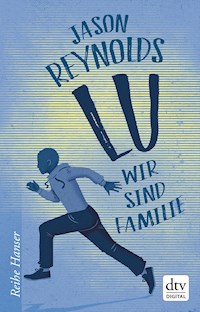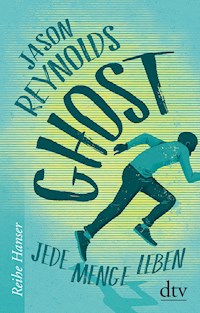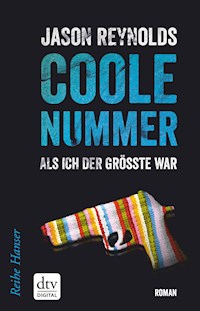8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zwei Stimmen, zwei Autoren, schwarz und weiß.. Eigentlich wollte Rashad nur eine Tüte Chips kaufen, doch kaum hat er den Laden betreten, wird er von einem Polizisten brutal niedergeschlagen. Beobachtet hat den Vorfall ein anderer Junge: Quinn, der ausgerechnet mit der Familie des Angreifers befreundet ist. Rashad ist schwarz, der Polizist weiß. Ein weiterer rassistischer Übergriff? Wie so viele? Rashad landet im Krankenhaus, und Quinn steht zwischen den Fronten. Er muss sich entscheiden: Tritt er als Zeuge auf und wird zum Verräter? Oder hält er den Mund und schweigt zu Diskriminierung und Gewalt. Derweil organisieren Rashads Freunde eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeiwillkür. Eine Stadt gerät in Ausnahmezustand. Und zwei Jugendliche mittendrin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jason Reynolds / Brendan Kiely
Nichts ist okay!
Zwei Seiten einer Geschichte
Roman
Aus dem Englischen von Klaus Fritz und Anja Hansen-Schmidt
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meinen jüngeren Bruder Christian.
Keiner soll dir das Gefühl geben, klein zu sein.
Nie sollst du Angst haben, dich zu erheben.
J. R.
Für all die Aktivisten und Erzieher, die mit Liebe arbeiten und sie vorleben – danke.
B. K.
»Aus der Geschichte können wir nur lernen, wenn wir uns an sie erinnern.«
Carmelo Soto
»Wenn ich nicht für mich selbst einstehe, wer steht dann für mich ein? Aber wenn ich für niemanden außer für mich selbst einstehe, was bin ich dann?«
Hillel der Alte
Zoom ran.
Zoom näher ran.
Noch ein bisschen.
Ein körniges Bild:
ein Junge, das Gesicht auf dem Asphalt.
Ein Mann über ihm. Fäuste stürzen auf ihn nieder wie Steine.
Gebrüll, Blaulicht und Sirenen.
Blut auf der Straße.
Der Junge bewegt sich.
Dann nicht mehr.
FREITAG
RASHAD
Und links! Und links! Und links, rechts, links! Und links! Und links! Und links, rechts, links!
Ist gut, ist ja schon gut.
Hab ’nen Abgang gemacht und sie links liegen lassen. Links, links, links, diese beknackte Schule und diesen noch beknackteren Jungoffiziers-Drill. Es war Freitag, und das bedeutete für mich und praktisch jeden anderen Menschen auf der Welt, dass Party angesagt war. Okay, vielleicht nicht für jeden. Sicher gab es irgendwo einen Mönch auf seinem Berg, der vielleicht an was anderes dachte. Aber ’n Mönch war ich nicht. Gott sei Dank. Für mich und meine Freunde jedenfalls war »Freitag« nur ein anderes Wort für »Party«. Montag, Dienstag, Bald-geschafft-Tag, Donnerstag und Party. Oder, wie mein Bruder Spoony immer sagt: »Paah-ty«. Und nichts anderes hatte ich im Kopf, als ich mich nach der Schule in eine Klokabine zwängte – Party machen und möglichst schnell raus aus dieser spießigen Uniform.
Gut, dass wir sie nicht jeden Tag tragen mussten. Nur an Freitagen, den »Uniformtagen«. Ausgerechnet freitags! Wer war eigentlich auf diese bescheuerte Idee gekommen? Jedenfalls lief ich schon den ganzen Tag in dieser Uniform rum, ab dem ersten Klingeln um zehn vor neun, weil wir ja exerzieren mussten, was letztlich Brüllen und Umhermarschieren bedeutete. Und das ist immer ein tolles Erlebnis, kurz bevor du dich mit dreißig Mitschülern ins Klassenzimmer setzt, wo die Lehrerin entweder am Rand eines Nervenzusammenbruchs steht oder einen Schüler anschreit, er soll sich sofort beim Direktor melden. Ein echter Spaß.
Eines möchte ich klarstellen: Ich hatte dieses Offizierszeugs, diese Kadettenausbildung, wirklich nicht nötig. Ich wollte nicht zu einem Militärverein gehören. Nicht, dass es schlimm gewesen wäre. Eigentlich war es genau wie jeder andere Unterricht auch, nur dass uns Chief Killabrew – der hat ja wohl den komischsten Nachnamen überhaupt – alles über die wichtigen Dinge im Leben beibrachte und wie man ein guter Mensch wird und so Sachen eben. Besser als Mathe war das allemal, und wenn dieser Drillscheiß und die Uniform nicht gewesen wären, dann hätte ich da ganz locker eine Eins gemacht, mit der ich ein paar Dreien hätte ausgleichen können. Ich wusste, dass mein Vater mich schon auf dem besten Weg zum Militär sah. Ohne mich. Dieses Nachwuchsoffiziers-Training war nicht mein Ding. Aber ich zog es durch, und zwar richtig, weil er mich letztlich dazu drängte. Dad gehört zu den Menschen, die glauben, dass ein schwarzer Junge in diesem Land keinen besseren Start kriegen kann, als zur Armee zu gehen. Das war genau das, was er immer behauptete, und zwar wortwörtlich.
»Eines sag ich dir, mein Junge«, sagte er immer und lehnte am Türrahmen meines Zimmers. Ich lag auf dem Bett, kritzelte in meinem Skizzenbuch und musste mich echt am Riemen reißen, um mir nicht einfach die Stifte in die Ohren zu stopfen. Dann fuhr er fort: »Zwei Wochen nachdem ich die Highschool geschafft hatte, kam mein Vater zu mir und sagte: ›Die Einzigen, die von nun an in diesem Haus leben werden, sind die Menschen, mit denen ich Liebe mache.‹«
»Ich weiß, Dad«, stöhnte ich dann immer und wusste genau, was als Nächstes kommen würde, denn das Ganze hörte ich mindestens einmal im Monat. Mein Vater ist berechenbar wie ein Uhrwerk, wahrscheinlich hat er das bei der Armee gelernt. Oder bei der Polizei. Jep, mein alter Herr hat nach nur vier Jahren die grüne Uniform eines Soldaten gegen die blaue Uniform eines Polizisten eingetauscht – obwohl er vom Militär redet, als ob er zwanzig Jahre dabei gewesen wäre. Und die blaue Uniform hat er auch nach vier Jahren an den Nagel gehängt und in einem Büro angefangen, wo er das macht, was man in einem Büro nun mal macht: gelangweilt rumhängen und sich dafür bezahlen lassen.
»Und ich wusste, was er mir sagen wollte: ›Raus hier!‹«, tönte Dad weiter. »Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. In der Schule war ich nicht sonderlich gut, und nun ja, fürs College war ich einfach nicht der richtige Typ.«
»Und deshalb bist du zur Armee gegangen, und das hat dir das Leben gerettet«, beendete ich die Geschichte für ihn und bemühte mich, die Schärfe aus meiner Stimme zu nehmen.
»Lass deine Klugscheißerei«, sagte er dann und deutete zornig auf mich. Immer klang meine Stimme zu bitter, dabei hütete ich mich echt davor, es zu weit zu treiben. Ich hatte es nur so satt, immer wieder dieselbe Geschichte zu hören.
»Ich bin kein Klugscheißer«, antwortete ich dann immer beschwichtigend. »Ich will’s dir nur sagen.«
»Was willst du mir sagen? Dass du keine Disziplin nötig hast? Dass du es nicht nötig hast, die Welt kennenzulernen?«
»Dad –«, begann ich, aber er würgte mich ab und spulte weiter seinen üblichen Text runter.
»Du hast also keine kostenlose Ausbildung nötig? Du musst also nicht für dein Land kämpfen?«
»Dad, ich –« Wieder schnitt er mir das Wort ab.
»Was ist los mit dir, Rashad? Willst du nicht wie dein Vater werden? Sieh dich mal um.« Seine Stimme wurde unnötig schrill, und mit fuchtelnden Armen deutete er voller Wut auf die Wände und die Fenster und so ziemlich alles im Zimmer. »Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen. Du und dein Bruder, ihr habt euch nie Sorgen machen müssen!« Dann kam sein Lieblingsspruch. Es hätte mich nicht überrascht, wenn er ihn sich auf die Brust hätte tätowieren lassen. »Hör zu. Ein schwarzer Junge kann in diesem Land keinen besseren Start kriegen, als zur Armee zu gehen.«
»David.« Ungefähr jetzt hörte ich immer meine Mutter im Flur. An ihrer Stimme merkte mein Vater, dass er es wieder mal zu weit getrieben hatte. »Lass ihn in Ruhe. Er handelt sich keinen Ärger ein und ist ein ordentlicher Schüler.« Ein ordentlicher Schüler. Ich hätte lauter Einsen haben können, wenn ich nicht die ganze Zeit vor mich hin gemalt und gekritzelt hätte. Aber ordentlich war immerhin … nun ja, eben ordentlich.
Dann entspannte sich die Miene meines Vaters jedes Mal, besänftigt von der Stimme meiner Mutter. »Hör mal, kannst du es nicht wenigstens versuchen, Rashad? Nur in der Highschool. Mehr will ich ja gar nicht. Ich hab deinen Bruder darum gebeten, und der hatte es noch nötiger als du. Aber er hat nicht zugehört, und jetzt steckt er bei diesem Paketdienst fest.« Bei ihm klang es so, als müsste man ohne dieses Offizierstraining geradewegs bei UPS landen. Als ob nur grüne und blaue Uniformen in Ordnung wären und braune Uniformen nur Versager trugen.
»Das ist ein guter Job«, ging meine Mutter dazwischen. »Der Junge kann für sich selbst aufkommen, er und seine Freundin haben eine eigene Wohnung. Außerdem kümmert er sich ehrenamtlich um diese Kids im Jugendhaus. Spoony ist jedenfalls in Ordnung.« Sie schob meinen Vater zur Seite, bis sie auch im Türrahmen stand und ich sie sehen konnte. »Und Rashad wird es auch schaffen.« Dad schüttelte nur den Kopf und ging hinaus.
Dieses Gespräch hatten wir schon mindestens zwanzig Mal geführt, Wort für Wort. Als ich dann auf die Highschool kam, ging ich zum ROTC. Eigentlich heißt es JROTC, aber das J kommt nie vor. Die Abkürzung steht für Junior Reserve Officer Training Corps – Nachwuchsausbildung für künftige Reserveoffiziere. Ich ging da hin, damit mein Dad nicht mehr nervte. Um ihn glücklich zu machen. Wie auch immer.
Jedenfalls war heute Freitag, »Uniformtag«, und gleich nach dem letzten Klingeln rannte ich mit meiner Sporttasche zu den Toiletten, um die grünen Klamotten loszuwerden.
Die Toiletten der Springfield Central Highschool waren nie leer. Es stand immer jemand vorm Spiegel und studierte, ob ihm endlich Barthaare wuchsen, es hockte immer jemand auf einem Waschbecken, der sein Handy checkte und den Unterricht schwänzte. Und nach der Schule, besonders an Freitagen, schauten alle rein, um sicherzugehen, dass nichts verabredet wurde, ohne dass sie davon erfuhren. Die Toiletten waren praktisch eine Erweiterung der Umkleideräume, und selbst Schüler wie ich, ohne irgendwelche sportlichen Talente, kamen und redeten über Dinge, über die auch die Sportskanonen redeten, ohne diese ganze Arschklatscherei – weshalb ich mich dort umso wohler fühlte.
»Was geht, Shad?«, sagte English Jones, während er sich selbstverliebt im Spiegel betrachtete. Model-Gesicht von links, Model-Gesicht von rechts. Mit der Hand am Haaransatz langfahren, dann runter ins Gesicht und über die Fläche streichen, wo hoffentlich eines Tages ein richtiger Bart wachsen wird. So macht man das. In-den-Spiegel-Gucken für Anfänger, und English war ein Meister darin. English war in so ziemlich allem ein Meister. Er war ein typischer grünäugiger Schönling, mit Eltern, die ihn verwöhnten, deshalb trug er schicke Klamotten und hatte Tattoos. Außerdem hieß er English – er hieß tatsächlich English, und deshalb konnte er sich die Mädchen praktisch aussuchen. Ein Junge wie maßgeschneidert, als hätten seine Eltern ihn genau so geplant. Aber seltsamerweise war ihm das nicht zu Kopf gestiegen, wie man vielleicht denken könnte, und deswegen waren die Mädels und die Lehrer und der Rektor und die Eltern und sogar der Basketballtrainer noch verrückter nach ihm. Genau, English war auch im Basketballteam. Er war Mannschaftskapitän, er war der beste Spieler. War ja eigentlich klar.
»Was geht, E?«, sagte ich und hob das Kinn kurz in seine Richtung, ehe ich mich in die Kabine zwängte. English und ich waren schon als Kinder eng befreundet, obwohl er ein Jahr älter ist als ich. Wir waren zwei Gänge eines Dreigangmenüs. Der dritte Gang bestand aus Shannon Pushcart, und die Fritten – die extrasalzige Beilage –, die bestand aus Carlos Greene. Carlos und Shannon waren auch da, beide über die Pissoirs gebeugt, aber sie schauten zu mir rüber, was übrigens peinlich ist. Man sollte nie jemanden anschauen, während man pinkelt, egal, wie gut man den Typen kennt, es ist peinlich.
»Gehst du heute Abend zu Jills Party, Gefreiter?«, verarschte mich Carlos wegen meiner Kadettenausbildung.
»Klar geh ich hin. Was ist mit dir? Oder hast du Basketballtraining?«, fragte ich aus der Kabine heraus. Dann setzte ich rasch hinzu: »Ach ja, hab ich ganz vergessen. Du hast’s ja nicht ins Team geschafft. Schon wieder nicht!«
»Ohhhhhhhh!« Shannon fand den Seitenhieb wahnsinnig komisch, wie alle Witze, die nicht auf seine Kosten gingen. Wasser rauschte, und ich wusste, das war Shannon, weil er der Einzige war, der je ein Pissoir spülte. »Der Witz veraltet wirklich nie«, sagte Shannon lachend.
Ich knöpfte meine Uniformjacke auf – ein Polyesterteil, mit Troddeln behangen wie ein Weihnachtsbaum – und warf sie über die Kabinentür.
»Was soll’s«, sagte Carlos.
»Ja, was soll’s«, schoss ich zurück.
»Habt ihr es nie satt, jeden Tag die gleichen Witze zu machen?«, drang Englishs Stimme dazwischen.
»Hast du es nie satt, dein eigenes Gesicht im Spiegel zu streicheln, English?«, gab Carlos zurück.
Shannon prustete. »Volltreffer!«
»Halt die Klappe, Shan«, fauchte English. »Außerdem nennt man das die Follikel stimulieren. Aber ihr wisst ja sowieso nicht, was das ist.«
»Mann, E, jetzt mal ernsthaft, das funktioniert nicht«, kam es von Shannon.
»Ja, vielleicht stehen deine Follikel nicht so auf dich?«, setzte Carlos noch einen drauf. Inzwischen bog ich mich in meiner Kabine schon vor Lachen.
»Aber deine Freundin sehr wohl«, sagte English mit prima Gefühl für Timing. Ein Tiefschlag, direkt in die Magengrube.
»Ohhhhhhh!«, kam es natürlich wieder von Shannon.
»Ich hab doch gar keine Freundin«, sagte Carlos. Aber das half auch nichts. Einen Witz über die Freundin zu machen – egal, ob echt oder eingebildet – ist nun mal eine gute Retourkutsche und geht immer, ein Klassiker, genau wie Witze über deine Mutter. Carlos seufzte, dann schüttelte er alles von sich ab wie ein echter Champ und fuhr fort: »Deswegen müssen wir auf die Party, damit ich die Mädels abchecken kann.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung«, sagte English. »Das ist echt das Klügste, was du den ganzen Tag gesagt hast.«
Raus aus dem grünlich blauen, kurzärmligen Hemd, das ich auch über die Tür warf.
»Genau. Meine Rede«, sagte Shannon, ein wenig zu beflissen. »Die Mädels abchecken«, äffte er Carlos nach, immer noch mit einer Prise Sarkasmus in der Stimme. Wenn mir das schon auffiel, dann fiel es Carlos erst recht auf.
»Ich kann euch nicht sagen, wie die aussehen, aber ich kann euch sagen, wen die garantiert nicht angucken werden … nämlich dich!«, spottete Carlos, um es Shannon heimzuzahlen, dass er über meinen Basketball-Joke gelacht hatte. Es war mindestens drei Minuten her, dass ich diesen Witz gemacht hatte, und Carlos hatte immer noch daran zu knabbern. Wie kleinlich.
»Halt die Klappe, Carlos. Jeder hier weiß, dass ich bessere Karten hab als du. In jeder Hinsicht«, erwiderte Shannon vollkommen ernst.
Ich setzte meinen Fuß auf die Kloschüssel, um meine Lackschuhe aufzuschnüren. Eines ist sicher: Lackschuhe sollten nur Männer tragen, die heiraten. Lackleder und Krieg haben nun wirklich absolut gar nichts miteinander zu tun.
»Darüber könnt ihr auf der Party streiten, Hauptsache, ihr kommt. Soll geil werden«, sagte English, und ich hörte, wie er auf die Tür zuging. Er und Shannon hatten heute eigentlich kein Training, aber sie gingen trotzdem in die Sporthalle, weil Basketball eben ihr Ding war. Besonders für English war Basketball sein Leben. Er klopfte an meine Kabine. »Schau nach mir, wenn du da bist, Alter.«
»Geht klar.«
»Bis später, Shad«, kam es von Shannon.
»Okay, Shad, melde dich, wenn du losmachst«, rief Carlos, während die Tür hinter ihm zufiel. Carlos ist in derselben Straße aufgewachsen wie ich, war wie English in der zwölften Klasse, hatte schon seinen Führerschein und nahm mich zu jeder Party mit. Wir zogen ihn dauernd auf, weil er seit Jahren immer wieder versuchte, ins Basketballteam zu kommen, und jedes Jahr aufs Neue abgeschmettert wurde, weil er nicht sonderlich gut war. Wenn man ihn fragt, ist er natürlich der netteste Kerl, der je einen Ball angefasst hat. Aber als Künstler war er wirklich gut, und das ist auch der Grund, weshalb wir so gut miteinander klarkamen. Bei ihm war es nicht Zeichnen oder Malen, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn, sein Ding war Graffiti. Carlos war ein Sprayer. Sein Erkennungszeichen war LOS(T), und das sah man überall in der Schule, in unserem Viertel und sogar auf der ganzen East Side. Immer wenn es zu einer Party ging, war das für ihn die Gelegenheit, mit seiner Schrottkarre in der Stadt herumzugurken, den Rücksitz voller Lackstifte und Sprühdosen, und mir seine Meisterwerke zu zeigen.
Eigentlich waren es eher unsere Meisterwerke, denn ich lieferte ihm die Ideen, wie und wo er taggen konnte, zum Beispiel an der Seitenwand der Bank bei uns im Viertel. Ich sagte ihm, er solle sie mit dollargrünen Blockbuchstaben zubomben. Für die Tür des Obdachlosenasyls schlug ich goldene Zierbuchstaben vor. Und für die Rückwand eines Basketballbretts auf dem West Side Court empfahl ich ihm Gangsta-Schrift. Ich für meinen Teil hatte nie den Mumm, selbst zu taggen. Ich hab ja schon erzählt, wie mein Vater drauf ist, oder? Na also. Außerdem war Carlos ein richtiger Profi. Er wusste, wie man die Düse kontrolliert und wenig tröpfeln lässt, um saubere Tags zu kriegen. Quasi perfekte Tags. Ich hab es ihm nie gesagt, weil wir so was nicht sagen, aber ich liebe seine Tags, alle miteinander.
Als ich ein paar Minuten später aus der Kabine kam, war ich ein anderer Mensch. So wie Clark Kent, der in die Telefonzelle rennt und sich in Superman verwandelt, war ich Superman, der in die Zelle rannte und zu einem hoffentlich viel cooleren Clark Kent wurde. Superman wird sich mit seinem Umhang und dem knallengen roten Slip ohnehin viel wohler gefühlt haben als ich in meiner Kadetten-Uniform. Wie auch immer. Einen Umhang hatte ich nicht und übrigens auch keinen knallengen roten Slip. Als der ganz normale Rashad Butler kam ich wieder raus: T-Shirt, Sneakers, denen ich mit Spucke eine Katzenwäsche verpasst hatte, und Jeans, die ich hochzog und dann so tief hinten runtersacken ließ, dass ich perfekt aussah. Mein Bruder hatte mir eine tolle Lederjacke geschenkt, die ihm zu eng geworden war, in die schlüpfte ich rein, und Wow!, jetzt war ich bereit für alles, was der Freitag zu bieten hatte. Hoffentlich eine kleine Knutscherei mit Tiffany Watts, der schärfsten Braut der elften Klasse. Wenigstens in meinen Augen. Carlos meinte immer, sie sehe aus wie eine Comicfigur. Als ob er je eine Chance bei ihr hätte. Eine Comicfigur? Also ehrlich. Die Comicfigur meiner Träume.
Bevor ich zu Jills Party ging, um Tiffany anzubaggern, musste ich aber noch ein paar Dinge erledigen. Es war früh am Nachmittag, und ich hatte ein paar Dollar, also wollte ich mir Chips und ein Päckchen Kaugummi leisten, um den Chipsgestank abzutöten. Mit ’nem Drachen im Mund kriegst du kein Mädchen rum. Aber ansonsten war ich völlig pleite, und es war noch nie cool, ohne Cash zu ’ner Feier zu gehen. Man musste immer was für Mother’s Pizza in der Tasche haben, den Pizzaladen, wo alle hingingen, wenn die Party vorbei war oder wenn sie früher abgebrochen wurde, was oft der Fall war. Außerdem muss man dem Typen, dessen Benzintank dich zur Party und wieder weg bringt, wie zum Beispiel Carlos, ein bisschen Geld in die Hand drücken. Also nahm ich den Bus rüber zur West Side, um mich mit Spoony bei UPS zu treffen, nur ein paar Blocks von zu Hause, damit er mir einen Zwanziger pumpen konnte.
Der Bus brauchte ewig, wie freitags immer, wirklich ewig. Also stieg ich an der Vierten Straße aus und ging die letzten paar Blocks zu Fuß zu Jerry’s Corner Mart, während es allmählich dunkel wurde – verrückt, wie früh es im Herbst dunkel wird. Jerry’s war ein Laden, wo es mehr oder weniger alles gab: Räucherstäbchen, Bomberjacken, Mützen, Snacks, Bier, Schirme und was man sonst noch so braucht. Der Laden hieß Jerry, obwohl nie ein Jerry dort gearbeitet hat. Vermutlich war Jerry irgend so ein reicher weißer Typ, der auf der East Side chillte und mit irgendeinem jungen Supermodel, bei der alles Fake war, auf einer Matratze aus echten Geldscheinen sein Ding durchzog. Das Geld hatten wir ausgegeben: für Lottoscheine, billiges Dosenbier und DVD-Raubkopien. Mein Geld.
Ich stieß die Tür zu Jerry’s auf. Es bimmelte wie immer, und der Typ hinter der Kasse schaute auf wie immer und kam dann hinter dem Tresen vor wie immer.
»Was geht, Mann«, sagte ich. Er nickte misstrauisch. Wie immer. Es waren nur zwei Leute im Laden, ein Polizist und eine Kundin, hinten am Flaschenkühlschrank. Der Bulle war kein Wachmann, so einer ohne Waffe und mit einem aufgebügelten Abzeichen. Mein Vater wollte unbedingt, dass sich mein Bruder bei denen bewarb, weil die anständig bezahlt wurden. Nein, dieser Bulle hier war ein echter Bulle. Das war nichts Besonderes, weil es sich rumgesprochen hatte, dass Jerry’s für viele Typen leichte Beute war. Du spazierst einfach rein, schnappst dir, was du haben willst, und spazierst wieder raus. Geld hast du nicht ausgegeben. Aber ich hatte nie irgendwo was geklaut. Ich hatte zu viel Schiss davor, was mein Alter mit mir anstellen würde. Wie ich ihn kannte, würde er mich sofort auf die Militärschule oder in ein Erziehungslager stecken. Wahrscheinlich würde er zu meiner Mutter sagen, ich bräuchte einfach mehr Liegestütze. Zum Glück bin ich nicht der Typ, der klaut, aber ich kenne eine Menge Leute, die das tut, und für einen Dieb gab es keinen besseren Spielplatz als Jerry’s. Ich glaubte also, dass es Jerry (wer immer das ist) mit den Diebstählen einfach zu bunt geworden war und er beschlossen hatte, einen Bullen an Bord zu holen.
Ich schlenderte an den Zeitschriften vorbei nach hinten zu den Chips, gleich neben den Getränken. Man nimmt sich seine Chips, dann dreht man sich um und holt sich ganz bequem aus dem Kühlschrank einen Softdrink oder ein Bier. Ich sah mir die Chips-Auswahl an. Jerry hatte wirklich alles, die ganzen stinkenden Geschmacksrichtungen: Barbecue, Sauerrahm und Zwiebel, Salz und Essig, Cheddar, Chili. Ich überlegte, welchen Geschmack ein Kaugummi wohl am schnellsten vertreiben konnte. Die normalen Chips mit gar nichts kamen nicht infrage. Im Ernst, wer isst denn Chips ohne alles?
Während ich rumüberlegte (immer diese Entscheidungen!), schien die andere Kundin, eine Weiße, die aussah, als ob sie gerade aus dem Büro käme – marineblauer Rock, passender Blazer, weiße Sneakers –, das gleiche Problem zu haben, nur eben mit dem Bier direkt hinter mir. Das konnte ich nur zu gut verstehen. Jerry führte jedes Bier, das man sich vorstellen kann, wenigstens kam es mir so vor. Ich achtete aber nicht weiter auf sie, ich hielt sie einfach für eine Frau, die eine lange Arbeitswoche hinter sich hatte und ein kaltes Bier zischen wollte, um das Wochenende einzuläuten. So macht meine Mutter das gelegentlich. Sie knackt die Dose und kippt das Bier in ein Weinglas, damit sie sich wegen der Rülpserei nicht so genieren muss. Als ob es eine elegante Art zu rülpsen gäbe! Die Lady hier sah aus wie eine, die so was auch macht. Der Typ Frau, der sich auch mal ein Bier mit Nachos gönnt, wenn die Kinder übers Wochenende beim Vater sind.
Pass auf – jetzt ist Folgendes passiert.
Ich entschied mich endlich für eine Sorte Chips – Barbecue, lecker und leicht mit Minze zu schlagen. Das war jetzt geklärt, und ich griff hinten in meiner Hosentasche nach meinem Handy, um Spoony Bescheid zu sagen, dass ich unterwegs war. Verdammt! Das Handy steckte noch in meiner Kadetten-Uniform. Also stellte ich meine Sporttasche auf den Boden, kniete mich hin, die Chipstüte unter den Arm geklemmt, und machte den Reißverschluss auf. Kaum war die Tasche offen, trat die Frau mit dem Bier einen Schritt zurück, stieß gegen mich und brachte mich aus dem Gleichgewicht. Eigentlich stieß sie nicht richtig gegen mich, sondern stolperte über mich. Ich klatschte eine Hand auf den Boden, damit ich nicht ganz übel aufs Gesicht fiel, die Chipstüte schlitterte davon, und die Frau kippte um, wie in Zeitlupe. Sie kämpfte darum, das Gleichgewicht zu behalten, aber dann fiel sie halb auf mich und halb auf den Boden. Die Flasche in ihrer Hand zersprang, und Bierschaum spritzte durch die Gegend.
»Oh mein Gott, es tut mir ja so leid!«, rief die Frau.
Und ehe ich meine Sinne wieder beisammenhatte und ihr sagen konnte, dass alles in Ordnung sei, auch mit mir, und ich mich vergewissern konnte, dass es ihr auch gut ging, rief der Typ, der bei Jerry’s arbeitete und von dem jeder wusste, dass er nicht Jerry selbst war: »Hey!« Damit war klar, dass gar nichts in Ordnung war. Zuerst dachte ich, er würde die Frau anschreien, von wegen: Das Bier müssen Sie aber trotzdem bezahlen!, und ich wollte ihm gerade sagen, er solle sich mal nicht so haben, da merkte ich, dass er auf meine offene Tasche starrte und auf die Chipstüte im Gang. »Hey, was machst du denn da?«
»Ich?« Verwirrt zeigte ich auf mich.
Der Bulle wurde munter und schob sich zwischen mich und den Kassierer, um sich alles anzusehen. Aber mich sah er überhaupt nicht an. Zuerst jedenfalls nicht. Er sah auf die Frau, die sich inzwischen, halb auf dem Boden kniend, die Hände abwischte.
»Alles in Ordnung mit Ihnen, Ma’am?«, fragte der Polizist besorgt.
»Ja, ja, ich –«
Und ehe sie noch ihren Satz beenden konnte, den Satz, der erklärt hätte, dass sie über mich gestolpert und hingefallen war, schnitt ihr der Bulle das Wort ab. »Hat er Ihnen was getan?«
Wieder rief ich aus: »Ich?« Wovon zum Teufel redete er da? Ich machte meine Tasche halb zu, weil ich wusste, gleich würde ich den Laden verlassen müssen.
»Nein, nein, ich –« Die Frau hatte sich jetzt aufgerappelt, offensichtlich perplex wegen seiner Frage.
»Der wollte die Chips klauen!«, schrie jetzt der Kassierer über die Schulter des Bullen. Dann starrte er mich wieder misstrauisch an und sagte: »Stimmt doch, oder? Das wolltest du? Die Chips hast du doch in deine Tasche gesteckt?«
Waaaas? Was ging da vor? Der beschuldigte mich wegen nichts und wieder nichts! Redete der wirklich mit mir? Ich hätte mich am liebsten umgedreht und mich vergewissert, dass da nicht noch ein anderer Junge hinter mir stand, der Chips in seinen Rucksack stopfte oder so, aber ich wusste, da war keiner. Ich wusste, dieses Arschloch redete mit … zu … von … mir. Das kam mir alles vor wie ein schlechter Scherz.
»In meine Tasche? Mann, hier stiehlt keiner was«, erklärte ich und richtete mich auf. Meine Hände waren schon oben, reflexartig, weil ich nun mal einen Bullen auf mich hatte zukommen sehen. Ich warf der Dame einen Blick zu. Sie zog sich langsam zurück, zu den Keksen und in den Gang mit den verpackten Kuchen. »Ich wollte gerade mein Handy aus der Tasche holen, da ist sie über mich gestolpert«, versuchte ich zu erklären, aber der Polizist brachte mich rasch zum Schweigen.
»Maul halten«, bellte er und kam näher.
»Warten Sie, warten Sie, ich –«
»Maul halten, hab ich gesagt«, brüllte er, dann stürzte er sich auf mich und packte mich am Arm. »Hast du nicht gehört? Bist du taub, oder was?« Während er über sein Walkie-Talkie Verstärkung anforderte, führte er mich zur Tür. Verstärkung? Wofür? Für wen?
»Nein, Sie verstehen das nicht«, flehte ich, unsicher, was daraus werden sollte. »Ich hab doch das Geld hier!« Mit meiner freien Hand langte ich in meine Tasche nach dem Dollarschein, mit dem ich die blöden Chips bezahlen wollte. Aber ehe ich das Geld zu fassen bekam, hatte mich der Bulle schon im Schwitzkasten und drehte mir die Arme auf den Rücken, dass mir die Schulter vor Schmerz brannte. Er schubste mich durch die Tür und stieß mich zu Boden, mit dem Gesicht voran. Das tat so übel weh, dass der Schmerz eine Farbe hatte – weiß –, und dann hatte ich ein schreckliches Knirschen in den Ohren, als meine Nase brach. Nachdem er mir Handschellen angelegt hatte, dass mir der Stahl in die Gelenke schnitt, riss er suchend an meinem Hemd und meiner Hose herum. Ich stieß einen Schrei aus, einen Klagelaut, der von irgendwo tief in mir kam. Einen Laut, wie ich noch nie einen von mir gegeben hatte, aus einem Gefühl heraus, das ich noch nie empfunden hatte.
Meine erste Reaktion auf den schrecklichen Schmerz war, mich zu bewegen. Nicht, weil ich fliehen wollte oder Widerstand leisten, ich wollte mich einfach bewegen. Es ist, wie wenn man sich den Zeh stößt. Als Erstes wirft man sich aufs Bett oder hüpft herum. Das war genau dieser Reflex. Ich musste mich einfach bewegen, in der Hoffnung, den Schmerz zu lindern. Aber das war keine gute Idee, denn jedes Mal, wenn ich auf dem Asphalt zuckte, mit jeder instinktiven Bewegung, schienen sich die Handschellen enger zu ziehen, und, schlimmer noch, ich musste einen weiteren Schlag einstecken. Erst in die Niere. Mit dem Knie in den Rücken. Mit dem Unterarm in den Nacken.
»Oh, du willst Widerstand leisten? Du willst Widerstand leisten?«, sagte der Bulle immer wieder, während er auf mich einschlug. Er fragte, als würde er eine Antwort von mir erwarten. Aber ich konnte nicht antworten. Und wenn ich es gekonnt hätte, dann hätte ich ihm gesagt, dass ich keinen Widerstand leisten wollte. Ich war ja schon in Handschellen gefesselt. Die Leute auf der Straße, die zusahen und deren leises Gemurmel »Lassen Sie ihn doch« allmählich zu weißem Rauschen wurde – diese Leute wussten, dass ich keinen Widerstand leistete. Das wollte ich wirklich nicht. Er sollte nur aufhören, mich zu verprügeln. Ich wollte nur leben. Jeder Schlag löste ein Erdbeben in mir aus und zerschmetterte Teile von mir, die ich nie gesehen hatte, Teile, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da waren. »Verdammte Gangster, können einfach nicht tun, was man ihnen sagt. Müssen lernen, wie man die Staatsgewalt respektiert. Das werd ich dir beibringen.« Das zischelte er mir sozusagen ins Ohr, wie um mich zu verhöhnen.
Blut sammelte sich in meinem Mund – es schmeckte metallisch, und meine Augen standen voller Tränen. Ich konnte sehen, dass mich jemand anschaute, aber er verschwamm rasch zu einer feuchten Schliere. Alles war daneben. Völlig falsch. Meine Ohren waren dicht, der Druck stöpselte sie zu. Alles, was ich wahrnehmen konnte, war das undeutliche Grunzen des Mannes, der sich über mich beugte, der mir wehtat, der mir sagte, ich solle aufhören, mich zu wehren, wo ich mich doch gar nicht wehrte, und dann der stechende Lärm von näher kommenden Sirenen.
In meinem Gehirn explodierte eine Million Gedanken zugleich und doch nur ein einziger –
Bitte
töte
mich
nicht.
QUINN
Freitagabends hatte ich immer nur zwei Sachen im Kopf: endlich raus aus dem Haus und ab zur nächsten Party. Aber bevor ich mit Guzzo und Dwyer einen draufmachen konnte, musste ich mich erst noch um Willy kümmern. Früher wollte Ma, dass ich freitags mit ihm zu Hause blieb, aber davon wurde ich zum Glück schon bald wieder erlöst, weil die Cambis, eine befreundete Familie aus der Nachbarschaft, Willy meistens zu sich einluden, um einen Film zu schauen und Pizza zu essen. Deshalb musste ich nach der Schule nur noch seine Tasche packen und ihn zu den Cambis rüberbringen. Das hätte er auch gut alleine machen können – er war schließlich schon in der siebten Klasse –, aber Ma predigte mir immer wieder: »Du musst Verantwortung übernehmen, Quinn.« Und selbst wenn sie dabei nicht direkt vor mir stand oder hinter mir oder drüben an der Küchentür, mit diesem mürrisch-strengen Gesicht, hockte da trotzdem ihre Stimme in meinem Kopf, damit ich auch ja nie vergaß, dass sie da war.
Wie immer war Willy vor mir zu Hause. Er hatte die Wohnungstür offen gelassen. Eigentlich war er viel zu alt, um sich wie ein Steinzeitmensch aufzuführen, aber er war nun mal der Jüngste in der Familie, und so behandelten wir ihn auch. Er saß mit der Playstation im Wohnzimmer. Sein Lebensziel bestand darin, sämtliche Spiele perfekt zu beherrschen, und das in möglichst kurzer Zeit. Gerade spielte er die neueste Version von Grand Theft Auto. Ma hasste dieses Spiel, aber als Willy mit ihr vereinbart hatte, er würde zum Fußballtraining gehen, hatte der süße kleine Prinz ausgehandelt, dass er dafür so oft GTA spielen durfte, wie er wollte. Aber egal. Willy konnte ungeheuer charmant sein. Er bekam immer, was er wollte. Wenn er lächelte, kamen Mrs Cambi bestimmt jedes Mal die Tränen. Bestimmt luden sie ihn deshalb so gerne zu sich ein.
»Nimm das!«, schrie Willy, der genau wusste, dass ich es war, der ins Wohnzimmer kam, nicht Ma, und nietete auf dem Bildschirm mit einer Pistole einen Typen um. Er hatte ein Polizeiauto gestohlen und fuhr ziellos durch die Straßen. Diesen Teil kannte ich schon. Bald würde er einen Hubschrauber finden und in seiner virtuellen Welt noch mehr Scheiß in die Luft sprengen. Ich gab es nur ungern zu, aber ich fand das Spiel verdammt unheimlich.
»He!«, brüllte ich. »Mach leiser, sonst denken die Leute noch, ich würde dich verprügeln. Hast du dein Zeug gepackt?«
Er wippte mit dem Kopf zur Musik und beachtete mich nicht.
»Willy!«
»Sag Will zu mir. Das klingt taffer.«
»Mein lieber, taffer Will, ich tret dir gleich so was von in den Arsch, wenn du nicht sofort deine Tasche packst.«
»Nein, tust du nicht.« Er drehte mir immer noch den Rücken zu, während ich mich langsam an ihn heranschlich. »Nein, tust du nicht, weil ich es sonst nämlich Ma erzähle, und dann tritt sie dir in den Arsch!«
»Kann sein«, sagte ich und verdrehte ihm den Arm hinter dem Rücken. »Aber das ist es mir wert.«
Er schrie und trat nach mir, aber ich hob ihn hoch und schleppte ihn durchs Zimmer bis zum Sofa, wo ich ihn mit dem Gesicht nach unten in die Polster fallen ließ. Dann stemmte ich ihm das Knie in den Rücken. »Gibst du auf?« Sein Gesicht wurde rot. »Na, was ist?« Ich drückte noch fester zu. Es tat nicht weh, das Polster war ja weich. Er war nur sauer, weil er sich nicht befreien konnte. Und er wollte, dass ich ihm wehtat, der sture Hund. Dann könnte er es mir heimzahlen, indem er mich bei Ma verpetzte, was mir mit Sicherheit fetten Ärger einbringen würde.
Es ist nämlich so, vor zwei Jahren ist mir beim Raufen mit ihm was ziemlich Blödes passiert. Damals war er in der fünften Klasse und ich in der neunten. Ich hatte den Abstand falsch eingeschätzt, und als wir umkippten, knallte er mit dem Kopf gegen die Ecke vom Couchtisch. Ich habe gleich den Notarzt gerufen und bin mit Willy ins Krankenhaus. Er musste genäht werden. Weil es nach dem Abendessen passiert ist, war Ma schon bei der Arbeit. Ich wollte sie nicht anrufen und sie unnötig stören. Ich wollte mich einfach nur um meinen Bruder kümmern und alles in Ordnung bringen, bevor sie am nächsten Morgen nach Hause kam. Aber die haben sie angerufen, sobald wir im Krankenhaus waren, und als sie dann kam, hat sie mich vor allen Leuten total runtergeputzt und geschrien wie verrückt. Ich konnte sie ja verstehen. Seit Dad tot ist, müssen wir alle unsere Rolle spielen.
Jetzt kam Willy gerne mit der Geschichte an, wenn er keine Lust hatte, das zu tun, was ich ihm sagte. Zum Beispiel:
»Iss die grünen Bohnen.«
»Warum?«
»Iss sie einfach. Sie sind gesund.«
»Und wenn ich sie nicht esse? Schlägst du mir dann wieder den Kopf ein? Du bist nicht mein Vater!«
Nein. Ich war kein Ersatz für Dad. Niemand konnte ihn ersetzen. Nachdem sie ihn in Afghanistan in die Luft gesprengt hatten, wurde er in Springfield sofort zum Heiligen erklärt. Ich war nicht er. Und ich würde es auch nie sein. Aber alle erwarteten, dass ich es trotzdem versuchte. Das war mein Rolle: der pflichtbewusste Sohn, der typisch amerikanische Junge mit einem typisch amerikanischen, todsicheren Viereinhalb-Meter-Sprungwurf und einem typisch amerikanischen Zweiernotenschnitt.
Aber Willy zum Packen zu bewegen und ihn aus dem Haus zu bekommen – so ein Generve war manchmal selbst für einen Musterknaben wie mich zu viel. Ich nahm das Knie weg und zog ihn vom Sofa hoch. »Komm jetzt, Willy«, sagte ich. »Bitte. Ich muss echt los. Pack deine Tasche.«
Er zog eine Riesenschau ab und schnaufte schwer, bis er sich endlich beruhigt hatte und in unser Zimmer stampfte. Sobald ich hörte, wie er Schubladen aufriss und zuschmiss und seine Fußballsachen zusammensuchte, ging ich in die Küche und packte mein eigenes Zeug. Zu einem normalen Freitagabend gehörte auch, dass ich mir was von Mas Bourbon in einen kleinen Flachmann abfüllte. Sie brauchte den Schnaps, um einzuschlafen, wenn sie von ihrer Schicht drüben im Lagerhaus von Uline zurückkam. Was nach zwölf Stunden harter Arbeit nur verständlich war. Ich klaute den Bourbon, um meinen Freitagabendrausch in Gang zu bringen. Ich, Guzzo und Dwyer, wir brachten uns immer gemeinsam in Feierlaune – Wochenendkrieger bis zum bitteren Ende.
Selbst Willy wusste nicht, dass ich Mas Bourbon klaute. Ich steckte die Flasche ein, während er in unserem Zimmer nach den Schienbeinschonern suchte. Er bekam gar nicht mit, dass ich mir heimlich was abfüllte. Denn seine Augen waren auch Mas Augen, und die waren wiederum die Augen von diesen ganzen Idioten in Springfield, die mich anschauten und immer nur an meinen Dad dachten.
Angeblich hatte ich Dads Augen und Dads Figur und Dads typisch amerikanisches Aussehen. Typisch amerikanisch? Was sollte das überhaupt sein? Ich hasste dieses Gerede. Was meinten diese Deppen eigentlich damit?
Ich ging zurück ins Wohnzimmer und schaltete das Spiel und den Fernseher aus. Dann schaute ich prüfend in alle Zimmer und knipste die Lampen aus und alles. Verantwortungsvoll – so bin ich eben. »Bist du fertig?«, rief ich.
»Ja«, sagte Willy.
»Alles klar, taffer Will?«
»Halt die Klappe.«
»Ich dachte, ich soll dich jetzt so nennen …«
»Arsch.«
»Na gut. Gehen wir.«
Sobald wir aus dem Haus waren und ich abgeschlossen hatte und wir die Straße langgingen, legte ich ihm den Arm um die Schultern. Er schüttelte ihn nicht ab, was mich überraschte und freute. Ich war zwar nicht sein Vater oder überhaupt ein Vater, aber ich fand es toll, einen Bruder zu haben, und ich hatte die kleine Nervensäge ganz schön gern.
Mich ärgerte nur, dass ich ihn zu den Cambis bringen musste. Nun übernimm doch mal ein bisschen Verantwortung! Zu Willy sagte Ma das nie. Die paar Straßen hätte er auch gut allein gehen können, er war schließlich zwölf und keine fünf mehr. Es war auch nicht weit, aber Ma und die Cambis machten sich fast in die Hose wegen der zwei Häuserblocks Entfernung zwischen unseren Straßen. Sie meinten, die Gegend werde immer gefährlicher, und angeblich war Sal Cambi neulich nach der Schule von ein paar Jugendlichen bis nach Hause verfolgt worden, und Mrs Cambi musste erst mit der Polizei drohen, damit sie von ihrer Veranda verschwanden. Offen gesagt hatte ich schon oft erlebt, dass Sal sich Willy gegenüber wie ein Arsch aufführte; vermutlich hat er was Blödes zu den Tpyen gesagt und dann nicht geblickt, dass die deswegen hinter ihm her waren. Der Junge war manchmal ein echter Volltrottel, aber ich war trotzdem froh, dass er mit Willy befreundet war. Die Cambis waren supernett, sie luden Willy freitags immer ein und behandelten ihn, als würde er zur Familie gehören. Diese Freundlichkeit rettete mich davor, auf ihn aufpassen zu müssen, und ich konnte weiter auf Partys rumhängen, so wie alle anderen, die ich kannte.
In unserer Gegend wohnen fast alle in Mehrfamilienhäusern. Wir wohnen im ersten Stock, über einem alten Ehepaar, Mr und Mrs Langone, und müssen nicht viel Miete zahlen, sagt Ma. Den Cambis dagegen gehört das ganze Haus, in dem sie wohnen, und deshalb, sagen sie, müssen sie auch bleiben, sonst wären sie schon längst weggezogen.
Ich hatte zwar noch keine Familie und musste mir keine Gedanken um Miete und Stromrechnungen und ähnlichen Scheiß machen, aber eines wusste ich genau: Ein Stadtviertel, in dem die Straßenlaternen nur selten repariert werden, in dem die Polizei mobile Überwachungstürme aufstellt und deutlich häufiger in den Straßen patrouilliert als früher, ein solches Viertel hat sich definitiv verschlechtert. Trotzdem liebe ich die West Side. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Was zum Teufel meinten die Leute eigentlich, wenn sie davon sprachen, die West Side würde sich verschlechtern? Was sagte das über die Menschen aus, die hier lebten, wie mich zum Beispiel, und die ganzen anderen Leute, die in letzter Zeit hierhergezogen waren?
Bei den Cambis rannte Willy die Vortreppe hoch, während ich unten stehen blieb. Er klingelte, und Mrs Cambi machte ihm auf. Willy flitzte an ihr vorbei, während sie mir von der Tür aus zuwinkte. Sie trug Hausschuhe. Ich blieb auf dem Bürgersteig stehen, weil ich nicht zu nah rankommen wollte. Ich hatte keine Lust, länger zu bleiben als nötig, ich wollte endlich los und feiern.
Aber Mrs Cambi versuchte mich wie immer zu locken. »Quinn, du weißt, du bist uns auch immer willkommen.« Sie lehnte sich gegen den Türrahmen und hielt die Tür auf. Der Geruch von gebratenem Knoblauch und Zwiebeln war schon von der Straße aus zu riechen. Ich wusste gar nicht mehr, wann Ma das letzte Mal für uns gekocht hatte.
»Danke«, sagte ich. »Aber ich bin schon satt. Ich hab noch was vor.«
»Natürlich. Beschäftigt wie immer, unser Quinn.«
»Außerdem will ich Willy nicht stören, wenn er mit seinen Freunden spielt.«
»Du störst hier niemanden, Quinn, das weißt du doch.«
»Danke noch mal, Mrs Cambi.«
»Regina. Bitte sag Regina zu mir. Mrs Cambi war meine Schwiegermutter.« Sie lächelte. Es war ein Lächeln, das ich viel zu oft zu sehen bekam: das stolze Mitleid für die beiden Söhne des Heiligen von Springfield. »Du bist ein guter Junge, Quinn«, sagte sie zu mir.
Ich nickte und machte mich davon.
Dieses ganze Getue nervte mich total. Die Welt war zum Kotzen, und es war mir scheißegal, wenn das weinerlich klang. Es war einfach Tatsache. Ja, klar, ich war ein guter Junge. Ein Vorzeigekind. Und mein Vater war ein Vorzeigemann gewesen, ein Mann, der, wenn er auf Urlaub kam, in seiner gebügelten blauen Uniform in der Suppenküche der Kirche stand und eine Kelle Hühnersuppe nach der anderen ausgab, die er natürlich auch noch selbst gekocht hatte. Ja, klar, ein Vorzeigemann, als er noch lebte, und ein Vorzeigemann, nachdem er tot war. Der Vorzeigemann und die Vorzeigefamilie, die er zurückließ.
Mein Dad wurde in Afghanistan in die Luft gesprengt, und Ma und alle, die wir kannten, und jede Menge Leute, die wir nicht kannten, die aber wussten, wer er war, erinnerten mich ständig daran, dass er sich für uns geopfert hatte. Er hatte sich für das Wohl unseres Landes geopfert. Er starb im Namen der Freiheit. Er starb, um all den Verrückten da draußen in der Welt, die nicht an Demokratie, eine liberale Wirtschaftsordnung, Bürgerrechte und den ganzen Scheiß glaubten, zu beweisen, dass wir recht haben und sie nicht. Aber für mich war mein Vater tot, und diese Scheiß-Verrückten hatten gewonnen. Und überhaupt, wer war hier verrückt? Ich für meinen Teil kam mir auch nicht immer ganz normal vor.
Seit ich von der Schule nach Hause gekommen war, hatten mich Dwyer und Guzzo mit Nachrichten bombardiert, und ich wusste, dass sie in der Gasse hinter Jerry’s Eckladen auf mich warteten. Eine Straße davor nahm ich schnell einen Schluck von meinem Bourbon, damit sie merkten, dass ich was dabeihatte. Damit sie wussten, dass ich auch endlich feiern wollte, aber vorher eben noch was erledigen musste. Ich nahm einen Schluck, weil ich nämlich ein verantwortungsvoller Sohn und Bruder war.