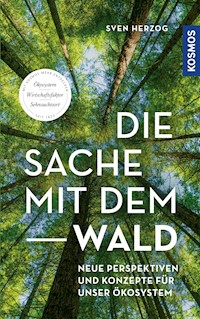
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Unseren Wäldern geht es schlecht. Ist die Ursache allein der Klimawandel? Welche Rolle spielt die Forstwirtschaft und gibt es wirklich zu viel Wild? Der Forstwissenschaftler Prof. Sven Herzog hinterfragt alte Konzepte und Glaubenssätze im Naturschutz und plädiert für einen "Schutz durch Nutzung". Er zeigt Wege zu intelligenten, nachhaltigen Konzepten, welche die gesellschaftlichen Bedürfnisse in Bezug auf Biodiversität, Klimaschutz und Erholung befriedigen, ohne dass dabei die Nutzung des Holzes auf der Strecke bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© Stocksy.com, Andreas Wonisch
INHALT
Warum ein Waldbuch?
1. Wälder und Menschen in geschichtlicher Zeit
2. Mythos Wald
3. Wälder als Ökosysteme
4. Wald und Wild
5. „Use it or loose it“: Nutzung des Waldes
6. Die Sache mit der Nachhaltigkeit
7. Urwald – Naturwald – Wirtschaftswald
8. Waldschäden, Waldsterben und Klimawandel
Brauchen wir eine Waldwende?
Weiterführende und vertiefende Literatur
Impressum
© Sven Herzog
WARUM NOCH EIN WALDBUCH?
Man sollte glauben, zum Thema Wald sei alles gesagt, vielleicht nur noch nicht von jedem. Immer neue Bücher kommen auf den Markt, esoterische ebenso wie emotionale, Bildbände ebenso wie Fach- oder Sachbücher. Viele transportieren eine bestimmte Sichtweise, sehen den Wald aus einer bestimmten Perspektive, vertreten bestimmte Partikularinteressen und blenden viele andere Aspekte dabei aus.
Dies wird dem Thema Wald jedoch nicht gerecht. „Wald“ verkörpert für uns Mitteleuropäer, Stadtmenschen ebenso wie Bewohner des ländlichen Raumes, ein breites Spektrum an Assoziationen, Empfindungen und Emotionen.
Welche Assoziationen entstehen, wenn Sie einmal die Augen eine Minute lang schließen und an „Wald“ denken?
Kindheitserinnerungen vom Waldspaziergang? Märchenbücher mit phantasievollen Bildern von urigen Wäldern, in denen allerlei Fabelwesen zu Hause sind? Vogelgezwitscher und das Summen von Insekten? Licht, das durch Baumkronen fällt? Erstarrte Winterlandschaft? Der Geruch von Harz? Das Reh vertraut auf der Waldlichtung? Vielleicht aber auch das Geräusch einer Motorsäge ganz von fern? Der leichte, nicht unangenehme Geruch nach warmem Motoröl in der Nähe einer Forstmaschine? Oder auch ein Hochglanzprospekt über nachhaltige und krisensichere Investitionen in Wälder?
Wir alle haben unsere individuellen Vorstellungen, wenn wir an Wälder denken, neben Emotionen und Erinnerungen verbinden wir diese mit (intakter) Natur, mit Erholung, mit Befreiung von den Alltagszwängen. Aber auch mit der nachhaltigen und achtsamen Nutzung natürlicher Ressourcen, der sich unsere Gesellschaft seit vielen Jahren als eine gedankliche Idealvorstellung verschrieben hat.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Derselbe Wald hat viele Gesichter: Projektionsfläche unserer Sehnsucht und magischer Ort, Freizeit und Naturerlebnis, Ruhe und Meditation, Natur und Technik, Brennholzlieferant und Kohlendioxidspeicher.
Allerdings, und das ist vielen Menschen nicht wirklich bewusst, sind es meist Wirtschaftswälder, auf die sich unsere Vorstellungen beziehen. Wälder, die seit langer Zeit von Menschen auf vielfältige Weise genutzt werden.
Die planmäßige, geregelte und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder Mitteleuropas war und ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit. Sie legte die Grundlage für die sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Entwicklung dieser Region.
Die frühe Neuzeit war geprägt durch die rapide Entwicklung der Montanindustrie und der Hochseeschifffahrt. Konstruktions- wie Energieholz wurde bald knapp und die geregelte Forstwirtschaft war die richtige Antwort auf die Energie- und Rohstoffkrise des 18. Jahrhunderts, die im Wesentlichen eine Krise der Holzversorgung nach massiver Übernutzung und weitgehender Zerstörung der Wälder darstellte.
Somit kann man die Entwicklung der nachhaltigen Forstwirtschaft aus ökonomischer Sicht in eine Reihe mit der Entwicklung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert oder der Digitalisierung seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts stellen.
Im beginnenden 20. Jahrhundert wurde es bald politisch. „Wald“ und „Natur“ waren spannende gesellschaftliche Themen. Naturschutz- und Wandervogelbewegung oder die „Naturgemäße Waldwirtschaft“ entstanden oder entwickelten sich in dieser Zeit. Nach deren Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus in den 1930er und 1940er Jahren galt die Beschäftigung mit dem Wald und der Natur in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit als etwas hoffnungslos Gestriges. Andere Fragen waren deutlich zeitgeistiger und standen im gesellschaftlichen Fokus.
Mit der Anti-Atomkraft-Bewegung, aber auch mit dem Waldsterben der 1970er und 1980er Jahre änderte sich diese Sichtweise allerdings bald. Die Sorge um die Bewahrung der natürlichen Ressourcen rückte wieder in den Vordergrund. Naturschutz (und Wälder sind für viele Menschen nach wie vor pure Natur) war wieder gesellschaftsfähig. Auch wenn das Waldsterben durch saure Niederschläge in seinen Auswirkungen seinerzeit vielleicht überbewertet wurde, so hat es doch dazu beigetragen, eine Sensibilität für das Thema Wald bei den Menschen und in der Gesellschaft zu schaffen und zu verankern.
Seit einigen Jahren stehen wir wieder vor sterbenden Bäumen, ein Bild des Schreckens für Profis ebenso wie für Laien. Forstliche Verbände rufen reflexhaft nach finanziellen Beihilfen und beschwören gebetsmühlenartig den Klimawandel als Ursache allen Übels. Von forstlichen Fehlentscheidungen in den vergangenen Jahrzehnten hören wir erstaunlich wenig. Von Seiten der Politik kommen hilflose Gesten, aber kaum konkrete Handlungskonzepte.
Auf der öffentlichen Bühne erscheinen Aktivisten und Publizisten, aber auch Verbandsvertreter und Forscher und stellen den Umgang der Forstleute mit unseren Wäldern in weiten Teilen infrage: Wäre es nicht besser, Wälder gar nicht mehr zu bewirtschaften? Weiß Mutter Natur nicht am besten, was gut für uns ist? Ist Holznutzung nicht Frevel an unseren natürlichen Ressourcen? Solche Fragen begegnen uns mittlerweile allenthalben.
Und wenn auch das relativ regenreiche Jahr 2021 vielerorts zeigt, dass nichts ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint, so bewegt sich die Diskussion um die Zukunft unserer Wälder, aber auch um die Zukunft einer nachhaltigen Forstwirtschaft, weiterhin im Krisenmodus. Der Geist ist aus der Flasche und nicht mehr einzufangen.
FAKTENBASIERTE INFORMATIONEN
An dieser Stelle setzt das vorliegende Buch an. Es will der lauten öffentlichen Diskussion nicht einfach noch eine weitere Meinung hinzufügen. Es hat auch nicht die Absicht, „wissenschaftlich fundierte Wahrheiten“ zu präsentieren. Denn „Wissenschaft“ und „Wahrheit“ passen bekanntlich nicht zusammen. Es sind Religionen und Ideologien, welche sich in Besitz der Wahrheit wähnen.
Die Absicht des vorliegenden Buches ist es, die interessierte Leserin und den interessierten Leser darin zu unterstützen, sich selbst ein Bild zu machen und die zahlreichen und widersprüchlichen Aussagen einmal kritisch zu hinterfragen, Zusammenhänge zu erkennen und festzustellen, dass die Dinge nicht ausschließlich schwarz oder weiß sind.
Dass in Wäldern einzelne Bäume sterben, ist normal. Auf diese Weise passt sich die Baumpopulation an wechselnde Umweltbedingungen während des langen Baumlebens an. Im Lebenszyklus eines Waldes sind „Jahrhundertereignisse“ wie Trockenjahre oder Stürme nichts Außergewöhnliches. Bäume sterben, die umstehenden Bäume schließen die Lücke alsbald.
Wenn allerdings ganze Waldbestände absterben, dann müssen wir uns fragen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Wo wurden Fehler gemacht? Und wie können wir diese in Zukunft vermeiden? Das vorliegende Buch versucht Antworten auf diese und zahlreiche andere Fragen zu geben. Es will dabei nicht belehren, sondern faktenbasierte Informationen liefern.
Welche Rolle spielen Böden, Pflanzen und Wildtiere in unseren Wäldern? Sind Rehe und Hirsche wirklich nur Schädlinge, die es zu dezimieren gilt?
Und was können Wälder in Zukunft leisten, um die gesellschaftlichen Bedürfnisse in Bezug auf Biodiversität, Klimaschutz und Erholung zu befriedigen, ohne dass dabei das forstliche Kerngeschäft, die Nutzung des Holzes, auf der Strecke bleibt?
Gerade in Zeiten großer politischer Unsicherheit und weltweiter Abhängigkeiten der Produktions- und Lieferketten ist die nachhaltige, lokale Versorgung mit Konstruktions- und Energieholz wichtiger als je zuvor.
Auf den folgenden Seiten wollen wir unseren Umgang mit Wäldern einmal „gegen den Strich bürsten“. Dabei werden wir erkennen, dass Forstwirtschaft sich nicht darin erschöpfen darf, Wälder lediglich zu verwalten. Langfristiges Denken und der kluge Einsatz natürlicher Ressourcen sind die Voraussetzung für langfristige Erfolge. Dabei stehen sich Ökonomie und Ökologie keineswegs so unversöhnlich gegenüber, wie dies derzeit in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird.
Es ist sicher nicht sinnvoll, Wälder wie unter einer Käseglocke zu schützen. Solche Ansätze sind in der Vergangenheit zu oft gescheitert. Sowohl eine kluge, nachhaltige forstliche Nutzung als auch eine Öffnung der Wälder für erholungssuchende Menschen mit unterschiedlichen Interessen stehen einem langfristigen Schutz der Waldökosysteme nicht im Wege. Schutz durch Nutzung ist weltweit heute eines der erfolgreichsten Schutzkonzepte.
Dazu bedarf es zukünftig allerdings einiger Voraussetzungen.Damit unsere Wälder mit ihren vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen eine Zukunft haben, ist es erforderlich, dass wir als Waldbesitzer und Forstleute festgefahrene Glaubenssätze verlassen, ohne dabei Bewährtes über Bord gehen zu lassen. Nachhaltigkeit bedeutet weder Verharren in ewig gestrigen Denkansätzen noch jedem Modetrend hinterherzulaufen!
Wenn wir nach Jahrzehnten erkennen, dass standortfremde Baumarten wie die Fichte enorme Probleme bekommen, dann sollten wir uns sehr gut überlegen, ob es jetzt klug ist, nun die Libanonzeder oder andere Exoten zu pflanzen, oder ob wir nicht zunächst die ökologischen Potentiale der vorhandenen Arten ausloten sollten. Wir sollten prüfen, ob die Entscheidungen der 1990er Jahre, Forstbetriebe personell massiv zu „verschlanken“ und Reviere deutlich zu vergrößern, wirklich zielführend waren. Oder ob es nicht klüger ist, wieder mehr Personal in die Fläche zu bringen und forstliche Arbeiten nicht weiter „outzusourcen“. Und müssen viele Forstdienststellen im Herbst und Winter tage- und wochenlang nur sehr bedingt arbeitsfähig sein, weil die Forstbeamten sich auf der Jagd befinden?
Als Bürger, Naturfreunde und Waldbesucher müssen wir lernen, Waldökosysteme mit ihren Böden, Tieren und Pflanzen achtsam zu behandeln, wenn wir diese für unsere Zwecke nutzen. Nur so werden auch unsere Kinder und Enkel die Wälder erleben und bewundern können, die heute begründet werden.
Wenn dieses Buch ein Stück dazu beitragen kann, hat es sein Ziel erreicht.
|
© Sven Herzog
1. WÄLDER UND MENSCHEN IN GESCHICHTLICHER ZEIT
Seit Menschen begonnen haben, über sich selbst und ihr Dasein nachzudenken, sind es neben den Tieren vor allem die Bäume und Wälder, die unsere Kultur- und Zivilisationsgeschichte über Jahrtausende immer wieder beeinflusst haben. Darauf gehen wir in Kapitel 2 näher ein.
Umgekehrt wurden Wälder ihrerseits bereits früh durch menschliche Aktivitäten beeinflusst. So können wir davon ausgehen, dass Menschen mit dem Beginn der Sesshaftigkeit eines bedeutenden Teiles der Bevölkerung bereits im Neolithikum einen signifikanten Einfluss auf die Wälder Mitteleuropas ausübten102. Holz wurde schnell der zentrale, das Leben bestimmende Rohstoff, man spricht deswegen auch von einer „hölzernen Zeit“.
Neben der Holznutzung waren es zwei weitere Phänomene, welche die Wälder Mitteleuropas seit der Jungsteinzeit signifikant beeinflussten: Rodung und Waldweide.
Sesshaftigkeit war zwingend mit Rodungen verbunden. Dadurch wurden Flächen für Siedlungen, vor allem aber Anbauflächen für das Getreide geschaffen. Die Ernährung der Haustiere wiederum erfolgte durch Waldweide, wie sie bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein auch in Mitteleuropa gängig war und lokal (etwa im Alpenraum) bis heute noch in Rudimenten zu beobachten ist. Die Tiere wurden – meist behirtet – in den Wald um die Siedlungen getrieben, von dessen Pflanzen und Früchten (Eicheln und Bucheckern spielten dabei eine wesentliche Rolle) sie sich ernährten. Während die Schweine zum Winter meist geschlachtet wurden, hielt man Rinder, Schafe und Ziegen den Winter über im Stall, wo diese mit Laubheu, also mit getrockneten Blättern und Trieben verschiedener Gehölze wie Hasel, Linde, Esche oder Ulme gefüttert wurden. Schließlich wurde Laub- und Nadelstreu aus den umliegenden Wäldern als Einstreu in den Ställen verwendet.
Diese vielfältigen Nutzungen des Waldes bedeuteten eine lokale Übernutzung und hatten Auszehrung der Böden der umliegenden Waldgebiete zur Folge. Die Böden verloren je nach Standort mehr oder weniger schnell ihre Fruchtbarkeit, die Verjüngungsfähigkeit der Wälder ließ nach.
Siedlungen zu Beginn menschlicher Sesshaftigkeit dürfen wir uns somit auch nicht wie heute über Jahrhunderte stationär vorstellen, sondern eher wie den (heute noch in Teilen der Tropen üblichen) Wald-Feld-Bau: Wenn die Böden nach einigen Jahren oder Jahrzehnten ausgezehrt waren, wenn die hölzernen Gebäude verfielen, zogen die Menschen weiter, rodeten neue Flächen und der Kreislauf begann aufs Neue. In den meisten Fällen waren die hinterlassenen Gebiete aber nicht dauerhaft geschädigt und entwaldet, sondern es bildete sich ein neuer, „Sekundärwald“, der seinerseits Jahrhunderte überdauerte und trotz niedriger Bevölkerungsdichte bereits in vor- und frühgeschichtlicher Zeit zumindest lokal das Waldbild prägte. Es gibt durchaus gute Gründe anzunehmen, dass die umfangreichen Wälder mit dominierender Buche (oder auch Fichte in den höheren Lagen) in weiten Teilen Mitteleuropas bereits die Folgen jahrtausendealter menschlicher Einflussnahme darstellen102.
Seit dem ersten vorchristlichen Jahrtausend war es die Kultur der Kelten, welche große Teile Mitteleuropas beeinflusste. Trotz erster größerer Siedlungen und Städte und dem damit verbundenen Raubbau im Umfeld der Siedlungen war Mitteleuropa offenbar immer noch sehr waldreich, auch wenn uns keine schriftlichen Zeugnisse aus dieser Epoche vorliegen182.
Hölzerne Zeit
Bei genauerer Betrachtung war die Epoche vom Neolithikum (Jungsteinzeit) über die Bronze- und Eisenzeit bis ins 19. Jahrhundert immer auch und vorwiegend eine „hölzerne Zeit“: Holz dominierte (bis zum Siegeszug der Kohle seit dem 19. Jahrhundert) die Energiegewinnung und war bis ins 20. Jahrhundert wichtigstes Bau- und Konstruktionsmaterial. Erst Kohle und Stahl, später Erdöl und Kunststoffe veränderten die Situation grundlegend. Der Soziologe und Volkswirt Werner Sombart schrieb über diese Zeit189: „Das Holz griff in alle Gebiete des Kulturdaseins hinein, war für alle Zweige des Wirtschaftslebens die Vorbedingung ihrer Blüte und bildete so sehr den allgemeinen Stoff aller Sachdinge, dass die Kultur vor dem 19. Jahrhundert ein ausgesprochen hölzernes Gepräge trägt.“
Schriftliche Zeugnisse hinterließen uns allerdings die Römer. Wer in der Schule Lateinunterricht hatte, kennt wahrscheinlich noch die Texte etwa von Caesar, Plinius oder Tacitus. Diese zeichnen, neben militärischen Berichten oder Informationen zu Land und Leuten, auch ein Bild der Landschaft in den besetzten Gebieten nördlich der Alpen.
Sie beschreiben die Wälder in „Germanien“, im Siedlungsraum der „Germanen“ (ein damals wie heute gerne verwendeter Sammelbegriff für verschiedene Ethnien nördlich der Donau und westlich des Rheins) als lebensfeindlich, dunkel, unwirtlich und als selbst in vielen Tagesmärschen nicht zu durchquerende Hindernisse.
Sicher ist dies ein subjektives Bild. Wir können uns aber leicht vorstellen, wie sich Menschen, die ein mediterranes Klima und das Licht des Südens gewohnt waren, im kalten und regnerischen Norden fühlten. In einer Landschaft, in der sowohl die Natur mit ihren Wäldern und wilden Tieren als auch manche Völker als ausgesprochen (lebens-)feindlich empfunden wurden. So ist es wohl die Summe aus Klima, Vegetation und einer unberechenbaren, asymmetrischen Kriegführung verschiedener lokaler Gruppen, welche diesen Eindruck prägte.
Erklärtes Ziel der Römer war es daher, das besetzte Gebiet zu „befrieden“. Dazu gehörte auch, Wälder zu roden, Siedlungsraum zu schaffen und Landwirtschaft zu betreiben, wie man dies aus der Heimat gewohnt war.
Gleichzeitig wurden enorme Mengen an Holz als Energiequelle und für Konstruktionszwecke benötigt. Militärische Befestigungsanlagen, Kastelle und Wohnsiedlungen wurden errichtet, Fahrzeuge für Transportzwecke und Kriegsmaschinen gebaut und eine wachsende soziale Oberschicht sah ein geheiztes Haus und heiße Bäder als Selbstverständlichkeit an.
Die Rodungen zur Römerzeit sind schwer zu beziffern, doch gehen wir davon aus, dass an Rhein und Mosel und entlang des Limes bereits in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in etwa die Verteilung von Wald und Ackerflächen herrschte, wie wir das heute zum Beispiel in der Wetterau oder am Oberrhein vorfinden143.
Während die Landwirtschaft der Römer bereits als hochentwickelt und aus heutiger Sicht sogar als nachhaltig gelten konnte, wurden die Wälder lediglich ausgebeutet, vergleichbar etwa mit der heutigen Exploitationswirtschaft, also einer ungeregelten und die wirtschaftlichen bzw. ökologischen Folgen nicht berücksichtigenden Holznutzung, in einigen tropischen Regionen. Von Nachhaltigkeit konnte hier keine Rede sein.
Aus heutiger Sicht interessant ist die Tatsache, dass, wie erwähnt, die Verteilung von Wald und Feld in einigen Regionen bereits seit der Römerzeit bis heute weitgehend unverändert besteht.
Dennoch gab es über die Jahrtausende immer wieder Flächen, die gerodet und besiedelt waren, doch später wieder aufgegeben und vom Wald vereinnahmt wurden. Diese „Wüstungen“ bergen beispielsweise keltische Siedlungen, römische Villen, mittelalterliche Dörfer oder Grabstätten aus allen Epochen. Insbesondere zur Zeit der Völkerwanderung und des Rückzugs des römischen Imperiums aus Nord- und Mitteleuropa, aber auch nach den Pestepidemien des Mittelalters hat sich der Wald zahlreiche ehemals gerodete Flächen wieder zurückgeholt143.
Dies bedeutet aber auch, dass, wie wir später noch sehen werden, in Mitteleuropa keine Urwälder, also vom Menschen unberührte Wälder, mehr existieren.
Eine besondere gesellschaftliche Bedeutung erreichte der Wald später, im fränkischen Reich. Dessen politisches System war im Wesentlichen auf die Interaktion zwischen den Königen und dem Adel gegründet. Das aus römischer Zeit brachgefallene Land, das „Niemandsland“, ging meist ins Eigentum des Königs bzw. Kaisers über.
Ein Problem bildeten in diesem Zusammenhang die „Gemeinfreiheiten“, die Gewohnheitsrechte der keltischen bzw. germanischen Stammesgesellschaften, welche von alters her ihren freien Mitgliedern Holznutzung, Jagd oder Fischfang gestatteten.
Dem schoben die fränkischen Könige, Merowinger ebenso wie Karolinger, alsbald einen Riegel vor. Durch den „Bann“, eine königliche Verfügung, wurde die Ausübung der Gemeinfreiheiten untersagt. Die Könige reservierten sich auf diese Weise Flächen insbesondere für die Jagd.61,120,173
Diese Form der Besitzergreifung von vormals öffentlichem Land wurde auch „Einforstung“ (inforestation) genannt, und alsbald wurden die Begriffe „Wald“ und „Forst“ synonym gebraucht. Erst in jüngster Zeit wird sprachlich wieder mehr zwischen „Wald“ und „Forst“ unterschieden. Das hat aber ganz andere Gründe, wie wir später noch sehen werden.
Bannforste wurden im Laufe der Jahrhunderte an vielen Orten in Europa etabliert; in England etwa war es Wilhelm der Eroberer, der dafür berüchtigt ist, auf diese Weise zahlreiche Flächen der Allgemeinheit entzogen zu haben. Aus heutiger Sicht haben diese frühen Übergriffe staatlicher Gewalt durchaus ihre Vorteile: Zahlreiche große Waldgebiete, beispielsweise Harz, Solling, Reinhardswald, Spessart, Nürnberger Reichswald, Schönbuch und viele andere sind nur aufgrund ihrer Eigenschaft als Bannwälder und später Teile von Königsgütern bis heute in diesem Umfang erhalten. Auch die Tatsache, dass etwa Rotwild in Deutschland noch nicht völlig ausgerottet wurde, hat etwas mit der Existenz ehemaliger Bannforste in der Hand der Landesherren und des Adels im 19. Jahrhundert zu tun (vgl. Kapitel 4).
Über die Jahrhunderte diente Landbesitz einschließlich Wald den Königen auch als Währung, um sich Adelige und Kirche als loyale Gefolgsleute zu sichern. Lehen und Schenkungen verteilten den Waldbesitz. Die Anzahl der Grund- und damit Waldbesitzer vermehrte sich, während der Umfang des einzelnen Grundbesitzes geringer wurde.
DIE PERIODE DER RODUNGEN
Einer Phase des wirtschaftlichen Wachstums und des Ausbaus der Siedlungen bis ins achte Jahrhundert folgte eine Zeit ökonomischer Rückschläge. Erst ab der ersten Jahrtausendwende ging es in Europa wirtschaftlich wieder aufwärts, das Klima wurde deutlich wärmer und die Bevölkerung Mitteleuropas wuchs. Für die Wälder hatte die „Periode der Rodungen“ begonnen, welche erst in der spätmittelalterlichen Klimaabkühlung ihr Ende fand.
Zwischen der ersten Jahrtausendwende und dem Ende des 14. Jahrhunderts reduzierte sich die Waldfläche von über der Hälfte der Fläche auf weniger als ein Drittel. Die Bevölkerung erreichte um die Mitte des 14. Jahrhunderts einen Höhepunkt. Allein für das heutige Gebiet Deutschlands können wir von etwa 15 Millionen Menschen ausgehen. Mehr Menschen bedeuteten mehr Nahrungsbedarf und in ungünstigen Jahren Hungersnöte. Da die Produktivität des Agrarlandes sich in einer Zeit ohne künstliche Düngemittel (diese wurden erst durch Justus von Liebig an der Universität Gießen im 19. Jahrhundert entwickelt) kaum steigern ließ, wuchs der Druck auf die Wälder.
Bauern und Klöstern wurde vom Grundherrn Wald überlassen mit der Verpflichtung, diesen zu roden und zu landwirtschaftlichen Flächen umzuwandeln. Je nach Epoche und Region erfolgte dies auf unterschiedliche Weise. Sogenannte Waldhufendörfer erstreckten sich in den Mittelgebirgen zunächst entlang der Täler, später wurden dann auch die Hänge gerodet. Zahlreiche Ortsbezeichnungen zeugen bis heute nicht nur von der Rodung, sondern auch von den Ausführenden (z. B. „Pfaffenrode“ oder „Konradsreuth“).
Ab dem 14. Jahrhundert gingen zahlreiche Siedlungen wieder verloren. Wir können davon ausgehen, dass bis heute etwa ein Fünftel der damaligen Siedlungen wieder aufgegeben wurde, „wüst gefallen“ ist und bis heute als „Wüstung“ nur noch in Flurkarten oder Flurbezeichnungen weiterexistiert. Beispiele aus jüngerer Vergangenheit (vgl. Abbildung S. 14) zeigen, wie schnell die Natur sich ehemalige Siedlungen wieder zurückholt.
Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts war z. B. im Reinhardswald dieser Zustand weitgehend erreicht; der Wald hatte einen nicht unerheblichen Teil der ehemals gerodeten Flächen wieder eingenommen20,21,80,89. Kriege, Seuchen und Hungersnöte waren häufige Gründe für das Wüstfallen von Siedlungen. Bereits nach wenigen Jahrzehnten wurden diese Orte wieder vom Wald überwuchert. Lediglich mit sehr geübtem Blick kann man hier und da bis heute solche mittelalterlichen Wüstungen noch erkennen.
Die verbliebenen Ortschaften erlebten eine gegenteilige Entwicklung. Hier breiteten sich die Feldmarken zunehmend aus, so dass mit der Zeit aus Wald mit einzelnen Rodungsinseln landwirtschaftliche Fluren mit inselartigen Wäldern darin entstanden143.
NÄHRWALD UND WALDWEIDE
Beschäftigen wir uns mit der Bedeutung der Wälder für die bäuerlichen Siedlungen, so erkennen wir, dass „Wald“ in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur Holzlieferant war. Der Begriff des „Nährwaldes“ trifft die Situation sehr gut.
Auch wenn der Acker es war, der die Menschen sesshaft machte, so war dieser allein über viele Jahrhunderte keineswegs in der Lage, das Überleben der Menschen zu sichern. Einen wesentlichen Teil der Nahrungsbasis lieferten Haustiere, also Schweine, Rinder, Ziegen und Schafe. Haustiere waren erforderlich, um in Mitteleuropa mit seinem ausgeprägten Jahreszeitenklima die Wintermonate zu überstehen.
Die ursprünglich geringen Erträge des Getreideanbaus waren allerdings nicht in der Lage, das Vieh mit zu ernähren: Wir können davon ausgehen, dass im Mittelalter nur etwa die dreifache Menge des ausgesäten Getreides wieder geerntet werden konnte, während heute je nach Getreideart und -sorte etwa das Zwanzig- bis Vierzigfache des ausgebrachten Getreides geerntet werden kann. Das Vieh musste die meiste Zeit des Jahres seine Nahrung in den umgebenden Wäldern suchen. Schweine, Ziegen, Schafe und Rinder wurden aus dem Dorf in die Wälder getrieben und ernährten sich dort.
Um die Verluste durch große Prädatoren (Raubtiere wie Bär, Wolf und Luchs) zu reduzieren, war eine Behirtung regelmäßig erforderlich. Hinsichtlich der Waldweide müssen wir bezüglich der Folgen für den Wald zwischen Schweinemast und der Weide von wiederkäuenden Huftieren (Schafe, Ziegen und Rinder) unterscheiden. Schweinemast war grundsätzlich weniger problematisch, je nach Intensität der „Baummast“, also der Produktion vor allem an Eicheln und Bucheckern, nahmen die Tiere einen mehr oder minder geringen Teil dieser Früchte auf. Für die Waldverjüngung blieb in der Regel genug übrig.
Abb. 3: Bilddokumente der Romantik zeigen die typischen aufgelichteten Wälder als Folge vielfacher Übernutzung (Jules Dupré, 1837).© wikimedia commons
Dennoch sollten wir bedenken, dass wir heute nicht genau sagen können, wie häufig „Mastjahre“ früher tatsächlich auftraten. Als Mastjahre bezeichnen wir Jahre mit intensiver Fruktifikation der Waldbäume, d. h. der Produktion von Eicheln, Bucheckern oder Kastanien. Wir wissen nicht, ob diese etwa in der Warmzeit des Hochmittelalters deutlich häufiger waren, so wie auch seit dem späten 20. Jahrhundert bis heute die Mastjahre wieder zunehmen.
Im Übrigen gilt die Fraßaktivität von Schweinen im Wald eher als günstig, fressen sie doch auch zu einem erheblichen Anteil Insektenlarven und Mäuse, also Organismen, welche im Wald aus menschlicher Sicht nach wie vor eher als „schädlich“ angesehen werden.
Problematischer waren die wiederkäuenden Huftiere, also Schafe, Ziegen und Rinder. Diese ernährten sich einerseits auf den waldfreien Lichtungen und Wiesen, aber zu einem wesentlichen Teil auch von der Waldverjüngung („Verbiss“) und Rinde größerer Bäume („Schäle“). Hinzu kommt die Laubheugewinnung durch die Bauern zur Fütterung der Tiere über den Winter. Auf den Bilddokumenten der Romantik zeigen sich die typischen aufgelichteten Wälder als eine Folge vielfacher Übernutzung, u.a. auch durch Waldweide (vgl. Abbildung 3).
Zahlen für zwei nordhessische Waldgebiete (Kaufunger Wald und Reinhardswald) aus dem Jahre 1739 belegen den Eintrieb von 795 Schweinen, 1173 Rindern und 3146 Schafen im Kaufunger Wald (4500 ha) und von 5459 Schweinen, 3059 Pferden, 5868 Rindern, 19 374 Schafen und 718 Ziegen für den Reinhardswald (21 000 ha)117. Diese Zahlen, selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich nicht alle Tiere das ganze Jahr im Wald aufhielten, und dass nicht alle Teile des Waldgebietes gleich intensiv beweidet wurden, sprechen für sich. Die Dichte an wiederkäuenden Huftieren lag schätzungsweise mindestens um den Faktor zehn, lokal und temporär aber sogar um den Faktor hundert über der von Natur aus vorhandenen Wildwiederkäuerdichte.
Wie intensiv die Nutzung der Wälder durch Waldweide auf Ebene der einzelnen Gemeinde tatsächlich war, zeigt ein Beispiel aus Sachsen (vgl. Kasten98).
Nutzung durch Waldweide im Dorf Taura in der Dahlener Heide in Sachsen
Das Dorf Taura bestand im Jahre 1551 aus insgesamt 31 Gehöften und bewirtschaftete 380 Hektar Feldflur. Die Bauern besaßen in diesem Jahr 228 Rinder, 36 Schweine und 354 Schafe. Gehen wir davon aus, dass diese im Wesentlichen siedlungsnah zur Waldweide getrieben wurden, so können wir leicht erkennen, dass hier ein Beweidungsdruck durch Rinder und Schafe im Wald existierte, der denjenigen der wildlebenden Huftiere um Größenordnungen überstieg und langfristig sicher massive Beeinträchtigungen der Waldstruktur und der Baumartenzusammensetzung bewirkte. Gehen wir weiterhin davon aus, dass die Mehrzahl dieser Tiere den Winter in Stallhaltung verbrachte, so kommt zu den unmittelbaren Fraßeinwirkungen noch ein Nährstoffexport durch Laubstreugewinnung für die Ställe sowie den Schnitt von Laubheu als Winterfutter hinzu. Auch wenn Exkremente der Weidetiere wiederum gewisse Nährstoffeinträge bedeuteten, so wurden die Waldböden langfristig durch mehr oder minder hohe Netto-Nährstoffverluste geschädigt.
Eine solche Situation dürfte im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit in vielen Teilen Mitteleuropas den Normalfall darstellen. Daher können wir anhand solcher Beispiele heute in etwa ermessen, welchen zerstörerischen Einfluss die Waldweide langfristig auf die Waldbestände hatte. Auch langfristig genutzte Hutewälder sind gekennzeichnet durch wenige, sehr licht stehende, alte fruchttragende Bäume (vgl. Abbildung 4), insbesondere Eichen, die eine parkartige, halboffene Landschaft bildeten. Durch eine intensive Beweidung mit Wiederkäuern kommt es nicht mehr zur Verjüngung, die typische Waldstruktur geht verloren.
Allerdings gibt es aus heutiger Sicht durchaus auch positive Aspekte der Waldweide. Betrachten wir nämlich die Biodiversität nicht allein durch die forstliche Brille auf Waldbaumarten bezogen, so können wir davon ausgehen, dass die gesamte Artendiversität in den durch Waldweide genutzten Waldbeständen vermutlich deutlich höher war, als dies im heutigen Wirtschaftswald der Fall ist. Mittlerweile wird die Waldweide heute auch wieder als ein strategisches Instrument im Naturschutz diskutiert117. Allerdings stellten die Haustiere im Rahmen der Waldweide auch immer eine ernstzunehmende (Nahrungs-)Konkurrenz für die wildlebenden Huftiere dar. Die bis heute zu beobachtende, gegenüber „natürlichen“ Verhältnissen deutlich reduzierte Zahl an freilebenden Huftieren in den Wäldern ist somit vermutlich nicht nur der direkten Bejagung durch den Menschen, sondern auch einer teils drastischen Verschiebung der Konkurrenzverhältnisse zwischen Haus- und Wildtieren geschuldet.
Abb. 4: Ehemaliger Hutewald: Kenzeichnend ist der parkartige Charakter der Landschaft mit einzelnen alten Eichen.© Sven Herzog
HANDWERK UND INDUSTRIE „FRESSEN“ WÄLDER
Auch wenn die Wälder bis weit in die Neuzeit (und in einigen Regionen Europas bis heute) im Wesentlichen Nährwälder waren, welche vor allem durch Waldweide und Imkerei direkt oder indirekt der menschlichen Ernährung dienten, so waren es verschiedene andere Nutzungen, welche letztlich die Zerstörung vieler mitteleuropäischer Wälder besiegelten.
Der Köhlerei kam schon früh in mittelalterlichen Wäldern eine große Bedeutung zu. Holzkohle war ein entscheidender Brennstoff im Rahmen der Metallverhüttung oder Glasherstellung. Nur durch Verwendung von Holzkohle waren die etwa zur Eisenschmelze erforderlichen Temperaturen erreichbar. Für die Holzkohleproduktion ist Laubwald, z. B. die umfangreichen Buchenbestände im Norden Hessens oder im Süden Niedersachsens, die bevorzugte Rohstoffquelle. Wo dieser fehlte, etwa in den Hochlagen der Mittelgebirge, kam auch Nadelholz zum Einsatz.
Während des Mittelalters beobachten wir einen Konzentrationsprozess der Eisenverhüttung und -verarbeitung, ausgehend von kleinen Waldschmieden zu größeren Metallhütten und Eisenhämmern entlang der Flüsse in der Nähe größerer Waldgebiete37,186.
Für die Verhüttung war Holzkohle aus den Wäldern, für die Metallverarbeitung (Hammerwerke) zusätzlich Energie aus Wasserkraft erforderlich. Auch hierauf finden wir bis heute in zahlreichen Orts- und Flurnamen Hinweise (z. B. die Gemeinde Wondrebhammer in der Oberpfalz). Die Holzkohleproduktion erfolgte in „Meilern“, zunächst wohl überwiegend in großen „Grubenmeilern“, später76 in kleineren, (vom Konzept her bereits seit dem Altertum bekannten) mobilen „Platzmeilern“, welche den (mit zunehmender Nutzung immer schwieriger erschließbaren) Holzvorräten mit vertretbarem Aufwand folgen konnten76,77.
Ein Platzmeiler (vgl. Abbildung 5) besteht aus einem runden, dicht aufgeschichteten Holzstapel aus großen Scheiten mit einer Abdeckung aus Reisig bzw. Erde, welche einen kontrollierten Abbrand des Holzes zu Holzkohle erlaubt. Die Kunst des Köhlers besteht darin, stets das richtige Maß an Luftzufuhr zu finden, welches das Erlöschen des Feuers einerseits und das vollständige Abbrennen des Holzes andererseits verhindert.
Die ehemaligen Standorte der mobilen, oft nur über einige Jahre oder Jahrzehnte am gleichen Ort befindlichen Meiler, die „Meilerplatten“, sind gelegentlich heute noch als kreisrunde, ebene Plätze von etwa 10 bis 15 Meter Durchmesser im Wald erkennbar.
Die leichte Umsetzbarkeit der Meiler, nachdem nach einigen Jahren oder Jahrzehnten der lokale Holzvorrat aufgebraucht war, führte zu einer Vielzahl an Meilerstandorten. So werden in einer Untersuchung für den nordhessischen Reinhardswald im Mittel 13 Meilerplatten pro Quadratkilometer beschrieben, für den benachbarten Kellerwald im Mittel 23 Meilerplatten pro Quadratkilometer, wobei diese allerdings nicht gleichmäßig über das Gebiet verteilt liegen, sondern deutliche lokale Klumpungen zeigen172.
Abb. 5: Holzkohlemeiler (Platzmeiler) im Solling um 1909© wikimedia commons
Diese Ergebnisse geben interessante Hinweise auf die Situation der Wälder in der beginnenden Neuzeit, wie wir unten noch genauer erkennen werden.
Neben der Holzkohleproduktion benötigte auch die Glasherstellung große Mengen Holz. Einerseits diente dieses zur Glasschmelze, vor allem aber in Form von Pottasche (Kalziumkarbonat, welches früher aus Holzasche gewonnen wurde) als wesentlicher Rohstoff bei der Herstellung der Glaswaren.
Auch Salinen waren von alters her auf enorme Mengen an Holz angewiesen. Pro Tonne produzierten Salzes gehen wir von einem Holzbedarf von orientierend geschätzt vier Raummetern (Raummaß für Holz, das als ein Kubikmeter parallel geschichtetes Rund- bzw. Scheitholz definiert ist) für Brennholz zum Salzsieden aus. Das erscheint auf den ersten Blick überschaubar, doch die teils jahrhundertelangen Produktionszeiträume der Salinen führten zusammen mit dem ebenfalls stetig benötigten Bau- und Konstruktionsholz langfristig zu umfangreichen Entwaldungen.
Beispielsweise existierte die Saline in Lüneburg etwa seit dem Jahr 800, bildete spätestens seit dem 12. Jahrhundert einen wichtigen überregionalen Wirtschaftsfaktor und stellte den Betrieb 1980 ein. Die Entstehung der Lüneburger Heide ist unter anderem eine Folge der lokalen Waldübernutzung durch den Salinenbetrieb. Allerdings waren es regelmäßig auch Salinenverwaltungen, welche schon früh und lange vor der Beschreibung des forstlichen Nachhaltigkeitsprinzips erste Ansätze nachhaltiger Wirtschaftsweisen ersannen. Während für die Saline in Lüneburg keine derartigen Aktivitäten überliefert sind210, gab es für die Saline Reichenhall bereits im 17. Jahrhundert regelmäßige Einschätzungen des Holzvorrates im Einzugsgebiet.
Noch deutlich ältere Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens, welche bis in die Bronzezeit zurückreichen, werden für die Salzgewinnung im Raum Hallstatt in Österreich beschrieben41.
Abb. 6: Holz aus den Mittelgebirgen wurde zu riesigen Flößen von bis zu 300 Meter Länge gebunden und rheinabwärts in die Niederlande transportiert. (Kolorierter Kupferstich von J. E. Grave nach einer Vorlage von J. Bulthuis, 1796)© Sven Herzog
Bau- und Konstruktionsholz wurde seit dem ausgehenden Mittelalter vor allem auch für die Montanindustrie (Grubenholz und Brennholz) in zahlreichen Mittelgebirgen (z. B. Harz, Erzgebirge) und für den Schiffbau, aber auch den Bau von Windmühlen in den zu dieser Zeit bereits waldarmen Niederlanden benötigt.
So wurden aus den Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald große Mengen Holzes oft über kleinere Flüsse in den Rhein transportiert und dort zu großen Flößen gebunden rheinabwärts in die Niederlande exportiert („Holländertannen“, vgl. Abbildung 6). Laubholz (z. B. Eichen) wurde als zusätzliche Nutzlast auf solchen Flößen befördert und für den Schiffbau verwendet. Für den Bau eines großen seegängigen Schiffes bedurfte es mehrerer Tausend etwa 150-jähriger Eichen. Mit Beginn der Neuzeit gab es in Europa rund 20 000 derartiger Schiffe, die allermeisten davon fuhren unter niederländischer Flagge. Da die Flößerei vergleichsweise große Mengen (schwimmfähigen) Nadelholzes benötigt, können wir davon ausgehen, dass die (Über-)Nutzung der Waldbestände spätestens zu diesem Zeitpunkt auch die fichten- und tannenreichen Hochlagen der Mittelgebirge erreicht hatte.
HOLZNOT: EUROPAWEITE KRISE ODER „FAKE NEWS“?
Die verschiedenen intensiven Nutzungen der Wälder führten bereits seit dem 16. Jahrhundert zu Klagen über eine bevorstehende Holznot. Der Zustand der Wälder hatte dann auch Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Tiefpunkt erreicht. Um 1800 waren in Deutschland zumindest in Siedlungsnähe und in der Nähe von Bergwerken oder Industrieanlagen kaum noch geschlossene Wälder vorhanden, die Holzvorräte erreichten ein Minimum.
Zeitgenössische Darstellungen sprechen vielfach von verwüsteten Landschaften, bei entsprechenden Ausgangssubstraten (Geest) bildeten sich durch die Entwaldung offene Sandböden, so dass Flugsande und Wanderdünen sogar Städte wie Celle bedrohten222.
Heidelandschaften sind typischerweise Relikte von durch Übernutzung zerstörten Waldgebieten auf ärmeren Standorten. Dennoch sind solche Lebensräume heute aus Naturschutzsicht wertvoll, zeigen diese doch eine ausgesprochen hohe Artenvielfalt und werden auch landschaftsästhetisch sehr positiv gesehen.
Relikte dieser zerstörten Wälder finden wir heute nicht nur in Form von Heiden (z. B. Lüneburger Heide), sondern auch in Gestalt von Trockenrasengesellschaften (Biotope, die sich an trockenen, nährstoffreichen, z. B. Kalkstandorten ausbilden) oder kahlen Gebirgsrücken. Viele dieser Lebensräume gelten aus Naturschutzsicht und hinsichtlich ihrer Artenvielfalt heute als ausgesprochen wertvoll. Das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche Landschaftselemente die Folge einer Raubbauwirtschaft an ehemaligen Wäldern darstellen.
Der Historiker Joachim Radkau und weitere Autoren entwickelten demgegenüber seit den 1980er Jahren die Vorstellung, dass eine allgemeine und umfassende Versorgungskrise in Bezug auf Holz nie bestanden habe. Vielmehr habe es sich bei dem Phänomen „Holznot“ um räumlich und zeitlich begrenzte Versorgungsengpässe und Übernutzungen gehandelt148,149,154,218. Die Autoren streiten das Problem als solches und die damit einhergehende lokale Waldverwüstung keineswegs ab, gehen allerdings davon aus, dass mit dem alarmistischen Argument der drohenden Holznot gezielt bestimmte politische Ziele und staatliche Interessen durchgesetzt werden sollten. Damit wird letztlich eine alte These vom „Popanz des Holzmangels“ aufgegriffen, die bereits Heinrich Ernst Christian von Berg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestellt hatte212,213.
Für die nordhessischen Wälder lässt sich beispielsweise zeigen, dass diese zu Beginn des 19. Jahrhunderts zumindest nicht flächendeckend zerstört waren169,172.
Allerdings besteht auch die gegenteilige Ansicht, dass nämlich die Holznot des 18. Jahrhunderts tatsächlich eine Krise säkularen Ausmaßes gewesen sei, welche letztlich erst durch die zunehmende Verwendung von Steinkohle zur Energiegewinnung gelöst werden konnte184,189.
Diese Diskussion lässt aufmerken, zeigt sie doch interessante Parallelen zur Energiekrise der 1970er Jahre, zum Waldsterben der 1980er Jahre und auch zur aktuellen Klimadebatte. Geschichte wiederholt sich nicht, doch wir können aus der Geschichte, in diesem Falle aus der Instrumentalisierung von Krisen für eigene politische oder unternehmerische Zwecke, einiges lernen.
So problematisch die Verknüpfung von wissenschaftlich plausiblen Hypothesen mit politischem Aktivismus sein mag, so sehr überzeugen doch manchmal die Resultate: Sowohl die Versorgungsprobleme mit dem Rohstoff Holz im 19. Jahrhundert als auch die Probleme mit verschiedenen Umweltbelastungen, welche in den 1970er bis 1990er Jahren zu ausgeprägten Waldschäden führten, wurden schließlich gelöst. Nun gibt es seit einigen Jahren wieder Stimmen, welche den Alarmismus im Kontext der Klimadiskussion kritisieren. Möglicherweise braucht eine Gesellschaft aber beides: saubere wissenschaftliche Hypothesen und politischen Aktivismus. Fragwürdig bleibt es, beides miteinander zu vermischen131,150.
NACHHALTIGKEIT ALS FORSTLICHES KONZEPT
So können wir festhalten, dass das 18. und frühe 19. Jahrhundert zumindest in vielen Regionen durch massive Versorgungsengpässe des zentralen Rohstoffes „Holz“ gekennzeichnet war. Auch spielt es letztlich nicht die entscheidende Rolle, ob die zunehmende Gründung akademischer forstlicher Lehranstalten in verschiedenen Ländern seinerzeit eher durch den Zwang der ökonomischen Verhältnisse selbst oder durch die (vielleicht gezielt manipulierte) politische Stimmung jener Zeit katalysiert wurde.
Auch war es auch dem sächsischen Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz (1645–1715) keineswegs bewusst, was er rund 200 Jahre später bewirken würde, als er in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht“214 das erste Mal mit kratzender Feder niederschrieb (oder vielleicht doch seinem Sekretär diktierte): „Wird derhalben die größte Kunst/Wissenschaft/Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen / wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist / ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.“ Der Begriff der Nachhaltigkeit war in der Welt.
Zunächst war das noch rein ökonomisch gedacht und auf die Holzproduktion bezogen, doch das sollte sich im Laufe der kommenden zwei Jahrhunderte ändern. Allerdings war es nicht von Carlowitz, der diese Gedanken in die Tat umsetzte und durch die Gründung forstlicher Ausbildungsstätten an zahlreiche junge Menschen weitergab. Diese Aufgabe fiel einer Generation von Forstleuten zu, welche wir heute als die „forstlichen Klassiker“ bezeichnen: Diese im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert wirkenden Forstleute, insbesondere Heinrich Cotta (1763–1844), Georg Ludwig Hartig (1764–1837), Gottlob König (1779–1849), Johann Christian Hundeshagen (1783–1834), Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil (1783–1859) und Carl Justus Heyer (1797–1856) waren erfahrene Praktiker, teils bereits mit eigener akademischer Ausbildung, denen es gelang, die anfangs noch vagen Vorstellungen von forstlicher Nachhaltigkeit zu operationalisieren und in konkrete, langfristige Handlungskonzepte umzusetzen. Sie waren wissenschaftlich und publizistisch tätig, gründeten eigene Lehr- und Ausbildungsstätten oder wurden an solche berufen, so dass es ihnen gelang, ihre Ideen auch weiterzutragen.
Aus dem Förster als Lehrberuf entstanden in diesen Jahren die Forstwissenschaften mit einer zugrundeliegenden, umfangreichen akademischen Ausbildung.
Die Bewirtschaftung der Wälder, nunmehr auf naturwissenschaftlicher und mathematischer Grundlage, änderte sich grundlegend.
Aufgelichtete oder devastierte (zerstörte) Wälder wurden wieder aufgeforstet, Waldweide und verschiedene andere landwirtschaftliche Nutzungen der Wälder wurden langsam zurückgedrängt.
Es sollte in einem Forstbetrieb langfristig nicht mehr Holz genutzt werden als nachwuchs, und der Siegeszug der vergleichsweise schnell wachsenden und vermeintlich unproblematischen Baumarten Fichte (auf den nähstoffreicheren Standorten) und Kiefer (auf nährstoffarmen oder anderweitig extremen Standorten) begann.
Die Nutzung des Holzes in Form teils umfangreicher Kahlschläge mit anschließender Neupflanzung wurde zum Standardverfahren der Waldwirtschaft, so dass sich über die Jahrzehnte Wälder aufbauten, wie wir sie in nicht geringer Zahl bis heute noch vorfinden. Dabei sprechen wir vom „Alterklassenwald“, da ein gepflanzter Waldbestand immer aus Bäumen gleichen Alters besteht und jedes Jahr ein weiterer Teil der Gesamtfläche auf diese Weise neu bepflanzt wird. Oftmals (nicht immer) wurde auch nur eine einzige Baumart gepflanzt, wir sprechen dann von „Reinbeständen“ im Gegensatz zu Mischbeständen mit mehreren Baumarten.
Dieser Weg, so viel sei hierzu angemerkt, war seinerzeit durchaus naheliegend und richtig. Die Probleme, die sich heute mit den Fichten- und Kieferreinbeständen (vgl. Kapitel 7) zeigen, waren seinerzeit zum einen nur teilweise abzusehen, zum anderen hatte die Lösung des aktuellen Problems, der Wiederbewaldung und der Verhinderung weiterer Schädigung der Böden, absoluten Vorrang vor anderen Überlegungen.
NATURGEMÄSSE WALDWIRTSCHAFT
Der auf diese Weise zunehmend entstehende Altersklassenwald wurde allerdings schon bald nicht mehr uneingeschränkt positiv gesehen.
Eine kleine Minderheit namhafter Forstwissenschaftler wie Gottlob König (1779–1849), Karl Geyer (1822–1907) oder Emil Adolf Roßmäßler (1806–1867) sah die Probleme der Reinbestandeswirtschaft und des Altersklassenwaldes voraus und plädierte dafür, dass sich Förster mehr an den natürlichen Prozessen im Wald orientieren sollten. In den 1920er Jahren schließlich formten sich diese Vorstellungen zu einem forstlichen Konzept, der „Naturgemäßen Waldwirtschaft“132.
Dieses ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch den Verzicht auf Kahlschläge („Dauerwald“) und die Abkehr von Altersklassenwald und Reinbeständen. Stattdessen sollen Wirtschaftswälder, wie es der Name andeutet, in Anlehnung an natürliche Wälder ein Mosaik an unterschiedlichen Baumarten unterschiedlichen Alters enthalten. Die Nutzung erfolgt lokal und kleinflächig überall dort, wo einzelne Stämme oder kleine Gruppen die erwünschten Dimensionen erreicht haben.
Bis heute lebt dieses Prinzip in der „Naturnahen Waldwirtschaft“ weiter und hat sich seit einigen Jahrzehnten in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern zum Standard forstlichen Wirtschaftens entwickelt. Wenngleich in der Bewirtschaftung zunächst aufwendiger, so erscheint diese Wirtschaftsweise heute deutlich risikoärmer und – bei mittlerweile sehr hohen Löhnen und extremen Lohnnebenkosten für Handarbeit im Wald – durch die „Naturverjüngung“ (statt Saat oder Pflanzung) teilweise auch kostengünstiger als die konventionellen Altersklassenwälder.
Allerdings müssen wir uns an dieser Stelle fragen, warum es bis ins 21. Jahrhundert gedauert hat, bis sich dieses Prinzip forstlichen Wirtschaftens durchgesetzt hat. Dies hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund sind in Deutschland sicherlich zwei verlorene Weltkriege.
Abb. 7: Bergmischwälder im Hochgebirge (hier in Tirol) wurden schon immer naturnah bewirtschaftet.© Sven Herzog
Danach kam es immer zu hochgradigen Übernutzungen der Wälder, um die von den jeweiligen Siegermächten geforderten Reparationsleistungen liefern zu können („Reparationshiebe“). Es entstanden in kurzer Zeit riesige Kahlschläge. Ende der 1940er Jahre wurde diese Situation zusätzlich durch eine Borkenkäferkalamität, etwa im Thüringer Wald8, verschärft. In dieser Situation war, wie bereits schon im frühen 19. Jahrhundert, schnelles Handeln angesagt. Somit waren es wieder vor allem Fichte und Kiefer, schnell und preiswert in Monokulturen gepflanzt, die in der Lage waren, die Kahlflächen mit den vorhandenen, sehr begrenzten Ressourcen dieser Zeit wieder zu bestocken.
Ein weiterer möglicher Grund für die Zurückhaltung dem Dauerwaldgedanken gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg wäre, dass jener ein Jahrzehnt zuvor durchaus in das ideologische Konzept des Nationalsozialismus passte und somit von der Politik bald vereinnahmt wurde55,88. Bis in die 1960er Jahre haftete dieser Wirtschaftsform (ähnlich wie auch dem Naturschutz10) somit ein unguter, „ewiggestriger“ Beigeschmack an.
Schließlich war es für viele Betriebe schlichtweg rationeller, einfacher und bequemer, in Kahlschlägen und Altersklassen zu denken und zu wirtschaften. Dies gilt auch und gerade für die staatlichen Forstverwaltungen. Auch die kurzfristige Rentabilität eines privaten Betriebes (sofern man in der Forstwirtschaft von Kurzfristigkeit sprechen kann) ist mit Fichten und Kiefern, die nach 80 bis 100 Jahren geerntet werden können, auf den ersten Blick günstiger. Erst als sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend zeigte, wie risikoanfällig solche Monokulturen sind (vgl. Kapitel 7 und 8), erfolgte ein Umdenken. Dieses zeigen die „Waldumbauprogramme“ aller deutschen Landesforstverwaltungen seit den 1990er Jahren, welche bis heute mit mehr oder weniger gutem Erfolg umgesetzt werden.
Solche Umbauprogramme erfordern, das ist das Kennzeichen forstlichen Wirtschaftens, allerdings viel Zeit. Jedes Jahr kann, gerade aus Gründen der Nachhaltigkeit, maximal etwa der hundertste Teil eines Waldbestandes umgewandelt werden. Denn dazu ist die Ernte des Altbestandes erforderlich. Und so traf die Sommertrockenheit der vergangenen Jahre immer noch auf zahlreiche Waldbestände, welche nicht gut an solche extremen Umweltsituationen angepasst waren. Das Fehlen eines hinreichend großen und gut qualifizierten Personal- und Maschinenbestandes in den Forstbetrieben und die Abkehr von vermeintlich überholten Waldschutzkonzepten tat ein Übriges. So müssen wir uns, wie wir im Folgenden sehen werden, heute erneut großen Herausforderungen in der Waldwirtschaft stellen.
© Sven Herzog
2. MYTHOS WALD
Jeder darf in Deutschland den Wald frei betreten. Dies ist – auch im internationalen Kontext – nicht selbstverständlich, doch wird der Wert dieses hohen Gutes kaum wahrgenommen, sondern gilt den Meisten als Selbstverständlichkeit.
Viele Menschen sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass Wälder letztlich nichts Anderes als Grundstücke sind, die einen Eigentümer haben, wirtschaftliche Erträge zeitigen müssen und/oder wichtige Funktionen im Natur- und Artenschutz erfüllen.
Und obwohl die meisten Menschen es keineswegs schätzen würden, wenn jedermann ohne zu fragen in ihren Garten käme, etwa um dort mit Freunden zu grillen, so nehmen sie für sich doch ganz selbstverständlich in Anspruch, Wälder zu jeder Tages- und Nachtzeit für ihre Freizeitaktivitäten, zum Pilzesuchen, zum Sammeln von Beeren und Kräutern, zum Spaziergang oder für sportliche Aktivitäten zu nutzen.
Dieses Recht ist hierzulande gesetzlich garantiert und kann, je nach Bundesland, lediglich geringfügig eingeschränkt sein oder aus wichtigen Gründen (z. B. nach Sturmereignissen, Waldbränden oder bei hohen Schneelagen) eingeschränkt werden.
Somit sind Wälder faktisch Allgemeingut. Die Rechte der Eigentümer sind so extrem wie – vielleicht mit Ausnahme des Mietrechtes – sonst nirgendwo in unserem Land beschnitten.
Woher kommt die hinter dieser Rechtslage stehende Einstellung? Hat sie vielleicht mit einem besonderen Verhältnis der Menschen zum Wald zu tun? Der Antwort wollen wir in diesem Kapitel auf die Spur kommen. Und anders als in den meisten anderen Kapiteln dieses Buches stehen hier eindeutig wir Menschen mit unseren Empfindungen, Emotionen, Ängsten und Sehnsüchten im Vordergrund.
WÄLDER: DUNKEL UND LEBENSFEINDLICH





























