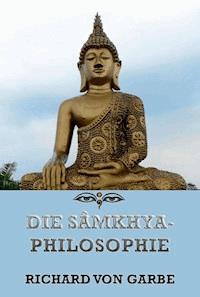
Die Samkhya-Philosophie E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Wort samkhya erscheint erst in der jüngeren Upanisad-Literatur (nach Jacobs Concordance überhaupt nur je einmal in der Svetasvatara, Cûlikâ, Garbha und Muktika Upanisad) und dann häufiger im Mahabharata. Daß auch die grammatische Bildung des Wortes uns in spätere Zeiten weist, hat Weber hervorgehoben1, aber dabei betont, daß man daraus nicht etwa auf die späte Existenz der Spekulationsweise, die dieser Name bezeichnet, schließen dürfe. Wenn Kapila und seine ältesten Nachfolger ihrem System überhaupt einen Namen gegeben haben, so ist dieser verloren gegangen und später durch den uns geläufigen ersetzt worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Sâmkhya-Philosophie
Friedrich von Garbe
Inhalt:
Vorwort zur ersten Auflage.
Vorwort zur zweiten Auflage.
Zweiter Abschnitt - Der Charakter der Sâmkhya-Philosophie
I. Allgemeines.
1. Der Name sâmkhya.
2. Die Aufgabe des Systems.
3. Die Anforderungen.
4. Die Erkenntnisquellen und die Methode.
5. Die Terminologie.
II. Die allgemein-indischen Bestandteile des Systems.
1. Der Samsâra und die Macht der Tat.
2. Die Erlösung bei Lebzeiten.
3. Der Wert der Askese.
4. Das Mythologische.
III. Die speziellen Grundanschauungen des Systems.
1. Der Atheismus.
2. Der übrige Inhalt.
Dritter Abschnitt - Die Lehre von der Materie
I. Kosmologie.
1. Die Realität der Erscheinungswelt.
2. Die Urmaterie.
3. Die drei Gunas.
4. Die Evolution und Reabsorption der Welt.
5. Der Begriff der Kausalität.
6. Die Produkte, besonders die feinen und groben Elemente.
II. Physiologie.
1. Der Organismus im allgemeinen.
2. Die Buddhi.
3. Der Ahamkâra.
4. Das Manas oder der innere Sinn.
5. Das innere Organ als Einheit.
6. Die Indriyas oder die äußeren Sinne.
7. Die dreizehn Organe als Gesamtheit.
8. Der feine oder innere Körper.
9. Der grobe Körper.
10. Die Zustände.
III. Die Materie als einheitlicher Begriff.
Vierter Abschnitt - Die Lehre von der Seele
I. Die Seele an sich.
1. Vorbemerkung über die Bezeichnungen der Seele.
2. Beweise für die Existenz der Seele.
3. Das Wesen der Seele.
4. Die Vielheit der Seelen.
II. Die empirische Seele.
1. Das Verhältnis der Seele zu den Organen und zum Leibe.
2. Das Verhältnis der Seele zum Handeln.
3. Die Aufgabe der Seele.
4. Das Gebundensein und seine Ursache, die Nichtunterscheidung.
5. Die Erlösung und ihre Ursache, die Unterscheidung.
Die Samkhya-Philosophie, Friedrich von Garbe
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849600150
www.jazzybee-verlag.de
Vorwort zur ersten Auflage.
Für die nachfolgende Darstellung der Sâmkhya-Philosophie habe ich das gesamte uns erhaltene Quellenmaterial verwertet, soweit es für das Verständnis des Systems und seiner Geschichte von Bedeutung ist. Trotzdem haben die Grundsätze, nach denen ich arbeitete, den Umfang des Buches innerhalb mäßiger Grenzen gehalten.
Ich bin erstens der Meinung gewesen, daß dem Interesse der Sache am meisten mit einer schlichten, objektiven Darlegung der Sâmkhya-Lehren gedient sei, und habe deshalb weder eine Kritik an diesen Lehren geübt noch meine Darstellung durch Vergleiche mit ähnlichen Ideen in der europäischen Philosophie zu beleben gesucht. Die Gefahr ist kaum zu vermeiden, daß durch solche Ausblicke die Besonderheiten eines indischen Systems verwischt werden. »Indische Dinge«, sagt Max Müller in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft VI. 22, »haben soviel von Vergleichung zu leiden, daß es notwendig ist, ihre charakteristische Eigentümlichkeit soviel als möglich hervorzuheben. Wir lernen durchaus nicht die Individualität des indischen Volkes erkennen, wenn wir seine Sprache, sein Denken und Forschen nur immer als Analogon oder als Komplement der griechischen und römischen Welt betrachten.« Andererseits ist der Parallelismus der Grundlehren des Sâmkhya-Systems mit denen der europäischen Dualisten so deutlich, daß kein Leser der Hinweise auf die Übereinstimmungen bedarf.
Zweitens habe ich nicht durch die vorliegende Arbeit meine im Laufe der letzten fünf Jahre veröffentlichten Übersetzungen der Sâmkhya-Texte überflüssig machen wollen. Wer die Fragen, zu deren Aufwerfung die Lehren der Sâmkhya-Philosophie in Indien geführt haben, bis in alle Einzelheiten verfolgen will, sei auf diese Übersetzungen verwiesen.
In der Hoffnung, für meine Arbeit auch Leser außerhalb des engen Kreises der Indologen zu finden1, habe ich nach Kräften das Beweismaterial und philologische Erörterungen in Anmerkungen unter den Text verwiesen. In den beiden ersten Kapiteln des einleitenden Abschnitts, die sich der Natur der Sache nach vorzugsweise an Sanskritisten wenden, waren freilich derartige Auseinandersetzungen auch im Text nicht zu vermeiden.
Im Ausdruck habe ich mich, soweit es mit der angestrebten Klarheit der Darstellung vereinbar war, an den Wortlaut der Quellen gehalten. Vollkommen unindisch dagegen ist meine Anordnung des Materials; in dieser Hinsicht konnte mir keines der Originalwerke als Vorbild dienen; denn Übersichtlichkeit in der Behandlung des Stoffes ist in Indien selten erreicht und von den meisten philosophischen Autoren nicht einmal erstrebt worden.
Möge dieses Buch dazu beitragen, die Gleichgiltigkeit der abendländischen Philosophie gegen ihre indische Schwester zu beseitigen. Diesem Wunsche habe ich nur noch den Ausdruck meines ehrerbietigen Dankes für die Unterstützungen hinzuzufügen, durch welche die Kgl. Preußische Regierung und die Akademie der Wissenschaften zu Berlin mir das Studium der indischen Philosophie unter der Leitung einheimischer Lehrer in Benares ermöglicht haben. Ohne diese Vergünstigung hätte ich mir die Ausführung meiner Arbeiten über das Sâmkhya-System, die mit dem vorliegenden Werke ihren Abschluß erreichen, nicht zutrauen dürfen. Herrn Professor A. Hillebrandt in Breslau danke ich herzlich für seine freundliche Hilfe bei der Korrektur.
Königsberg i. Pr.
März 1894.
R. Garbe.
Vorwort zur zweiten Auflage.
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage haben sich zahlreiche wichtige Arbeiten mit dem Sâmkhya-System beschäftigt, unter denen die von Jacobi, Oldenberg und Takakusu besondere Hervorhebung verdienen. Das Material, das von dem letztgenannten Gelehrten aus der chinesischen Übersetzungsliteratur gewonnen und zugänglich gemacht worden ist, hat auf die ältere Literatur des Sâmkhya-Systems erst das rechte Licht geworfen. Ich habe alles, was an neuen, die Sâmkhya-Philosophie berührenden Schriften zu meiner Kenntnis gelangt ist, für die vorliegende zweite Auflage zu Bäte gezogen und meine Gründe gegen abweichende Ansichten, von deren Richtigkeit ich mich nicht überzeugen konnte, vorgebracht. Meine Grundanschauungen über die geschichtliche Stellung der Sâmkhya-Philosophie haben sich im Laufe der Zeit immer mehr befestigt; im einzelnen aber hat meine Darstellung viele Veränderungen und zeitgemäße Verbesserungen erfahren. Naturgemäß sind diese Veränderungen am stärksten in dem einleitenden Abschnitt, der zum Teil ganz neu geschrieben und auch an Umfang am meisten gewachsen ist. Weniger einschneidend sind die Änderungen in den folgenden Abschnitten, in der eigentlichen quellenmäßigen Darstellung des Systems, obwohl auch hier nicht unerhebliche Zusätze Aufnahme gefunden haben.
Die Neubearbeitung des Buches, der ich vor dem Ausbruch des Weltkrieges freudig entgegensah, ist in eine schwere Zeit gefallen. Als das Manuskript fertiggestellt war, machte mein Gesundheitszustand es ratsam, die Leitung des Druckes anderen berufenen Händen anzuvertrauen. Zu meiner Freude erklärte sich Herr Dr. Poul Tuxen in Kopenhagen, dessen Beistand mir wegen seiner engen Vertrautheit mit der indischen Philosophie besonders erstrebenswert schien, zur Übernahme dieser mühsamen Aufgabe bereit. Nur die Revisionen habe ich selbst noch durchgesehen. Dr. Tuxen hat die Korrekturen mit größter Sorgfalt gelesen, die Indices der neuen Ausgabe entsprechend gestaltet und einige sachliche Versehen – in jedem Fall mit meinem Einverständnis – berichtigt. Es sei ihm für diese wertvolle Hilfe herzlich gedankt.
Auch der Verlagshandlung und der Druckerei, die trotz der großen Schwierigkeiten der Papierbeschaffung und des Mangels an Arbeitskräften die Veröffentlichung des Buches in mustergiltiger Weise und ohne Stockung fast so schnell wie in Friedenszeiten ermöglicht haben, gebührt mein aufrichtiger Dank.
Tübingen
Oktober 1916.
R. Garbe.
Fußnoten
1 Für solche Leser sei bemerkt, daß in indischen Worten c und ch wie tsch, j wie dsch, s und s wie sch, s scharf wie unser ß, r wie r mit leichter vokalischer Beimischung (als ri), e und o stets lang auszusprechen sind.
Zweiter Abschnitt - Der Charakter der Sâmkhya-Philosophie
I. Allgemeines.
1. Der Name sâmkhya.
Das Wort sâmkhya erscheint erst in der jüngeren Upanisad-Literatur (nach Jacobs Concordance überhaupt nur je einmal in der Svetâsvatara, Cûlikâ, Garbha und Muktikâ Upanisad) und dann häufiger im Mahâbhârata. Daß auch die grammatische Bildung des Wortes uns in spätere Zeiten weist, hat Weber hervorgehoben1, aber dabei betont, daß man daraus nicht etwa auf die späte Existenz der Spekulationsweise, die dieser Name bezeichnet, schließen dürfe. Wenn Kapila und seine ältesten Nachfolger ihrem System überhaupt einen Namen gegeben haben, so ist dieser verloren gegangen und später durch den uns geläufigen ersetzt worden.
Sâmkhyaist von samkhyâ ›Zahl‹ abgeleitet und bedeutet zunächst ›aufzählend, Aufzählung‹, dann aber ›Untersuchung, Prüfung, Unterscheidung, genaues Abwägen, Erwägung‹. Die gewöhnliche Annahme ist nun, daß man von der zweiten Bedeutung ausgehend dem System Kapilas den Namen Sâmkhya gegeben habe2. Ich halte das nicht für richtig. Zwar hat schon im Mahâbhârata das Wort sâmkhya die übertragene Bedeutung ›Unterscheidung usw.‹ angenommen – die im Petersburger Wörterbuch s.v. gesammelten Stellen genügen, um dies festzustellen –, doch wird durch andere Stellen klar, daß es sich dabei um eine Umdeutung des Wortes handelt, die erst durch den Charakter des Sâmkhya-Systems herbeigeführt worden ist. Weil das Sâmkhya-System methodische Erschließung der Prinzipien und vor allen Dingen scharfe Unterscheidung von Geist und Materie lehrte, ist im Laufe der Zeit dem Worte sâmkhya die Bedeutung ›methodische Erschließung, Unterscheidung‹ beigelegt worden. Ursprünglich aber bedeutete das Wort nichts anderes als ›aufzählend‹; die Lehre Kapilas wurde wegen der Aufzählung der 25 Prinzipien, auf welche die Anhänger des Systems seit jeher großes Gewicht legten, und »vielleicht auch wegen der absonderlichen Vorliebe dafür, abstrakte Begriffe in trockene Zahlenverhältnisse zu zerlegen«3, die ›Aufzählungs-Philosophie‹ genannt4. Es ist dies allerdings eine Bezeichnung, die dem wahren Wesen und Werte des Sâmkhya-Systems sehr wenig gerecht wird. Dadurch bin ich auf einen Gedanken gekommen, der mit meiner Beurteilung der ältesten Geschichte des Systems im Einklang steht. Wenn man bedenkt, was für eine Rolle die Spitznamen in der indischen Namengebung spielen und wie oft der spöttische, verächtliche Inhalt dieser Namen in späterer Zeit in Vergessenheit geraten ist, so scheint mir die Vermutung nahe genug zu liegen, daß die Brahmanen von Madhyadesa die ihnen widerstrebende Sâmkhya-Philosophie mit dem Spottnamen der ›Aufzählungslehre‹ (sâmkhya neutr.) und deren Anhänger als die ›Zahlmenschen‹ (sâmkhya masc.) bezeichnet haben, und daß, als später die Sâmkhya-Lehre sich große Anerkennung errungen hatte, der Name bestehen blieb, den man sich gewöhnt hatte zu gebrauchen5. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich auch die Umdeutung des Namens, von der eben gehandelt wurde, am natürlichsten.
Daß in der indischen Literatur einige Male Sâmkhya als nomen proprium oder Beiname eines alten Weisen6 sowie als einer der 1000 Namen Sivas vorkommt7, ist für unser System bedeutungslos. Sâmkhya als Name des Siva erklärt sich wohl durch die Beziehungen des Gottes zum Yoga, dem Tochtersystem des Sâmkhya.
2. Die Aufgabe des Systems.
Die Weltanschauung, die in den Sâmkhya-Schriften zum Ausdruck kommt, ist konsequenter Pessimismus. Alles bewußte Leben ist Leiden. Das Glück, von dem uns die Erfahrung zu zeugen scheint, existiert nicht in Wahrheit; denn auch die Lust ist mit Schmerzen durchsetzt und führt schließlich zu Leid; darum wird auch sie »von den Unterscheidenden zu den Schmerzen gerechnet«8. Das schlimmste der Leiden aber ist die Notwendigkeit der Wiederkehr von Alter und Tod in jeder neuen Existenz. »Alle lebenden Wesen ohne Unterschied leiden den durch Alter und Tod bewirkten Schmerz; allen, selbst dem Wurm, ist die Todesfurcht gemeinsam, die sich in dem Wunsche darstellt: ›Möge ich nicht aufhören zu existieren, möge ich leben!‹ Und was Furcht hervorruft, ist Schmerz; deshalb ist der Tod Schmerz9.«
Die beiden Hauptwerke der Sâmkhya-Schule, die Kârikâ und die Sûtras, bezeichnen in den ersten Worten die vollständige Aufhebung des Schmerzes als die Aufgabe der Lehre, die sie vortragen. Dem wunderlichen Schematismus des Systems entsprechend, wird sogleich gesagt, daß es einen dreifachen Schmerz gebe10. Damit ist nach der übereinstimmenden Erklärung sämtlicher Kommentare gemeint 1. der in der eigenen Person entstehende (âdhyâtmika), d.h. der durch körperliche Leiden und Beschwerden des Gemüts verursachte, 2. der von anderen Wesen (auch Pflanzen) uns zugefügte (âdhibhautika) und 3. der auf übernatürliche Einflüsse zurückgeführte (âdhidaivika). Bedarf es nun aber einer schwer verständlichen philosophischen Lehre, um diese Schmerzen zu heilen? Gibt es nicht – so fragt ein Materialist – mit leichter Mühe zu beschaffende Mittel zu seiner Abwehr? Medikamente zur Stillung körperlicher Schmerzen; schöne Frauen, Getränke, Speisen, Kleidung und Schmuck zur Heilung der Leiden des Gemüts; Erfahrung und Vorsicht zum Schutz gegen Schaden, der von außen kommt; und selbst Zaubermittel gegen übernatürliche Einflüsse? Auf diese Frage lautet die Antwort: Nein! denn alle diese Mittel wirken nicht mit Sicherheit und gewähren selbst im besten Falle nur zeitweilig Schutz und Erleichterung. »Aber wir haben doch außer diesen weltlichen Mitteln, die uns allerdings keinen genügenden Schutz gegen den Schmerz bieten, die sicheren und zuverlässigen, deren Anwendung die Religion uns lehrt. In der Schrift sind ja die Opfer vorgeschrieben, durch deren Vollziehung wir uns nach dem Tode einen Platz im Himmel sichern können, wo aller Schmerz ein Ende hat!« Der strenggläubige Brahmane, der diesen Einwand macht, erhält darauf dieselbe Antwort wie der Materialist; von den rituellen Mitteln zur Abwehr des Schmerzes gilt das gleiche wie von den weltlichen; auch sie beseitigen den Schmerz nicht absolut und für alle Zeit. Die Opfer sind unrein, denn sie erfordern Blutvergießen; und das Töten von Tieren ist unter allen Umständen eine Schuld, die nach dem Gesetz der Vergeltung ihre Frucht tragen, d.h. einen Schmerz im Gefolge haben muß. Man vergleiche auch den entschieden geringschätzigen Sâmkhya-Ausdruck daksinâ- oder dâksinaka bandha im vierten Abschnitt unter II. 4. Selbst wenn jemand durch das Opfer in eine der himmlischen Welten gelangt ist, so sieht er mit Schmerzen, daß es dort droben höhere Stufen gibt als die von ihm erreichte. »Und es ist natürlich, daß das höhere Glück eines anderen dem weniger Glücklichen Schmerzen bereitet11.« Die Hauptsache aber ist, daß der in den Himmel Aufgestiegene nur einen vergänglichen Erfolg erzielt hat; denn auch die Götter und die anderen Bewohner jener Welten unterliegen noch der Metempsychose12. Und schließlich haftet an den Opfern die Ungerechtigkeit, daß nur reiche Leute die großen Kosten, die ihre Vollziehung erfordert, bestreiten können; den Armen ist dieser Weg zur zeitweiligen Befreiung vom Schmerz ebenso verschlossen als die von dem Materialisten empfohlene Anwendung der weltlichen Mittel13.
Noch zwei weitere Hoffnungen auf Befreiung vom Schmerz halten die Sâmkhyasûtras für nötig zu zerstreuen. Nach V. 82 soll der Yogin, der durch die Ausübung der Yoga-Praxis in den Besitz der viel besprochenen übernatürlichen Kräfte gelangt ist und über alle Naturgesetze Gewalt hat, nicht wähnen, damit das Ziel erreicht zu haben; denn auch der Besitz dieser Kräfte ist vergänglich, wie jeder andere Besitz. Und wer da meint, daß über kurz oder lang so wie so aller Schmerz zu Ende sei, wenn die Schöpfung sich zurückbildet und in der Zeit der Weltauflösung alles bewußte Leben erlischt, dem wird III. 54 folgendes vorgehalten: auch auf die Perioden der Weltauflösung folgen immer wieder neue Schöpfungen, und »wie ein Mann, der ins Wasser getaucht ist, wieder emportaucht«, so treten beim Beginn der neuen Schöpfungsperiode die Wesen wieder ihre qualvolle Wanderung durch unzählige Existenzen an.
Wer die wirkliche Erlösung vom Schmerz erzielen will, muß nicht sowohl den Schmerz beseitigen (unterdrücken, verhüllen)14, als sein Auftreten für alle Zukunft unmöglich machen. Da nun der Schmerz notwendig so lange währt, als die Seele sich mit Körpern und Organen verbindet15, so ist das Heil nur dann erreicht, wenn der Wanderung der Seele ein Ende gesetzt ist. Zu diesem Ziel, dem ›absoluten Aufhören‹ (atyanta-nivrtti) des Schmerzes, ist allein die Philosophie imstande dem Menschen zu verhelfen. Mit diesem Gedanken stimmen alle orthodoxen Systeme, ausschließlich der ritualistischen Mîmâmsâ, überein; nur wird in keinem anderen das Elend des Weltdaseins mit derselben Entschiedenheit, wie in der Sâmkhya-Philosophie, betont, und das Verlangen nach Erlösung vom Schmerz tritt uns deshalb in der brahmanischen Philosophie nirgends so deutlich entgegen wie hier.
Eine weitere Übereinstimmung mit dem Vedânta-, Vaisesika- und Nyâya-System ist die Überzeugung, daß nur eine bestimmte Erkenntnis die Kraft habe, den Menschen zu erlösen. Die Sâmkhya-Philosophie erfordert »die richtige Erkenntnis des Entfalteten, des Unentfalteten und des Erkenners«16, d.h. die Erkenntnis der absoluten Verschiedenheit, die zwischen der ganzen materiellen Welt und der Urmaterie, aus der sie hervorgegangen, einerseits und der Seele, des wahren Selbstes, andererseits besteht17. »Wenn infolge dieser Unterscheidung der Schmerz bis auf den letzten Rest zu Ende ist, hat man das Ziel erreicht; durch nichts anderes18.« Um diese unterscheidende Erkenntnis (viveka, viveka-jñâna) herbeizuführen, entwickelt die Sâmkhya-Lehre ihre Theorie der Weltentfaltung, indem sie nicht nur die Entstehung der Erscheinungswelt in ihrem Kausalzusammenhang, sondern auch die psychischen Vorgänge zu erklären unternimmt.
Was der Sâmkhya-Philosophie lediglich Mittel zum Zweck ist – Kosmologie, Physiologie und Psychologie –, erscheint freilich uns Abendländern, die wir nicht in dem Dogma von der Metempsychose befangen sind und das Erlösungsbedürfnis im Sinne der indischen Philosophie nicht teilen können, als der eigentlich bedeutungsvolle Teil ihrer Lehren. Bleiben wir aber zunächst noch ganz auf indischem Boden stehen mit der Frage, wer nach der Anschauung der Sâmkhya-Philosophie dazu berufen ist, die erlösende Erkenntnis zu erreichen und andere durch Belehrung zu ihr zu führen. Ein Blick auf die entsprechenden Verhältnisse im Vedânta läßt uns den menschlich höheren Standpunkt, den hier die Sâmkhya-Lehre einnimmt, erkennen. Bei Deussen, System des Vedânta 63, lesen wir, »daß alle diejenigen, welche durch das Sakrament des Upanayanam (der Einführung bei einem Lehrer unter feierlicher Umgürtung mit der Opferschnur) wiedergeboren (dvija) sind, also, falls sie diese Bedingung erfüllen, alle Brâhmanas, Kshatriyas und Vaiçjas, daß ferner auch die Götter und die (abgeschiedenen) Rishis zur Vidyâ [d.h. zur erlösenden Heilslehre] berufen sind; daß hingegen die Çûdras (die Angehörigen der vierten, nichtarischen Kaste) von derselben ausgeschlossen bleiben.« Der Offenbarungscharakter des Vedânta als der brahmanischen Philosophie katA exoxhn brachte diese Beschränkung auf die drei obersten Kasten mit sich. Für die in freierer Atmosphäre entwickelte Sâmkhya-Philosophie, die dem alles Lebende mit der gleichen Liebe umfassenden Buddhismus zur Grundlage gedient hat, gab es schon bei ihrer Entstehung für diese brahmanische Einschränkung keinen Grund19; und es gereicht ihr zur Ehre, daß sie auch in späterer Zeit sich nicht dazu verstanden hat, irgendeiner Menschenklasse den Weg zum ewigen Heil zu verschließen. So selbstverständlich uns dieser Standpunkt erscheint, so bewundernswert ist er bei einem System, das zwei Jahrtausende lang äußerlich im Einklang mit dem Brahmanentum gestanden und mehrere Jahrhunderte hindurch in ihm eine geistige Herrschaft ausgeübt hat.
In Kârikâ 53 werden die Wesen folgendermaßen eingeteilt20: »Die göttliche [Schöpfung] ist achtfältig, die tierische fünffach, die menschliche von einer Art.« Wenn hier die überirdischen Geschöpfe, je nachdem sie in der Welt des Gottes Brahman, des Prajâpati, des Indra leben oder zu den Ahnen, den Gandharvas, Yaksas, Râksasas oder Pisâcas gehören, für acht verschiedene Arten erklärt werden, so wird dadurch die Zusammenfassung der Menschenwelt in eine einzige Klasse um so bedeutungsvoller. Ein System, das gerade mit besonderer Vorliebe Abteilungen und Unterabteilungen ziffernmäßig feststellt, würde bei dieser Gelegenheit gewiß nicht versäumt haben, auch die Menschen in der üblichen naheliegenden Weise zu klassifizieren, wenn ihm nicht die Kasten-und Rassenunterschiede als nichtig gegolten hätten. Wären zu irgendeiner Zeit die Sûdras von dem Studium der Sâmkhya-Philosophie ausgeschlossen gewesen, so würde dieser Grundsatz zweifellos in den Lehrbüchern des Systems verkündet worden sein, wie er in den Lehrbüchern des Vedânta aufgestellt und ausführlich begründet ist. An keiner der zahlreichen Stellen aber, an denen die Sâmkhya-Schriften die Vorbedingungen für die Erreichung der erlösenden Erkenntnis erörtern – wir werden sie gleich im Zusammenhang betrachten – ist überhaupt von dem Stande oder der Abstammung des Erlösungsbedürftigen die Rede. Mehrfach21 werden die zur Erkenntnis Berufenen in drei Klassen eingeteilt, aber nicht etwa nach irgendeinem äußerlichen Gesichtspunkt, sondern nur nach dem Grade ihrer moralischen und intellektuellen Befähigung in wenig, mittelmäßig und hervorragend Begabte. Damit gilt ein jeder als berufen, der imstande ist, dem Gedankengange des Systems zu folgen und gewillt, den an ihn gestellten Forderungen zu genügen. In Sûtra IV. 2 wird berichtet, daß einstmals ein im Gebüsch verborgener Dämon unbemerkt mit anhörte, wie ein Lehrer seinem Schüler Unterricht in der Heilslehre erteilte – Vijñânabhiksu bezieht dies auf Arjunas Belehrung durch Krsna in der Bhagavadgîtâ – – und daß auf solche Weise der Dämon die Erlösung gewann. Diese Legende gibt Vijñânabhiksu Gelegenheit zu erklären, daß auch Frauen, Sûdras und andere das höchste Ziel erreichen können22. Wenn noch im sechzehnten Jahrhundert dies von einem strenggläubigen Anhänger des Brahmanentums bei der Erklärung eines Sâmkhya-Textes ausgesprochen ist, so brauchen wir nach keinen weiteren Beweisen dafür zu suchen, daß die Sâmkhya-Philosophie niemals das religiöse Vorurteil des Vedânta geteilt hat.
Ein jeder nun, der die unterscheidende Erkenntnis gewonnen hat, ist zur Belehrung anderer berufen; die Beschränkung auf professionelle Lehrer wird ausdrücklich in unserem System zurückgewiesen23. Wiederum ein unbrahmanischer Zug! Aber nur wer zur unmittelbaren Erschauung (sâksâtkâra) der Wahrheit gelangt und infolgedessen bei Lebzeiten erlöst (jîvan-mukta) ist, soll die Unterweisung anderer Unternehmen24. Denn wenn jemand als Lehrer auftreten wollte, der bloß die richtige Lehre vortragen gehört, aber durch Reflektieren und Meditieren noch nicht jenes Ziel erreicht hat, so würde endlose Verwirrung die Folge sein; oder um mit Vijñânabhiksu zu reden: »Wenn jemand das Wesen des Selbstes, ohne es ganz vollständig zu kennen, lehrte, so würde er hinsichtlich dieses oder jenes Teiles wegen des eigenen Irrtums wiederum seinen Schüler in Irrtum versetzen, dieser wieder einen anderen und so fort; auf diese Weise würde eine Tradition entstehen, die einer Reihe von sich gegenseitig führenden Blinden vergleichbar wäre (andha-paramparâ)25.«
3. Die Anforderungen.
Die Vedânta-Philosophie steht der Lehre von der Werkgerechtigkeit nicht konsequent gegenüber; so entschieden sie feststellt, daß die Erlösung allein durch das Wissen und nicht durch Werke zu gewinnen ist, so erklärt sie doch die Opfer und sonstigen frommen Werke keineswegs für überflüssig; sie gelten ihr vielmehr als ein mitwirkendes Hilfsmittel zur Erlangung des Wissens. Ja, infolge der engen Verbindung mit der ritualistischen Mîmâmsa geht sie so weit, die im brahmanischen Gesetz vorgeschriebenen Pflichten auch für den nach dem Wissen Strebenden als verbindlich zu erklären. Nur wer das Wissen erlangt hat, ist nach dem Vedânta der Beobachtung dieser Pflichten enthoben27.
Die Sâmkhya-Philosophie hat lange Zeit hindurch diese Theorie bekämpft. Noch in der Kârikâ ist mit keinem Worte davon die Rede, daß der Werkdienst eine nützliche Vorbereitung zur Erreichung der Erkenntnis sei; in Kârikâ 2 wird einfach die Vollziehung der Opfer widerraten. Auch im Mahâbhârata (XII. 9600 fg.) wird eine alte (schon S. 194 Anm. 1 erwähnte) Erzählung berichtet, in der Kapila beim Anblick einer zum Opfern weggeführten Kuh einen Ausruf gegen die Veden ausstößt, der seine Mißbilligung des Tieropfers zum Ausdruck bringen sollte28.
Erst die Sûtras, deren Abfassung wir oben S. 97 gegen 1400 ansetzen zu müssen glaubten, haben sich außer anderen vedântistischen Lehren auch die Theorie von dem Nutzen des Werkdienstes zu eigen gemacht29. Sie wird hier genau so formuliert wie im Vedânta. Zwar ist die unterscheidende Erkenntnis ausnahmslos das einzige Mittel zur Erlösung30, und doch wird die Erfüllung der im brahmanischen Gesetz vorgeschriebenen Pflichten empfohlen31. Die Kommentatoren führen dann mit größerer oder geringerer Entschiedenheit aus, daß die Werke nur als Hilfsmittel zu betrachten seien und daß sie an Wert nicht den unumgänglichen Mitteln zur Erreichung der Erkenntnis, von denen gleich gehandelt werden soll, nahe kommen. Diese Vedânta-Lehre von der Bedeutung des Werkdienstes ist nun aber in rein äußerlicher Weise in die Sâmkhyasûtras eingefügt, nicht organisch mit unserem System verschmolzen; denn an verschiedenen Stellen bricht auch noch in den Sûtras der echte, mit jener Lehre im Gegensatz stehende Standpunkt des Sâmkhya durch. Sûtra I. 84 heißt es, daß aus der Vollziehung des im Gesetz vorgeschriebenen Werkes Schmerz über Schmerz sich ergibt, und nicht etwa das Aufhören der Nichtunterscheidung, »wie aus dem Übergießen mit [kaltem] Wasser nicht Befreiung von der Erstarrung erfolgt«. Und im folgenden Sûtra wird hinzugefügt, daß es sich ganz gleich bleibt, ob man mit dem Werke einen Wunsch verbindet oder nicht; auch aus dem wunschlosen, im Innern geübten Opfer entstehe Schmerz über Schmerz. Derselbe Gedanke wird mit anderen Worten in Sutra IV. 8 zum Ausdruck gebracht: »Denken an das, was kein Mittel ist, führt zum Gebundensein, wie bei Bharata32«, und Vijñânabhiksu bemerkt dazu: »Was kein unmittelbares Mittel zur unterscheidenden Erkenntnis ist, auf dieses hat man, auch wenn es eine Vorschrift der Moral sein sollte, doch sein Denken nicht zu richten, d.h. nicht den Wunsch des Herzens auf dessen Ausübung zu lenken.« In Sûtra IV. 12 wird gar die Arbeit zum Zwecke der Selbsterhaltung für überflüssig erklärt.
Die echte Sâmkhya-Lehre also lautet: selbst gute Werke befördern nicht, sondern hindern die Erreichung der unterscheidenden Erkenntnis. Von einer Moral ist also im Sâmkhya-System nicht die Rede33 – diese Lücke hat erst sein Tochtersystem, der Buddhismus, in bewundernswerter Weise ausgefüllt –, und es darf deshalb bei einer unparteiischen Beurteilung nicht verschwiegen werden, daß die unverfälschte Sâmkhya-Philosophie, die für die Schärfung des Verstandes der indischen Denker von hoher Bedeutung gewesen ist, einen gewissen Anteil an der ungünstigen Entwicklung des indischen Volkscharakters gehabt haben wird. Selbst in den Lehrbüchern des Systems läßt sich an einzelnen Stellen dieser sittlich schädigende Einfluß erkennen34.
Mit der Verwerfung moralischer Werke als eines Hilfsmittels zur Erkenntnis steht im engsten Zusammenhang dasjenige Erfordernis zur Erreichung des erlösenden Wissens, das der Sâmkhya-Lehre als conditio sine qua non gilt: die Gleichgültigkeit gegen alle weltlichen Dinge (virâga, vairâgya). Denn auch das Ausüben guter Werke ist mit dieser Gleichgiltigkeit nicht zu vereinigen. Der mit Begierde oder Kummer Behaftete ist absolut unfähig, die Belehrung in sich aufzunehmen; »in einem, dessen Sinn auf solche Weise verdüstert ist, geht der Same der Belehrung nicht auf35«. Die Begierden nun aber werden nicht durch den Genuß gestillt36, sondern nur durch die Erkenntnis der Fehler und Mängel, die allem Materiellen anhaften37. Eine solche Erkenntnis führt den Menschen dazu, seinem Besitz und allen weltlichen Genüssen zu entsagen. Nur das freiwillige Aufgeben der weltlichen Güter und der Hoffnungen erzeugt den Zustand des Gemüts, den die Philosophie verlangt, während erzwungenes Aufgeben den Beraubten leidvoll macht38. Wer diese Welt mit voller Gleichgiltigkeit gegen ihre Genüsse aufgibt und sich dem Streben nach der Erkenntnis widmet, wird dem Schwan verglichen39, der es nach dem indischen Volksglauben versteht, aus einer Mischung von Milch und Wasser nur die wertvolle Milch zu sich zu nehmen und das wertlose Wasser zurückzulassen. Die errungene Gleichgiltigkeit ist freilich ein verlierbares Gut; um es zu bewahren, wird die Vermeidung menschlicher Gesellschaft – ja selbst eines einzigen Gefährten, wofern dieser nicht im Besitze der höchsten Erkenntnis ist40 – anempfohlen, da das Zusammenleben mit anderen leicht zur Entstehung von Leidenschaften, zu Zank und Streit führt41; keinenfalls aber soll man aus freien Stücken Gemeinschaft mit Leuten halten, die noch von Begierden erfüllt sind42.
Das Sâmkhya-System unterscheidet eine niedere und eine höhere Gleichgiltigkeit (apara- und para-vairâgya)43. Unter den ersten Begriff fällt diejenige, die als Vorbereitung auf das Streben nach der Erkenntnis gefordert wird, während die ›höhere Gleichgiltigkeit‹ erst eintreten kann, nachdem die unterscheidende Erkenntnis erreicht ist44. Auf dem Standpunkt der ›niederen Gleichgültigkeit‹ hat man der Freude an den Sinnesobjekten und der Teilnahme an äußeren Vorgängen entsagt; die ›höhere Gleichgiltigkeit‹ aber besteht darin, daß man nach der Erkenntnis des Unterschiedes von Geist und Materie auch die feinsten Modifikationen der Materie in Gestalt seiner eigenen inneren Organe, die man dann als nicht zu dem Selbst gehörig, sondern ihm wesensverschieden weiß, mit derselben Indifferenz ansieht wie die Objekte der Außenwelt. Dieser Zustand ist eine unmittelbare Vorstufe der Erlösung. Wir haben es also hier nur mit der ›niederen Gleichgiltigkeit‹ zu tun, die der Erreichung der unterscheidenden Erkenntnis vorangehen muß, aber nicht zu ihr zu führen braucht. Da sie auch in dem letzteren Falle ein Verdienst bleibt und jedes Verdienst nach dem Gesetz der Vergeltung belohnt wird, so ist demjenigen, der diese Welt aufgegeben und doch das erlösende Wissen nicht gewonnen hat, im Sâmkhya-System in Aussicht gestellt, daß er in die Urmaterie aufgehen und bei Beginn einer neuen Weltperiode als Gott wieder in das Weltdasein eintreten wird45.
Von der Notwendigkeit der Belehrung war bereits S. 199 die Rede. Schon die bloße Tatsache, daß jemand von einem berufenen Lehrer in der Sâmkhya-Philosophie unterrichtet wird, gilt als ein Glück, dessen Ursache großes in vielen Existenzen erworbenes Verdienst ist46. Nur bei sehr Befähigten führt aber die Belehrung oder, wie es technisch heißt, ›das Hören‹ (sravana) unmittelbar zum Ziel47; in der Regel ist darauf die Reflexion (manana) und anhaltende Meditation (nididhyâsana) erforderlich48; es finden sich deshalb in unseren Texten, wenn von den Anforderungen an den Erlösungsbedürftigen gehandelt wird, diese drei Begriffe stehend in dem Kompositum sravana-manana-nididhyâsana verbunden. Vijñânabhiksu zu VI. 57 erklärt sogar, daß die Verhältnisse bei den Bewohnern der himmlischen Welten ebenso liegen, wie auf Erden.
Aber auch da, wo Reflexion und anhaltende Meditation geübt werden, stehen – abgesehen von der Möglichkeit, daß die Reflexion ganz falsche Wege einschlagen kann49 – der Erreichung der erlösenden Erkenntnis noch allerlei Hindernisse im Wege, unter denen das größte die anfangslose fehlerhafte Anlage (anâdi-mithyâ-vâsanâ)50 unseres Denkorgans ist. Die Nichtunterscheidung (aviveka) erzeugt die Disposition zur Nichtunterscheidung in der folgenden Existenz, und diese Disposition ist dann wiederum die Ursache der Nichtunterscheidung; so haben wir hier, nach rückwärts gesehen, eine Verkettung ohne Anfang, da der Samsâra von Ewigkeit her existiert, vergleichbar dem Fall von Same und Sproß (bîjânkura-vat) oder, wie wir sagen würden: von Henne und Ei51. Daraus, daß diese Verkettung von Nichtunterscheidung und Disposition anfangslos ist, darf man aber nicht schließen, daß sie auch bis in alle Ewigkeit hin währen müsse; denn durch die eintretende Unterscheidung wird sie gelöst52.
Die in unserer Naturanlage liegenden Hindernisse werden erfolgreich bekämpft durch die Konzentration des Denkens53. Ist diese Konzentration auf das höchste Maß gesteigert, so daß kein Abirren der Gedanken auf andere Objekte hin mehr stattfindet, so tritt die unmittelbare Erschauung (sâksâtkâra) der Wahrheit ein.
Die Lehre von der Konzentration bildet bekanntlich den Hauptinhalt des Yoga-Systems, in dessen Lehrbüchern ausführlich die Regeln über das äußere und innere Verhalten des Asketen gegeben sind. Bei der engen Verbindung von Sâmkhya und Yoga darf es uns nicht wundernehmen, daß die Theorien des Yoga-Systems über diesen Punkt in die Sâmkhya-Schriften eingedrungen sind. Die Kârikâ erwähnt nichts von der Yoga-Praxis, was zu der Auffassung (S. 78) stimmt, daß die Kârikâ ein reines Sâmkhya-Werk, sein will im Gegensatz zu dem Sastitantra, dem Lehrbuch des Sâmkhya-Yoga; nur einmal spricht die Kârikâ (in Strophe 45) von der aus der übernatürlichen Kraft (aisvarya) sich ergebenden Erfüllung eines jeden Wunsches. Auch die Kommentatoren zur Kârikâ beschäftigen sich nur gelegentlich (bei Strophe 23) mit der Yoga-Praxis und den wunderbaren durch sie zu erreichenden Kräften. Die Sûtras dagegen behandeln die Yoga-Praxis als einen integrierenden Teil der Sâmkhya-Lehre54, aber doch noch ohne auf die Einzelheiten systematisch einzugehen. Erst die Kommentatoren zu den Sûtras operieren mit dem ganzen Apparat der acht yogânga oder Bestandteile der Yoga-Praxis55, als da sind Selbstbezwingung (yama), Einhaltung der Observanzen (niyama), Verharren in bestimmten Körperhaltungen (âsana), Anhalten des Atmens (prânâyâma), Abwendung der Sinne von den Sinnesobjekten (pratyâhâra), Sammlung (dhâranâ), Meditation (dhyâna) und Versenkung (samâdhi)56; auch haben sie aus Yogasûtra I. 17, 18 die Lehre entlehnt, daß über die bewußte Konzentration (samprajñâta-yoga) hinaus ein Zustand zu erstreben sei, in dem die Konzentration zu voller Bewußtlosigkeit gesteigert ist und ›aus dem es kein Auferstehen gibt‹ (asamprajñâta-yoga). Erst in diesem Zustande der Bewußtlosigkeit ist nach der von den späten Sâmkhya-Lehrern übernommenen Anschauung des Yoga-Systems das Ziel erreicht57.
Wenn nun auch diese ganze künstliche Methode zur Gewinnung der Erkenntnis durch Absolvierung fest bestimmter Vorstufen der ursprünglichen und reinen Sâmkhya-Lehre fremd ist, so haben wir doch gesehen, daß auch von ihr – wenigstens als Regel – ein mühsames Erarbeiten der unterscheidenden Erkenntnis vorausgesetzt wird. Wie viel von dem einzelnen zu leisten ist, wie lange er die heiße Denkarbeit zu üben hat und ob er überhaupt ans Ziel gelangt, hängt ganz von seiner individuellen Beanlagung ab58. Immer aber tritt die Erkenntnis da, wo sie erreicht wird, blitzartig, intuitiv ein, wie bei einem, der über die Himmelsrichtungen in Verwirrung ist, die Aufhebung des Irrtums wohl durch Belehrung und Beweisführung vorbereitet werden kann, aber doch nur durch die unmittelbare Erschauung bewirkt wird59. Mit dieser Vorstellung scheint die in den Sâmkhyasûtras III. 77-79 vorgetragene Lehre von den drei Stufen, der Erkenntnis, der geringen, mittelmäßigen und höchsten Unterscheidung, nicht zu stimmen. Da wir nun in der Yoga-Philosophie drei solche Erkenntnisstationen angenommen finden60 und bei den Kommentatoren zu den eben zitierten Sâmkhyasûtras61 lesen, daß die Steigerung der Unterscheidung auf die dritte und höchste Stufe (viveka-nispatti) erst bei derjenigen Konzentration eintritt, bei welcher das Bewußtsein vergangen ist, so ist wohl nicht zu bezweifeln, daß auch diese Lehre von den drei Graden der unterscheidenden Erkenntnis aus dem Yoga-System entlehnt ist.
Ich habe hier nur dasjenige zur Sprache gebracht, was zum Verständnis der von unserem System gestellten Anforderungen zu wissen nötig ist; der psychologische Prozeß, auf dem das Eintreten des erlösenden Wissens beruht, kann erst in dem vierten Abschnitt dieses Werkes erörtert werden.
4. Die Erkenntnisquellen und die Methode.
Sämtliche indischen Systeme bekunden echt philosophischen Sinn dadurch, daß sie es für notwendig halten, über die von ihnen angenommenen Quellen der Erkenntnis Rechenschaft zu geben. Das allgemein gebrauchte Wort für Erkenntnis- und Beweismittel ist pramâna62, etymologisch: dasjenige, wodurch etwas abgemessen, genau festgestellt, also eine richtige Erkenntnis (pramâ) gewonnen wird63.
Hinsichtlich der Zahl der Pramânas weichen die Systeme voneinander ab64; in der Erörterung des wichtigsten aber und von allen Schulen (ausschließlich der Cârvâkas) als das eigentlich philosophische Beweismittel erkannten, der Schlußfolgerung nämlich, zeigen die Lehrbücher der orthodoxen Systeme die größte Übereinstimmung. Die ganze Terminologie, die Definitionen, die Behandlung der Einzelheiten und die Beispiele sind auf diesem Gebiete mit geringen Abweichungen überall die gleichen. Dies erklärt sich daraus, daß dieser Gegenstand von der Vaisesika-Nyâya-Schule bis zu der höchsten für Indien erreichbaren Vollendung ausgearbeitet und deshalb in der dort festgestellten Form von den anderen Schulen übernommen worden ist65. Wenn also die Theorie der Schlußfolgerung in den Sâmkhya-Schriften eingehend (am ausführlichsten in der Sâmkhya-tattva-kaumudî zu Kârikâ 5 und im Sâmkhya-pravacana-bhâsja zu Sûtra I. 103) behandelt wird, so erkennen wir hier ein fremdes Element, dessen Erörterung der indische Geschmack verlangte66, von dem aber eine europäische Darstellung der Sâmkhya-Philosophie nur insoweit Kenntnis zu nehmen braucht, als es für die Methode dieses Systems von Bedeutung ist.
Unser System erkennt drei Quellen der Erkenntnis an: 1. die Perzeption (pratyaksa, drsta), 2. die Schlußfolgerung (anumâna), 3. die zuverlässige Mitteilung (âptavacana, sabda)67. Die außerdem noch im Nyâya-System angenommene Erkenntnis aus der Analogie (upamâna) und die weiteren in der Mîmâmsâ aufgestellten Pramânas (s. oben S. 156 Anm. 1) werden in Kârikâ 4 und Sûtra I. 88 als entweder in jenen drei enthalten oder als nicht dem Begriff des Pramâna entsprechend zurückgewiesen68.
Die Perzeption wird in Kârikâ 5 als ›Feststellung der einzelnen Objekte [durch die Sinnesorgane]‹ definiert, in Sûtra I. 89 als ›diejenige Denkfunktion, welche [mit einem Dinge] in Verbindung stehend seine Form wiedergibt‹. Als ein Vorzug der Sinneswahrnehmung vor den anderen Erkenntnisquellen gilt, daß sie alle Besonderheiten ihrer Objekte mit einem Male erfassen kann69, während eine Beschreibung durch Worte immer noch so und so viele Einzelheiten übrig läßt, die nicht zur Vorstellung kommen.
Versagt die Sinneswahrnehmung, so darf man die Nichtexistenz des in Frage stehenden Dinges nur dann feststellen, wenn dieses seiner Natur und den Umständen nach wahrgenommen werden müßte; »denn sonst könnte jemand, der aus einem Hause herausgegangen die Einwohner dieses Hauses nicht sieht, zu der Überzeugung kommen, daß diese nicht existieren70





























