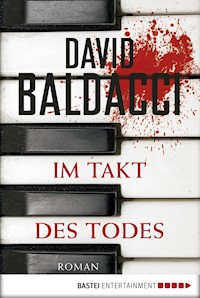9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Camel Club
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der Sprecher des Repräsentantenhauses in Washington wird Opfer eines Anschlags. Als kurz darauf ein hochrangiger Mitarbeiter der Kongressbibliothek tot aufgefunden wird, ist für Oliver Stone und den Camel Club schnell klar: Diese beiden Morde müssen etwas miteinander zu tun haben. Was hat es mit dem wertvollen Buch auf sich, das der tote Bibliothekar sein Leben lang gehütet hatte und das nun verschwunden ist? Steht es in Zusammenhang mit den Staatsgeheimnissen, mit denen ein Unbekannter in großem Stil handelt? In ihrem zweiten spannenden Fall riskieren die Mitglieder des Camel Club wieder alles, um die Machenschaften in höchsten Regierungskreisen aufzudecken...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Ähnliche
INHALT
CoverTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68DanksagungenDAVID BALDACCI
DIE SAMMLER
Roman
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Uwe Anton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Collectors
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Umschlaggestaltung: Hilden Design, München
Umschlagmotiv: Mauritius Die Bildagentur GmbH
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-8387-0942-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Art und Lynette, in Liebe und Respekt, und zum Gedenken an Jewell English.
KAPITEL 1
Roger Seagraves verließ das Capitol nach einem interessanten Meeting, das wenig mit Politik zu tun hatte. Am Abend saß er allein im Wohnzimmer seines bescheidenen Vorstadthauses und traf eine wichtige Entscheidung. Er musste jemanden töten, und dieser Jemand war ein sehr bedeutendes Ziel. Doch für Seagraves war diese Aufgabe nicht beängstigend oder gar erschreckend, sondern eine lohnende Herausforderung.
Am nächsten Morgen fuhr er in sein Büro im nördlichen Virginia. Als er an seinem Schreibtisch in dem kleinen, vollgestopften Raum saß, der genauso aussah wie die anderen Zimmer zu beiden Seiten des Flurs, fügte er im Geiste die kritischen Teile der anstehenden Aufgabe zusammen und kam zu dem Schluss, dass er die Sache keinem Dritten anvertrauen durfte, sondern selbst in die Hand nehmen musste. Seagraves hatte zuvor schon getötet, sehr oft sogar. Der einzige Unterschied war, dass er es diesmal nicht für seine Regierung tun würde, sondern für sich selbst.
Die nächsten beiden Tage verbrachte er mit sorgfältiger Planung, die er in die Erledigung seiner täglichen Pflichten einflocht. Die drei unumgänglichen Gebote seiner Mission waren ihm in Fleisch und Blut übergegangen.
Erstens: Mach die Sache nicht zu kompliziert.
Zweitens: Sei auf jede Eventualität vorbereitet.
Drittens: Gerate niemals in Panik.
Regel zwei und drei waren schon deshalb wichtig, falls der Plan nicht aufging, was durchaus geschehen konnte.
Es gab noch eine vierte Regel, an die Seagraves sich stets gehalten hatte, die aber eher allgemeiner Natur war: Mach dir zunutze, dass die meisten Dummköpfe sind, wenn es um Wichtiges geht, zum Beispiel ihr Überleben.
Roger Seagraves war zweiundvierzig, ledig und kinderlos. Eine Frau und Nachwuchs hätten seine unorthodoxe Lebensweise komplizierter gestaltet. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit für die Regierung war er um die halbe Welt gereist und hatte immer wieder falsche Identitäten angenommen. Zum Glück war es im Computerzeitalter erstaunlich einfach, in die Rolle eines anderen zu schlüpfen. Ein paar Anschläge auf der Tastatur des Dell-PC, schon summte irgendwo in Indien ein Server, und aus einem Laserdrucker schob sich ein neues Ich mit allem offiziellem Drumherum und einem ausreichenden Kreditrahmen.
Seagraves konnte sich fast alles, was er brauchte, auf einer Internetseite besorgen, für die er ein sorgsam gehütetes Passwort benötigte. Diese Internetseite war eine Art Supermarkt für Mord & Totschlag, die Seagraves’ kriminelle Kunden manchmal »EvilBay« nannten. Dort konnte man praktisch alles erwerben, von erstklassig gefälschten Ausweisen und gestohlenen Kreditkartennummern bis hin zu den Diensten professioneller Mörder oder Waffen nicht nachvollziehbarer Herkunft, wenn man den Mord selbst begehen wollte. Normalerweise erwarb Seagraves das benötigte Material von einem Händler, mit dem 99 Prozent seiner Kunden zufrieden waren und der eine Geld-zurück-Garantie anbot. Auch Killer legen Wert auf Qualität.
Roger Seagraves war groß, gut gebaut und gut aussehend mit seinem dichten, gewellten Blondhaar. Oberflächlich betrachtet wirkte er sorglos und lässig mit seinem ansteckenden Lächeln. Praktisch jede Frau warf ihm einen zweiten Blick zu, und mancher neidische Mann ebenfalls – ein Umstand, den Seagraves oft zu seinem Vorteil nutzte. Wenn man jemanden ermorden oder betrügen muss, sollte man die Mittel, über die man verfügt, so effektiv wie möglich einsetzen. Das hatte Seagraves bereits in Diensten der Regierung gelernt. Obwohl er im Prinzip noch immer für die Vereinigten Staaten tätig war, arbeitete er auch für sich selbst. Seine offiziellen Pensionsansprüche reichten bei weitem nicht, um ihm den angenehmen Ruhestand zu ermöglichen, den er seines Erachtens verdient hatte, nachdem er so viele Jahre sein Leben für die rot, weiß und blau gestreifte Flagge riskiert hatte. Wobei sie für ihn hauptsächlich rot wie Blut gewesen war.
Am dritten Nachmittag nach seinem erleuchtenden Besuch im Capitol veränderte Seagraves sorgsam seine Gesichtszüge und zog sich mehrere Kleidungsstücke über. Als es dunkel wurde, fuhr er mit einem Van in die exklusiveren Ausläufer des nordwestlichen District of Columbia, wo auf den Grundstücken der Botschaften und der protzigen Villen bis an die Zähne bewaffnete Wachleute patrouillierten.
Seagraves parkte auf dem Hinterhof eines Gebäudes gegenüber von einem exklusiven Club, der in einem eindrucksvollen georgianischen Backsteinbau untergebracht war. Der Club wurde von Leuten besucht, die von Geld und Politik besessen waren, und davon gibt es in Washington mehr als in jeder anderen Stadt der Welt. Diese Leute mochten es, im Club zusammenzusitzen und nach Herzenslust über Parteien, Politik und Protektion zu sprechen, obwohl es nur mittelmäßiges Essen und durchschnittliche Weine gab.
Seagraves trug einen blauen Overall mit der Schablonenaufschrift »Service« auf dem Rücken. Der Schlüssel, den er zuvor angefertigt hatte, passte in das einfache Schloss des leerstehenden Gebäudes, das auf eine umfassende Renovierung wartete. Den Werkzeugkasten in der Hand, nahm Seagraves immer zwei Stufen auf einmal bis ins oberste Stockwerk und betrat einen Raum, der zur Straße lag. Er leuchtete mit einer Taschenlampe, bis er das einzige Fenster entdeckte, das er bei einem früheren Besuch aufgebrochen und geölt hatte, um unliebsame Geräusche zu vermeiden.
Nun öffnete Seagraves den Werkzeugkasten und setzte schnell und geschickt sein Scharfschützengewehr zusammen, brachte den Schalldämpfer an, hebelte eine einzige Patrone in die Kammer – er litt nicht gerade an mangelndem Selbstvertrauen –, kroch vorwärts und schob das Fenster fünf Zentimeter auf, gerade weit genug, um den Schalldämpfer durch die Öffnung zu bekommen. Er sah auf die Uhr und schaute dann von seinem Aussichtspunkt die Straße rauf und runter, ohne befürchten zu müssen, entdeckt zu werden, da das Gebäude, in dem er sich befand, in völliger Dunkelheit lag. Darüber hinaus war das Gewehr sehr unauffällig: Es verfügte über Camoflex-Technik und wechselte die Farbe, um sich dem jeweiligen Hintergrund anzupassen.
Ach, was der Mensch nicht alles vom primitiven Nachtfalter gelernt hatte.
Als die Limousine und der erste Wagen mit den Leibwächtern vor dem Club hielten, zog Seagraves das Fadenkreuz auf den Kopf eines der Männer, die aus dem Fahrzeug stiegen, schoss aber nicht. Noch war es nicht an der Zeit. Das Clubmitglied verschwand im Gebäude, gefolgt von seinen Sicherheitsleuten, stiernackigen Typen in dunklen Anzügen und mit Empfängern im Ohr. Seagraves beobachtete, wie die Limousine und der Wagen des Sicherheitspersonals wieder losfuhren.
Wieder blickte er auf die Uhr: noch zwei Stunden. Erneut beobachtete er die Straße unter ihm. Aus weiteren Privatwagen und Taxen stiegen Frauen mit ernsten Gesichtern. Sie trugen weder Klunker von De Beers noch Modelle von Versace, sondern schlichte, elegante Kostüme von der Stange und geschmackvollen, dazu passenden Schmuck. Die Männer, die sie mit genauso ernsten Mienen begleiteten, zeichneten sich durch Nadelstreifenanzüge, langweilige Krawatten und offensichtlich schlechte Laune aus.
Es wird nicht besser, meine Herren, glauben Sie mir.
Zwei Stunden verstrichen quälend langsam, doch Seagraves’ Blick wich keine Sekunde von der Backsteinfassade des Clubs. Durch die großen Fenster sah er das Treiben der Leute, die Drinks in den Händen hielten und sich leise, beinahe verschwörerisch unterhielten.
Okay, schreiten wir zur Tat.
Seagraves schaute noch einmal rasch über die Straße. Keine Menschenseele sah in seine Richtung. Im Lauf seiner Karriere hatte er herausgefunden, dass so gut wie nie jemand zu ihm blickte. Er wartete geduldig, bis das Zielobjekt sich ein weiteres Mal ins Fadenkreuz bewegte; dann betätigte er mit dem behandschuhten Finger den Abzug. Er schoss nicht gern durch eine Fensterscheibe, obwohl bei der Munition, die er benutzte, das Glas die Flugbahn nicht beeinflusste.
Plop! Dem Geräusch folgte augenblicklich das Klirren von Glas und der dumpfe Aufschlag, mit dem die pummelige Leiche auf den gebohnerten Eichenfußboden prallte. Der Ehrenwerte Robert Bradley hatte beim Einschlag der Kugel nicht den geringsten Schmerz verspürt. Er war tot gewesen, ehe sein Gehirn dem Mund befehlen konnte: Schreien!
Gar nicht mal so übel, ging es Seagraves durch den Kopf. Es gibt schmerzhaftere Alternativen, sich von dieser Welt zu verabschieden.
Er legte das Gewehr ganz ruhig ab, zog den Overall aus und enthüllte die Polizeiuniform darunter. Er setzte eine dazu passende Mütze auf und stieg die Treppe zum Hintereingang hinunter. Als er das Gebäude verließ, hörte er die Schreie von der anderen Straßenseite. Seit dem Schuss waren lediglich neunzehn Sekunden verstrichen – Seagraves hatte im Kopf mitgezählt. Nun bewegte er sich schnell die Straße entlang, wobei er weiterhin die Sekunden zählte. Als im nächsten Augenblick die sorgfältig choreografierte Szene eingeleitet wurde, hörte er das laute Aufheulen des Automotors. Sofort rannte er los und zog dabei seine Pistole. Er hatte fünf Sekunden, um ans Ziel zu kommen. Gerade noch rechtzeitig stürmte er um die Ecke und wurde fast von der Limousine überfahren, als sie an ihm vorbeiraste. Im letzten Augenblick sprang er zur Seite, rollte sich über die Schulter ab und kam auf der Mitte der Fahrbahn zu liegen.
Von der Straßenseite aus riefen Leute ihm etwas zu und zeigten auf den Wagen. Seagraves drehte sich um, packte die Waffe mit beiden Händen und feuerte auf die Limousine. Die Platzpatronen klangen wie echte Munition. Er gab fünf Schüsse ab, sprintete einen halben Block weit über den Asphalt und sprang in einen Wagen, der dort stand, offensichtlich ein ziviles Polizeifahrzeug, das sofort losfuhr und mit heulenden Sirenen und flackerndem Blaulicht der Limousine folgte, die ihm davonzuziehen drohte.
Der Wagen, den er »verfolgte«, bog an der nächsten Kreuzung links ab, dann rechts, jagte eine schmale Gasse entlang und blieb auf halber Höhe stehen. Der Fahrer schwang sich aus dem Wagen, rannte zu dem hellgrünen VW-Käfer, hinter dem er stehen geblieben war, sprang hinters Steuer und fuhr davon.
Als Seagraves’ Wagen außer Sichtweite des Clubs war, schaltete der Fahrer das Blaulicht und die Sirene aus, gab die Jagd auf und entfernte sich in die entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer schaute Seagraves nicht einmal an, als der nun auf den Rücksitz kletterte und die Polizeiuniform auszog. Darunter trug er einen eng sitzenden, einteiligen Jogginganzug; schwarze Schuhe hatte er schon an. Im Fußraum des Wagens lag ein sechs Monate alter schwarzer Labrador mit Maulkorb.
Die Limousine fuhr durch eine Nebenstraße, bog an der nächsten Ecke links ab und hielt an einem Park, der zu dieser späten Stunde verlassen war. Die hintere Tür wurde geöffnet, Seagraves stieg aus, und der Wagen raste davon.
Seagraves hielt die Leine kurz, als er und sein Hund ihre abendliche Runde begannen. Als sie an die nächste Ecke kamen, fuhren vier Polizeiwagen an ihnen vorbei. Niemand in dem Konvoi warf ihnen auch nur einen Blick zu.
Eine Minute später schoss in einem anderen Stadtteil ein Feuerball in den Himmel. Das gemietete – und zum Glück unbewohnte – Stadthaus des Toten war in die Luft geflogen. Anfangs würde man eine undichte Gasleitung dafür verantwortlich machen. Doch im Zusammenhang mit dem Mord an Bob Bradley würden die Bundesbehörden später nach anderen Erklärungen suchen, auch wenn sie so schnell keine finden würden.
Nachdem Seagraves drei Blocks weit spaziert war, stieg er mit dem Hund in einen wartenden Wagen und war keine Stunde später wieder zu Hause. Mittlerweile war die Regierung der Vereinigten Staaten schon auf der Suche nach einem neuen Sprecher des Abgeordnetenhauses, der den soeben verstorbenen Robert »Bob« Bradley ersetzen sollte.
Das sollte nicht allzu schwierig werden, überlegte Seagraves, als er am nächsten Tag zur Arbeit fuhr, nachdem er in der Morgenzeitung vom Mord an Bradley gelesen hatte. Schließlich wimmelte es in der Stadt ja von verdammten Politikern. Seagraves hielt vor dem Tor, zeigte seine Dienstmarke und wurde vom bewaffneten Posten durchgewinkt, der ihn gut kannte.
Er schritt durch die Eingangstür des weitläufigen Gebäudes in Langley, Virginia, passierte weitere Sicherheitsschleusen und betrat schließlich sein zweieinhalb mal drei Meter großes, vollgestopftes Büro, das genauso aussah wie alle anderen am Flur. Seagraves war zurzeit Beamter im mittleren Dienst, der hauptsächlich als Verbindungsmann zwischen seiner Behörde und den unfähigen Blödmännern auf dem Capitol Hill diente – Amateure, die aus unerfindlichen Gründen ins Amt gewählt worden waren. Seagraves’ Job war nicht annähernd so anspruchsvoll wie sein vorheriger und war sozusagen ein Knochen, den man ihm für frühere Verdienste hingeworfen hatte. Anders als in vergangenen Jahrzehnten holte die CIA ihre »Spezialagenten« aus der Kälte heim, sobald sie das Alter erreicht hatten, in dem die Reflexe langsamer wurden und die Begeisterung für den Job nachließ.
Als Seagraves sich den öden Papierkram vornahm, wurde ihm klar, wie sehr er das Töten vermisst hatte. Wer einmal berufsmäßig gemordet hat, überlegte er, kommt wohl nie über den Blutdurst hinweg. Der vergangene Abend hatte ihm zumindest ein wenig vom alten Ruhm zurückgegeben.
Jedenfalls war jetzt ein Problem aus dem Weg geräumt. Aber wahrscheinlich würde sehr bald ein anderes dessen Stelle einnehmen.
Umso besser, überlegte Roger Seagraves. Er löste gern solche Probleme und war dabei sehr einfallsreich. Es lag in seiner Natur.
KAPITEL 2
Rülpser aus schwarzem Rauch – wahrscheinlich mit genug krebserregenden Stoffen versetzt, um eine oder zwei ahnungslose Generationen auszulöschen – wurden von einem Fabrikgebäude aus verwitterten alten Ziegelsteinen in einen Himmel gespien, der schwarz war vor Regenwolken und sich über einer Industriestadt spannte, die wegen der Billiglöhne, die in noch schlimmer verpesteten Städten Chinas gezahlt wurden, einen unausweichlichen Tod starb. In einer schmale Gasse hatte sich eine kleine Menge um einen Mann versammelt. Es war kein Schauplatz eines Verbrechens mit blutiger Leiche; es war kein Straßen-Shakespeare, der seine schauspielerischen Künste darbot; es war nicht einmal ein Prediger, der zwecks Errettung unsterblicher Seelen mit lauter Stimme und Klingelbeutel hausieren ging. Der Mann, der im Mittelpunkt des Interesses stand, war in seinem Gewerbe als »Geber« bekannt – und nun tat er sein Bestes, um die Menge beim Glücksspiel »Three Card Monte« um ihr Geld zu erleichtern.
Der Geber wurde von einem Team von Halsabschneidern unterstützt: den »Lockvögeln«, die in regelmäßigen Abständen getürkte Spiele gewannen, um die Hoffnung der Opfer auf eine eigene Glückssträhne aufrechtzuerhalten. Dem »Aufpasser«, der Schmiere stand. Dem »Schläger«, der Störenfriede und protestierende Verlierer zum Schweigen brachte. Den beiden »Fängern«, deren Aufgabe darin bestand, für einen ständigen Nachschub an Ahnungslosen zu sorgen, die sich auf ein Kartenspiel einließen, das sie niemals gewinnen konnten.
Die Frau, die das Treiben von der anderen Straßenseite aus beobachtete, kannte nur den Geber. Seine Bande kannte sie nicht, hatte aber nach dem ersten Eindruck keine allzu hohe Meinung von ihr. Nun trat sie näher und beobachtete, wie die Menge abwechselnd jubelte und aufstöhnte, als Wetten gewonnen oder verloren wurden. Die Frau hatte ihre Laufbahn als Lockvogel für einen der besten Geber des Landes begonnen, der fast überall seinen Tisch aufstellen konnte, um eine Stunde später mit mindestens zwei Riesen in der Tasche abzuziehen, ohne dass seine Opfer auch nur ahnten, dass sie keiner Pechsträhne, sondern einem Ganoven zum Opfer gefallen waren.
Der Geber, den die Frau nun beobachtete, war ein Könner, und das aus gutem Grund: Er war von demselben Mann ausgebildet worden wie sie selbst. Wie die Frau mit kundigem Blick erkannte, benutzte er die Doppelkarten-Technik mit der vorn liegenden Dame, bei der im kritischen Moment des Gebens die hintere Karte die Dame ersetzen würde – das war der Schlüssel zum Gewinn.
Das Three Card Monte basierte auf dem Hütchenspiel, nur ging es hier darum, die Dame aus den drei Karten auf dem Tisch zu finden, nachdem der Geber sie mit verwirrender Geschwindigkeit gemischt und ausgelegt hatte. Nur war die Dame unmöglich zu finden, weil sie gar nicht auf dem Tisch lag: Einen Sekundenbruchteil, ehe die vermeintlich »richtige« Lage der Dame offengelegt wurde, tauschte der Geber sie mit flinken Fingern gegen eine andere Karte aus. Seit es Kartenspiele gab, hatte man mit dieser simplen Bauernfängerei ahnungslosen Opfern das Geld aus der Tasche gezogen.
Die Frau glitt hinter einen Müllcontainer, suchte Blickkontakt mit ihrer Komplizin, die in der Menge stand, nickte unmerklich in Richtung des Aufpassers und setzte sich dann eine große, gespiegelte Sonnenbrille auf. Einen Moment später wurde die Aufmerksamkeit des Aufpassers von einer Spielerin im Minirock abgelenkt, die sich direkt vor ihm bückte, um eine heruntergefallene Münze aufzuheben, wobei sie dem Aufpasser einen Blick auf ihren festen Hintern und den roten Stringtanga bot, der kaum ausreichte, selbigen zu verbergen. Der Aufpasser glaubte zweifellos, unheimliches Glück gehabt zu haben, doch genau wie beim Three Card Monte spielte Glück die geringste Rolle: Die Frau trug den Rock nur zum Zweck der Ablenkung – eine sehr simple Technik, die bei Männern jedoch funktionierte, seitdem Frauen Kleidung trugen.
Vier schnelle Schritte, und die Frau mit der Sonnenbrille stand mitten unter den Betrügern. Sie bewegte sich so selbstsicher und energisch, dass die Menge ihr den Weg freimachte, während der überrumpelte Aufpasser hilflos zuschaute.
»Okay!«, rief sie und hielt ihren Ausweis hoch. »Ich will Ihre Papiere sehen!« Sie zeigte mit dem Finger auf den Geber, einen kleinen, untersetzten Mann mittleren Alters mit einem schwarzen Bärtchen, hellgrünen Augen und den flinksten Händen im ganzen Staat. Er betrachtete die Frau unter seiner Baseball-Kappe, während er langsam in seine Jacke griff und eine Brieftasche herausholte.
»Okay, Leute, die Party ist zu Ende«, rief die Frau und öffnete ihr Jackett, sodass jeder die silberne Marke sehen konnte, die an ihrem Gürtel befestigt war. Die Menge stob auseinander, ohne es auf einen Streit um das verlorene Geld ankommen zu lassen. Auch das Mädchen im Minirock huschte davon.
Die Frau mit der Sonnenbrille war Mitte dreißig, groß und breitschultrig, mit schlanken Hüften und langem rotem Haar. Sie trug schwarze Jeans, einen grünen Rollkragenpulli und eine kurze Lederjacke. Jedes Mal, wenn sie sprach, straffte sich ein langer Muskel an ihrem Hals. Eine kleine, stumpfe Narbe in der Form eines Angelhakens befand sich dicht unter ihrem rechten Auge, wurde jetzt aber von der Sonnenbrille verborgen.
Sie hatte bereits bemerkt, dass die Wetteinsätze auf dem Tisch in dem Moment verschwunden waren, in dem sie »Okay« gerufen hatte. Die Frau wusste genau, wo das Geld geblieben war: Der Geber hatte blitzschnell auf die Situation reagiert und sich das geschnappt, worauf es ankam: die Geldscheine.
Die Frau überprüfte den Ausweis des Gebers, gab ihn dann zurück und befahl dem Mann, sich mit dem Gesicht an die Mauer zu stellen, damit sie ihn abtasten konnte. »Umdrehen«, sagte sie, als sie fertig war. Dann nahm sie eine Karte vom Tisch und hielt sie hoch, damit der Geber sie sehen konnte: Es war die schwarze Dame. »Ich hab gewonnen«, sagte die Frau.
Der Geber blickte seelenruhig auf die Karte. »Seit wann kümmern Cops sich um ein harmloses Glücksspiel?«
Die Frau legte die Karte auf den Tisch zurück. »Wie gut, dass Ihre Opfer nicht gewusst haben, mit wie viel ›Glück‹ dieses Glücksspiel zu tun hat. Vielleicht sollte ich ein paar von denen aufklären, damit sie zurückkommen und Ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln.«
Der Geber seufzte. »Okay, Sie haben gewonnen, Officer …?«
Statt dem Mann ihren Namen zu nennen, legte die Frau ihre Dienstmarke und den Ausweis auf den Tisch. Der Geber spähte neugierig darauf.
»Nur zu«, sagte die Frau. »Ich habe keine Geheimnisse.«
Zögernd griff der Mann nach den Gegenständen und riss die Augen auf: Der Ausweis erwies sich als Payback-Karte, und die Dienstmarke war aus Blech und trug die Prägung einer deutschen Brauerei.
Die Augen des Gebers wurden noch größer, als die Frau die Sonnenbrille abnahm. Er erkannte sie auf den ersten Blick. »Annabelle!«
»Leo, Leo, was ist aus dir geworden«, sagte Annabelle Conroy kopfschüttelnd. »Wieso ziehst du in einer so beschissenen Stadt mit einem Haufen solcher Verlierer die Monte-Nummer ab?«
Leo Richter zuckte mit den Achseln, grinste aber breit. »Die Zeiten sind hart. Und die Jungs sind okay … noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber sie lernen.«
»Auf jeden Fall haben sie schon gelernt, wie man seinen Boss im Stich lässt«, sagte Annabelle verächtlich.
»Ach, die sind schon in Ordnung«, entgegnete Leo. »Und das Monte hat noch immer seinen Mann ernährt.« Er wedelte mit den Geldscheinen, steckte sie wieder in die Gesäßtasche und kicherte. »Annabelle, die kleine Würfelkönigin, gibt sich als Cop aus!«
»Ich habe mit keinem Wort behauptet, Polizistin zu sein, Leo. Die Leute haben es bloß angenommen. Das ist ja gerade der Trick. Wenn du es clever genug anstellst, halten die Leute dich für Gott weiß was. Wo wir gerade davon sprechen … versuchst du etwa, einen Cop zu bestechen?«
»Nach meiner bescheidenen Erfahrung funktioniert das öfter, als es misslingt«, sagte Leo, fischte eine Zigarette aus einer Packung in seiner Hemdtasche und bot Annabelle eine an. Sie lehnte ab.
»Wie viel machst du so am Tag?«, fragte sie.
Leo warf ihr einen argwöhnischen Blick zu, während er seine Winston anzündete. Dann nahm er einen Zug und blies den Rauch durch die Nase. Es sah aus wie Miniaturnachbildungen der fetten Wolken, die über ihnen aus den Schornsteinen quollen. »Tut mir leid, der Kuchen ist schon aufgeteilt. Ich muss mich um meine Angestellten kümmern.«
»Angestellte? Zahlst du für diese Penner Sozialabgaben, oder was? Außerdem hab ich mit Monte nichts am Hut, Leo«, fügte sie hinzu, ehe er antworten konnte. »Also, wie viel? Ich frage aus einem bestimmten Grund.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich wartend gegen die Mauer.
Leo zuckte mit den Achseln. »Normalerweise arbeiten wir in einer Schicht an sechs verschiedenen Stellen jeweils eine Stunde. An einem guten Tag machen wir zwei- bis dreitausend. Hier gibt’s viele Gewerkschaftsfritzen, die Schwarzgeld übrig haben, das sie auf den Kopf hauen können. Aber die Jungs und ich ziehen demnächst weiter. Hier gibt es bald Massenentlassungen. Außerdem wollen wir nicht, dass die Leute sich allzu gut an unsere Gesichter erinnern.«
»Wie viel bleibt dir von den Nettoeinnahmen?«, fragte Annabelle.
»Sechzig Prozent. Die Kosten sind hoch heutzutage. Ich habe bis jetzt um die dreißig Riesen gespart und will das bis zum Winter verdoppeln. Damit komme ich dann ein Weilchen über die Runden.«
»Ein sehr kurzes Weilchen, wie ich dich kenne.« Annabelle Conroy steckte die Biermarke und die Payback-Karte ein. »Bist du an großem Geld interessiert?«
»Als du mir diese Frage das letzte Mal gestellt hast, hat man auf mich geschossen.«
»Man hat auf uns geschossen, weil du zu gierig wurdest.«
Jetzt lächelte keiner mehr.
»Worum geht’s?«, fragte Leo.
»Das sag ich dir, nachdem wir ein paar kleinere Dinger gedreht haben, um uns Kapital zu beschaffen. Für die ganz große Nummer brauche ich Knete.«
»Die ganz große Nummer, aha. Wer ist denn da noch scharf drauf?«
Sie neigte den Kopf und sah auf ihn hinunter. In den hochhackigen Stiefeln war sie fast eins achtzig groß. »Ich. Ich hab damit nie aufgehört.«
Leo musterte ihr langes rotes Haar. »Warst du nicht brünett, als ich dich das letzte Mal gesehen habe?«
»Ich bin immer das, was ich gerade sein muss.«
Er grinste wieder. »Die gute alte Annabelle.«
Ihr Blick wurde hart. »Was ist jetzt? Bist du dabei?«
»Und das Risiko?«
»Ist hoch. Der Gewinn aber auch.«
Mit ohrenzerfetzender Lautstärke heulte die Alarmanlage eines Autos los. Keiner der beiden zuckte auch nur zusammen. Ganoven, die in ihrer Liga spielten, durften nicht schreckhaft sein, sonst endeten sie schnell im Knast oder auf dem Friedhof.
Schließlich nickte Leo. »Okay, ich bin dabei. Was jetzt?«
»Jetzt trommeln wir ein paar Leute zusammen.«
»So eine richtige All-Star-Truppe?« Bei dieser Aussicht glänzten Leos Augen.
»Für das ganz große Ding sind nur die Besten gut genug.« Sie hob die schwarze Dame auf. »Da, ich hab schon wieder gewonnen! Mein Gewinn ist ein Abendessen.«
»Ich fürchte, in dieser Gegend gibt’s nur Hamburger aus Gammelfleisch«, sagte Leo.
»Okay, dann essen wir in Los Angeles. Wir fliegen in drei Stunden.«
»Was? Ich habe nicht mal gepackt! Und ich hab kein Ticket.«
»In deiner linken Jackentasche. Ich hab’s reingeschoben, als ich dich abgetastet habe.« Sie warf einen Blick auf seinen Schmerbauch und runzelte die Stirn. »Du hast kräftig zugelegt, Leo.«
Annabelle drehte sich um und ging davon, noch während Leo in seiner Tasche kramte und den Flugschein entdeckte. Er schnappte sich seine Spielkarten und lief hinter ihr her. Den Tisch ließ er einfach stehen.
Das Three Card Monte hatte jetzt erst mal Pause. Das ganz große Ding rief.
KAPITEL 3
Beim Abendessen in L. A. legte Annabelle in groben Zügen ihre Pläne für die nächsten Tage dar und vertraute Leo an, wer die beiden anderen Beteiligten an dem Coup sein sollten.
»Klingt gut, aber wie soll die ganz große Nummer denn nun aussehen? Du hast noch kein Wort darüber gesagt.«
»Eins nach dem anderen«, erwiderte Annabelle, die an diesem Abend das Kleine Schwarze trug und in Leos Augen richtig schnuckelig aussah. Nun drehte sie das Weinglas in der Hand und ließ gewohnheitsmäßig den Blick durch das Nobelrestaurant schweifen, um Dummköpfe auszuspähen. Früher oder später fand sich immer ein Trottel, den man abzocken konnte.
Mit einem Ruck warf Annabelle das rotgefärbte Haar zurück und stellte Blickkontakt zu einem Kerl her, der drei Tische entfernt saß. Schon seit einer Stunde verschlang der Bursche sie mit Blicken und gab ihr ganz offen Zeichen, während seine unverhohlen gedemütigte Begleiterin stumm vor sich hin schäumte. Wieder leckte der Bursche sich die Lippen und zwinkerte Annabelle zu.
Oh nein, du Penner, du hast nicht den Hauch einer Chance.
Leo unterbrach ihre Gedanken. »Hör zu, Annabelle, ich bau keinen Scheiß. Mensch, ich bin doch extra mit dir nach L. A. geflogen!«
»Ja, auf meine Kosten.«
»Wir sind Partner, du kannst mich ruhig einweihen. Ich bin verschwiegen.«
Sie musterte ihn, während sie den Cabernet austrank. »Lass gut sein, Leo. Nicht mal du bist ein so überzeugender Lügner.«
Ein Kellner kam und reichte Annabelle eine Visitenkarte. »Von dem Gentleman da drüben«, sagte er und zeigte diskret auf den Mann, der sie andauernd angaffte.
Annabelle nahm die Karte. Darauf stand, dass der Bursche »Agent« war – Talentsucher. Zuvorkommend hatte er auf der Rückseite des Kärtchens handschriftlich eine bestimmte Sexualpraktik vermerkt, die er mit Annabelle auszuüben gedachte.
Na schön, du Talentsucher. Du willst es nicht anders.
Annabelle ging zu einem Tisch, den fünf stämmige Zeitgenossen in Nadelstreifenanzügen belegten. Sie sagte etwas, worauf alle lachten. Einem von ihnen tätschelte sie den Schopf, einem anderen – ein Kerl von ungefähr vierzig Jahren mit grauen Schläfen und breiten Schultern – gab sie einen Schmatz auf die Wange. Wieder sagte sie etwas, und wieder lachten alle. Dann setzte sie sich zu den Männern und sprach ein paar Augenblicke mit ihnen. Neugierig beobachtete Leo sie. Schließlich verließ Annabelle den Tisch, winkte Leo und ging zum Ausgang.
»He, Süße«, quatschte der Talentsucher sie an, als sie an seinem Tisch vorbeikam. »Rufen Sie mich an, ja? Sie sind eine so heiße Braut, dass ich jetzt schon in Flammen stehe.«
Vom Tablett eines vorübergehenden Kellners griff Annabelle sich ein Glas Wasser. »Dann ist es ja höchste Zeit zum Löschen, Freundchen«, sagte sie und schüttete ihm das Wasser auf den Schoß.
Er sprang auf. »Verflucht! Das wirst du mir büßen, du Schlampe!«
Seine Begleiterin hielt sich eine Hand vor den Mund, um ihre Erheiterung zu verbergen.
Ehe der Mann nach Annabelle greifen konnte, packte sie zu und umklammerte sein Handgelenk. »Siehst du die Jungs da drüben?« Sie nickte hinüber zu den Nadelstreifenträgern, die den Mann feindselig anstarrten. Einer ließ die Fingerknöchel knacken. Ein anderer schob die Hand unter die Anzugjacke und ließ sie dort. »Bestimmt hast du gesehen, dass ich mit denen gesprochen habe«, sagte Annabelle, »denn du glotzt mich ja schon den ganzen Abend an. Weißt du, das ist die Familie Moscarelli. Und der da ist mein Exmann, Joey junior. Streng genommen gehöre ich zwar nicht mehr zur Familie, aber irgendwie bleibt man immer ein Teil der Moscarellis.«
»Moscarelli?«, wiederholte der Mann trotzig. »Zum Teufel, was sind das für welche?«
»Sie standen in Vegas an dritter Stelle der Mafia-Hierarchie, bis das FBI sie und andere Familien ausgehoben hat. Jetzt beschäftigen sie sich wieder mit dem, was sie am besten können: Sie kontrollieren im Big Apple und in Newark die Müllabfuhr.« Sie drückte dem Mann den Arm. »Also, wenn du ein Problem mit deiner feuchten Hose hast, wird Joey sich bestimmt darum kümmern.«
»Den Stuss soll ich glauben?«, maulte der Talentsucher.
»Wenn du’s nicht glaubst, dann sprich mit ihm.«
Der Mann sah nochmals hinüber zu dem Tisch. Joey junior hielt jetzt ein Steakmesser in der haarigen Pranke, während ein Tischnachbar ihn zu beschwichtigen versuchte. Annabelle packte das Handgelenk ihres Verehrers fester. »Oder soll ich Joey bitten, mit seinen Jungs an deinen Tisch zu kommen? Du brauchst keinen Bammel zu haben, er ist zurzeit auf Bewährung draußen, deshalb kann er dich nicht richtig durch die Mangel drehen.«
»Nein, nein …« Beunruhigt nahm der Talentsucher den Blick von Joey und seinem mörderischen Steakmesser. »Ich meine … es war ja nichts«, fügte er kleinlaut hinzu. »Ist ja bloß Wasser. So was kann doch passieren.« Er lehnte sich zurück und betupfte seinen Schoß mit der Serviette.
Annabelle wandte sich seiner Begleiterin zu, die vergeblich ihr Gekicher zu unterdrücken versuchte. »Findest du das komisch, Süße?«, fragte Annabelle. »Wir alle haben über dich gelacht, nicht mit dir. Du solltest lieber Selbstachtung finden, sonst sind solche miesen Schleimbeutel wie der hier die einzigen Stecher, neben denen du aufwachst, bis du so alt bist, dass dein Schicksal keinen mehr interessiert, nicht mal dich selbst.«
Der Frau blieb das Lachen im Hals stecken.
»Au Mann«, sagte Leo, als sie das Restaurant verließen, »da hab ich meine Zeit damit verplempert, Dale Carnegie zu lesen, dabei hätte ich bloß mit dir abhängen müssen.«
»Lass gut sein, Leo.«
»Okay, aber was war das für ’ne Nummer? Moscarelli-Familie? Wer waren die Figuren wirklich?«
»Fünf geile Buchhalter aus Cincinnati, die heute Abend versuchen werden, irgendwelche Schnallen ins Bett zu kriegen.«
»Du hast Glück gehabt, dass sie solchen Kampfgeist hatten.«
»Mit Glück hatte das nichts zu tun. Ich habe denen weisgemacht, ich wollte mit einem Bekannten in der Öffentlichkeit eine Filmszene proben, so was käme in L. A. ständig vor. Also habe ich sie gebeten, sie sollten sich wie Mafiosi benehmen, um uns die passende Atmosphäre für die Szene zu liefern. Wären sie überzeugend genug, könnten sie vielleicht einen Auftritt im Film kriegen. Wahrscheinlich war es das aufregendste Erlebnis, das sie je hatten.«
»Na gut, aber woher wusstest du, dass der Typ dich tatsächlich anbaggert?«
»Es war bestimmt keine Brechstange, was er da in der Hose hatte. Oder glaubst du, ich hätte ihm das Wasser aus Vergnügen auf den Schoß gekippt?«
Am nächsten Tag fuhren Annabelle und Leo in einem Mietwagen, einem dunkelblauen Lincoln, in Beverly Hills den Wilshire Boulevard entlang. Aufmerksam betrachtete Leo die Ladengeschäfte, an denen sie vorbeikamen. »Woher hast du den Tipp gekriegt?«
»Die üblichen Quellen. Er ist jung und hat in der Szene kaum Erfahrung, aber ich hab’s wegen seiner Spezialität auf ihn abgesehen.« Annabelle lenkte den Wagen auf einen Parkplatz und zeigte auf ein Geschäft. »Da ist der Schuppen, wo unser Ladenschwengel die Kundschaft bescheißt.«
»Was ist er für ein Typ?«
»Sehr metrosexuell.«
Ratlos sah Leo sie an. »Metrosexuell? Was ist denn das? Steht er auf U-Bahnen, oder was?«
»Du solltest häufiger unter die Leute gehen, Leo, und mehr Zeit am Computer verbringen.«
Gleich darauf führte Annabelle ihn in eine teure Kleiderboutique. Begrüßt wurden sie von einem sehnigen, gut aussehenden jungen Mann in schickem Schwarz. Er hatte blondes, glatt nach hinten gekämmtes Haar und fesche Eintagesstoppeln am Kinn.
»Arbeiten Sie hier ganz allein?«, fragte Annabelle, während sie die offenbar gut betuchten Kundinnen des Ladens musterte. Die Frauen mussten wohlhabend sein, denn die Schuhe hier kosteten von tausend Dollar aufwärts. Wer sie bezahlen konnte, durfte dafür auf Zehnzentimeterabsätzen umherstelzen, bis die Achillessehne riss.
Der junge Mann nickte. »Ja, und ich arbeite gern in diesem Geschäft. Dienstleistung macht mir Spaß.«
»Na klar«, sagte Annabelle halblaut.
Sobald sämtliche anderen Kundinnen gegangen waren, hängte Annabelle unbemerkt das Geschlossen-Schild an die Tür. Leo brachte eine Damenbluse zur Kasse, während Annabelle ins hintere Umfeld der Ladentheke schlenderte. Leo gab dem Verkäufer seine Kreditkarte. Sie rutschte dem jungen Mann aus der Hand, sodass er sich bückte, um sie aufzuheben. Kaum hatte er sich aufgerichtet, stand Annabelle schon hinter ihm. »Ein hübsches kleines Spielzeug haben Sie da«, sagte sie und betrachtete den winzigen Apparat, durch den der Angestellte gerade Leos Kreditkarte zog.
»Verzeihung, Ma’am, aber hinter die Ladentheke haben Sie keinen Zutritt«, sagte er gereizt.
Annabelle achtete nicht auf seine Bemerkung. »Haben Sie das selber gebastelt?«
»Es ist ein Prüfgerät«, entgegnete der Verkäufer indigniert. »Damit checken wir Kreditkarten auf ihre Gültigkeit. Es untersucht sie auf verschlüsselte Codes. Früher hatten wir viel Ärger mit gestohlenen Kreditkarten, deshalb hat der Inhaber uns angewiesen, so ein Gerät zu benutzen. Ich tue es möglichst unauffällig, damit niemand in Verlegenheit kommt. Sicher haben Sie Verständnis dafür.«
»Oh, das ist mir alles vollkommen verständlich, Tony.« Annabelle langte an dem Angestellten vorbei und nahm den kleinen Apparat in die Hand. »Dieses Ding liest Name, Kontonummer und Geheimzahl, damit Sie die Karte fälschen können, nicht wahr, Tony?«
»Oder Sie verscherbeln die Daten an einen Kartenfälscherring, was wahrscheinlicher ist«, sagte Leo. »Auf diese Weise machen Sie sich Ihre metrosexuellen Händchen nicht so schmutzig. Stimmt’s, Tony?«
Tony starrte sie nacheinander an. »Woher kennen Sie meinen Namen? Sind Sie Bullen?«
»Oh nein, viel besser.« Annabelle legte ihm einen Arm um die schmalen Schultern. »Wir sind genau solche Halsabschneider, wie Sie einer sind.«
Zwei Stunden später spazierten Annabelle und Leo im Hafen von Santa Monica die Uferstraße entlang. Der Tag war sonnig und wolkenlos, und die leichte Brise, die vom Meer kam, wehte einen Schwall köstlich lauer Luft landeinwärts. Leo wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn, zog die Jacke aus und legte sie über den Arm.
»Verdammt noch mal, ich hatte schon vergessen, wie nett es hier ist.«
»Herrliches Wetter und die reichsten Opfer der Welt«, sagte Annabelle. »Eben darum sind wir hier. Denn wo die reichsten Trottel sind …«
»Da sind auch die tüchtigsten Abzocker nicht weit«, vollendete Leo.
Annabelle nickte. »Okay, das ist er: Freddy Driscoll, Kronprinz der Urkundenfälschung.«
Leo spähte voraus und las, indem er in die Sonne blinzelte, das kleine Schild über dem Verkaufsstand. »Designer Heaven?«
»Genau. Mach es so, wie ich gesagt habe.«
»Wie könnte ich es jemals anders machen als so, wie du es gesagt hast?«
Auf den Tischen des Verkaufsstands lagen ordentlich aufgestapelt Jeans, Designerhandtaschen, Uhren und sonstige Accessoires. Der Inhaber, ein älterer Mann von kleiner, pummeliger Statur, grüßte höflich. Er hatte ein freundliches Gesicht, und unter seinem Strohhut ragten Büschel weißen Haars hervor.
»Hui, das sind ja supergünstige Preise«, äußerte Leo, während er sich ein paar Sachen anschaute.
Der Mann grinste stolz. »Ich betreibe keinen solchen Aufwand wie die Luxusboutiquen, sondern gebe mich mit Sonne, Sand und Meer zufrieden.«
Annabelle und Leo kramten in den Waren und suchten ein paar Sachen aus. Zwecks Bezahlung reichte Annabelle dem Mann einen Hundertdollarschein.
Er nahm den Geldschein, setzte eine dicke Brille auf, besah sich den Schein aus einem bestimmten Winkel und gab ihn Annabelle zurück. »Tut mir sehr leid, Madam, aber der Lappen ist falsch.«
»Ganz recht«, bestätigte Annabelle seelenruhig. »Weil ich es für angebracht hielt, gefälschte Produkte mit Falschgeld zu bezahlen.« Der Mann zuckte mit keiner Wimper, lächelte sie nur gutmütig an. Nun betrachtete Annabelle den Flunkerkies aus dem gleichen Blickwinkel. »Das Problem ist, dass selbst der beste Fälscher das Hologramm von Benjamin Franklin nicht hundertprozentig hinkriegt. Aus diesem Blickwinkel erkennt man die Mängel. Für eine perfekte Fälschung bräuchte man eine zweihundert Millionen Dollar teure Druckerei. So eine gibt es in den Vereinigten Staaten nur einmal, und da kommt man als Fälscher nicht so schnell rein.«
»Also nimmt man einen Wachsstift«, ergriff Leo das Wort, »und fertigt eine hübsche Zeichnung unseres guten alten Benjamin an. Dann erblickt jeder, der wenigstens so schlau ist, sich den Schein ein bisschen genauer anzusehen, ein Aufblinken und glaubt, er hätte das Hologramm gesehen, obwohl gar keins da ist.«
»Aber Sie haben den Unterschied erkannt«, sagte Annabelle. »Sie haben solche Lappen nämlich selbst schon in nahezu meisterhafter Qualität fabriziert.« Sie hob eine Jeans hoch. »Ich würde Ihren Lieferanten mitteilen, sie sollten sich die Zeit nehmen, den Markennamen auf den Reißverschluss zu stempeln, so wie’s beim echten Produzenten geschieht.« Sie legte die Jeans weg und zeigte eine Handtasche vor. »Und hier muss der Gurt doppelt genäht werden. Auch das ist verräterisch.«
Leo hob eine Uhr in die Höhe. »Und eine richtige Rolex geht lautlos, die tickt nicht wie ’ne Zeitbombe.«
»Ehrlich, ich bin erschüttert«, sagte der Mann, »das Opfer von Produktpiraten geworden zu sein. Vor ein paar Minuten habe ich weiter unten am Pier einen Polizeibeamten gesehen. Ich geh ihn holen. Bitte bleiben Sie hier, bestimmt will er Ihre Aussagen zu Protokoll nehmen.«
Mit ihren langen, geschmeidigen Fingern fasste Annabelle ihn am Arm. »Sparen Sie sich die Ausreden. Wir müssen reden.«
»Worüber?«, fragte der Mann mit merklicher Vorsicht.
»Wie wir zwei kleine und dann das ganz große Ding drehen«, antwortete Leo. Sofort sah er in den Augen seines Gegenübers ein Funkeln.
KAPITEL 4
Über den Konferenztisch hinweg musterte Roger Seagraves den Mäusemann und das klägliche Dutzend Strähnen fettigen schwarzen Haars, das er sich vergebens über die schuppige Kopfhaut des klobigen Schädels gekämmt hatte. Obendrein hatte der Mann eine Hühnerbrust und dünne Beine, dafür jede Menge Fett an Bauch und Gesäß. Obwohl erst knapp über vierzig, hätte es ihn vermutlich unsägliche Mühe gekostet, weiter als zwanzig Meter zu laufen, ohne einen Kreislaufkollaps zu erleiden. Wahrscheinlich trieb ihn schon das Hochheben einer Einkaufstasche an den Rand der Erschöpfung. Er hätte, so lautete Seagraves’ Überzeugung, als Musterbeispiel für den körperlichen Verfall des gesamten männlichen Teils der Menschheit im einundzwanzigsten Jahrhundert dienen können. Sein Anblick erzürnte Seagraves, weil in seinem Leben der Sport und die Fitness stets eine große Rolle gespielt hatten.
Noch heute joggte er jeden Tag zehn Kilometer, ehe die Sonne ganz am Himmel stand. Noch immer war er zu einhändigen Liegestützen fähig und konnte das Doppelte seines Körpergewichts stemmen. Vier Minuten lang konnte er unter Wasser die Luft anhalten, und gelegentlich trainierte er an seinem Wohnsitz in der westlichen Fairfax County mit der Football-Mannschaft der örtlichen High School. Kein über Vierzigjähriger war imstande, sportlich mit siebzehnjährigen Burschen mitzuhalten, doch Seagraves blieb nie weit hinter ihnen zurück. In seinem früheren Job hatten alle diese Fähigkeiten einem einzigen Zweck gedient: sein Überleben zu sichern.
Nun richtete er die Aufmerksamkeit wieder auf den Mann, der ihm am Tisch gegenübersaß. Jedes Mal, wenn er dieses Mäuschen sah, verspürte er den Wunsch, ihm eine Kugel ihn den Kopf zu jagen und ihn aus seinem lethargischen Elend zu erlösen. Aber kein vernünftiger Mensch erschoss seine Goldene Gans oder vielmehr, wie in diesem Fall, seine Goldene Maus. Egal wie viel Seagraves an der Physis seines Komplizen auszusetzen haben mochte, er brauchte den Mann.
Diese Kreatur hieß Albert Trent. Sein missratener Körper beherbergte ein fähiges Hirn, das musste Seagraves ihm zugestehen. Ein bedeutsamer Bestandteil ihres Projekts, das vielleicht sogar wesentlichste Detail, ging auf eine Idee Trents zurück. Deshalb arbeitete Seagraves mit ihm zusammen, mehr als aus jedem anderen Grund.
Eine Zeitlang unterhielten die beiden Männer sich über die bevorstehende Befragung von CIA-Vertretern durch das Committee of Intelligence, dem Geheimdienstausschuss, dem Albert Trent als wichtiges Mitglied angehörte. Anschließend besprachen sie eine Reihe wichtiger Informationen, die von der CIA in Langley und anderen Einrichtungen des riesigen Geheimdienstapparats der US-Regierung gesammelt worden waren. Sie observierten aus dem All, lauschten am Telefon, spionierten Fax und E-Mail aus und guckten den Menschen manchmal geradewegs über die Schulter.
Nachdem sie alles erörtert hatten, lehnten die beiden Männer sich zurück und tranken lauwarmen Kaffee. Einen Bürokraten, der eine anständige Tasse Kaffee zubereiten konnte, musste Seagraves erst noch finden. Vielleicht lag es am hiesigen Wasser.
»Der Wind wird stärker«, sagte Trent, dessen Blick auf der Kladde ruhte, die vor ihm lag. Er strich sich auf dem Wanst den roten Schlips glatt und schabte sich an der Nase.
Seagraves schaute zum Fenster hinaus. Von nun an war es Zeit für verschlüsselte Formulierungen – für den Fall, dass irgendjemand mithörte. Heutzutage war man nirgends vor Lauschern sicher, am wenigsten auf dem Capitol Hill. »Eine Kaltluftfront kommt, ich habe es in den Nachrichten gesehen. Vielleicht gibt’s Regen, vielleicht auch nicht.«
»Ich habe gehört, es soll ein Gewitter geben.«
Seagraves spitzte die Ohren. Das Stichwort »Gewitter« fand stets seine höchste Beachtung. Bob Bradley, ehedem Sprecher des Abgeordnetenhauses, war so ein »Gewitter« gewesen. Jetzt lag er im heimatlichen Kansas unter der Erde, und ein Haufen verwelkter Blumen garnierte sein Grab.
Seagraves lachte laut auf. »Sie wissen ja, was man vom Wetter sagt: Alle reden darüber, aber niemand tut was dagegen.«
Auch Trent lachte. »Für meine Begriffe sieht alles ganz gut aus. Wir wissen die ständige Kooperationsbereitschaft der CIA wirklich zu schätzen.«
»Es geschieht aus Pflicht und Schuldigkeit.«
Trent nickte. »Der neue Vorsitzende des Ausschusses weiß, wie man sich an die Regeln hält. Er hat schon eine Unterschriftensammlung gestartet, um die Anhörung zu beenden.«
»Wir stehen im Krieg gegen den Terrorismus – eine völlig neuartige Herausforderung. Die Feinde unserer Nation lauern überall. Danach müssen wir handeln. Wir müssen sie erledigen, ehe sie uns erwischen.«
»Ganz genau«, pflichtete Trent bei. »Es ist eine neue Ära und eine neue Art der Auseinandersetzung. Alles ist völlig legal.«
»Versteht sich von selbst.« Seagraves unterdrückte ein Gähnen. Er hoffte, dass der Lauscher – falls es einen gab – seine Freude an diesem patriotischen Gesülze hatte. Er interessierte sich längst nicht mehr für sein Heimatland; so wenig wie für irgendein anderes Land. Er kümmerte sich nur noch um sich selbst, den Einmann-Freistaat Roger Seagraves, und das mit großem Erfolg, denn er besaß die nötigen Fähigkeiten, den Schneid und den Zugang zu Wissen von enormem Wert. »Tja, wenn wir mit allem durch sind, mach ich mich auf die Socken. Um diese Tageszeit ist mit Staus zu rechnen.«
Trent tippte auf die Kladde. »Damit muss man immer rechnen.«
Mit einem Blick streifte Seagraves die Kladde, die er Trent ausgehändigt hatte; dann nahm er den Schnellhefter, den sein Kumpan ihm zuschob. Darin befanden sich Rückfragen, die zusätzliche Informationen zu gewissen Observationspraktiken der CIA betrafen. In der dicken Kladde gab es nichts Aufregenderes zu lesen als eine der beispiellos langweiligen, übermäßig komplizierten Analysen, die seine Behörde dem Geheimdienstausschuss routinemäßig vorlegte. Diese Berichte waren Meisterwerke der Kunst, mit einer Million Wörtern rein gar nichts zu sagen.
Doch wenn man den Code kannte und die Möglichkeit hatte, buchstäblich zwischen den Zeilen zu lesen – und das würde Trent noch am heutigen Abend tun, wie Seagraves wusste –, offenbarten die Seiten der Kladde noch etwas anderes: die Namen von vier sehr aktiven amerikanischen Undercoveragenten und ihre gegenwärtigen überseeischen Aufenthaltsorte in verschlüsselter Form. Diese Namen und Anschriften waren schon an finanziell bestens ausgestattete Terror-Organisationen verkauft worden, die nun in drei Ländern des Nahen Ostens und Asiens den Agenten die Türen eintreten und ihnen den Kopf abreißen würden. Zwei Millionen US-Dollar pro Namen waren inzwischen auf ein Konto überwiesen worden, das kein amerikanischer Steuerprüfer jemals zu sehen bekam. Trent fiel die Aufgabe zu, die Namen längs der Nahrungskette nach unten weiterzureichen.
Seagraves’ Geschäft boomte. Während Amerikas Feinde weltweit an Zahl zunahmen, verkaufte er Geheimnisse an moslemische Terroristen, südamerikanische Kommunisten, asiatische Diktatoren und sogar an Mitglieder der Europäischen Union.
»Tolle Lektüre«, sagte Trent. Er bezog sich mit dieser Bemerkung auf den Schnellhefter, den er Seagraves hingeschoben hatte. Dem darin enthaltenen Text konnte Seagraves die verschlüsselte Identität des neuen »Gewitters« sowie das dazugehörige Warum und Wieso entnehmen.
Am späteren Abend sah Seagraves sich daheim den Namen an und machte sich in seiner gewohnt systematischen Art und Weise daran, die Liquidierung des »Gewitters« zu planen. Allerdings musste in diesem Fall sehr viel feinsinniger vorgegangen werden als mit einem Scharfschützengewehr. Zum Glück hatte Trent erstklassige Arbeit geleistet und über die Zielperson eine Information beschafft, die die Angelegenheit sehr erleichterte. Seagraves wusste genau, wen er anrufen musste.
KAPITEL 5
Pünktlich um sechs Uhr dreißig an einem klaren, kühlen Morgen in Washington, D.C., öffnete sich die Vordertür von Jonathan DeHavens dreistöckigem Wohnhaus, und er trat in grauem Tweedjackett, hellblauem Schlips und schwarzer Hose heraus. DeHaven, ein großer, hagerer Mann Mitte fünfzig mit einem sorgsam gekämmten Schopf silbergrauen Haars, atmete tief die erfrischende Morgenluft und betrachtete einige Augenblicke lang die prachtvollen alten Herrenhäuser, die sich an der Straße reihten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!