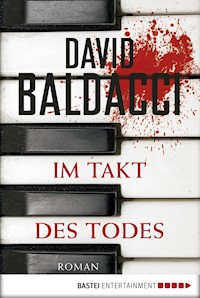9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein weiterer Bestseller aus der Feder des Starautors David Baldacci
Rufus Harms büßt seit 25 Jahren im Militärgefängnis von Fort Jackson für ein schreckliches Verbrechen, dem Mord an einem kleinen Mädchen. Doch da erhält er einen Brief der US Army, aus dem zweifelsfrei hervorgeht, daß in Wahrheit andere für das Vergehen verantwortlich sind.
Rufus setzt alles daran, Gerechtigkeit zu finden. Aber die wahren Täter sitzen in der einzigen Institution, die ihm dazu verhelfen könnte. Und die Drahtzieher wissen bereits, daß Rufus die Wahrheit kennt.
David Baldacci hat mit "Die Wahrheit" einen packenden Roman über Schuld und Gerechtigkeit geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
DANKSAGUNG
ZITAT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
David Baldacci
DIEWAHRHEIT
Aus dem Amerikanischen vonUwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der Originalausgabe: THE SIMPLE TRUTH
© 1998 by Columbus Rose, Ltd.
© für die deutschsprachige Ausgabe: 1999 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln,
unter Verwendung zweier Fotos von Image Bank
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1711-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Michelle
Die schlichte Wahrheit ist:Ohne dich werde ich mit dem Leben nicht fertig.
Auch dem liebevollen Andenken anBrenda Gayle Jennings, einem ganz besonderen Kind,soll dieses Buch gewidmet sein.
DANKSAGUNG
Jennifer Steinberg für die wieder einmal ausgezeichnete Recherche.
Lou Saccoccio für die kenntnisreiche Hilfe in Fragen des Militärrechts.
Steve Jannings für seine scharfsinnigen redaktionellen Kommentare.
Der Warner-Books-Familie – Larry, Maureen, Mel, Emi, Tina, Heather, Jackie J. und Jackie M. und all den anderen unglaublich netten und engagierten Menschen, die mein Leben so sehr bereichert haben.
Meiner Mutter, die mir die schöneren Stellen im südwestlichen Virginia gezeigt hat, eine Gegend, die sie ausgezeichnet kennt.
Karen Spiegel, die mich bei dieser Geschichte auf einem langen Weg begleitet hat.
Dem Anwalt Ed Vaughan, der mir einige der komplizierteren Aspekte erläutert hat, was die Gesetze und die gerichtliche Praxis in Virginia betrifft.
Allen weiteren Menschen, die mir behilflich waren, mich über eine faszinierende Institution schlau zu machen: den Obersten Gerichtshof der USA.
Meinem Freund und Agenten Aaron Priest, der mir – wie immer – zahlreiche wertvolle Ratschläge gab, als ich mich durch diesen Roman gearbeitet habe.
Frances Jalet-Miller, die sehr viel Zeit, Mühe und Kraft aufgewendet hat, mir dabei zu helfen, das gesamte Potenzial des Romans zu erkennen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft.
Die Wahrheit ist selten rein und niemals einfach.
Oscar Wilde
PROLOG
In diesem Gefängnis bestehen die Türen aus zolldickem Stahl. Fabrikneu kamen sie hierher, glänzend und glatt; nun aber sind sie von Dellen übersät. Menschliche Gesichter, Knie, Ellbogen, Zähne und Rückstände von Blut haben auf den grauen Oberflächen ihre Spuren hinterlassen. Knasthieroglyphen: Schmerz, Furcht, Tod – dies alles ist unauslöschlich auf diesen Türen verzeichnet, zumindest so lange, bis eine neue Metallplatte geliefert wird und alles von vorne beginnt.
In Augenhöhe sind viereckige Klappen in die Türen eingelassen. Die Wächter öffnen sie auf ihrem Rundgang und richten das grelle Licht von Taschenlampen auf das menschliche Vieh im Innern. Unvermittelt hämmern sie mit ihren Schlagstöcken gegen das Metall: Geräusche, die wie Gewehrschüsse klingen. Die Altgedienten sind daran gewöhnt; sie starren mit hintergründigem Trotz zu Boden oder blicken ins Leere – die Leere, die sie umgibt; die Leere ihres Lebens. Nicht, dass hier jemand Notiz davon nähme oder dass es jemandem etwas bedeuten würde. Die Neuen, die ›Rotärsche‹, verkrampfen sich noch ängstlich, wenn der Knall der Stockschläge ertönt oder das Licht aufflammt; einige machen sich in ihre Drillichhose und sehen zu, wie der Urin über ihre schwarzen Schuhe rinnt. Doch nach einiger Zeit kommen auch die Neuen darüber hinweg, und dann hämmern auch sie mit der Faust gegen die verdammte Tür, kämpfen die Bitterkeit und die Schuljungentränen nieder, die in ihnen aufsteigen. Wenn sie überleben wollen.
Nachts ist es in den Gefängniszellen so dunkel wie in einer Höhle, bis auf ein paar seltsame Schemen hier und da in der Finsternis. In dieser Nacht entlädt sich ein Gewitter über der Gegend. Wann immer Blitze vom Himmel zucken, peitschen sie grelles Licht durch die kleinen Plexiglasfenster in die Zellen hinein. Das Wabenmuster des Maschendrahts, der straff vor dieses Glas gespannt ist, wird bei jedem Blitz an die gegenüberliegende Zellenwand geworfen.
Jedes Mal wenn Licht in die Zelle zuckt, wird das Gesicht des Mannes aus dem Dunkel gerissen, als hätte es unvermittelt eine Wasseroberfläche durchbrochen. Anders als die anderen Häftlinge ist er allein in seiner Zelle, allein mit sich selbst und seinen Gedanken. Die anderen Gefangenen fürchten ihn, sogar die Wächter, obwohl sie bewaffnet sind; denn er ist ein Mann von beeindruckender Gestalt. Wenn er an den anderen Knastbrüdern – kaum weniger harten und gewalttätigen Männern – vorübergeht, wenden diese rasch den Blick ab.
Sein Name ist Rufus Harms, und hier, im Militärgefängnis von Fort Jackson, hat er den Ruf eines Zerstörers: Wer sich mit ihm anlegt, den zermalmt er. Nie macht er den ersten Schritt, aber stets den letzten. Fünfundzwanzig Jahre hinter Gittern haben einen schrecklichen Tribut von ihm gefordert. Wie die Altersringe im Holz eines Baumes bilden die Spuren von Narben auf seiner Haut und die schlecht verheilten Knochenbrüche eine Chronik der Jahre, die er hier verbracht hat. Doch viel schlimmer noch wurde das weiche Gewebe seines Hirns in Beeinträchtigung gezogen, jener Teil, in dem die Menschlichkeit wohnt: Erinnerungen, Gedanken, Liebe, Hass – alles besudelt, alles gegen ihn selbst gerichtet. Vor allem die Erinnerungen: ein kleiner Tumor aus Eisen im Hinterkopf, der gegen das Rückgrat drückt.
In seiner massigen Gestalt schlummert gewaltige Kraft. Man kann es an den langen, muskulösen Armen erkennen, den breiten, kompakten Schultern. Selbst seine Leibesfülle lässt außergewöhnliche Stärke erahnen. Und dennoch ist er wie eine unterhöhlte Eiche, deren herausgerissene Wurzeln keinen Grund finden; ein Baum, im Wachstum gekappt, dessen Äste, zum Teil schon tot oder im Absterben begriffen, auch durch Beschneiden nicht mehr zu retten sind. Er ist ein lebendes Paradox: ein sanfter Mann, der andere Menschen respektiert und treu an seinen Gott glaubt; zugleich aber trägt er unwiderruflich das Stigma eines grausamen Mörders. Deshalb wird er von den Wächtern und den anderen Gefangenen in Ruhe gelassen. Mehr wollte er auch gar nicht. Bis zu diesem Tag, als sein Bruder ihm etwas brachte. Einen Topf voller Gold am Ende des Regenbogens, ein Aufbranden der Hoffnung. Einen Weg, der hinausführt aus diesem Ort.
Ein weiterer Blitz reißt Harms’ Augen aus der Finsternis. Sie sind dunkelrot verfärbt, als wären sie blutunterlaufen – bis man die Tränen auf seinem dunklen, massigen Gesicht bemerkt. Als das Licht des Blitzes erlischt, glättet er das Blatt, darum bemüht, kein Geräusch zu machen, das eine Einladung an die Wächter wäre, in seiner Zelle herumzuschnüffeln. Die Beleuchtung im Gefängnis wurde bereits vor Stunden gelöscht; daran kann auch er nichts ändern. Wie schon seit einem Vierteljahrhundert wird für ihn die Dunkelheit erst mit der fahlen Helle des heraufdämmernden Morgens enden. Doch für Harms spielt es keine Rolle, ob seine Zelle hell oder dunkel ist. Er hat den Brief bereits gelesen, hat jedes Wort in sich aufgenommen. Jede Silbe schneidet wie die scharfe, kurze Klinge eines Springmessers. Am oberen Rand des Blattes befindet sich in Fettdruck das Emblem der Armee der Vereinigten Staaten. Er kennt es gut, sehr gut. Seit fast dreißig Jahren ist die Army sein Arbeitgeber, sein Wächter.
Und nun verlangt sie Informationen von Rufus Harms, einem gescheiterten, vergessenen Soldaten aus der Vietnam-Ära. Detaillierte Informationen. Informationen, die er nicht geben kann. Auch ohne Licht findet sein Finger das Ziel und berührt jene Stelle auf dem Blatt, die Erinnerungsfetzen an die Oberfläche bringt – Bruchstücke, die in seinem Innern treiben, seit er hier einsitzt, all die Jahre, als ein lähmender, nie enden wollender Albtraum. Doch das Kernstück seiner Erinnerungen schien niemals greifbar zu sein. Bis jetzt. Bis er den Brief zum ersten Mal gelesen hatte. Er hatte den Kopf so tief auf das Papier gesenkt, als wollte er mit Gewalt die verborgene Bedeutung der maschinengeschriebenen Kringel enthüllen, das größte Geheimnis seines irdischen Daseins lösen. An diesem Abend haben die verzerrten Bruchstücke und Fetzen sich mit einem Mal zu einer deutlichen Erinnerung zusammengefügt, zur Wahrheit. Endlich.
Bis Harms diesen Brief von der Army gelesen hatte, besaß er nur zwei klare Erinnerungen an jene Nacht vor fünfundzwanzig Jahren: das kleine Mädchen und den Regen. Es war ein schreckliches Unwetter gewesen, beinahe so schlimm wie in dieser Nacht. Die Gesichtszüge des Mädchens waren fein geschnitten, die Nase eine bloße Knospe aus Haut und Knorpeln. Weder Sonne noch Alter noch Sorgen hatten Schatten in das Licht auf ihrem Antlitz geworfen; ihre durchdringenden Augen waren blau und unschuldig und noch ohne die Tiefe menschlicher Erfahrungen, allein die hoffnungsvolle Erwartung eines langen Lebens, das noch vor ihr lag, war darin zu lesen. Ihre Haut war weiß wie Zucker und makellos – bis auf die hässlichen roten Druckstellen an ihrem Hals, so zart und verletzlich wie eine Blume. Diese Druckstellen stammten von den Händen des Soldaten Rufus Harms, denselben Händen, die nun krampfhaft den Brief umklammerten, während sein taumelnder Geist wieder in eine gefährliche Nähe zu diesem Bild geriet.
Immer wenn Harms an das tote Mädchen dachte, weinte er, musste er weinen. Er konnte nicht anders. Doch er weinte stumm, und das aus gutem Grund. Die Wächter und Sträflinge waren Geier, Haie. Aus einer Million Kilometer Entfernung rochen sie Blut, Schwäche, eine Angriffsmöglichkeit. Sie erkannten sie am Zucken der Augen, an den geweiteten Poren der Haut, sogar am Geruch des Schweißes. Hier im Gefängnis waren alle Sinne geschärft. Hier bedeuteten Kraft und Schnelligkeit, Härte und Brutalität das Leben. Oder den Untergang.
Harms kniete neben dem Mädchen, als die Militärpolizisten es fanden. Ihr dünnes Kleid klebte an ihrer winzigen Gestalt, die tief im durchnässten Boden lag, als hätte man sie aus großer Höhe fallen lassen, in ihr eigenes flaches Grab, das sie mit ihrem Körper gebildet hatte. Einmal hatte Harms zu den Militärpolizisten aufgeblickt, doch sein Verstand hatte lediglich einen Wirrwarr dunkler Silhouetten registriert. Nie im Leben hatte er eine solche Wut verspürt, selbst dann noch, als Übelkeit ihn packte, als die Welt sich vor seinen Augen drehte und als Puls, Atmung und Blutdruck ins Bodenlose fielen. Er hielt seinen Kopf mit beiden Händen umklammert, als wollte er verhindern, dass ihm das Hirn die Schädelknochen sprengte und durch Kopfhaut und Haar in die regennasse Luft explodierte.
Als er wieder auf das tote Mädchen hinunterschaute und den Blick dann auf die beiden zuckenden Hände richtete, die ihrem jungen Leben ein Ende bereitet hatten, war der Zorn so plötzlich aus Harms gewichen, als hätte jemand in seinem Inneren einen Stöpsel gezogen. Doch sein Körper gehorchte ihm nicht; er konnte sich nicht rühren, konnte nur dort hocken, nass und zitternd, die Knie tief im Schlamm versunken, und auf das tote Mädchen starren. Ein riesiger schwarzer Gorilla in einem grünen Kampfanzug, der sich über ein kleines, hellhäutiges Opfer beugte – so beschrieb es später ein fassungsloser Zeuge.
Erst am nächsten Tag erfuhr Harms den Namen des kleinen Mädchens: Ruth Ann Mosley, zehn Jahre alt, aus Columbia, South Carolina. Ruth und ihre Familie hatten den Bruder des Mädchens besucht, der auf dem Stützpunkt stationiert war. An diesem Abend hatte Harms Ruth Ann Mosley nur als Leiche gesehen, als totes Fleisch – klein, ja winzig im Vergleich zu der gewaltigen Masse seines eins fünfundneunzig großen, zweihundertsiebzig Pfund schweren Körpers. Das verschwommene Bild des Gewehrkolbens, den ihm einer der Militärpolizisten an den Schädel schmetterte, war der letzte mentale Splitter, den Harms sich von dieser Nacht bewahrte. Der Schlag schleuderte ihn neben dem Mädchen zu Boden. Es lag auf dem Rücken, und in jeder Vertiefung seines leblosen Antlitzes sammelten sich Regentropfen. Rufus Harms lag mit dem Gesicht im Schlamm. Er sah nichts mehr. Erinnerte sich an nichts mehr.
Bis zu diesem Abend. Er sog die regenfeuchte Luft in die Lungen und schaute aus dem halb geöffneten Fenster. Von einem Augenblick auf den anderen war er eine dieser seltenen Kreaturen geworden: ein Unschuldiger hinter Gittern.
Im Lauf der Jahre hatte Harms sich eingeredet, dass das Böse wie ein Krebsgeschwür in seiner Seele lauerte. Er hatte sogar an Selbstmord gedacht, um Buße dafür zu tun, einem anderen Menschen das Leben genommen zu haben, noch dazu einem Kind. Doch er war tief religiös, keiner jener Knastbrüder, die im Bau aus Mangel an anderen Zielen den Weg zu Gott gefunden hatten. Deshalb konnte er nicht die Todsünde des Selbstmords begehen. Überdies wusste er, dass der Mord an dem Mädchen ihn zu einem Leben nach dem Tod verdammt hatte, das tausendmal schlimmer war als jenes, welches er jetzt ertrug. Er war nicht bereit, sich überstürzt dem hinzugeben. Da war er hier, in dieser von Menschen geschaffenen Hölle, einstweilen noch besser aufgehoben.
Und nun erkannte er, dass seine Entscheidung richtig gewesen war. Gott hatte es gewusst, hatte ihn für diesen Augenblick am Leben erhalten. Mit verblüffender Klarheit erinnerte er sich an die Männer, die in jener Nacht zu ihm in die Arrestzelle gekommen waren. Vor seinem inneren Auge sah er wieder deutlich jedes der verzerrten Gesichter, die Streifen auf den Uniformen, die einige von ihnen trugen – seine Kameraden. Ihm fiel wieder ein, dass sie ihn eingekreist hatten wie Wölfe ihre viel größere, stärkere Beute; lediglich ihre bloße Überzahl hatte ihnen Mut verliehen. Er erinnerte sich an den verräterischen Hass ihrer Worte. Was sie an jenem Abend getan hatten, hatte Ruth Ann Mosleys Tod verursacht. Und in einem gewissen Sinne war auch Rufus Harms in jener Nacht gestorben.
Für diese Männer war Harms ein wehrfähiger Soldat, der jedoch niemals für sein Land gekämpft hatte. Und zweifellos glaubten sie, dass er verdient hatte, was man ihm antat. Inzwischen war er ein Mann mittleren Alters, der langsam in einem Käfig dahinsiechte – die Strafe für ein Verbrechen, dessen Ursprung viele Jahre zurücklag. Und er war machtlos, ohne jede Aussicht, dass ihm auch nur ein Anschein von Gerechtigkeit widerfuhr. Und trotz alledem starrte er in das vertraute Dunkel seiner Gruft, und ein einziges, heftiges Verlangen gab ihm Kraft: Nach fünfundzwanzig Jahren schrecklicher und schmerzlicher Schuld, die ihn unaufhörlich gequält hatte, bis er sein ohnehin verpfuschtes Leben beinahe weggeworfen hätte, war es nun an der Zeit, dass sie leiden sollten. Er umklammerte die abgegriffene Bibel, die seine Mutter ihm geschenkt hatte, und gelobte dies dem Gott, der ihn niemals verlassen hatte.
KAPITEL 1
Die Stufen der Treppe, die hinauf zum United States Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, führte, waren breit und schienen nicht enden zu wollen. Es kam einem so vor, als müsse man den Olymp ersteigen, um bei Zeus eine Audienz zu erbitten, was in gewisser Hinsicht auch zutraf. In die Fassade über dem Haupteingang waren die Worte EQUAL JUSTICE UNDER LAW eingemeißelt: ›Gleiches Recht vor dem Gesetz‹. Dieser Leitspruch stammte aus keinem wichtigen Dokument oder Urteil, sondern war das Werk von Cass Gilbert, dem Architekten, der das Gerichtsgebäude entworfen hatte. Es war lediglich eine Frage der Schriftgröße gewesen: Der Satz passte genau auf die Fläche, die Gilbert für ein einprägsames juristisches Motto vorgesehen hatte.
Ironischerweise hatte der Kongress die Mittel zum Bau des majestätischen dreistöckigen Gebäudes 1929 bewilligt, im Jahr des Schwarzen Freitags, als die Börsenkurse einbrachen und die Weltwirtschaftskrise begann. Nahezu ein Drittel der Baukosten – neun Millionen Dollar – waren für Marmor aufgewendet worden: Reiner Vermont, herangekarrt mit einem Heer von Güterwagen, bildete die Fassade des Gebäudes. Die vier Innenhöfe bestanden aus kristallinem Stein aus Georgia, die Böden und Wände des Gebäudeinnern hingegen aus dem milchigen Marmor von Alabama. Nur in der Großen Halle war der Boden mit dunklem italienischem und afrikanischem Marmor ausgelegt. Auch die Steinsäulen in der Großen Halle waren aus Marmorblöcken zusammengefügt: italienischer Montarrenti, der nach Knoxville in Tennessee verschifft worden war. Dort hatten ganz normale Menschen die Blöcke im Schweiße ihres Angesichts zu den fast zehn Meter hohen Säulen zusammengefügt, welche nun jenes Gebäude trugen, das seit 1935 die berufliche Heimat von neun Männern war – und seit 1981 stets zumindest einer Frau. Es waren neun Personen, von denen jede Außergewöhnliches geleistet hatte. Die Bewunderer des Gebäudes bezeichneten es als prachtvolles Beispiel für den korinthischen Stil der klassisch-griechischen Architektur. Seine Gegner erklärten, es sei eher ein Palast für die aberwitzigen Vergnügungen von Königen als ein Ort, an dem vernünftig Recht gesprochen wurde.
Und doch war dieses Gericht seit den Zeiten eines John Marshall der Verteidiger und das Sprachrohr der Verfassung. Die neun Richter, die hier Recht sprachen, konnten einen Erlass des Kongresses für verfassungswidrig erklären. Sie konnten einen amtierenden Präsidenten zwingen, Tonbänder und Dokumente freizugeben, die schlussendlich zu seinem unrühmlichen Rücktritt führten. Neben der Legislative – dem Kongress – und der Exekutive – dem Präsidenten – hatten die Gründerväter die Jurisdiktion als dritte und gleichberechtigte Säule der Regierung errichtet. Und deren höchste Instanz war der Oberste Gerichtshof, die vielleicht stärkste Säule der Macht, denn seine Entscheidungen zu den verschiedensten bedeutsamen Fragen verliehen dem Willen des amerikanischen Volkes gesetzliche Form und Gestalt.
Der ältere Mann, der durch die Große Halle ging, setzte diese ehrbare Tradition fort. Er war groß und knochig und besaß hellbraune Augen, die keine Brille benötigten. Seine Sehkraft war noch ausgezeichnet, obwohl er jahrzehntelang Kleingedrucktes gelesen hatte. Sein Haar war fast völlig gelichtet; die Schultern waren im Lauf der Jahre schmal und gekrümmt geworden, und er hinkte leicht. Dennoch verbreitete Chief Justice Harold Ramsey, der Oberste Richter, knisternde Energie. Sogar seine Schritte wirkten entschlossen und voller Unrast. Und Ramsey besaß einen beispiellosen Intellekt, der jede körperliche Benachteiligung mehr als nur wettmachte.
Er war der hochrangigste Jurist des Landes, und dies hier war sein Gerichtshof, sein Gebäude. »Ramsey-Court« nannten die Medien es schon seit geraumer Zeit, so wie es zuvor »Warren-Court« geheißen hatte und anders: Es hatte die Namen sämtlicher Vorgänger Ramseys getragen – seine Erblast für alle Zeit. Ramsey führte sein Gericht straff und mit harter Hand und versuchte seit nunmehr zehn Jahren, eine beständige Mehrheit der anderen Richter um sich zu scharen. Er mochte die Mauschelei, die hinter den geschlossenen Türen des Gerichts betrieben wurde. Hier und da gab er ein genau überlegtes Wort oder eine kurze Bemerkung von sich, und in der einen oder anderen unbedeutenden Sache gab er nach, um später eine Gefälligkeit einfordern zu können. Geduldig wartete er darauf, dass der richtige Fall kam, der ihm als Mittel zur Veränderung dienen konnte, mitunter auf eine Weise, mit der seine Kollegen nie gerechnet hätten. Ramsey war besessen davon, die fünf Stimmen zusammenzubekommen, die für eine Mehrheit erforderlich waren.
Er war als beigeordneter Richter zum Obersten Gerichtshof gekommen und vor zehn Jahren in das höchste Amt aufgestiegen. Anfangs war Ramsey auf dem Papier lediglich der Erste unter Gleichen gewesen, doch in Wahrheit war er mehr als der Primus inter Pares. Ramsey war ein Mann mit fest gefügten Ansichten und einer ganz persönlichen Philosophie. Es war sein Glück, dass man ihn zu einer Zeit für den Obersten Gerichtshof nominiert hatte, als der Auswahlprozess noch nichts mit politischen Spitzfindigkeiten zu tun hatte, wie es heutzutage der Fall war. Damals wurden noch keine lästigen Fragen über die Ansichten des Kandidaten über spezifische rechtliche Themen wie zum Beispiel Abtreibung, Todesstrafe und positive Diskriminierung gestellt – Fragen, die den heutzutage hochgradig politisierten Vorgang behinderten, Richter am Supreme Court zu werden. Wenn man damals, vor zehn Jahren, vom Präsidenten nominiert wurde, über die erforderliche juristische Qualifikation verfügte und keine besonders schlimmen Leichen im Keller liegen hatte, war man drin.
Der Senat hatte Ramsey einstimmig bestätigt; er hatte kaum eine Wahl gehabt: Ramsey war Spitzenklasse – von seiner Ausbildung bis hin zu seiner anwaltlichen Tätigkeit. Er besaß zahlreiche akademische Titel, allesamt von Eliteuniversitäten, und stets hatte er zu den besten seines Jahrgangs gezählt. Nach der Anwaltstätigkeit folgte ein mit Auszeichnungen bedachtes Zwischenspiel als Juraprofessor, wobei Ramsey außergewöhnliche und weit reichende Thesen verfocht, welche Richtung die Gesetzgebung und demzufolge auch die Menschheit einschlagen sollte. Anschließend war er für das Bundesberufungsgericht vorgeschlagen worden und rasch zum Vorsitzenden Richter seines Bezirks aufgestiegen. Während seiner Amtszeit am Berufungsgericht hatte der Supreme Court keine einzige der Mehrheitsentscheidungen Ramseys aufgehoben. Im Lauf der Jahre hatte Ramsey das geeignete Netzwerk an Verbindungen aufgebaut und alles Notwendige getan, um das Amt zu erlangen, das er nun innehatte und eifersüchtig hütete.
Er hatte sich dieses Amt verdient. Nie war ihm etwas geschenkt worden – was mit einer seiner unumstößlichen Ansichten im Einklang stand: Wenn man in den USA hart arbeitete, hatte man Erfolg. Niemand hatte ein Recht auf Almosen, weder die Armen noch die Reichen, noch die Mittelschicht. Die Vereinigten Staaten waren das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, doch um diese Möglichkeiten auszuschöpfen, musste man schuften und schwitzen und Opfer bringen. Für die Ausreden jener, die es zu nichts brachten, hatte Ramsey kein Ohr. Er war in abgrundtiefer Armut aufgewachsen, der Vater ein schlagwütiger Alkoholiker, die Mutter eine gebrochene Frau, die keine Zuflucht bot und deren mütterliche Gefühle vom Vater zertreten und zerschlagen worden waren. Kein viel versprechender Start ins Leben. Und wo stand er jetzt? Wenn er unter solchen Umständen nicht nur überleben, sondern es zu etwas bringen konnte, dann konnten es auch andere. Schafften sie es nicht, war es ihre Schuld. Etwas anderes ließ Ramsey sich nicht einreden.
Er stieß ein zufriedenes Seufzen aus. Soeben hatte eine neue Sitzungsperiode des Gerichts begonnen. Alles lief reibungslos. Doch es gab einen Haken. Eine Kette war nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und damit musste Ramsey sich nun befassen. Mit seinem potenziellen Waterloo. Zurzeit lief alles ausgezeichnet – aber was würde in fünf Jahren sein? Mit solchen Problemen befasste man sich besser frühzeitig, bevor sie einem aus der Hand glitten.
Er wusste, er würde demnächst mit Elizabeth Knight aneinander geraten. Sie war genauso intelligent wie er und vielleicht auch genauso hart. Ramsey hatte es von dem Tag an gewusst, als ihre Ernennung bestätigt worden war. Eine Frau, die frisches Blut in einen Gerichtshof voller älterer Herren brachte. Ramsey hatte Elizabeth Knight vom ersten Tag an bearbeitet. Er fragte sie um ihre Meinung, wenn er glaubte, ihre Haltung sei neutral – in der Hoffnung, dass die Verantwortung, eine Entscheidung treffen zu müssen, die eine Mehrheit herbeiführte, Elizabeth Knight in sein Lager ziehen würde. Er hatte versucht, sie unter seine Fittiche zu nehmen, sie in die Feinheiten des Gerichtsalltags einzuweihen. Doch sie hatte eine sehr starrköpfige, unabhängige Ader an den Tag gelegt. Ramsey hatte erlebt, wie andere Oberste Richter selbstgefällig wurden, sorglos – mit der Folge, dass ihr Führungsanspruch von anderen herausgefordert wurde, die energischer waren. Ramsey war entschlossen, sich niemals in diese Versager einzureihen.
»Murphy macht sich Sorgen um den Fall Chance«, sagte Michael Fiske zu Sara Evans. Sie waren in ihrem Büro im ersten Stock des Gerichtsgebäudes. Michael war eins fünfundachtzig groß und stattlich und besaß die geschmeidigen Proportionen des Sportlers, der er früher gewesen war. Die meisten Assessoren – wissenschaftliche Mitarbeiter mit der Befähigung zum Richteramt, wie sie korrekt hießen – arbeiteten ein Jahr lang in der Verwaltung des Obersten Gerichtshofs, bevor sie in angesehenere Positionen in Privatkanzleien, im öffentlichen Dienst oder in den Lehrbetrieb wechselten. Michael trat nun, was noch nie vorgekommen war, sein drittes Jahr als Oberassessor von Richter Thomas Murphy an, dem legendären Liberalen an diesem Gericht.
Michael besaß einen phänomenalen Verstand. Sein Hirn funktionierte wie eine Geldzählmaschine: Daten strömten in seinen Kopf, wurden blitzschnell sortiert und an die richtige Stelle weitergeleitet. Er konnte mit einem Dutzend komplizierter, ineinander verzahnter Szenarien jonglieren, sie gegeneinander abwägen und ermitteln, welche Auswirkungen ein jedes auf die anderen hatte. Vor Gericht befasste er sich gern mit schwierigen Fällen von nationaler Bedeutung, auch wenn er sich dabei mit Kollegen herumschlagen musste, deren Verstand so messerscharf war wie der seine. Und Michael hatte festgestellt, dass selbst im Rahmen rigoroser intellektueller Dispute Zeit und Gelegenheit für etwas Tieferes blieb als das, was die trockenen, scharf umrissenen Worte eines Gesetzestextes verkündeten. Im Grunde wollte Michael den Obersten Gerichtshof gar nicht verlassen. Die Welt draußen hatte keinen Reiz für ihn.
Sara machte einen besorgten Eindruck. Während der letzten Sitzungsperiode hatte Richter Murphy entschieden, den Fall Chance zu verhandeln. Die mündliche Verhandlung wurde anberaumt und die Eingaben für den Richter vorbereitet. Sara war Mitte zwanzig, eins fünfundsechzig groß und schlank, doch mit wohlproportionierten weiblichen Rundungen. Ihr Gesicht war fein geschnitten, die Augen groß und blau. Ihr Haar war dicht und braun – im Sommer nahm es immer eine leicht blonde Färbung an – und schien stets frisch und angenehm zu duften. Sie war Assessorin von Richterin Elizabeth Knight. »Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, Murphy stünde bei dieser Sache hinter uns. Ist doch genau sein Fall. Der kleine Mann gegen die allgewaltige Bürokratie.«
»Er glaubt aber auch fest daran, dass Präzedenzfälle berücksichtigt werden müssen.«
»Auch wenn es falsch ist?«
»Du rennst offene Türen ein, Sara, aber ich habe mir gedacht, ich sollte es dir sagen. Ohne ihn wird Richterin Knight keine fünf Stimmen bekommen, das weißt du. Selbst mit ihm schafft sie es vielleicht nicht.«
»Tja, was will er dann?«
Darauf lief es die meiste Zeit hinaus. Das berühmte Netzwerk der Assessoren. Wie die schamlosesten politischen Hausierer schacherten sie und debattierten und versuchten, Stimmen für ›ihre‹ Richter zu ergattern. Es stand unter der Würde der Richter, offen um Stimmen zu feilschen, oder um eine bestimmte Formulierung in einer Urteilsbegründung, oder um eine Auslegung, Streichung oder Hinzufügung. Das galt aber nicht für die Verwaltungsangestellten des Gerichts, von denen die meisten diesen Kuhhandel sogar mit beträchtlichem Stolz betrieben. Es ließ sich mit einer gewaltigen, nie endenden Klatschkolumne vergleichen, bei der allerdings nationale Interessen auf dem Spiel standen. Zumindest wenn die Sache in den Händen von Fünfundzwanzigjährigen lag, die gerade ihren ersten richtigen Job angetreten hatten.
»Murphy lehnt den Standpunkt von Richterin Knight ja nicht unbedingt ab. Aber wenn sie bei einer Beratung fünf Stimmen bekommen will, muss die Begründung sehr genau getroffen und eingegrenzt werden. Er lässt sich nicht das Fell über die Ohren ziehen. Er hat im Zweiten Weltkrieg gedient und hat eine hohe Meinung vom Militär. Das muss beim Entwurf der Urteilsbegründung berücksichtigt werden.«
Sara nickte anerkennend. Die persönliche Vergangenheit der Richter spielte bei ihrer Urteilsfindung eine größere Rolle, als die meisten Außenstehenden glauben mochten. »Danke. Aber zuerst muss Richterin Knight die Gelegenheit bekommen, eine Begründung aufzusetzen.«
»Natürlich bekommt sie die Gelegenheit. Ramsey wird dagegen stimmen, Feres und Stanley aufzuheben, das weißt du. Und Murphy wird bei der Beratung wahrscheinlich dafür stimmen, den Fall Chance zu behandeln. Murphy ist der älteste beigeordnete Richter, also wird er darüber entscheiden, wer die Begründung verfasst. Wenn Knight ihre fünf Stimmen bekommt, wird Murphy ihr diese Aufgabe zuschustern. Und wenn sie ordentliche Arbeit leistet – keine in die Breite gehenden Formulierungen –, sind wir alle wunschlos glücklich.«
Die Vereinigten Staaten gegen Chance war einer der wichtigsten Fälle, die in dieser Sitzungsperiode auf der Liste standen. Barbara Chance war Soldatin in der Army gewesen. Man hatte sie eingeschüchtert und schikaniert, und wiederholt war sie von mehreren ihrer männlichen Vorgesetzten zum Geschlechtsverkehr genötigt worden. Der Fall hatte die üblichen internen Dienstwege der Army durchlaufen, und einer der Männer war vors Kriegsgericht gestellt und zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Doch Barbara Chance hatte sich nicht damit zufrieden gegeben. Nachdem sie aus dem Militärdienst ausgeschieden war, hatte Chance auf Schadenersatz geklagt – mit der Begründung, die Army habe zugelassen, dass diese feindselige Umgebung für sie selbst und andere weibliche Rekruten überhaupt erst entstehen konnte.
Barbara Chance hatte den Dienst quittiert und dann Klage eingereicht. Der Fall hatte sich langsam durch die Instanzen gearbeitet, und stets war die Army Sieger geblieben. Doch der Fall barg dermaßen viele juristische Grauzonen, dass er schließlich wie ein Findelkind auf der Schwelle dieses Palastes gelandet war.
Die derzeitige Rechtsprechung lief darauf hinaus, dass Barbara Chance – es war die reinste Ironie – keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Es war so gut wie unmöglich, dass Militärangehörige ihren Dienstherrn auf Schadenersatz verklagten, ganz gleich aus welchem Grund und welches Verschulden auch vorliegen mochte. Doch die Richter konnten die Gesetzeslage ändern. Und Richterin Knight und Sara Evans arbeiteten hinter den Kulissen eifrig daran, genau das zu tun. Bei diesem Vorhaben war Thomas Murphys Unterstützung von ausschlaggebender Bedeutung. Es mochte Murphy zwar nicht gelingen, das Recht der Army auf Immunität völlig aufzuheben, aber der Fall Chance konnte zumindest ein Loch in die Mauer der Unbesiegbarkeit des Militärs stanzen.
Es schien verfrüht zu sein, über das Urteil in einem Fall zu diskutieren, der noch gar nicht verhandelt worden war, doch in vielen Fällen und für viele Richter war die mündliche Verhandlung eher nebensächlich: Bei Verhandlungsbeginn hatten die meisten Richter ihre Entscheidung bereits gefällt. Der Prozess als solcher, das Urteil und dessen Begründung waren für die Richter eher eine Gelegenheit, den Kollegen ihre Ansichten und Befürchtungen darzulegen, was häufig dadurch geschah, dass die Richter auf extrem hypothetische Beispiele zurückgriffen. Es war eine geistige Einschüchterungstaktik, so als wollten sie sagen: »Verstehen Sie, werte Kollegen, was passieren könnte, wenn Sie für dieses und jenes stimmen würden?«
Michael erhob sich und schaute zu Sara hinunter. Nur auf sein Drängen hin hatte sie sich für eine weitere Sitzungsperiode beim Obersten Gericht verpflichtet. Sara war auf einer kleinen Farm in North Carolina aufgewachsen und hatte in Stanford studiert. Wie alle Assessoren am Supreme Court konnte sie mit einer blendenden beruflichen Zukunft rechnen: Beim Obersten Gerichtshof gearbeitet zu haben war wie ein goldener Schlüssel, der einem Anwalt beinahe jede Tür öffnete – sofern man mit beiden Beinen auf dem Boden blieb. Es gab Beispiele von Assessoren, die nach Verlassen des Obersten Gerichts so sehr vor Selbstbewusstsein gestrotzt hatten, dass ihre juristischen Fähigkeiten nicht mehr ihrem Dünkel entsprachen. Doch Michael und Sara waren dieselben geblieben, die sie gewesen waren. Aus diesem Grund – und wegen Saras Intelligenz, ihrer erfrischend ausgeglichenen Persönlichkeit und ihres guten Aussehens – hatte Michael seiner Kollegin vor einer Woche eine sehr wichtige, sehr persönliche Frage gestellt. Eine Frage, auf die er bald eine Antwort zu erhalten hoffte. Vielleicht jetzt. Er war noch nie ein besonders geduldiger Mensch gewesen.
Sara schaute erwartungsvoll zu ihm hoch.
»Hast du über meinen Antrag nachgedacht?«
Sie hatte gewusst, dass die Frage kommen würde. Sie war ihr lange genug ausgewichen. »Ich habe über nichts anderes nachgedacht.«
»Man sagt, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn es so lange dauert.« Michael sagte es im Scherz, doch der Humor war sichtlich gezwungen.
»Michael, ich mag dich sehr.«
»Du magst mich? O je, noch ein schlechtes Zeichen.« Sein Gesicht lief plötzlich rot an.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich … es tut mir Leid.«
Er zuckte die Achseln. »Wahrscheinlich nicht halb so Leid wie mir. Ich habe noch nie jemandem einen Heiratsantrag gemacht.«
»Und ich habe noch keinen bekommen. Michael, ich fühle mich geschmeichelt. Ehrlich. Du bist alles und hast alles, was eine Frau sich wünschen kann.«
»Nur eins nicht.« Michael schaute auf seine Hände, die plötzlich leicht zitterten. »Ich respektiere deine Entscheidung. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, man könnte mit der Zeit jemanden lieben lernen. Entweder ist von vornherein etwas da oder eben nicht.«
»Du wirst eine andere finden, Michael. Und sie wird großes Glück haben, dich zu bekommen.« Sara wusste, wie plump und unbeholfen ihre Worte waren. »Hoffentlich bedeutet das jetzt nicht, dass ich meinen besten Freund am Gericht verliere.«
»Doch, wahrscheinlich.« Als Sara erbleichte, hob Michael eine Hand. »War nur ein Scherz.« Er seufzte. »Das hört sich jetzt wahrscheinlich furchtbar selbstgefällig an, aber gerade bin ich zum ersten Mal im Leben richtig abgeblitzt.«
»Ich wünschte, mein Leben wäre so einfach gewesen.« Sara lächelte.
»Wünsch es dir lieber nicht. Dann kann man Zurückweisungen nämlich viel schwerer verkraften.« Michael ging zur Tür. »Wir sind immer noch Freunde, Sara, ja? Ich bin viel zu gern mit dir zusammen, als dass ich darauf verzichten wollte. Und auch du wirst einen Partner finden, und auch der kann sich verdammt glücklich schätzen.« Er schaute sie nicht an, als er hinzufügte: »Hast du ihn schon gefunden?«
Sie zuckte leicht zusammen. »Warum fragst du?«
»Ein sechster Sinn, vielleicht. Das Verlieren fällt meist ein bisschen leichter, wenn man weiß, gegen wen man verloren hat.«
»Es gibt keinen anderen«, sagte sie schnell.
Michael wirkte nicht besonders überzeugt. »Wir sehen uns später.«
Verwirrt schaute Sara ihm hinterher.
»Ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre am Gericht.« Ramsey blickte aus dem Fenster, und auf seinem Gesicht lag ein leises Lächeln.
Er saß Elizabeth Knight gegenüber, der jüngsten Richterin am Supreme Court. Sie war Mitte vierzig, schlank, von durchschnittlicher Größe und hatte langes schwarzes Haar, das sie jedoch zu einem strengen, unvorteilhaften Knoten zurückgebunden hatte. Ihr Gesicht war scharf geschnitten, und ihre Haut war völlig faltenlos, als hätte sie niemals auch nur einen Tag in Wind und Wetter verbracht. Elizabeth Knight hatte sich rasch den Ruf als eine der sprachgewandtesten Juristen bei den mündlichen Verhandlungen erworben, und von allen Richtern am Supreme Court arbeitete sie am härtesten.
»Die Erinnerungen sind bestimmt noch sehr lebendig.« Elizabeth Knight lehnte sich in ihrem Schreibtischsessel zurück und ging im Geiste den Arbeitsplan für den Rest des Tages durch.
»Es war ein gewaltiger Lernprozess.«
Sie schaute ihn an. Ramsey hatte seine großen Hände hinter dem Kopf verschränkt und sah ihr nun direkt in die Augen.
»Ich habe fünf volle Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie der Hase läuft«, fuhr er fort.
Knight zwang sich, nicht zu lächeln. »Sie sind viel zu bescheiden, Harold. Ich bin überzeugt, Sie hatten es schon herausgefunden, bevor Sie diese heiligen Hallen zum ersten Mal betreten haben.«
»Nein. Wirklich, das braucht seine Zeit. Aber ich hatte viele gute Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte. Felix Abernathy … der alte Tom Parks. Man braucht sich nicht zu schämen, sich die Erfahrung anderer anzueignen. Eine Lehrzeit, die wir alle durchmachen. Wenngleich Sie, Elizabeth, gewiss schneller vorangekommen sind als die meisten«, fügte er rasch hinzu. »Trotzdem wird hier die Tugend der Geduld sehr geschätzt. Sie sind erst seit drei Jahren hier. Für mich ist dieser Gerichtshof seit über zwanzig Jahren meine Heimat. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine.«
Knight lächelte immer noch nicht. »Ich weiß, dass es Sie ein wenig beunruhigt, wie ich gegen Ende der letzten Sitzungsperiode dem Fall Chance den Weg auf die Liste der zu verhandelnden Fälle geebnet habe.«
Ramsey setzte sich kerzengerade auf. »Glauben Sie nicht alles, was Sie hier hören.«
»Ganz im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Buschtrommeln der Assessoren überaus zuverlässig sind.«
Ramsey lehnte sich wieder zurück. »Nun ja, ich muss gestehen, das hat mich ein wenig überrascht. Der Fall beinhaltet keine ungeklärten Fragen. Ein Eingreifen unsererseits dürfte also kaum erforderlich sein. Muss ich noch mehr sagen?« Er hob die Hände.
»Ist das wirklich Ihre Meinung?«
Eine leichte Röte überzog Ramseys Gesicht. »Die jedermann zugänglichen Urteile dieses Gerichts in den letzten fünfzig Jahren lassen erkennen, dass wir nicht zu intervenieren brauchen. Ich bitte Sie lediglich, den Präzedenzfällen, die an diesem Gericht entschieden wurden, die Achtung zu erweisen, die sie verdienen.«
»Niemand schätzt dieses Verfassungsorgan mehr als ich.«
»Das freut mich zu hören.«
»Und ich würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen könnte, dass Sie sich auch nach der mündlichen Verhandlung noch mit dem Fall Chance beschäftigen.«
Ramsey musterte sie missmutig. »Das wird eine sehr kurze Diskussion. Schließlich braucht man nicht lange, um ja oder nein zu sagen. Offen gesagt, am Ende des Tages werde ich mindestens fünf Stimmen haben, und Sie nicht.«
»Nun ja, ich habe immerhin schon mal drei Richter davon überzeugt, für die Zulassung des Falles zu stimmen.«
Ramsey schien sich ein Lachen verkneifen zu müssen. »Sie werden bald herausfinden, dass es eine ganz andere Sache ist, ob ein Richter dafür stimmt, einen Fall zuzulassen, oder ob er zu seinen Gunsten entscheidet. Glauben Sie mir, ich werde die Mehrheit bekommen.«
Elizabeth Knight lächelte freundlich. »Ihre Zuversicht ist ansteckend. Davon kann ich lernen.«
Ramsey erhob sich. »Dann vergessen Sie bloß nicht diese andere Lektion. Kleinere Fehler führen normalerweise zu größeren. Wir sind auf Lebenszeit ernannt worden, und unser einziges Kapital ist unsere Reputation. Sind Sie Ihren guten Ruf erst einmal los, bekommen Sie ihn nie mehr zurück.« Ramsey ging zur Tür. »Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag, Beth«, sagte er, bevor er das Zimmer verließ.
KAPITEL 2
»Rufus?« Samuel Rider drückte sich vorsichtig den Hörer ans Ohr. »Wie haben Sie mich gefunden?«
»Hier oben gibt es nicht besonders viele Anwälte, Samuel«, sagte Rufus Harms.
»Ich bin nicht mehr beim JAG.«
»In der freien Wirtschaft verdient man wohl ganz gut.«
»Manchmal vermisse ich die Uniform«, log Rider. Er hatte schreckliche Angst vor der Einberufung gehabt – damals, Anfang der siebziger Jahre. Glücklicherweise hatte er ein abgeschlossenes Jurastudium vorweisen können und war auf Nummer Sicher gegangen: Er hatte sich für die Militärgerichtsbarkeit – das Judge Advocates General’s Office, kurz JAG – entschieden, statt mit Helm und Kampfanzug durch die Dschungel Vietnams zu streifen, als lebende Zielscheibe für ›Charlie‹, den Vietkong.
»Ich muss Sie sprechen. Warum, will ich am Telefon nicht sagen.«
»Ist in Fort Jackson alles okay? Ich habe gehört, dass Sie dorthin verlegt wurden.«
»Alles bestens. Der Knast hier ist in Ordnung.«
»Das habe ich nicht gemeint, Rufus. Ich frage mich nur, warum Sie mich nach so vielen Jahren anrufen.«
»Sie sind immer noch mein Anwalt, oder? Und jetzt brauche ich wirklich einen.«
»Mein Terminplan ist ziemlich voll, und ich komme normalerweise kaum aus der Stadt heraus.«
»Ich muss Sie morgen sehen, Samuel. Sind Sie mir das nicht schuldig?«
»Ich habe damals alles für Sie getan, was ich konnte.«
»Sie haben sich auf einen Kuhhandel eingelassen. Kurz und schmerzlos.«
»Nein«, entgegnete Rider, »wir hatten vor der Verhandlung eine Vereinbarung mit dem Gericht getroffen, die vom Anklagevertreter abgesegnet wurde. Es war das Klügste, was wir tun konnten.«
»Sie haben aber nicht versucht, ein günstigeres Urteil für mich herauszuholen. Die meisten Anwälte versuchen das.«
»Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Im Gefängnis lernt man so einiges.«
»Sie können das Urteil nicht anfechten. Sie wissen, wir haben uns damals auf Geschworene der Army eingelassen.«
»Aber Sie haben keine Zeugen aufgerufen. Sie haben eigentlich gar nichts getan. Jedenfalls habe ich nicht viel davon mitbekommen.«
Rider ging unwillkürlich in die Defensive. »Ich habe getan, was ich konnte. Vergessen Sie nicht, Rufus, man hätte Sie hinrichten können. Ein kleines weißes Mädchen! Du lieber Himmel, die Anklagevertretung hätte auf Mord plädiert. Man hat es mir gesagt! Mit anderen Worten: Ich habe dafür gesorgt, dass Sie noch leben.«
»Bis morgen, Samuel. Ich habe Sie auf meine Besucherliste gesetzt. Gegen neun Uhr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Ach, und bringen Sie ein kleines Radio mit.« Bevor Rider ihn nach dem Grund für diese Bitte fragen konnte oder warum er überhaupt ins Gefängnis kommen sollte, hatte Rufus Harms schon aufgelegt.
Rider lehnte sich in seinem bequemen Sessel zurück und ließ den Blick durch das geräumige, holzgetäfelte Büro schweifen. Er hatte sich in einer ländlichen Kleinstadt in der Nähe von Blacksburg, Virginia, als Anwalt niedergelassen. Er verdiente wirklich ganz ordentlich: ein schönes Haus, alle drei Jahre ein neuer Buick, zweimal im Jahr Urlaub. Die Vergangenheit – besonders der schrecklichste Fall, den er in seiner kurzen Laufbahn als Militäranwalt je übernommen hatte – lag weit hinter ihm. Es war ein Scheißfall gewesen, der auf den Magen schlug, und man konnte so viel Rennie schlucken, wie man wollte – es linderte die Beschwerden nicht.
Rider stützte das Kinn auf eine Hand, und seine Gedanken trieben zurück zum Beginn der siebziger Jahre, einer Zeit des Chaos im Militär, in den USA, in der ganzen Welt. Jeder beschuldigte jeden, für jeden Fehler verantwortlich zu sein, der je in der Geschichte des Universums gemacht worden war. Rufus Harms hatte am Telefon verbittert geklungen. Aber er hatte das kleine Mädchen umgebracht. Brutal. Praktisch vor den Augen ihrer Familie. Er hatte ihr binnen Sekunden das Genick gebrochen, bevor jemand auch nur versuchen konnte, ihn aufzuhalten.
Zu Harms’ Gunsten hatte Rider vor dem Prozess eine Vereinbarung ausgehandelt, doch das Militärgesetz sah vor, dass der Anwalt sie vor der Urteilsverkündung widerrufen konnte. Der Angeklagte würde entweder die zuvor ausgehandelte Strafe bekommen oder aber die, welche der Richter oder die Abgeordneten – das militärische Gegenstück zu den Geschworenen – ausgesprochen hatten, je nachdem, welche Strafe milder war.
Doch Harms’ Worte machten dem Anwalt zu schaffen. Er hatte sich damals tatsächlich überreden lassen, sich während des Prozesses nicht allzu sehr ins Zeug zu legen. Er hatte sich mit dem Ankläger darauf geeinigt, keine Zeugen von außerhalb aufzurufen, die Leumundsaussagen machen würden und Ähnliches. Und er hatte sich bereit erklärt, die offiziellen Ermittlungsergebnisse nicht anzuzweifeln und darauf zu verzichten, neue Beweise und Zeugen ausfindig zu machen.
Damit hatte er sich nicht unbedingt an die Regeln gehalten; denn das Recht des Verteidigers, den Kuhhandel zu widerrufen, durfte in keiner grundlegenden Hinsicht eingeschränkt werden. Doch hätte Rider nicht auf diese Weise hinter den Kulissen agiert, hätte der Ankläger die Todesstrafe beantragt und mit seinen Beweisen wahrscheinlich auch durchgesetzt. Es spielte kaum eine Rolle, dass der Mord so schnell verübt worden war und dass man den Tatbestand des Vorsatzes in ernste Zweifel ziehen konnte. Die kalte Leiche eines Kindes konnte auch die logischste aller juristischen Analysen zum Entgleisen bringen.
Die schlichte Wahrheit lautete, dass niemand sich für Rufus Harms interessierte. Er war ein Schwarzer, der den Großteil seiner Army-Laufbahn im Bau verbracht hatte. Der sinnlose Mord an einem Kind hatte sein Ansehen in den Augen des Militärs bestimmt nicht gehoben. Viele waren der Auffassung gewesen, ein solcher Mann habe gar keinen Anspruch auf Gerechtigkeit, es sei denn, sie erfolgte prompt, schmerzhaft und tödlich. Vermutlich hatte Rider damals selbst so gedacht. Deshalb hatte er bei der Verteidigung Harms’ nicht gerade eine Politik der verbrannten Erde betrieben, dem Mann aber immerhin das Leben gerettet. Und mehr hätte kein Anwalt erreichen können.
Weshalb will Harms mich dann sprechen, fragte er sich.
KAPITEL 3
Als John Fiske sich vom Tisch der Verteidigung erhob, schaute er zu seinem Gegner, Paul Williams, hinüber. Der junge stellvertretende Staatsanwalt hatte soeben zuversichtlich die Details seines Antrags erläutert.
»Jetzt bist du geliefert, Paulie«, flüsterte Fiske. »Du hast es vermasselt.«
Als Fiske sich Richter Walters zuwandte, brachte er schon mit dieser Bewegung eine gewisse mühsam unterdrückte Spannung zum Ausdruck. Fiske war breitschultrig, mit eins achtzig jedoch kleiner als sein jüngerer Bruder. Und im Gegensatz zu Michaels Gesichtszügen waren Johns alles andere als von klassischem Schnitt. Er hatte Pausbacken, ein zu ausgeprägtes Kinn und eine zweimal gebrochene Nase. Das erste Mal war sie bei einer Prügelei an der High School gebrochen worden; der zweite Bruch war ein Überbleibsel aus seiner Zeit als Cop. Doch Fiskes schwarzes Haar fiel ihm ungekämmt über die Stirn, was irgendwie kämpferisch, attraktiv und Vertrauen erweckend wirkte, und in seinen braunen Augen loderte ein glühender Wille.
»Euer Ehren, um die Zeit des Gerichts nicht zu vergeuden, möchte ich der Staatsanwaltschaft ein Angebot bezüglich ihres Antrags machen. Wenn die Anklage sich bereit erklärt, diesen Antrag kostenpflichtig zurückzuziehen und dem Fonds der öffentlichen Pflichtverteidiger eintausend Dollar zu stiften, werde ich meinen Gegenantrag zurückziehen und nicht auf Schadenersatz klagen, und wir alle können nach Hause gehen.«
Paul Williams sprang so schnell auf, dass ihm die Brille von der Nase rutschte und auf den Tisch fiel. »Euer Ehren, das ist eine Unverschämtheit!«
Richter Walters schaute in den gut besuchten Saal, dachte stumm an seinen ebenso prall gefüllten Terminkalender und winkte beide Männer müde zu sich an den Richtertisch. »Kommen Sie bitte zu mir.«
»Euer Ehren«, sagte Fiske, als er am Seitensteg des Richterstuhls stand, »ich möchte der Gesellschaft nur einen Gefallen erweisen.«
»Die Gesellschaft kann auf Gefälligkeiten von Mr Fiske verzichten«, sagte Williams empört.
»Kommen Sie, Paulie, tausend Mäuse, und Sie können sich noch ein Bier trinken, bevor Sie zu Ihrem Boss gehen und ihm erklären, wieso Sie Mist gebaut haben. Ich gebe Ihnen das Bier sogar aus.«
»Nicht in zehntausend Jahren werden Sie auch nur einen Cent von uns bekommen«, sagte Williams verächtlich.
»Nun ja, Mr Williams, dieser Antrag ist ein wenig ungewöhnlich«, erklärte Richter Walters. Am Strafgericht von Richmond wurden Anträge vor oder während des Prozesses gestellt, und ihnen lagen keine langen Schriftsätze mit der Darlegung der Beweisgründe bei. Die traurige Wahrheit sah leider so aus, dass die meisten Strafprozesse im Voraus entschieden wurden. Nur bei ungewöhnlichen Fällen, bei denen der Richter sich nach den Plädoyers der Anwälte seiner Entscheidung nicht sicher war, bat er um schriftliche Begründungen, bevor er ein Urteil sprach. Daher war Richter Walters ein wenig verwirrt, dass die Staatsanwaltschaft unaufgefordert einen langen Schriftsatz eingereicht hatte.
»Ich weiß, Euer Ehren«, sagte Williams. »Doch wie ich erklärt habe, handelt es sich um eine ungewöhnliche Situation.«
»Ungewöhnlich?«, sagte Fiske. »Verrückt wäre der bessere Ausdruck, Paulie.«
»Mr Fiske«, warf Richter Walters ungeduldig ein, »ich habe Sie schon einmal wegen ungebührlichen Verhaltens in meinem Gerichtssaal getadelt und werde nicht zögern, Sie wegen Missachtung zu bestrafen, falls Ihr weiteres Verhalten es rechtfertigt. Fahren Sie jetzt mit Ihrer Erwiderung fort.«
Williams kehrte an seinen Tisch zurück, und Fiske ging zum Pult. »Euer Ehren, obwohl der ›Dringlichkeitsantrag‹ der Staatsanwaltschaft mitten in der Nacht an mein Büro gefaxt wurde und ich keine Zeit hatte, eine angemessene Erwiderung vorzubereiten, werden Sie gemäß der zweiten Absätze auf den Seiten vier, sechs und neun des Memorandums der Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommen, dass die Tatsachen, auf die dort Bezug genommen wurde, angesichts dieser Aktenlage nicht aufrechtzuerhalten sind. Das gilt besonders im Hinblick auf das Vorstrafenregister des Angeklagten, die Aussagen der Beamten, welche die Verhaftung vorgenommen haben, sowie die Aussagen der beiden Augenzeugen am Tatort des Verbrechens, das mein Mandant angeblich begangen haben soll. Überdies ist der Präzedenzfall, den die Anklage auf Seite zehn anführt, vor kurzem durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Virginia aufgehoben worden. Ich habe die diesbezüglichen Unterlagen meiner Erwiderung beigefügt und die entsprechenden Stellen für Sie gekennzeichnet.«
Während Richter Walters die Akte studierte, beugte Fiske sich zu Williams hinüber. »Jetzt sehen Sie, was passiert, wenn Sie mitten in der Nacht so eine Scheiße abziehen.« Fiske gab Williams seinen Schriftsatz. »Da mir nur etwa fünf Minuten blieben, Ihren Schriftsatz zur Kenntnis zu nehmen, habe ich mir überlegt, Ihnen den gleichen Gefallen zu tun. Sie können meinen Schriftsatz ja gleichzeitig mit dem Richter lesen.«
Walters hatte die Akte inzwischen studiert und bedachte Williams mit einem Blick, der selbst dem unaufmerksamsten Zuschauer im Saal einen kalten Schauer über den Rücken jagte.
»Ich hoffe, die Staatsanwaltschaft hat eine angemessene Erwiderung parat, Mr Williams, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie sie lauten könnte.«
Williams erhob sich. Als er nach Worten suchte, stellte er fest, dass seine Stimme ihn verlassen hatte – genau wie seine Überheblichkeit.
»Nun?«, fragte Richter Walters erwartungsvoll. »Äußern Sie sich bitte, oder ich bin geneigt, Mr Fiskes Antrag auf Schadenersatz stattzugeben, bevor ich ihn auch nur gehört habe.«
Als Fiske zu Williams hinüberschaute, wurde sein Ausdruck ein wenig milder. Man wusste ja nie, wann man mal einen Gefallen brauchte. »Euer Ehren, die faktischen und juristischen Fehler im Antrag der Staatsanwaltschaft sind gewiss auf die Arbeitsüberlastung der Anwälte zurückzuführen und stellen bestimmt keine Absicht dar. Ich verringere mein Vergleichsangebot auf fünfhundert Dollar, verlange aber, dass eine offizielle Entschuldigung der Staatsanwaltschaft zu den Akten genommen wird. Ich hätte letzte Nacht wirklich etwas Schlaf gebrauchen können.« Die letzte Bemerkung rief allgemeines Gelächter im Saal hervor.
Plötzlich erklang aus dem hinteren Bereich des Sitzungssaales eine dröhnende Stimme. »Richter Walters, falls ich mich dazu äußern darf – die Staatsanwaltschaft nimmt dieses Angebot an.«
Alle schauten zu dem Rufer hinüber, einem kleinen, fast kahlköpfigen, dicken Mann in einem Leinenanzug mit Kreppstreifen. Sein haariger Nacken wurde von dem steifen Kragen eingezwängt. »Wir nehmen das Angebot an«, wiederholte der Mann mit heiserer, von jahrzehntelangem Rauchen dunkler Stimme, die zugleich den angenehmen, gedehnten Akzent eines Mannes aufwies, der sein ganzes Leben in Virginia verbracht hatte. »Und wir entschuldigen uns beim Gericht dafür, seine kostbare Zeit verschwendet zu haben.«
»Es freut mich, dass Sie gerade zufällig hereingeschaut haben, Mr Graham«, sagte Walters.
Bobby Graham, der Staatsanwalt von Richmond, nickte knapp und verließ den Saal dann durch die Doppelglastür. Er hatte Fiske keine Entschuldigung der Staatsanwaltschaft angeboten, doch der Verteidiger beharrte auch gar nicht darauf. Vor Gericht bekam man nur selten alles, was man verlangte.
»Der Antrag der Staatsanwaltschaft wird kostenpflichtig abgewiesen«, erklärte Richter Walters und schaute Williams an. »Mr Williams, ich glaube, Sie sollten wirklich ein Bier mit Mr Fiske trinken. Aber Sie sollten es ihm ausgeben, mein Sohn.«
Als der nächste Fall aufgerufen wurde, schnappte Fiske seinen Aktenkoffer und verließ den Saal. Williams folgte ihm auf dem Fuße.
»Sie hätten mein erstes Angebot annehmen sollen, Paulie.«
»Das werde ich nicht vergessen, Fiske«, sagte Williams wütend.
»Bloß nicht!«
»Wir werden Jerome Hicks trotzdem einbuchten«, schnaubte Williams. »Glauben Sie ja nicht, dass wir aufgeben.«
Für Paulie Williams und die meisten anderen städtischen Staatsanwälte, mit denen Fiske zu tun hatte, waren die Mandanten lebenslange persönliche Feinde, die allesamt die härtesten Strafen verdienten. Das wusste Fiske nur zu gut. Und er wusste, dass die Staatsanwaltschaft bei manchen Angeklagten goldrichtig damit lag. Aber nicht bei allen.
»Wissen Sie, worüber ich gerade nachdenke?«, wandte Fiske sich an den Staatsanwalt. »Ich frage mich, wie schnell zehntausend Jahre vergehen können.«
Als Fiske den Gerichtssaal im zweiten Stock verließ, kamen ihm Polizeibeamte entgegen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, als er noch Cop in Richmond gewesen war. Einer von ihnen lächelte und nickte zum Gruß, die anderen aber schauten Fiske nicht einmal an. Für sie war er ein Verräter an der Truppe; er hatte Dienstmarke und Waffe gegen Anzug und Aktenkoffer eingetauscht. War jetzt Sprachrohr der anderen Seite. In der Hölle sollst du schmoren, Bruder Fiske!
Fiske schaute zu einer Gruppe junger Schwarzer hinüber, deren Bürstenhaarschnitt so kurz war, dass sie geradezu kahl geschoren wirkten. Die Hosen hingen bis zum Schritt hinab. Man konnte ihre Boxershorts sehen, weite Lederjacken, unförmige Tennisschuhe ohne Schnürsenkel. Ihr offener Trotz gegen das Strafrechtssystem war mehr als deutlich.
Die jungen Männer drängten sich um ihren Anwalt, einen Weißen, dickleibig vom vielen Sitzen im Büro, verschwitzt; die Manschetten seines Hemds unter dem teuren Nadelstreifenanzug waren speckig, die Halbschuhe ausgelatscht, und die Hornbrille saß ein wenig schief auf der Nase, während er seinen Pfadfindern etwas einzuhämmern versuchte. Er schlug mit der Faust in eine fleischige Handfläche, als er zu den jungen Schwarzen redete. Mit den nackten Oberkörpern unter den geöffneten Seidenhemden, die sie sich vom Drogengeld gekauft hatten, boten sie ein beinahe lächerliches Bild, während sie dem fetten Anwalt aufmerksam lauschten, offenbar in dem Glauben, dies sei das einzige Mal, dass sie diesen Mann brauchten, den sie sonst nur mit Verachtung betrachtet hätten oder durch das Visier einer Waffe. Bis sie ihn das nächste Mal brauchten. Und sie würden ihn brauchen. In diesem Gebäude war er der Zauberer, war er Magic. Hier kam Michael Jordan nicht an ihn heran. Sie waren die dummen Stammeskrieger und er der König des Dschungels. Hilf uns, Tarzan! Sorg dafür, dass sie uns nicht einbuchten!
Fiske wusste, was der Mann im Anzug sagte, als könnte er ihm von den Lippen lesen. Der Dicke hatte sich darauf spezialisiert, Bandenmitglieder zu verteidigen. Bei jedem Verbrechen, an dem sie zufällig beteiligt gewesen waren, war die beste Strategie: Ehernes Schweigen, Leute! Ihr habt nichts gesehen, nichts gehört. Ihr könnt euch an gar nichts erinnern. Schüsse? Wahrscheinlich Fehlzündungen eines Motors. Vergesst nicht, Jungs: Ihr sollt nicht töten! Aber wenn ihr schon töten müsst, solltet ihr euch wenigstens nicht gegenseitig in die Pfanne hauen. Um seinen Worten zusätzlichen Nachdruck zu verleihen, schlug der Fette mit der Handfläche auf seinen Aktenkoffer. Die Gruppe löste sich auf, und das Spiel begann.
Ein Stück weiter den Gang hinunter saßen auf einer klobigen, mit grauem Teppich bezogenen Bank, die in die Wand eingelassen war, drei Mädchen im Teenageralter, die nachts auf den Strich gingen. Die bunt gemischte Gruppe – eine Schwarze, eine Asiatin, eine Weiße – wartete darauf, dass die Rechtsprechung sich ihrer annahm. Die Asiatin wirkte nervös, brauchte wahrscheinlich eine Zigarette zur Beruhigung oder einen Schuss. Den beiden anderen sah man an, dass sie altgediente Bordsteinschwalben waren. Sie schlenderten umher, setzten sich wieder, zeigten ein bisschen Schenkel, wackelten gelegentlich mit den Brüsten, wenn ein alter Knacker oder junger Spund vorüberkam. Warum wegen einer kleinen Sache vor Gericht ein Geschäft sausen lassen? Schließlich war man hier in Amerika.
Fiske nahm den Fahrstuhl und ging am Metalldetektor und dem Röntgengerät vorüber – heutzutage Standardausstattung in praktisch jedem Gerichtsgebäude –, als Bobby Graham auf ihn zukam, eine unangezündete Zigarette in der Hand. Fiske mochte den Mann weder persönlich noch beruflich. Staatsanwalt Graham suchte sich die Fälle, die er zur Anklage brachte, nach der Größe der Schlagzeilen aus, die sie ihm einbringen würden. Nie übernahm er einen Fall, bei dem er sich wirklich ins Zeug legen musste, um zu gewinnen. Die Öffentlichkeit mochte keine Staatsanwälte, die den Kürzeren zogen.
»Nur ein kleiner Routineantrag in einem Allerweltsfall, was?«, sagte Fiske. »Der große Boss weiß mit seiner Zeit doch eigentlich was Besseres anzufangen, stimmt’s, Bobby?«
»Vielleicht hatte ich so eine Ahnung, dass Sie einen meiner kleinen Anwälte mit Haut und Haaren fressen und wieder ausspucken wollten. Hätten Sie es mit einem schweren Kaliber zu tun gehabt, wäre Ihnen das nicht so leicht gefallen.«
»Mit wem denn? Mit Ihnen, zum Beispiel?«
Mit einem schiefen Lächeln schob Graham sich die Zigarette zwischen die Lippen. »Es ist ein Witz, finden Sie nicht auch? Angeblich wohnen wir in der Hauptstadt des Tabaks, die größte Zigarettenfabrik der Welt ist nur einen Katzensprung entfernt, und man darf in den heiligen Hallen der Justiz nicht mal rauchen.« Er kaute am Ende seiner filterlosen Pall Mall und sog lautstark an der kalten Zigarette. In Wirklichkeit waren im Gerichtsgebäude von Richmond Raucherzonen ausgewiesen, nur nicht dort, wo Graham zufällig gerade stand.
Der Staatsanwalt ließ sich zu einem triumphierenden Grinsen hinreißen. »Ach, übrigens, Jerome Hicks wurde heute Morgen wegen Mordverdachts an einem Burschen drüben in der Southside festgenommen. Eine Sache zwischen Schwarzen. Drogen waren auch im Spiel. Mann, was für ’ne Überraschung. Offensichtlich wollte er seinen Koksbestand aufbessern, ohne die normalen Akquisitionskanäle zu benutzen. Aber Ihr guter Jerome konnte nicht ahnen, dass wir sein Opfer beschatten ließen.«
Fiske lehnte sich müde an die Wand. Siege vor Gericht waren häufig ohne Wert, vor allem, wenn der Mandant seine kriminellen Neigungen nicht im Zaum halten konnte. »Wirklich? Davon wusste ich noch gar nichts.«
»Ich musste zu einer Prozess-Vorbesprechung hierher kommen, und da dachte ich mir, ich sag’s Ihnen persönlich. Kollegiale Höflichkeit.«
»Wie wahr«, sagte Fiske trocken. »Warum haben Sie Paulie Williams mit seinem Antrag nicht zurückgepfiffen, wenn Sie es schon wussten?« Als Graham nicht reagierte, beantwortete Fiske seine Frage selbst. »Wollten Sie mich nur durch den Reifen springen lassen?«
»Man muss sich bei der Arbeit auch mal ein bisschen Spaß gönnen.«
Fiske ballte eine Hand zur Faust, öffnete sie rasch wieder. Graham war es nicht wert, sich zu ärgern. »Apropos Höflichkeit unter Kollegen … gab es Augenzeugen?«
»Oh, ungefähr ein halbes Dutzend, und die Mordwaffe hat man zusammen mit Jerome in dessen Wagen gefunden. Als er fliehen wollte, hätte er um ein Haar zwei Polizisten überfahren. Wir haben Blutspuren, die Drogen … wir haben alles hübsch beisammen. Man hätte dem Kerl gar keine Kaution gewähren dürfen. Ich überlege mir ernsthaft, diese windige Anklage wegen Drogenhandels fallen zu lassen, bei der Sie ihn vertreten, und mich nur auf die neue Entwicklung zu konzentrieren. Ich muss meine beschränkten Möglichkeiten voll ausschöpfen. Dieser Hicks ist ein schlimmer Finger, John. Ich glaube, wir werden in diesem Fall die Todesstrafe beantragen müssen.«
»Die Todesstrafe? Also, jetzt machen Sie aber ’nen Punkt, Bobby.«
»Die bewusste, absichtliche und vorsätzliche Tötung eines Menschen in Tateinheit mit Raub ist Mord, und der zieht nun mal die Todesstrafe nach sich. Das steht zumindest in meinem Gesetzbuch des Staates Virginia.«
»Mir ist scheißegal, was das Gesetz besagt. Hicks ist erst achtzehn.«
Graham verzog das Gesicht. »Seltsame Worte von einem Anwalt, der geschworen hat, die Gesetze zu achten.«
»Das Gesetz ist für mich ein Sieb, das dazu dient, die Tatsachen herauszufiltern und den Dreck aufzufangen.«
»Genau. Diese Brüder sind Dreck. Abschaum. Kommen aus dem Mutterleib gekrochen, um anderen Menschen etwas anzutun. Wir sollten Gefängnisse für Kleinkinder bauen, bevor diese Arschlöcher heranwachsen und jemanden verletzen können.«
»Jerome Hicks’ ganze Jugend war …«
»Genau, schieben Sie es auf seine beschissene Kindheit«, unterbrach Graham ihn. »Immer wieder die alte Leier!«
»Genau, immer wieder dieselbe alte Leier.«
Graham lächelte und schüttelte den Kopf. »Hören Sie, ich bin auch nicht mit einem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen. Wollen Sie mein Geheimnis wissen? Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um es zu etwas zu bringen. Und wenn ich es schaffen kann, können andere es auch. Fall abgeschlossen.«
Fiske ging davon, schaute dann aber noch einmal zurück. »Lassen Sie mich einen Blick in den Polizeibericht über die Verhaftung werfen. Ich rufe Sie dann an.«
»Wir haben nichts zu besprechen.«
»Wenn der Junge hingerichtet wird, bringt Ihnen das auch nicht das Amt des Attorney-General ein, Bobby, und das wissen Sie. Da müssen Sie sich schon eine größere Zielscheibe aussuchen.« Fiske wandte sich ab und ging davon.
Graham drehte die Zigarette zwischen den Fingern. »Besorgen Sie sich mal einen richtigen Job, Fiske.«
Eine halbe Stunde später traf John Fiske sich in einem Bezirksgefängnis in einem Vorort mit einem seiner Mandanten. Sein Beruf als Anwalt führte ihn oft aus Richmond hinaus, in die Bezirke Henrico, Chesterfield, Hanover, sogar bis nach Goochland. Es gab immer mehr Arbeit, immer mehr Stress. Fiske war nicht besonders erfreut darüber, hatte sich aber damit abgefunden. Mittlerweile war es für ihn so selbstverständlich wie die Tatsache, dass jeden Morgen die Sonne aufging. Es würde immer so weitergehen – bis zu dem Tag, an dem alles endete.
»Ich muss mit Ihnen über ein Teilgeständnis sprechen, Derek. Dann könnte ich ein milderes Strafmaß für Sie herausholen.«
Derek Brown – oder DB-1, wie er auf den Straßen genannt wurde – war ein hellhäutiger Schwarzer, dessen Arme mit hasserfüllten, obszönen und malerischen Tätowierungen verziert waren. Er hatte so lange im Gefängnis gesessen, dass seine Haut gelbbraun wirkte; Adern zogen sich wie Würmer über seine Bizepse. Fiske hatte Derek einmal dabei beobachtet, wie er auf dem Sportplatz des Gefängnisses mit nacktem Oberkörper Basketball spielte. Er war sehr muskulös und hatte weitere Tätowierungen auf Rücken und Schultern. Aus der Ferne sah es wie eine bizarre Orchesterpartitur aus. Derek konnte in die Höhe schnellen wie ein Pfeil, um dann traumgleich zu schweben, von irgendetwas in der Luft gehalten, das Fiske nicht sehen konnte. Die anderen Gefangenen, sogar die Wächter drehten sich zu ihm um und schauten bewundernd zu, wenn der junge Bursche den Ball in den Korb warf, hämmerte oder streichelte. Aber Derek war nie gut genug gewesen, um in einer Collegemannschaft zu spielen, ganz zu schweigen von der NBA. Deshalb saßen sie beide nun hier im Bezirksgefängnis und musterten sich gegenseitig.
»Die Staatsanwaltschaft bietet vorsätzliche Körperverletzung an. Was allerdings immer noch ein Kapitalverbrechen wäre.«
»Warum nicht fahrlässige Körperverletzung, Mann? Oder im Affekt?«
Fiske starrte ihn an. Diese Burschen standen so oft vor Gericht, dass sie das Strafgesetzbuch besser kannten als die meisten Anwälte.
»Körperverletzung im Affekt … das wäre in der Hitze des Gefechts gewesen, Derek. Ihre Hitze kam einen Tag später.«
»Der Typ hatte ’ne Knarre. Ich leg mich doch nich’ mit ’nem Wichser an, wenn der ’ne Wumme hat, Mann. Und ich hatte meine nich’ dabei. Sind Sie blöd, Mann, oder was?«
Fiske hätte am liebsten ausgeholt und dem Jungen Vernunft eingebläut. »Tut mir Leid, die Staatsanwaltschaft geht nicht von vorsätzlicher Körperverletzung runter.«
»Wie lange müsste ich sitzen?«, fragte Derek frostig. Seine Ohrläppchen waren durchstochen, mindestens zwölfmal, wie Fiske zählte.
»Fünf Jahre, die Untersuchungshaft eingerechnet.«
»Oh, Scheiße! Fünf Jahre, weil ich Pack ’n bisschen mit ’nem verdammten Taschenmesser angekratzt hab?«
»Mit einem Stilett. Ein Stilett mit fünfzehn Zentimeter langer Klinge. Und Sie haben ihn nicht angekratzt, sondern zehnmal auf ihn eingestochen. Vor Zeugen.«
»Mann, der Typ hat meine Schnalle angemacht. Sind das nich’ mildernde Umstände?«