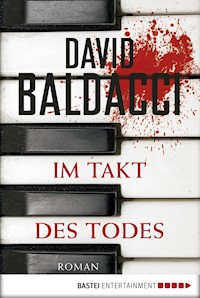9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Vertraue niemandem, töte jeden!
In einem Bunker unterhalb von Washington, D.C. trifft sich eine Gruppe von Männern, um eine junge Frau zum Tode zu verurteilen. Das Opfer ist Faith Lockhart, eine Lobbyistin, die aussagen will, was sie über Bestechungen in Washington weiß. Aus diesem Grund steht sie unter dem Schutz des FBI. Als beim Attentat auf Faith ihr Bewacher getötet wird, entkommt sie mit Hilfe des Privatdetektivs Lee Adams. Auf der gemeinsamen Flucht vor den Profi-Killern decken die beiden eine unglaubliche Verschwörung auf. Aber kann Faith ihrem Begleiter wirklich trauen?
"Die Verschwörung" - der hochspannende Thriller von Bestsellerautor David Baldacci.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber den AutorTitelImpressumWidmungDanksagungKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47KAPITEL 48KAPITEL 49KAPITEL 50KAPITEL 51KAPITEL 52KAPITEL 53KAPITEL 54KAPITEL 55KAPITEL 56KAPITEL 57KAPITEL 58KAPITEL 59Über den Autor
Mit seinem ersten Roman, Der Präsident, verfilmt als Absolute Power, stürmte David Baldacci die internationale Thrillerszene. Seitdem sind von ihm auf Deutsch zehn weitere Romane erschienen, die alle zu Bestsellern wurden. Weltweit erschienen seine Bücher in vierzig Sprachen, mit einer Gesamtauflage von über fünfzig Millionen Exemplaren.
Nach Im Bruchteil der Sekunde und Mit jedem Schlag der Stunde ist dies ein weiterer Band in der Serie um das Ermittlerduo Sean King und Michelle Maxwell.
David Baldacci lebt mit seiner Familie in der Nähe von Washington D.C.
David Baldacci
DieVerschwörung
Roman
Aus dem Amerikanischen vonUwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Columbus Rose, Ltd.
Titel der englischen Originalausgabe: »Saving Faith«
Published by arrangement with Warner Books, Inc., New York
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
unter Mitarbeit von Ronald M. Hahn
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln, unter Verwendung eines Fotos von IMAGE BANK
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1712-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meinen FreundAaron Priest
DANKSAGUNG
Meiner lieben Freundin Jennifer Steinberg, die eine Fülle von Informationen für mich aufgespürt hat. Aus dir wäre eine großartige Privatdetektivin geworden!
Meiner Frau Michelle, die mir stets die Wahrheit über meine Bücher sagt.
Neal Schiff vom fbi für die ständige Hilfe und Zusammenarbeit bei meinen Romanen.
Mein besonderer Dank gilt fbi-Spezialagent Shawn Henry, der mir großzügig seine Zeit, seine Fachkenntnisse und seinen Enthusiasmus schenkte und mir geholfen hat, ein paar schlimme Schnitzer in der Story zu vermeiden. Deine Kommentare waren ein großer Gewinn für das Buch, Shawn.
Martha Pope für ihr wertvolles Insiderwissen in Sachen Capitol Hill und ihre Geduld mit einem politisch Ahnungslosen. Du wärst eine hervorragende Lehrerin, Martha!
Bobby Rosen, Diane Dewhurst und Marty Paone, die mir von ihren beruflichen Erlebnissen und Erinnerungen erzählt haben.
Tom DePont, Dale Barto und Charles Nelson von der NationsBank für ihre Hilfe bei wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Themen.
Joe Duffy, der mir die Entwicklungshilfe der usa und deren Mechanismen erklärt hat, und seiner Frau Anne Wexler, die ihre wertvolle Zeit und ihr Wissen mit mir teilte.
Ganz besonderer Dank gebührt meinem Freund Bob Schule, der mir bei der Entstehung dieses Romans außerordentlich geholfen hat und mir nicht nur faszinierende Einzelheiten über seine lange und außergewöhnliche Karriere in Washington erzählte, sondern auch zahlreiche Freunde und Kollegen ansprach, um mir ein besseres Verständnis für Politik und Lobbyismus zu verschaffen und dafür, wie Washington wirklich funktioniert. Du bist ein wunderbarer Freund und echter Profi, Bob.
Mein Dank gilt weiter dem Abgeordneten Rod Blagojevich (Demokratische Partei, Illinois), der mir Einblicke ins Leben eines Parlamentariers gewährte.
Dem Abgeordneten Tony Hall (Demokratische Partei, Ohio), der mir ein besseres Verständnis für das Elend der Armen dieser Welt vermittelte und dafür, wie dieses Thema in Washington behandelt wird (oder auch nicht).
Meinem guten Freund und Verwandten, dem Abgeordneten John Baldacci (Demokratische Partei, Maine) für seine Hilfe und Unterstützung bei diesem Projekt. Wären in Washington alle so wie John, wäre die Handlung dieses Romans völlig unglaubhaft.
Larry Benoit und Bob Beene für ihre Hilfe in allen Fragen des Lobbyismus und die praktischen Grundlagen der Regierungsarbeit bis zu den letzten Eckchen und Winkeln im Kapitol. Ihnen verdanke ich eine meiner Lieblingsszenen in diesem Roman.
Mark Jordan von Baldino’s Lock and Key, der mir erklärt hat, wie Alarmanlagen und Telefonsysteme arbeiten und wie man sie knackt. Mark, du bist der Größte.
Steve Jennings, der wie üblich jedes Wort gelesen und dazu beigetragen hat, den Roman zu verbessern.
Meinen lieben Freunden David und Catherine Broome, die mir die Landschaft North Carolinas gezeigt und mich fortwährend ermutigt und unterstützt haben.
All jenen, die zu diesem Roman beigetragen haben, doch aus einer Vielzahl von Gründen anonym bleiben möchten. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.
Meiner Lektorin und Freundin Frances Jalet-Miller. Ihr Geschick, ihre Ermutigung und freundliche Überzeugungskraft waren genau das, was ein Autor sich von einer Lektorin wünscht. Auf viele weitere gemeinsame Bücher, Francie.
Letztlich, doch keinesfalls an letzter Stelle, danke ich Larry, Maureen, Jamie, Tina, Emi, Jonathan, Karen Torrres, Martha Otis, Jackie Joiner und Jackie Meyer, Bruce Paonessa, Peter Mauceri und allen anderen im Verlag Warner Books. Es brauchte uns alle, um es zu schaffen.
Sämtliche genannten Personen haben mir das Wissen und die Hilfe gegeben, diesen Roman zu schreiben. Doch wie ich diese Hilfe umgesetzt habe, um in Die Verschwörung die Winkelzüge, Gaunereien und ausgemachten Verbrechen unter einen Hut zu bringen und Verschwörer und Kriminelle zu schildern, habe ich allein zu verantworten.
KAPITEL 1
Der große Raum lag tief unter der Erde und war nur durch einen Expressaufzug zu erreichen. Man hatte diesen Raum in den frühen sechziger Jahren als geheimes Projekt erbaut; offiziell waren damals Renovierungsarbeiten an einem Privatgebäude vorgenommen worden, unter dem sich dieser Raum befand – ein »Superbunker«, der ursprünglich als Schutzraum bei einem atomaren Angriff dienen sollte. Der Bunker war jedoch nicht für die oberste Führungsschicht der amerikanischen Regierung bestimmt gewesen, sondern für Personen, die als »zweitrangig« eingestuft wurden und wahrscheinlich nicht in der Lage wären, sich zu retten, denen aber ein höheres Maß an Schutz zugestanden wurde als dem Normalbürger. Selbst bei der völligen Vernichtung musste politisch alles seine Ordnung haben.
Der Bunker war zu einer Zeit erbaut worden, als die Leute es noch für möglich hielten, einen direkten atomaren Treffer zu überleben, sofern sie sich tief unter der Erdoberfläche in einen stählernen Kokon einschlossen. Nachdem der atomare Holocaust den Rest des Landes vernichtet hatte, würden die politisch Verantwortlichen sich aus den Trümmern wühlen, auch wenn es dann nichts mehr gab, für das man noch politische Verantwortung hätte übernehmen können – es sei denn, für verdampfte Materie.
Das ursprüngliche oberirdische Gebäude war längst abgerissen worden, doch der Bunkerraum existierte noch immer. Er befand sich nun unter dem Gebäude eines seit Jahren leer stehenden Supermarkts. Vergessen von der Welt, diente der Bunker inzwischen bestimmten Personen, die für den größten Geheimdienst der usa arbeiteten, als Besprechungsraum. Die Sache war nicht ungefährlich, weil diese Konferenzen nichts mit den offiziellen Pflichten der Teilnehmer zu tun hatten und die Angelegenheiten, die bei den Treffen diskutiert wurden, ungesetzlich waren. An diesem Abend ging es um Mord, sodass man zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte.
Die superdicken Stahlwände waren mit einem Kupfermantel verstärkt. Dieser Mantel sowie Tonnen schallisolierender lockerer Erde zwischen dem Bunker und der Oberfläche boten Schutz vor neugierigen elektronischen Ohren, die im All oder sonst wo lauschen mochten. Niemand kam besonders gern in den unterirdischen Raum; er war unbequem und wirkte ironischerweise sogar auf Männer, die bekanntermaßen Sympathie für Heimlichtuerei empfanden, viel zu übertrieben. Doch die Erde wurde inzwischen von so vielen technisch hochgerüsteten Überwachungssatelliten umkreist, dass kaum ein Gespräch, das an der Oberfläche geführt wurde, vor Lauschern sicher war. Man musste sich schon in der Erde vergraben, um vor seinen Feinden in Sicherheit zu sein. Und wenn es einen Ort gab, an dem Personen sich im begründeten Vertrauen darauf versammeln konnten, dass ihre Gespräche in einer Welt ausgeklügeltster Beobachtungs- und Abhörtechnologie nicht verfolgt werden konnten, dann war es dieser Bunker.
Die Männer, die sich an diesem Tag zu einem ihrer Treffen versammelt hatten, waren ausnahmslos grauhaarige Herren weißer Hautfarbe, von denen die meisten auf die Sechzig zugingen, das bei ihren Arbeitgebern übliche Rentenalter. Unauffällig und sachlich gekleidet, hätten sie Ärzte, Anwälte oder Anlageberater sein können. Es waren durchweg Männer von der Sorte, die man einen Tag, nachdem man ihnen das erste Mal begegnet war, schon wieder vergessen hatte. Anonymität war ihr Handwerkszeug. Bei Menschen wie ihnen hing das Leben – oder ein gewaltsamer Tod – von solchen Feinheiten ab.
Die Mitglieder dieser Clique kannten Tausende von Geheimnissen, die der Öffentlichkeit nie zugänglich gemacht werden konnten, weil sie mit einem Sturm der Empörung auf die Taten reagiert hätte, die für das Entstehen dieser Geheimnisse verantwortlich waren. Doch Amerika verlangte oft nach bestimmten Ergebnissen wirtschaftlicher, politischer, gesellschaftlicher oder anderer Natur, die nur zu erreichen waren, wenn man bestimmte Teile der Welt blutig schlug. Die Aufgabe dieser Männer bestand darin, Mittel und Wege zu finden, wie man so etwas in aller Heimlichkeit anstellte, damit kein schlechtes Licht auf die Vereinigten Staaten fiel und das Land vor den verfluchten internationalen Terroristen und anderen Ausländern geschützt blieb, denen es nicht passte, wenn Amerika die Muskeln spielen ließ.
An diesem Abend hatte man sich im Bunker versammelt, um über die Planung des Mordes an Faith Lockhart zu diskutieren. Technisch gesehen war es der cia auf Grund einer vom Präsidenten erlassenen Durchführungsverordnung zwar verboten, sich an Mordverschwörungen zu beteiligen, doch diese Männer, die ausnahmslos der cia angehörten, waren heute Abend nicht als Vertreter des Geheimdienstes anwesend. Es war eine eher private Zusammenkunft, und man war sich nahezu einig darüber, dass die Frau sterben musste, und zwar bald. Ihr Tod war unerlässlich für das Wohlergehen der Vereinigten Staaten. Mochte es nicht einmal der Präsident wissen – die Anwesenden wussten es. Weil es bei dem Mordanschlag jedoch auch um ein zweites Menschenleben ging, waren die Diskussionen erbittert geworden, und die Versammelten erinnerten an Abgeordnete, die sich auf dem Capitol Hill Gefechte um Regierungszuschüsse in Milliardenhöhe lieferten.
»Sie wollen damit also sagen«, meinte einer der Weißhaarigen und stieß einen schlanken Finger in die rauchgeschwängerte Luft, »dass wir zusammen mit der Lockhart auch einen fbi-Agenten töten müssen.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum einen der unseren? Das kann nur zu einer Katastrophe führen.«
Der Mann am Kopfende des Tisches nickte gedankenvoll. Robert Thornhill war der höchstdekorierte Kalte Krieger der cia; sein Status beim Geheimdienst war einmalig, sein Ruf makellos und die Liste seiner beruflichen Siege unerreicht. Als stellvertretender Leiter der Operationsabteilung genoss Thornhill die größten Freiheiten und war verantwortlich für den Einsatz der Außenagenten und die geheime Anwerbung ausländischer Spitzel. Die Einsatzleitung der cia kannte man außerdem inoffiziell als »Spionageladen«. Ihr stellvertretender Leiter war der Öffentlichkeit völlig unbekannt – für Thornhill die perfekte Ausgangslage, bedeutungsvolle Arbeit zu leisten.
Er hatte die Angehörigen der auserlesenen Gruppe, die ebenso wie er über den Zustand der cia bestürzt waren, selbst zusammengestellt. Er war es auch gewesen, der gewusst hatte, dass der Bunker, diese weitläufige unterirdische Zeitkapsel aus den frühen Sechzigern, immer noch existierte. Und er hatte das Geld aufgetrieben, um den Bunker heimlich wieder auf Vordermann und seine technische Einrichtung auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Es gab im ganzen Land Tausende dieser kleinen, von Steuerzahlern finanzierten Spielzeuge, doch viele waren völlig verfallen. Thornhill unterdrückte ein Lächeln. Tja, was hätte die Regierung noch zu tun, wenn sie nicht das schwer verdiente Geld der Bürger aus dem Fenster werfen könnte?
Auch jetzt, als seine Hand über die Konsole aus rostfreiem Stahl mit den drolligen Einbau-Aschenbechern fuhr, als er die gefilterte Luft roch und die schützende Kühle der ihn umgebenden Erde spürte, schweiften seine Gedanken für einen Augenblick in die Ära des Kalten Krieges zurück. Damals hatten Hammer und Sichel immerhin ein bestimmtes Maß an Gewissheit bedeutet; der schwerfällige russische Stier war Thornhill lieber als die wendige Sandviper, bei der man erst wusste, ob sie in der Nähe lauerte, wenn sie zubiss und einem ihr Gift in die Adern spritzte. Es gab viele Leute, die sich im Leben nichts sehnlicher wünschten, als die usa in die Knie brechen zu lassen. Es war Thornhills Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nie dazu kam.
Er ließ den Blick in die Runde schweifen und erkannte zufrieden, dass die Hingabe der anderen Anwesenden zu ihrem Land der seinen in nichts nachstand. Thornhill hatte Amerika schon seit früher Kindheit dienen wollen. Sein Vater war beim oss gewesen, dem Vorläufer der cia im Zweiten Weltkrieg. Thornhill senior hatte nur wenig von dem verlauten lassen, was er damals getan hatte, doch er hatte dem Sohn die Philosophie eingeimpft, dass es im Leben nichts Größeres gab, als seinem Land zu dienen. Gleich nach dem Studium in Yale war der junge Thornhill zur cia gegangen. Sein Vater war bis zu seinem Todestag stolz auf ihn gewesen. Und der Sohn war stolz auf den Vater.
Thornhills silbern schimmerndes Haar verlieh ihm eine distinguierte Ausstrahlung. Seine Augen waren grau und lebhaft, sein Kinn energisch, die Stimme tief und kultiviert. Technische Fachausdrücke kamen ihm ebenso leicht und klangvoll über die Lippen wie Gedichte von Longfellow. Er trug noch immer Anzüge mit Weste und rauchte lieber Pfeife als Zigaretten. Der achtundfünfzigjährige Mann hätte seine Zeit bei der cia in aller Ruhe absitzen und dann das ruhige Leben eines weit gereisten und kultivierten Exstaatsdieners führen können. Doch er hatte nicht vor, sich in aller Stille zu verabschieden. Der Grund dafür war glasklar.
In den letzten zehn Jahren waren die Zuständigkeiten und der Etat der cia immer mehr beschnitten worden. Es war eine katastrophale Entwicklung; denn die Feuerstürme, die in verschiedenen Teilen der Erde aufloderten, wurden immer häufiger von fanatischen Köpfen entfacht, die man keinem politischen Körper zurechnen konnte und die obendrein die Mittel besaßen, sich Massenvernichtungswaffen anzueignen. Doch während fast allgemein die Ansicht vertreten wurde, Hochtechnologie sei die Antwort auf alle Schlechtigkeiten auf Erden, wusste Thornhill nur zu gut, dass nicht einmal die besten irdischen Satelliten die Gefühlslage der Menschen in den Straßen von Bagdad, Seoul oder Belgrad messen konnten. Kein Computer in der Erdumlaufbahn vermochte die Gedanken der Menschen aufzufangen oder zu erkunden, welche teuflischen Wünsche in ihren Herzen brannten. Deshalb würde Thornhill einen cleveren Außenagenten, der bereit war, sein Leben aufs Spiel zu setzen, jederzeit der besten Technik vorziehen, die man für Geld kaufen konnte.
Er verfügte über eine kleine Gruppe fähiger cia-Agenten, die ihm und seinen privaten Zielen absolut ergeben waren. Alle hatten hart dafür gearbeitet, der Agency wieder ihre einstige herausragende Stellung zurückzugeben. Und nun hatte Thornhill endlich das Mittel, eben dieses Ziel zu erreichen. Schon bald würde er mächtige Abgeordnete, Senatoren und sogar den Vizepräsidenten in der Hand haben – und genügend hochrangige Bürokraten, um jeden Ratschlag von außen zu ersticken. Man würde das cia-Budget wieder erhöhen, das Personal aufstocken, und der Geheimdienst würde wieder die Rolle in der Welt spielen, die ihm von Rechts wegen zustand.
Diese Strategie hatte bei J. Edgar Hoover und dem fbi funktioniert. Thornhill hielt es nicht für einen Zufall, dass der Etat und der Einfluss des fbi unter seinem verstorbenen Direktor und dessen angeblichen »Geheimakten« über mächtige Politiker gestiegen waren. Wenn es auf dieser Welt eine Organisation gab, die Robert Thornhill aus tiefstem Herzen hasste, war es das fbi. Er war bereit, jede Taktik anzuwenden, die seinen eigenen Laden wieder in die vorderste Reihe brachte, auch wenn dies bedeutete, seinem erbittertsten Gegner das eine oder andere abzuschauen. Tja, Ed, ich werde dir zeigen, wie man es noch besser macht.
Thornhill richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Männer, die um ihn versammelt waren. »Natürlich wäre es ideal, müssten wir keinen von unseren Leuten umbringen«, sagte er. »Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass das fbi Faith Lockhart rund um die Uhr bewacht. Sie ist nur verletzlich, wenn sie zu dem Haus geht. Und da die Möglichkeit besteht, dass sie ohne Ankündigung ins Zeugenschutzprogramm übernommen wird, müssen wir beide vor dem Haus erledigen.«
Ein anderer Mann meldete sich zu Wort. »Also gut, beseitigen wir Faith Lockhart – aber lassen Sie um Himmels willen den fbi-Mann am Leben, Bob.«
Thornhill schüttelte den Kopf. »Das Risiko ist zu groß. Ich weiß, es ist erbärmlich, einen Kollegen zu töten. Aber es wäre ein katastrophaler Fehler, uns vor der Pflicht zu drücken. Sie wissen doch, was wir in das Unternehmen investiert haben. Wir dürfen nicht versagen.«
»Verdammt noch mal, Bob«, sagte der Mann, der zuerst protestiert hatte, »wissen Sie, was passiert, wenn das fbi dahinter kommt, dass wir einen ihrer Leute liquidiert haben?«
»Wenn wir nicht mal das geheim halten können«, sagte Thornhill mit scharfer Stimme, »haben wir unseren verdammten Beruf verfehlt. Es ist doch nicht das erste Mal, dass Menschenleben geopfert werden müssen.«
Ein anderer Mann beugte sich im Sessel vor. Er war der jüngste Anwesende, hatte sich jedoch durch seine Intelligenz und die Fähigkeit, extreme und gezielte Brutalität anzuwenden, den Respekt der anderen erworben.
»Eigentlich haben wir bisher immer nur den Plan durchgespielt, Lockhart zu beseitigen, um den fbi-Ermittlungen gegen Buchanan zuvorzukommen. Warum wenden wir uns nicht an den fbi-Direktor, dass er seinen Leuten die Anweisung erteilt, die Ermittlungen einzustellen? Dann müsste keiner dran glauben.«
Thornhill maß den jüngeren Kollegen mit einem enttäuschten Blick. »Und wie würden Sie dem fbi-Direktor erklären, welche Gründe uns dazu bewegen?«
»Wie wäre es mit einer leichten Abwandlung der Wahrheit?«, erwiderte der jüngere Mann. »Selbst in der Geheimdienstbranche dürfte für so was hin und wieder Platz sein, oder?«
Thornhill lächelte gutmütig. »Der fbi-Direktor würde uns alle am liebsten auf Dauer in irgendeinem Museum ausstellen. Und seine Nachforschungen, um die es hier geht, könnten sich als Knüller erweisen. Und da soll ich zu ihm gehen und sagen, hören Sie, guter Mann, lassen Sie Ihre Untersuchung bitte einstellen, damit die cia illegale Mittel anwenden kann, um Ihren Laden zu übertrumpfen? – Genial. Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Und wo möchten Sie Ihre Gefängnisstrafe absitzen?«
»Du lieber Himmel, Bob, wir arbeiten jetzt mit dem fbizusammen. Wir leben nicht mehr in den sechziger Jahren. Vergessen Sie nicht das ctc.«
Das ctc war die Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung, eine gemeinsame Einrichtung von cia und fbi mit dem Ziel, durch gegenseitige Bereitstellung von Informationen und Mitteln die Wirksamkeit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu erhöhen. Das ctc war von den Beteiligten allgemein als Erfolg bewertet worden. Für Thornhill dagegen bot es dem fbi nur eine weitere Möglichkeit, seine gierigen Finger in die Angelegenheiten der cia zu stecken.
»Zufällig habe auch ich in bescheidenem Maße mit dem ctc zu tun«, sagte er. »Ich halte es für ideal, um das fbi und seine Pläne im Auge zu behalten. Und seine Pläne haben normalerweise nichts Gutes zu bedeuten, sofern sie uns betreffen.«
»Na hören Sie mal, Bob, wir sitzen doch alle im gleichen Boot.«
Thornhill blickte den jüngeren Mann auf eine Weise an, dass alle anderen im Raum erstarrten. »Sagen Sie diese Worte nie wieder in meinem Beisein«, erklärte er.
Der andere Mann erbleichte und sank im Sessel zurück. Thornhill klemmte sich das Mundstück seiner Pfeife zwischen die Zähne. »Soll ich Ihnen konkrete Fälle nennen, in denen das fbi die Lorbeeren für Erfolge eingeheimst hat, die auf unser Konto gehen? Für Ruhmestaten, bei denen unsere Agenten ihr Blut vergossen haben? Soll ich Ihnen sagen, wie oft wir die Welt vor dem Untergang bewahrt haben? Möchten Sie wissen, wie das fbi Ermittlungsergebnisse manipuliert, um als alleiniger Retter dazustehen, damit weitere Gelder in sein ohnehin aufgeblähtes Budget gepumpt werden? Soll ich Ihnen aus meiner sechsunddreißigjährigen Karriere Beispiele dafür nennen, wie das fbi alles daransetzte, die Aufgaben und Erfolge der cia und ihrer Agenten herabzuwürdigen? Wollen Sie das hören?« Der andere Mann schüttelte langsam den Kopf, während Thornhills bohrender Blick auf ihm ruhte. »Es wäre mir sogar scheißegal, wenn der fbi-Direktor persönlich hier herunterkäme, um mir den Hintern zu küssen und mir unverbrüchliche Treue zu schwören. Auch dann würde sich meine Meinung nicht ändern. Niemals. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Ich verstehe, was Sie meinen«, antwortete der jüngere Mann, auch wenn es ihn Mühe kostete, nicht verwundert den Kopf zu schütteln. Bis auf Robert Thornhill wusste jeder in diesem Raum, dass cia und fbi im Grunde gut miteinander auskamen. Obwohl das fbi bei gemeinsamen Operationen allein seiner Größe wegen manchmal schwerfällig vorging, veranstaltete es keine Hexenjagd mit dem Ziel, die cia in Misskredit zu bringen. Doch die Anwesenden wussten sehr genau, dass Robert Thornhill das fbi für ihren schlimmsten Feind hielt. Außerdem wussten sie, dass Thornhill bereits vor Jahrzehnten eine Vielzahl gerissener, hinterhältiger Morde inszeniert hatte – im Einvernehmen mit der cia-Führung. Einem solchen Mann kam man besser nicht in die Quere.
»Aber wird das fbi nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wenn wir den Agenten töten?«, wandte ein anderer Kollege ein. »Sie haben die Mittel, eine Politik der verbrannten Erde zu praktizieren. So gut wir auch sind, kräftemäßig ist das fbi uns überlegen. Und wie stehen wir dann da?«
Gemurmel entstand in der Runde. Thornhill ließ den Blick misstrauisch über die Gesichter schweifen. Die versammelten Männer waren unsichere Verbündete, ängstlich, undurchsichtig und seit langem daran gewöhnt, nur sich selbst zu trauen. Es war schon ein Wunder gewesen, sie alle unter einen Hut gebracht zu haben.
»Das fbi wird alles tun, den Mord an dem Agenten und der Hauptzeugin eines seiner bisher ehrgeizigsten und bedeutendsten Ermittlungsfälle aufzuklären. Aus diesem Grunde schlage ich vor, dass wir dem fbi die Lösung des Falles liefern – eine Lösung, wie wir sie für richtig halten.« Die Männer blickten Thornhill neugierig an. Er nippte an seinem Wasserglas; dann stopfte er gemächlich seine Pfeife.
»Nachdem Faith Lockhart unserem Freund Buchanan jahrelang geholfen hat, seinen Laden am Laufen zu halten, hat ihr die Angst, ihr Gewissen oder ihr gesunder Menschenverstand schließlich so sehr zugesetzt, dass sie zum fbi gegangen ist, um alles auszuplaudern, was sie weiß. Dank einer kleinen Vorsichtsmaßnahme meinerseits konnten wir diese Entwicklung voraussehen. Buchanan hat nicht die geringste Ahnung, dass seine Partnerin sich gegen ihn gestellt hat. Er weiß auch nicht, dass wir sie beseitigen wollen. Das wissen nur wir.« Im Stillen beglückwünschte Thornhill sich zu dieser Bemerkung. Sie kam gut an, machte ihn allwissend. Und Allwissenheit gehörte zu seiner Branche.
»Aber beim fbi könnte man auf den Gedanken kommen, dass Buchanan von Lockharts Verrat weiß oder irgendwann davon erfährt. Wenn also für einen außen stehenden Beobachter irgendjemand ein stichhaltiges Motiv hat, Faith Lockhart zu töten, dann ist es Danny Buchanan.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte jemand.
»Ganz einfach«, erwiderte Thornhill knapp. »Wir werden Buchanan nicht erlauben, von der Bildfläche zu verschwinden. Stattdessen geben wir dem fbi den Tipp, Buchanan und seine Kundschaft hätten Lockharts schrägen Zug entdeckt und sie und den Agenten ermorden lassen.«
»Wenn das fbi Buchanan schnappt, wird er doch alles ausplaudern«, erwiderte der andere Mann rasch.
Thornhill schaute ihn an wie ein enttäuschter Lehrer einen Schüler. Im Lauf des letzten Jahres hatte Buchanan ihnen alles geliefert, was sie brauchten. Nun brauchten sie Buchanan nicht mehr.
Langsam dämmerte den Anwesenden, was er meinte. »Wir stecken es dem fbi also nach Buchanans Ableben«, sagte ein anderer Mann. »Drei Leichen. – Korrektur: Drei Morde.«
Thornhill ließ den Blick durch den Bunkerraum schweifen und musterte schweigend die Gesichter der anderen, um ihre Reaktionen einzuschätzen, was die Änderung seines Plans betraf. Obwohl sie Vorbehalte hatten, einen fbi-Agenten zu ermorden, wusste Thornhill, dass den Männern drei Tote nichts bedeuteten. Sie waren vom alten Schlag und wussten genau, dass solche Opfer manchmal notwendig waren. Ihr Job kostete mitunter andere Menschen das Leben; andererseits hatte ihr Tun bisher einen offenen Krieg vermieden. Drei Menschen zu töten, um drei Millionen zu retten – wer konnte dagegen etwas einwenden? Selbst wenn die Opfer nahezu unschuldig waren. Jeder Soldat, der im Kampf fiel, war unschuldig. Thornhill war der Überzeugung, dass die cia ihren wahren Wert bei verdeckten Einsätzen beweisen konnte, die in nachrichtendienstlichen Kreisen den eigentümlichen Begriff »dritte Option« trugen, weil sie zwischen Diplomatie und offenem Krieg angesiedelt waren. Allerdings hatten sich gerade bei »dritten Optionen« einige der größten Katastrophen für die cia ereignet. Doch wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Eine passende Inschrift für Thornhills Grabstein.
Er ließ keine förmliche Abstimmung vornehmen. Sie war unnötig.
»Danke, meine Herren, ich werde mich um alles kümmern«, sagte er und beendete die Sitzung.
KAPITEL 2
Das Cottage mit den Holzschindeln stand allein am Ende einer kurzen Schotterstraße mit festgestampfter Fahrbahn, deren unbefestigter Rand von einem Gewirr wuchernder Pflanzen bewachsen war: Löwenzahn, Ampfer und Vogelmiere. Das kleine, baufällige Gebäude stand auf einem ebenen, hektargroßen Stück gerodeten Landes; an drei Seiten befand sich so dichter Wald, dass die Bäume einander bekämpften und versuchten, auf Kosten der Nachbarn Sonnenlicht zu ergattern. Die Feuchtgebiete in der Gegend und Probleme bei der Erschließung hatten dafür gesorgt, dass das achtzig Jahre alte Haus nie Nachbarn gekannt hatte. Der nächste Ort lag etwa fünf Autokilometer entfernt; für diejenigen, die mutig genug waren, sich zu Fuß durch die dichten Wälder zu schlagen, war es weniger als die Hälfte.
In den letzten zwanzig Jahren war das rustikale Cottage meist für improvisierte Teenagerpartys benützt worden, hin und wieder auch von Landstreichern, die sich nach der Bequemlichkeit und relativen Sicherheit von vier Wänden und einem Dach über dem Kopf sehnten, mochte beides noch so löchrig sein. Der jetzige Besitzer hatte die Bruchbude erst vor kurzem geerbt und schließlich beschlossen, sie zu vermieten – mit Erfolg. Der neue Bewohner hatte die Miete sogar für ein Jahr im Voraus bar bezahlt.
An diesem Abend wurde das schenkelhohe Gras vor dem Cottage von einem aufbrisenden Wind niedergedrückt und wieder aufgerichtet. Hinter dem Gebäude schien eine Reihe stämmiger Eichen die Bewegungen des Grases nachzuahmen; sie wiegten sich hin und her. Auch wenn es kaum möglich erschien – bis auf den Wind hörte man keine anderen Geräusche.
Nur eines.
Im Wald, ein paar Hundert Meter hinter dem Cottage, bewegten sich zwei Füße platschend durch ein seichtes Bachbett. Die schmutzige Hose des Mannes und seine durchnässten Stiefel kündeten von den Schwierigkeiten, mit denen er sich im Dunkeln durch das überwucherte Gelände bewegt hatte. Selbst das Licht des zu drei Vierteln vollen Mondes war ihm keine große Hilfe gewesen. Der Mann blieb stehen und wischte seine schlammigen Stiefel am Stumpf eines umgestürzten Baumes ab.
Nach diesem Gewaltmarsch war Lee Adams verschwitzt und durchgefroren zugleich. Er war einundvierzig Jahre alt, einsfünfundachtzig groß und außergewöhnlich kräftig. Er machte regelmäßig Krafttraining, wie man seinem Bizeps und den Rückenmuskeln ansehen konnte. In Lees Beruf war es sehr wichtig, gut in Form zu bleiben. Zwar musste er oft tagelang in Autos sitzen und observieren oder in Bibliotheken und Gerichtsgebäuden Mikrofiche-Aufzeichnungen durchsehen, hin und wieder jedoch kletterte er auf Bäume, schlug Männer zusammen, die größer waren als er, oder kämpfte sich – so wie jetzt – mitten in der Nacht durch Wälder, die von Wasserrinnen durchzogen waren. Ein kleines Extratraining konnte zwar nicht schaden, aber er war keine Zwanzig mehr, und das ließ sein Körper ihn spüren.
Lee hatte dichtes, welliges braunes Haar, das ihm ständig in die Stirn zu hängen schien, ein blitzendes, ansteckendes Lächeln, ausgeprägte Wangenknochen und anziehende blaue Augen, die Frauenherzen von vierzehn Jahren aufwärts höher schlagen ließen. Allerdings hatte er sich in seinem Job so viele Knochenbrüche und andere Verletzungen zugezogen, dass sein Körper ihm viel älter erschien, als er tatsächlich war, was er jeden Morgen beim Aufstehen zu spüren bekam. Abnutzungserscheinungen. Schmerzen. Krebsgeschwulste oder bloß Arthritis, fragte Lee sich manchmal. Was, zum Teufel, spielte es für eine Rolle? Wenn Gott deine Rückfahrkarte löst, hat er das Recht dazu. Dann ändern auch gesunde Ernährung, Gewichtheben oder Fitnesstraining nichts an seinem Entschluss, dir den Stecker rauszuziehen.
Lee spähte nach vorn. Er konnte das Cottage noch nicht sehen; das Walddickicht war zu dicht. Er fummelte an den Einstellknöpfen des Fotoapparats herum, den er aus seinem Rucksack genommen hatte, und atmete ein paar Mal tief durch.
Lee hatte die Tour zum Haus zwar schon mehrmals gemacht, das Innere des Hauses aber nie betreten. Allerdings hatte er Dinge gesehen – seltsame Dinge. Deswegen war er wieder hergekommen. Es war an der Zeit, mehr über das Geheimnis zu erfahren, das dieser Ort barg.
Als Lee wieder zu Atem gekommen war, marschierte er weiter. Seine einzigen Gefährten waren umherhuschende Wildtiere. Hirsche, Kaninchen, Eichhörnchen und sogar Biber gab es reichlich in diesem noch immer ländlichen Teil des nördlichen Virginia. Während er weiterging, lauschte er dem Flattern fliegender Geschöpfe. Er konnte sich nur huschende, tollwütige Fledermäuse vorstellen, die blind um seinen Kopf herumschwirrten. Und es kam ihm so vor, dass er alle paar Schritte geradewegs in einen Moskitoschwarm geriet. Wenngleich man Lee eine große Summe Bargeld als Vorschuss gezahlt hatte, dachte er ernsthaft darüber nach, seinen Tagessatz bei diesem Auftrag drastisch zu erhöhen.
Als er den Waldrand erreicht hatte, blieb er stehen. Er hatte beträchtliche Erfahrung, Schlupfwinkel zu erkunden und die Aktivitäten und Gewohnheiten anderer Menschen auszuspionieren. Dabei ging man am besten langsam und methodisch vor, wie ein Pilot mit seiner Checkliste. Man musste nur hoffen, dass nichts geschah, das einen zum Improvisieren zwang.
Lees gebrochene Nase war ein bleibendes Ehrenzeichen aus seiner Zeit als Amateurboxer bei der Marine. Damals hatte er seinen jugendlichen Aggressionen Luft gemacht, indem er im Ring mit Gegnern kämpfte, die es mit ihm aufnehmen konnten, was ihr Gewicht und ihr Können betraf. Lees damaliges Waffenarsenal waren Boxhandschuhe, schnelle Fäuste, flinke Beine, gute Reflexe und sehr viel Mumm gewesen. Meist hatte es zum Sieg gereicht.
Nach der Militärzeit war für ihn alles ziemlich gut gelaufen. Obwohl er seit vielen Jahren als Freiberufler arbeitete, war er zwar kein reicher Mann, aber auch kein armer Schlucker. Er war auch nie ganz allein, auch wenn er seit fast fünfzehn Jahren geschieden war.
Das einzig Gute, das seine Ehe hervorgebracht hatte, war vor kurzem zwanzig geworden. Seine Tochter war groß, blond und intelligent, stolze Inhaberin eines Stipendiums an der Universität von Virginia und der Star der Hochschul-Hockeymannschaft. In den vergangenen zehn Jahren hatte Renee Adams allerdings nicht das geringste Interesse gezeigt, irgendetwas mit ihrem Alten zu tun haben zu wollen – eine Entscheidung, die von ihrer Mutter uneingeschränkt begrüßt wurde, wenn nicht sogar auf ihr Drängen zurückzuführen war, wie Lee nur zu gut wusste. Dabei war seine Exfrau bei ihren ersten Verabredungen so lieb gewesen, so nett, so vernarrt in seine Marineuniform und so scharf darauf, mit ihm ins Bett zu gehen.
Um sich über den Verlust Lees hinwegzutrösten, hatte seine Verflossene, eine ehemalige Stripperin namens Trish Bardoe, einen Burschen namens Eddie Stipowicz geheiratet, einen arbeitslosen Ingenieur mit Alkoholproblemen. Lee hatte damals geglaubt, Trish würde geradewegs in eine Katastrophe schlittern, und hatte versucht, das Sorgerecht für Renee zu bekommen, da ihre Mom und ihr Stiefvater sich nicht um sie kümmern konnten. Tja, aber um diese Zeit erfand Eddie – ein hinterhältiger Hurensohn, den Lee nicht ausstehen konnte – mehr oder weniger zufällig irgendeinen blöden Mikrochip und war stinkreich geworden. Lees Kampf um das Sorgerecht hatte daraufhin ziemlich an Schwung verloren. Um der Ungerechtigkeit und Demütigung die Krone aufzusetzen, hatten das Wall Street Journal, Time, Newsweek und eine Reihe anderer Zeitschriften ausführliche Artikel über Eddie veröffentlicht. Er war berühmt. Im Architectural Digest hatte man sogar sein Haus vorgestellt.
Lee hatte sich ein Exemplar der Zeitschrift besorgt. Trishs neues Zuhause war ein riesiger Kasten – hauptsächlich scharlachrot und auberginefarben – und wirkte so finster, dass es Lee an das Innere eines Sarges erinnerte. Die Fenster waren so gewaltig, dass sie einer Kathedrale zur Ehre gereicht hätten, und das Interieur war so gigantisch, dass man sich darin verlaufen konnte. Ferner verfügte das Heim über genug Zierleisten, Holzvertäfelungen und Treppenhäuser, um eine durchschnittliche Stadt im Mittelwesten ein ganzes Jahr lang zu beheizen. Außerdem besaßen Trish und Eddie einen steinernen Springbrunnen mit den Skulpturen nackter Menschen darauf. Ein echter Hammer. Als Lee dann noch das doppelseitige Foto des glücklichen Paares sah, fiel ihm nur eine passende Unterzeile ein: »Herr Arschgeige und Frau Sexbombe – viel Geld und null Geschmack«.
Ein Foto jedoch hatte Lees ungeteilte Aufmerksamkeit erregt. Es zeigte Renee auf dem prächtigsten Hengst, den Lee je gesehen hatte; das Pferd stand auf einem tiefgrünen Rasen, der so makellos gemäht war, dass er wie die spiegelglatte Oberfläche eines Teichs aussah. Lee hatte das Foto sorgfältig ausgeschnitten und an einem sicheren Ort verwahrt – in seinem »Familienalbum«, wenn man es so nennen wollte. Natürlich wurde er selbst in dem Artikel mit keinem Wort erwähnt. Wozu auch?
Eins war Lee allerdings sauer aufgestoßen: Renee wurde als Eds Tochter bezeichnet. »Stieftochter«, hatte Lee beim Lesen vor sich hin gemurmelt. »Stieftochter. Das kannst du mir nicht auch noch wegnehmen, Trish.« Meist war er nicht neidisch auf den Reichtum seiner Exfrau; schließlich bedeutete dieser Wohlstand auch, dass es seiner Tochter an nichts mangelte. Aber irgendwie tat es ihm doch weh.
Wenn man jahrelang etwas besessen hat, das Teil von einem selbst war und das man mehr liebte, als vielleicht gut war, und wenn man es dann verliert ... nun ja, Lee gab sich alle Mühe, nicht zu eingehend über diesen Verlust nachzudenken. Er war zwar ein großer, starker Bursche und ein zäher Knochen, aber wenn er zuließ, dass seine Gedanken zu lange an dem klaffenden Loch in seiner Brust verweilten, endete es stets damit, dass er Rotz und Wasser heulte wie ein kleines Kind.
Manchmal war das Leben wirklich komisch. So komisch, als bekäme man eine Bombengesundheit attestiert, und am nächsten Tag fällt man tot um.
Lee musterte die verschlammten Hosenbeine, massierte sein müdes Bein, in dem ein schmerzhafter Krampf wütete, und verjagte gleichzeitig einen Moskito von einem Auge. Ein Haus, so groß wie ein Hotel. Bedienstete. Springbrunnen. Rassepferde. Schnittiger Privatjet ... Es war nicht auszuhalten.
Er drückte sich den Fotoapparat an die Brust. Er hatte einen 400er-Film eingelegt, den er »turbolud«, indem er die iso-Geschwindigkeit auf 1600 einstellte. Ein schneller Film brauchte weniger Licht; außerdem sorgte die kürzere Öffnungszeit der Blende dafür, dass die Fotos schärfer wurden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es durch Verwackeln oder Vibrationen der Kamera zu Verzerrungen kam, war wesentlich geringer. Lee schraubte ein 600-mm-Teleobjektiv auf und klappte das dreibeinige Stativ auseinander.
Er spähte zwischen den Ästen wilder Hornsträucher hindurch und konzentrierte sich auf die Rückseite des Cottage. Vereinzelte Wolken trieben am Mond vorbei und machten die Finsternis um ihn herum noch tiefer. Lee schoss mehrere Fotos; dann verstaute er die Kamera.
Er starrte wieder zum Haus, doch es war zu weit weg. Von seinem Standort aus konnte er nicht erkennen, ob es bewohnt war oder nicht. Zwar brannte nirgends ein Licht, aber vielleicht gab es in dem Gebäude Räumlichkeiten, die man von hier aus nicht überschauen konnte. Außerdem konnte er von hier die Vorderseite nicht sehen. Möglicherweise war dort ein Fahrzeug geparkt. Bei seinen früheren Märschen zu diesem Haus hatte Lee auf den Verkehr und die Fußspuren geachtet. Viel war allerdings nicht zu sehen gewesen. Offenbar fuhren nur wenige Autos diese Straße hinunter, und Spaziergänger oder Jogger gab es überhaupt nicht. Sämtliche Wagen, die Lee beobachtet hatte, hatten hier gewendet. Die Fahrer hatten offenbar eine falsche Abbiegung genommen. Alle bis auf eines.
Lee blickte zum Himmel. Der Wind hatte sich gelegt. Er schätzte grob, dass die Wolken den Mond noch einige Minuten verdecken würden. Er schulterte den Rucksack, verharrte einen Moment mit angespannten Muskeln, als wollte er seine ganze Kraft mobilisieren, und glitt dann zwischen den Sträuchern hervor.
Lee bewegte sich geräuschlos voran, bis er eine Stelle erreichte, wo eine Reihe überwucherter Büsche ihm Deckung bot. Von hier aus konnte er Vorder- und Rückseite des Hauses im Auge behalten. Während er beobachtete, hellten die Schatten sich auf, als der Mond wieder hinter den Wolken zum Vorschein kam – ein leuchtendes Gesicht, das Lee müßig zu beobachten und sich zu fragen schien, was er dort trieb.
Wenngleich die Gegend ziemlich einsam war, war die Innenstadt Washingtons nur vierzig Autominuten entfernt, was dieses Haus in vieler Hinsicht sehr praktisch machte. Lee hatte Erkundigungen über den Besitzer eingezogen und festgestellt, dass er sauber war. Dem Mieter jedoch kam man nicht so leicht auf die Spur.
Lee zog ein Gerät hervor, das wie ein Kassettenrecorder aussah, jedoch ein batteriebetriebener Türschlossknacker war. Dann folgte ein Etui mit Reißverschluss. Lee öffnete es, tastete die darin befindlichen Dietriche ab und suchte den heraus, den er benötigte. Mit einem Imbusschlüssel schraubte er den Dietrich am Gerät fest. Seine Finger bewegten sich schnell und sicher, auch dann noch, als wieder eine Wolkenbank über ihn hinwegzog und die Dunkelheit erneut tiefer wurde. Lee hatte diese Werkzeuge schon so oft benützt, dass jeder Handgriff auch mit verbundenen Augen gesessen hätte.
Er hatte sich die Schlösser des Hauses schon bei Tageslicht mit einem Hochleistungs-Feldstecher angeschaut und eine seltsame Entdeckung gemacht. An den Außentüren befanden sich Riegelschlösser. An den Fenstern im ersten und zweiten Stock waren Rahmenschlösser angebracht. Und sämtliche Schlösser und Beschlagteile sahen nagelneu aus. Nagelneue Schlösser an einem verfallenden Mietshaus am Arsch der Welt.
Als er darüber nachdachte, wurde er so nervös, dass ihm trotz des kühlen Wetters Schweißperlen auf die Stirn traten. Seine Hand legte sich kurz auf die Neun-Millimeter im Gürtelhalfter. Das Metall der Waffe hatte eine beruhigende Wirkung. Lee zog die Pistole hervor und machte sie feuerbereit, indem er den Sicherungshebel löste, den Hammer spannte, sodass eine Kugel in die Zündkammer transportiert wurde, und den Hebel wieder vorlegte.
Dass die Bruchbude sogar über ein elektronisches Sicherheitssystem verfügte, war der größte Hammer. Ein kluger Mann hätte sein Einbruchwerkzeug eingepackt und wäre nach Hause gefahren, um seinem Auftraggeber zu melden, dass nichts zu machen war. Aber Lee war stolz auf seinen Beruf. Er wollte auch diesen Auftrag zu Ende bringen – oder wenigstens so lange fortführen, bis etwas passierte, dass er es sich anders überlegte. Und wenn es sein musste, konnte Lee sehr schnell laufen.
Ins Haus einzudringen war eigentlich nicht besonders schwierig, insbesondere deshalb nicht, weil Lee den Zahlencode der Alarmanlage kannte. Lee hatte sich den Code bei seinem dritten Besuch an diesem Haus beschafft, als die beiden Leute hier erschienen waren. Lee hatte längst gewusst, dass das Haus verkabelt war; deshalb war er entsprechend vorbereitet gewesen. Er war vor den beiden hier eingetroffen und hatte gewartet, während das Paar im Innern der Bruchbude irgendetwas getrieben hatte. Nach Verlassen des Hauses hatte die Frau den Zugangscode eingegeben, um die Alarmanlage zu aktivieren. Lee hatte im gleichen Gebüsch gehockt wie jetzt. Er hatte zufällig ein elektronisches Gerät bei sich gehabt, das die Zahlenfolge des Codes sozusagen aus der Luft geschnappt hatte – wie einen Baseball, der präzise im Handschuh eines Fängers landet. Sämtliche elektrischen Strömungen erzeugen Magnetfelder, die wie kleine Sender wirken. Als die hoch gewachsene Frau die Zahlenfolge eingab, hatte die Alarmanlage für jede Zahl ein eigenständiges Signal abgestrahlt – genau in Lees elektronischen Fanghandschuh hinein.
Noch einmal ließ er den Blick über die Wolkendecke schweifen; dann zog er Latexhandschuhe mit verstärkten Fingerspitzen und Handflächenpolstern an, zückte eine Taschenlampe und holte erneut tief Luft. Augenblicke später trat er aus der Deckung der Büsche hervor und schlich leise zur Hintertür. Dort zog er die verschlammten Stiefel aus und stellte sie neben den Eingang. Bei seinem Besuch wollte er keine Spuren hinterlassen. Gute Privatschnüffler blieben unsichtbar. Er klemmte sich die Lampe unter den Arm, schob den Dietrich ins Schloss und aktivierte die Apparatur.
Lee benützte den elektronischen Türschlossknacker zum Teil aus Gründen der Schnelligkeit und Zeitersparnis, zum Teil aber auch deshalb, weil er noch nicht genug Schlösser von Hand geknackt hatte, um auf diesem Gebiet ein wahrer Könner zu sein. Man musste Dietriche und Spannwerkzeuge ständig einsetzen, wollte man seinen Fingern das nötige Feingefühl verleihen. Solche Instrumente waren sehr empfindlich, besonders dann, wenn die Zuhaltungen des Schlosses ihr Tänzchen begannen. Mit einem Dietrich und einem Spannwerkzeug konnte ein erfahrener Schlosser jedes Schloss schneller knacken als Lee mit seinem elektronischen Gerät. Aber das Schlösserknacken von Hand war eine wahre Kunst, und Lee kannte seine Grenzen. Kurz darauf spürte er, dass der Riegel zurückglitt.
Als er die Tür nach innen schob, erklang mit einem Mal das leise Piepen der Alarmanlage in der tiefen Stille. Augenblicke später hatte Lee die Steuertafel entdeckt und tippte rasch die sechsstellige Zahlenfolge ein. Das Piepsen erstarb augenblicklich. Als Lee leise die Tür hinter sich zuzog, wusste er, dass er nun als Schwerverbrecher galt.
Der Mann ließ das Gewehr sinken, und der rote Leuchtpunkt der Laserzieleinrichtung verschwand vom breiten Rücken des ahnungslosen Lee. Der Mann, der die Waffe hielt, hieß Leonid Serow und war ehemaliger kgb-Offizier – und ein Mann, der auf Mord spezialisiert war. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte Serow plötzlich ohne einträgliche Beschäftigung dagestanden. Doch sein Talent, Menschen auf wirkungsvolle Weise umzubringen, war auch in der »zivilisierten« Welt sehr gesucht. Als Kommunist, den man jahrelang ziemlich verhätschelt und mit eigener Wohnung und eigenem Wagen ausgestattet hatte, war Serow im Kapitalismus buchstäblich über Nacht reich geworden. Wenn er das vorher geahnt hätte!
Serow kannte Lee Adams nicht. Er hatte auch keine Ahnung, was er hier wollte. Er hatte Lee erst bemerkt, als dieser aus dem Gebüsch neben dem Haus getreten war, genau gegenüber von Serow. Die wenigen Geräusche, die Lee gemacht hatte, waren vom Wind überdeckt worden.
Serow schaute auf die Armbanduhr. Sie mussten bald hier sein. Er betrachtete den langen Schalldämpfer, der an seinem Gewehr befestigt war, und rieb sanft über den langen Lauf, als wollte er sein Lieblingskuscheltier streicheln oder als wollte er dem brünierten Metall zu verstehen geben, dass er uneingeschränktes Vertrauen in dessen absolute Treffsicherheit hatte. Der Schaft des Gewehrs bestand aus einem Spezialgemisch aus Kevlar, Fiberglas und Grafit, das für außergewöhnliche Festigkeit sorgte. Der Lauf der Waffe war nicht auf herkömmliche Weise gezogen, sondern besaß ein gerundetes Rechteckprofil, eine so genannte Polygonbohrung, mit einer Rechtsdrehung. Solche Läufe erzielten angeblich eine um bis zu acht Prozent höhere Mündungsgeschwindigkeit. Und was noch wichtiger war: Ballistische Untersuchungen der Kugeln, die aus dieser Waffe abgefeuert wurden, waren praktisch unmöglich, da sich im Lauf keine Felder oder Züge befanden, die nach dem Abfeuern unverwechselbare Spuren im Metall der Geschosse hinterließen. Der Teufel lag eben im Detail. Serow hatte seine gesamte Karriere auf dieser Philosophie aufgebaut.
Die Gegend war so einsam, dass er schon darüber nachgedacht hatte, ob er den Schalldämpfer abmontieren und sich auf sein Können als Scharfschütze, das High-Tech-Zielfernrohr und den bestens durchdachten Fluchtplan verlassen sollte. Serow hielt seine Zuversicht für gerechtfertigt. Es war wie mit einem umstürzenden Baum. Wenn man mitten im Nirgendwo jemanden umbrachte, wer hörte ihn dann schon sterben? Außerdem wusste Serow, dass manche Schalldämpfer die Flugbahn einer Kugel stark beeinflussen konnten – mit dem Ergebnis, dass niemand dran glauben musste außer dem verhinderten Attentäter, sobald dessen Auftraggeber von der Pleite erfahren hatte. Trotzdem: Serow hatte die Konstruktion des Schalldämpfers persönlich beaufsichtigt und war zuversichtlich, dass er wie geplant funktionieren würde.
Der Russe bewegte sich leise und drehte die Schulter, um einen Krampf zu lösen. Seit Anbruch der Dunkelheit war er hier. Doch Serow war an lange Nachtwachen gewöhnt. Wenn er Aufträge erledigte, wurde er niemals müde: Das Leben bedeutete ihm so viel, dass es seinen Adrenalinspiegel in die Höhe trieb, wenn er die Vorbereitungen traf, ein anderes Leben auszulöschen – so, als käme zugleich mit dem Risiko stets ein neuer Kraftschub. Ob man einen Berg bestieg oder einen Mord beging: Seltsamerweise fühlte man sich in der Nähe des Todes lebendiger.
Serows Fluchtweg durch die Wälder sollte ihn auf eine stille Straße führen, wo ein Wagen auf ihn wartete, um ihn zum nahe gelegenen Dulles-Flughafen zu bringen. Dann würde er andere Aufträge übernehmen, an Orten, die wahrscheinlich noch exotischer waren. Doch was Serow betraf, hatte auch dieser Ort seinen Reiz.
Es war ziemlich schwierig, jemanden in einer Stadt umzulegen. Die Wahl des Tatorts, das Betätigen des Abzugs und die Flucht waren in Städten immer ziemlich kompliziert, weil es dort Zeugen gab und die Polizei in sämtlichen Himmelsrichtungen immer nur wenige Schritte entfernt war. Doch auf dem Land, in der Einsamkeit einer bäuerlichen Umgebung, von Bäumen gedeckt, in einer Gegend, in der die Häuser weit voneinander entfernt waren, konnte er Tag für Tag mit gleich bleibender Effizienz töten, wie ein Wolf in einer Schafherde.
Serow saß auf einem Baumstamm. Er war nur ein paar Meter vom Waldrand und ungefähr dreißig Meter vom Haus entfernt. Trotz des dichten Waldes bot die Stelle ihm freies Schussfeld. Auf diese Entfernung hatte eine Kugel auf ihrem Weg zwischen Mündung und Ziel nur zwei Zentimeter Toleranz.
Der Mann und die Frau, hatte man Serow mitgeteilt, würden das Haus durch die Hintertür betreten. Bloß würden sie es nicht bis dahin schaffen. Was der Laserstrahl unmerklich berührte, wurde von der Kugel zerfetzt und zerrissen. Serow wusste, dass er sogar ein Glühwürmchen treffen konnte, selbst wenn es doppelt so weit von ihm entfernt war wie die Hintertür.
Alles war so perfekt vorbereitet, dass sein Instinkt ihm zu höchster Wachsamkeit riet. Nun hatte er einen ausgezeichneten Grund, nicht in diese Falle zu tappen: den Mann im Haus. Er war kein Polizist. Gesetzeshüter schlichen nicht durch die Sträucher und brachen in anderer Leute Häuser ein. Da man Serow nichts davon gesagt hatte, dass der Mann heute Abend hier auftauchen würde, zog er den Schluss, dass der Bursche nicht auf seiner Seite stand. Doch Serow wich nicht gern von einmal gefassten Plänen ab. Er nahm sich vor, an seinem ursprünglichen Vorhaben festzuhalten und durch den Wald zu fliehen, nachdem die beiden tot am Boden lagen – falls der Mann im Haus blieb. Sollte der Bursche sich irgendwie einmischen oder nach draußen kommen, sobald die Schüsse gefallen waren ... nun ja, dann gab es eben drei Leichen statt zwei. Serow hatte ausreichend Munition dabei.
KAPITEL 3
Daniel Buchanan saß in seinem verdunkelten Büro und nippte schwarzen Kaffee, der so stark war, dass er bei jedem Schluck fast spüren konnte, wie sein Puls sich beschleunigte. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar, das immer noch dicht und lockig war, aber nach dreißig Jahren Plackerei in Washington nicht mehr blond, sondern grau. Nach einem weiteren langen Tag, an dem er sich bemüht hatte, Abgeordnete davon zu überzeugen, dass seine Ziele ihrer Beachtung bedurften, war er total geschafft. Gewaltige Mengen Koffein waren zunehmend sein einziges Heilmittel. Dass er eine ganze Nacht durchschlief, kam nur selten vor; er machte nur hier und da ein Nickerchen und schloss die Augen, wenn man ihn zur nächsten Konferenz oder zum nächsten Flug fuhr. Manchmal nickte er auch während einer endlos langen Debatte im Kongress ein oder schlief für ein oder zwei Stunden zu Hause in seinem Bett – seine offizielle Schlafenszeit, sozusagen. Ansonsten galt seine ganze Kraft und Zeit dem Kapitol mit all seinen beinahe mystischen Facetten.
Buchanan war einsachtzig groß – ein Mann mit breiten Schultern, funkelnden Augen und gewaltigem Leistungsdrang. Einer seiner Jugendfreunde war in die Politik gegangen. Buchanan dagegen hatte kein Interesse gehabt, irgendwelche Ämter auszuüben, doch seine Lebhaftigkeit, Schlagfertigkeit und seine natürliche Überredungsgabe hatten ihn zum geborenen Lobbyisten gemacht. Von Anfang an war er erfolgreich gewesen. Seine Karriere war seine Besessenheit. Konnte Danny Buchanan keinen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren nehmen, war er ein unglücklicher Mann.
Wenn er in den Büros der Abgeordneten saß, lauschte er dem Summen des Stimmanzeigers und ließ die Monitore nicht aus den Augen, mit denen die Büros ausgestattet waren. Diese Monitore unterrichteten ihn über den derzeitigen Stand der Abstimmungen, die Abgabe der Ja- und Neinstimmen und darüber, wie viel Zeit seinen Gesprächspartnern blieb, bis sie wie Ameisen davonhuschten, um auch ihre Stimme abzugeben. Etwa fünf Minuten vor Ende der Stimmabgabe beendete Buchanan sein Gespräch und machte sich selbst auf, den aktuellen Lagebericht in der Hand, um nach weiteren Abgeordneten Ausschau zu halten, mit denen er reden musste. Der Lagebericht führte die täglichen Abstimmungstermine auf, die Buchanan halfen, herauszufinden, wo bestimmte Abgeordnete sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten mochten – entscheidend wichtige Informationen, wenn man Dutzenden sich bewegender Ziele nachspürte: gestresste Männer, die möglicherweise gar nicht mit einem reden wollten.
Heute war es ihm gelungen, das Gehör eines einflussreichen Senators zu finden. Buchanan war mit der nichtöffentlichen U-Bahn zum Kapitol gefahren, um bei der Abstimmung eines Ausschusses dabei zu sein. Er hatte den Mann mit dem zuversichtlichen Eindruck verlassen, einen Helfer gefunden zu haben. Zwar gehörte der Senator nicht zu seiner »speziellen Truppe«, aber Buchanan war klar, dass man nie wissen konnte, aus welcher Richtung einem irgendwann Hilfe zuteil wurde. Es war ihm egal, dass seine Klientel nicht bedeutend war und nicht zu der Wählerschicht zählte, die sich der besonderen Beachtung der Abgeordneten sicher sein konnten. Er setzte sich trotzdem mit allen Mitteln für sie ein. Seine Sache war gut. Deswegen durfte er auch Methoden benützen, die in diesen Breitengraden weniger dem allgemein akzeptierten Verhaltenskodex entsprachen.
Buchanans Büro war spärlich möbliert. Außerdem fehlte es ihm an vielen typischen Utensilien des rührigen Lobbyisten: Danny, wie er sich gern nennen ließ, arbeitete nicht mit Computern, Disketten, Akten und Aufzeichnungen, in denen irgendetwas Wichtiges stand. Akten konnten gestohlen werden, in Computer konnte man sich hineinhacken, und die Telefone wurden ohnehin allesamt angezapft. Spione belauschten alles und jeden mit allen möglichen Tricks, von dem uralten Dreh mit dem Wasserglas, das man an eine Wand drückte, bis hin zu den neuesten High-Tech-Geräten, die ein Jahr zuvor noch nicht einmal erfunden worden waren und die jeden Informationsstrom praktisch aus der Luft saugen konnten. Die meisten Organisationen spuckten vertrauliche Mitteilungen auf eine Weise aus, wie torpedierte Schiffe Matrosen ins Meer spuckten.
Und Buchanan hatte eine Menge zu verbergen.
Zwanzig Jahre lang war er der einflussreichste, umtriebigste Lobbyist von allen gewesen; in mancher Hinsicht hatte er dabei in Washington Pionierarbeit geleistet. Doch der Lobbyismus hatte sich in einer heimeligen Welt hoch bezahlter, bei Parlamentsdebatten vor sich hin schnarchender Anwälte entwickelt; nun aber war er zu einem Geschäft geworden, dessen Komplexität kalt und gefühllos machte und in dem die Risiken nicht hoch genug sein konnten. Als Auftragskiller des Kongresses hatte Buchanan die Umweltverschmutzer bei ihren Kämpfen gegen die Umweltschützer erfolgreich vertreten und ihnen ermöglicht, einer ahnungslosen Öffentlichkeit den Tod durch Pestizide und Gifte verschiedenster Art zu bringen. Er war der führende Politstratege der Pharmakonzerne gewesen, deren Medikamente die Mütter gleich zusammen mit ihren Kindern ins Jenseits befördert hatten. Er war als leidenschaftlicher Fürsprecher der Rüstungsproduzenten hervorgetreten, denen es völlig egal war, ob ihre Waffen sicher waren. Dann hatte Buchanan hinter den Kulissen die Fäden für die Automobilindustrie gezogen, die lieber vor Gericht gegangen war als einzugestehen, dass die Sicherheitseinrichtungen in ihren Fahrzeugen nicht dem Standard entsprachen. Und schließlich, bei seinem allergrößten Coup, hatte Buchanan die Tabakindustrie in einem blutigen Krieg an allen Fronten angeführt. Damals hatte Washington es sich nicht leisten können, Buchanan oder seine Klienten zu ignorieren. Und er hatte ein Riesenvermögen zusammengerafft.
Viele der Strategien, die Danny Buchanan damals ausgeheckt hatte, waren inzwischen Allgemeingut und wurden auch bei den derzeitigen Gesetzesmanipulationen benützt. Vor Jahren hatte Buchanan von »seinen« Abgeordneten Gesetzesvorlagen lancieren lassen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, um auf diese Weise die Basis für spätere Veränderungen zu unterminieren. Heute wurde diese Taktik im Kongress ständig angewandt. Nichts hassten Buchanans Klienten so sehr wie Veränderungen. Ständig hatte er seinen Rücken gegen diejenigen decken müssen, die ihm etwas anzuhängen versuchten, da sie das wollten, was Buchanans Klienten nicht wollten. Mehr als einmal hatte er politische Katastrophen abgewendet, indem er die Büros der Abgeordneten mit Briefen und Informationsmaterial überflutet hatte – und mit kaum verschleierten Drohungen, ihnen die finanzielle Unterstützung zu streichen. »Mein Klient wird Ihre Wiederwahl unterstützen, Herr Senator, weil wir wissen, dass Sie für uns da sind. Ach, übrigens, der Spendenscheck ist schon auf Ihrem Wahlkampfkonto.« Wie oft hatte er diese Worte schon gesagt?
Seltsamerweise hatte gerade der Lobbyismus im Dienste der Mächtigen vor zehn Jahren zu einer dramatischen Veränderung in Buchanans Leben geführt. Ursprünglich hatte er zuerst seine Karriere aufbauen und sich dann mit einer Frau zur Ruhe setzen und eine Familie gründen wollen. Um sich noch einmal die Welt anzuschauen, bevor er sich diesem letzteren Vorhaben widmete, war er mit einem 60000 Dollar teuren Range Rover auf einer Fotosafari durch Westafrika gefahren, hatte dort aber nicht nur wunderschöne Wildtiere gesehen, sondern auch Schmutz, Elend und menschliches Leid, wie er es nie zuvor erlebt hatte. Bei einer Reise in eine abgelegene Gegend im Sudan war er Zeuge eines Massenbegräbnisses von Kindern gewesen. Man hatte ihm erzählt, eine Epidemie habe sich im Dorf ausgebreitet: eine jener verheerenden Krankheiten, die das Gebiet immer wieder befielen und Alte und Junge dahinrafften. Auf Buchanans Frage nach der Krankheit hatte man ihm geantwortet, es wäre »etwas ähnliches wie die Masern«.
Auf einer anderen Reise hatte er in einem chinesischen Hafen beim Entladen von Milliarden amerikanischer Zigaretten zugeschaut, die von Menschen geraucht wurden, die ihr Leben auf Grund der verheerenden Luftverpestung ohnehin schon hinter Atemmasken verbrachten. Er hatte gesehen, wie man Mittel zur Empfängnisverhütung, die in den Vereinigten Staaten verboten waren, an Hunderttausende von Menschen in Südamerika verschleuderte – mit Gebrauchsanweisungen in englischer Sprache. In Mexico City hatte er Hütten neben Wolkenkratzern gesehen, in Russland Verhungernde neben verbrecherischen Kapitalisten. Obwohl es ihm nie gelungen war, Nordkorea zu bereisen, wusste er, dass dieses Land ein legalisierter Gangsterstaat war, in dem in den vergangenen fünf Jahren schätzungsweise zehn Prozent der Bevölkerung verhungert war. Jedes Land konnte Buchanan eine neue, schreckliche Geschichte erzählen.
Nach zwei Jahren »Pilgerfahrt« hatte sich Buchanans Interesse an der Ehe und der eigenen Familie in Nichts aufgelöst. Alle sterbenden Kinder, die er gesehen hatte, waren seine Kinder geworden. Seine Familie. Auch wenn auf der ganzen Welt weiterhin frische Gräber für Millionen Junge, Alte und Hungernde ausgehoben wurden – diese Menschen sollten nicht mehr kampflos krepieren. Und Buchanan wollte den Krieg für sie führen. Er hatte alles für sie gegeben, mehr noch, als die Tabak-, Chemie- und Waffenkonzerne von ihm bekommen hatten. Noch heute erinnerte er sich genau daran, wann und wo ihm dies alles bewusst geworden war: beim Rückflug von einer Südamerikareise auf der Flugzeugtoilette. Ihm war speiübel gewesen, und er hatte vor dem Bottich gekniet und das Gefühl gehabt, jedes tote Kind, das er gesehen hatte, mit eigenen Händen ermordet zu haben.
Nach seiner Wandlung war Buchanan gezielt an Orte gereist, an denen Hunger, Krankheit und Tod herrschten, um herauszufinden, wie er am besten helfen konnte. In eines dieser Länder hatte er persönlich eine Schiffsladung Nahrungsmittel und Medikamente überführt, musste aber erkennen, dass es keine Möglichkeit gab, die Fracht ins Landesinnere zu bringen. Plünderer hatten sich die Lieferungen unter den Nagel gerissen, und Buchanan hatte es hilflos mit ansehen müssen. Daraufhin hatte er als ehrenamtlicher Spendensammler für humanitäre Organisationen wie care oder misereor gearbeitet. Er hatte seine Sache gut gemacht, aber die Dollars hatten sich als Tropfen auf den heißen Stein erwiesen. Die Zahlen sprachen gegen sie; die Probleme wurden ständig größer.
Buchanan war nach Washington zurückgekehrt, hatte die von ihm gegründete Firma verlassen und nur einen Menschen mitgenommen: Faith Lockhart. Seit nunmehr einem Jahrzehnt waren seine Klienten, seine Mündel, die ärmsten Länder der Welt. Um die Wahrheit zu sagen, fiel es ihm schwer, sie als geopolitische Einheiten zu betrachten. In seinen Augen waren sie keine Staatsgebilde, sondern Heerscharen hungernder, kranker Menschen, die unter verschiedenen Flaggen dahinvegetierten und keine Stimme besaßen, weder im eigenen Land noch sonst wo auf der Welt. Buchanan hatte den Rest seines Lebens der Lösung des unlösbaren Problems der Habenichtse dieser Welt gewidmet.
In Washington hatte er seine immensen Fähigkeiten als Lobbyist und seine Verbindungen zu nutzen versucht – um erkennen zu müssen, dass seine neuen Projekte in der Beliebtheit neben denen verblassten, für die er sich früher stark gemacht hatte. Als er noch Advokat der Reichen und Mächtigen auf dem Capitol Hill gewesen war, hatten die Politiker ihn lächelnd begrüßt – zweifellos in Erwartung von Wahlkampfspenden und anderen Zuwendungen. Nun zeigte man ihm die kalte Schulter. Einige Kongressabgeordnete brüsteten sich sogar damit, nicht mal einen Reisepass zu besitzen, und erklärten, die Vereinigten Staaten würden schon jetzt viel zu viel Entwicklungshilfe zahlen. Wir haben schon genug Arme bei uns zu Hause, erklärten sie, und wir sollten uns erst mal um sie kümmern.
Doch am häufigsten bekam Buchanan zu hören: »Was soll mir das einbringen, Danny? Warum sollten meine Wähler in Illinois mir wieder ihre Stimme geben, wenn ich etwas gegen den Hunger in Äthiopien unternehme?« Buchanan war von einem Büro zum anderen geschickt worden und hatte meist nur mitleidige Blicke geerntet: Danny Buchanan, der vielleicht größte Lobbyist, den es je gegeben hatte, war senil geworden, wirr im Kopf. Eine traurige Geschichte. Sicher, es ist eine gute Sache, sich für die Armen einzusetzen und so weiter, wer würde das bestreiten? Aber jetzt komm wieder auf den Teppich, Danny. Afrika? Sterbende Säuglinge in Südamerika? Mann, ich hab hier meinen eigenen Scheiß am Hals.
»Hör mal, Danny, wenn es nicht um Handel, Militär oder Erdöl geht – warum, zum Teufel, verschwendest du meine Zeit?«, hatte ein hoch angesehener Senator geantwortet und damit wahrscheinlich den Grundsatz der amerikanischen Außenpolitik auf einen Nenner gebracht.
Sind sie wirklich alle so blind?, fragte Buchanan sich unaufhörlich. Oder bin ich so ein Narr?
Schließlich war er zu dem Schluss gelangt, dass ihm nur eine Möglichkeit blieb. Sie war zwar ungesetzlich, aber wer an den Abgrund gedrängt wurde, durfte in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich sein: Buchanan setzte sein gesamtes Vermögen aufs Spiel, das er im Lauf der Jahre angehäuft hatte, und ging dazu über, gewisse Politiker in Schlüsselpositionen zu bestechen, um sich ihrer Unterstützung zu versichern. Es hatte hervorragend geklappt. Die Hilfe für seine Schützlinge nahm auf unterschiedlichste Weise zu. Selbst als Buchanans Vermögen aufgebraucht war, sahen die Dinge positiv aus, waren zumindest nicht schlechter geworden – sofern man es nicht schon als Erfolg wertete, wertvolles, hart erkämpftes Terrain zu halten. Alles hatte bestens funktioniert, bis vor etwa einem Jahr ...
Wie aufs Stichwort riss ihn ein Klopfen an der Bürotür aus seinen Gedanken. Das Gebäude war geschlossen, das Reinigungspersonal längst gegangen. Buchanan blieb an seinem Schreibtisch sitzen und beobachtete, wie die Tür aufging und die schemenhafte Gestalt eines hoch gewachsenen Mannes im Rahmen erschien. Der Fremde tastete nach dem Schalter und knipste das Licht an.
Buchanan kniff die Lider zusammen, als über ihm die Deckenlampen aufflammten. Als seine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt hatten, erkannte er Robert Thornhill, der seinen Trenchcoat auszog, sein Jackett glatt strich. Als er sich setzte, waren seine Bewegungen ruhig und bedächtig, als hätte er gerade zu einem Gläschen im Country Club Platz genommen.
»Wie sind Sie hier hereingekommen?«, fragte Buchanan scharf. »Das Gebäude ist angeblich sicher.« Aus irgendeinem Grund spürte er, dass vor der Tür noch andere lauerten.
»Ist es auch, Danny. Jedenfalls für die meisten.«
»Es gefällt mir nicht, dass Sie hierher kommen, Thornhill.«
»Ich bin jedenfalls so höflich, Ihren Vornamen zu benützen. Und es würde mich freuen, wenn Sie auch mir diese Freundlichkeit erweisen würden. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber immerhin verlange ich nicht von Ihnen, dass Sie mich Mister Thornhill nennen. So ist es doch zwischen Herr und Knecht üblich, nicht wahr, Danny? Sie sehen – so böse bin ich gar nicht.«
Buchanan wusste, dass das selbstgefällige Gehabe dieses Mannes gespielt war, um ihn zu verunsichern und aus dem Konzept zu bringen. Er lehnte sich im Sessel zurück und verschränkte die Hände im Schoß.
»Und wie komme ich zu der Ehre Ihres Besuches, Bob?«
»Wegen Ihres Treffens mit Senator Milstead.«
»Ich hätte ihn auch in der Stadt treffen können. Ich weiß überhaupt nicht, warum Sie darauf bestanden haben, dass ich nach Pennsylvania fahre.«
»Weil Sie auf diese Weise eine weitere Gelegenheit haben, sich für die darbenden Massen einzusetzen. Sie sehen, auch ich habe ein Herz.«
»Sie nutzen die Notlage von Millionen Männern, Frauen und Kindern, für die es schon ein Wunder ist, wenn sie die Sonne aufgehen sehen, für Ihre eigenen egoistischen Pläne aus. Macht das eigentlich einen Kratzer in Ihr Gewissen, Bob? Falls Sie überhaupt wissen, was das ist.«
»Ich werde nicht dafür bezahlt, ein Gewissen zu haben. Ich werde bezahlt, die Interessen unseres Landes zu schützen. Ihre Interessen. Außerdem – brauchte man ein Gewissen, um zu überleben, wäre Washington entvölkert. Im Übrigen stehe ich Ihren Bemühungen positiv gegenüber. Ich habe nichts gegen die Armen und Hilflosen. Gut für Sie, Danny!«
»Tut mir Leid, das kaufe ich Ihnen nicht ab.«