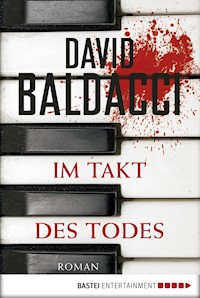9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Camel Club
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
In diesem Spiel geht es um alles. Sieg oder Niederlage. Leben oder Tod.
Der mysteriöse Camel Club will die geheimen Machenschaften der amerikanischen Regierung aufdecken - Korruption und Betrug sollen ein Ende bereitet werden. Auch Trickbetrügerin Annabelle Conroy hat sich dieser Aufgabe verschrieben, doch plötzlich wird sie selbst zur Gejagten: Nachdem sie einen skrupellosen Kasinoboss aus Rache um vierzig Millionen Dollar erleichtert hat, steht sie als Nächste auf seiner Abschussliste.
Im Kampf um ihr Leben ist Annabelle die Hilfe des Clubs gewiss. Die Karten werden jedoch neu gemischt, als dessen Anführer Oliver Stone von seiner Vergangenheit eingeholt wird und selbst vor einem Killer fliehen muss ...
Das Hörbuch zum dritten Band der erfolgreichen Thriller-Reihe um den Camel Club von Bestsellerautor David Baldacci.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Ähnliche
David Baldacci
DIE SPIELER
Roman Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Uwe Anton
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar Vollständige eBook-Ausgabe des in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG erschienenen Werkes Lübbe Digital in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Stone Cold« Für die Originalausgabe: Copyright © 2007 by Columbus Rose, Ltd. Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2009 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln Textredaktion: Wolfgang Neuhaus, Oberhausen Datenkonvertierung eBook: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8387-0642-9 Sie finden uns im Internet unter: www.luebbe.de Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
– Für Bernard Mason – zuverlässig, aufrecht und geradeheraus. – Zum Gedenken an Frank L. Jennings, der sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet hat.
KAPITEL 1
Harry Finn stand wie üblich um halb sieben auf, kochte Kaffee, ließ den Hund wie jeden Morgen auf den eingezäunten Hinterhof hinaus, duschte, rasierte sich, weckte die Kinder, damit sie pünktlich in die Schule kamen, und überwachte in der nächsten halben Stunde die komplizierte Morgenroutine, bei der das Frühstück verschlungen, Schultaschen und Schuhe gesucht und Streitigkeiten vom Zaun gebrochen und beigelegt wurden. Harrys Frau gesellte sich zu ihm, noch ein bisschen verschlafen, aber dennoch bereit für einen weiteren Tag als Mutter und Mama-Taxi von drei Kindern, darunter einem frühreifen, nach Unabhängigkeit strebenden Jungen im Teenageralter.
Harry Finn war in den Dreißigern, ein Mann mit jungenhaften Gesichtszügen und klaren blauen Augen, die nichts übersahen. Er hatte jung geheiratet und liebte seine Frau und seine drei Kinder. Sogar dem Hund der Familie, einem schlappohrigen, goldenen Labrador-Pudel-Mischling namens George, brachte er aufrechte Zuneigung entgegen. Finn war eins fünfundachtzig groß und hatte einen langgliedrigen Körper, wie geschaffen für Geschwindigkeit und Ausdauer. Wie üblich trug er verblichene Jeans und ein Freizeithemd. Die Brille mit den runden Gläsern und der kluge, betuliche Gesichtsausdruck verliehen ihm das Aussehen eines Buchhalters, der es nach einem Tag voller ermüdender Zahlen genoss, Hardrock à la Aerosmith zu hören. Finn war athletisch, brachte aber nicht mit den Muskeln, sondern mit seinem Grips das Brot auf den Tisch und die iPods in die Ohren seiner Kinder. Er war sehr gut in seinem Job. Nur wenige Menschen konnten, was Harry Finn konnte, und überlebten auch noch dabei.
Er gab seiner Frau einen Abschiedskuss, drückte die Kinder, sogar den Teenager, und schnappte sich eine Stofftasche, die er am Abend zuvor neben die Haustür gestellt hatte. Dann stieg er in seinen Toyota Prius und fuhr zum National Airport am Potomac River, direkt am Stadtrand von Washington, D. C. Der offizielle Name des Flughafens war in Ronald Reagan Washington National Airport geändert worden, doch für die Einheimischen würde er immer der »National« bleiben. Finn fand einen Parkplatz in der Nähe des Hauptterminals, dessen auffälligstes architektonisches Merkmal eine Reihe von Kuppeln war, die Thomas Jeffersons geliebtem Monticello nachempfunden waren. Mit der Tasche in der Hand ging er über einen Bürgersteig in das elegante Gebäude. In einer Kabine der Herrentoilette öffnete er die Tasche, zog eine dicke blaue Jacke mit reflektierenden Streifen an den Ärmeln und blaue Arbeitshosen an, legte sich orangefarbene Ohrenschützer um den Hals und befestigte einen offiziell aussehenden Ausweis an der Jacke.
Um das Drehkreuz zu überwinden, schloss er sich einer Gruppe Flughafenangestellter an, die durch eine spezielle Sicherheitsschleuse gingen. Es war die reinste Ironie, doch hier kam nicht einmal die oberflächliche Sicherheit zur Anwendung, die gewöhnlichen Passagieren auferlegt wurde. Als Finn auf der anderen Seite der Schleuse war, bestellte er eine Tasse Kaffee und folgte dann beiläufig einem anderen Arbeiter durch eine Sicherheitstür in den Außenbereich. Der Mann hielt ihm tatsächlich die Tür auf.
»In welcher Schicht arbeitest du?«, fragte Finn.
Der Mann sagte es ihm.
»Ich fange gerade an«, sagte Finn. »Wäre ja kein Problem, wenn ich nicht wegen dem verdammten Football-Spiel so lange aufgeblieben wäre.«
»Wem sagst du das?«, pflichtete der Mann ihm bei.
Finn stieg die Metalltreppe hinunter und ging zu einer 737, die für einen Kurzstreckenflug nach Detroit mit Anschlussflug nach Seattle vorbereitet wurde. Unterwegs kam er an mehreren Leuten vorbei, darunter einem Tankwart, zwei Gepäckbeladern und einem Mechaniker, der die Reifen einer Maschine mit Flugziel Michigan überprüfte. Niemand sprach ihn an, weil er aussah und sich auch so verhielt, als hielte er sich völlig rechtmäßig hier auf. Während er um das Flugzeug herumging, trank er seinen Kaffee aus.
Er ging weiter zu einem Airbus A320, der sich in ungefähr einer Stunde auf den Weg nach Florida machen würde. Ein Gepäckwagen stand neben der Maschine. Mit einer geübten Bewegung zog Finn das kleine Päckchen aus seiner Jacke und schob es in eine Seitentasche eines der Koffer auf dem Wagen. Dann kniete er sich neben einen der Reifen am Fahrwerk der riesigen Maschine und tat so, als würde er das Profil überprüfen. Wieder nahmen die anderen Arbeiter keine Notiz von ihm, da Finn den Eindruck erweckte, als fühle er sich in seiner Umgebung vollkommen heimisch. Eine Minute später plauderte er mit einem Mechaniker der Bodenmannschaft, analysierte die Chancen der Washington Redskins und die bedauernswerten Aussichten für die Beschäftigten in der Luftfahrtindustrie.
»Nur den hohen Tieren geht’s richtig gut«, sagte Finn. »Die drucken geradezu Geld.«
»Stimmt genau«, sagte der andere. Beide klatschten sich ab, um einander zu zeigen, dass sie einer Meinung waren, was die Gier der Reichen und Skrupellosen betraf, die den gar nicht so freundlichen Himmel beherrschten.
Finn bemerkte, dass die hintere Frachtschleuse der Maschine nach Detroit mittlerweile offen war. Er wartete, bis die Gepäckträger mit ihrem Wägelchen-Kordon losgefahren waren, um andere Koffer zu holen, und kletterte dann auf den Hubwagen, der dort stand. Er schlüpfte ins Frachtabteil und zwängte sich in sein Versteck. Er hatte es ausgesucht, nachdem er Pläne der Frachträume einer 737 studiert hatte – Unterlagen, die problemlos verfügbar waren, wenn man wusste, wo man suchen musste. Finn hatte bei seiner Internetrecherche außerdem erfahren, dass dieses Flugzeug nur zur Hälfte beladen sein würde, sodass sein zusätzliches Gewicht im Frachtraum nicht die geringste Rolle spielte.
Während er in seinem Versteck lag, wurde das Flugzeug mit dicken Koffern und gestressten Passagieren beladen, und dann ging es auch schon auf die Reise nach Detroit. Finn reiste relativ bequem im Frachtraum, obwohl es hier entschieden kälter war als im Passagierraum, sodass er froh war, die dicke Jacke zu tragen. Nach ungefähr einer Stunde Flugzeit landete die Maschine und rollte zum Terminal. Ein paar Minuten später wurde die Frachtluke geöffnet und das Gepäck entladen. Finn wartete geduldig, bis der letzte Koffer von Bord war; dann verließ er sein Versteck und spähte durch die geöffnete Heckluke: Es waren ein paar Leute in der Nähe, aber niemand schaute in seine Richtung. Finn kletterte aus der Maschine und ließ sich auf den Asphalt fallen. Eine Minute später bemerkte er zwei Sicherheitsbeauftragte, die in seine Richtung kamen, dabei Kaffee tranken und sich unterhielten. Er griff in seine Tasche, holte ein Lunchpaket heraus, nahm ein Schinkensandwich und biss hinein, wobei er sich vom Flugzeug entfernte.
Als die zwei Wachmänner an ihm vorbeigingen, nickte er ihnen zu. »Ist das normaler Kaffee oder entkoffeinierter Karamell-Latte mit Schuss und vier Tropfen Was-weiß-ich?« Er grinste mit vollem Mund. Die beiden Uniformierten kicherten über seine Bemerkung, und er ging weiter.
Finn betrat das Terminal, ging auf eine der Toiletten, legte Jacke, Ohrenschützer und Ausweis ab, telefonierte kurz und machte sich dann auf den Weg zum Sicherheitsbüro des Flughafens.
»Ich habe eine Bombe in eine Tasche gepackt, die heute Morgen auf dem National Airport in einen A320 verfrachtet wurde«, sagte er zu dem wachhabenden Beamten. »Und ich bin soeben im Laderaum einer 737 von D. C. hierhergeflogen. Ich hätte den Vogel jederzeit zum Absturz bringen können.«
Der Beamte, der keine Waffe trug, reagierte augenblicklich und sprang über den Schreibtisch, um Finn zu Boden zu reißen. Finn wich geschickt zur Seite. Der Mann schlug der Länge nach hin und rief um Hilfe. Andere Beamte stürmten aus dem Hinterzimmer herbei und näherten sich Finn mit gezogenen Waffen. Doch Finn hatte sein Beglaubigungsschreiben schon gezückt, ehe die Männer ihre Waffen in den Händen hielten.
In diesem Augenblick wurde die Tür aufgestoßen. Drei weitere Männer kamen herein und hielten die Marken ihrer Bundesbehörde wie königliche Zepter in die Höhe.
»Homeland Security!«, blaffte einer von ihnen die Wachen an und zeigte auf Finn. »Dieser Mann arbeitet für uns. Und irgendjemand steckt bis zum Hals in Schwierigkeiten.«
KAPITEL 2
»Gut gemacht, Harry, wie immer«, sagte der Chef des Homeland-Security-Teams später und gab Finn einen Klaps auf den Rücken. Berichte waren ausgefüllt, E-Mails abgeschickt und Handyakkus geleert worden, während man die gravierenden Verstöße gegen die Flughafensicherheit, von Harry Finn aufgedeckt, an die zuständigen Stellen weitergeleitet hatte. Normalerweise hätte Finn vom Heimatschutzministerium – oder DHS, wie das Department of Homeland Security allgemein bekannt war – niemals den Auftrag bekommen, einen Verstoß gegen die Flughafensicherheit zu begehen; die Bundesluftfahrtbehörde FAA grenzte ihren Verantwortungsbereich sorgsam nach außen ab. Finn glaubte den Grund dafür zu kennen: Bei der FAA wusste man genau, wie viele Schwächen im System es gab, und so wollte man natürlich nicht, dass ein Außenstehender dahinterkam.
Finn war kein Angestellter des DHS; vielmehr war die Firma, für die er arbeitete, von der Behörde beauftragt worden, die Sicherheitsvorkehrungen staatlicher und privater Einrichtungen in den gesamten USA zu überprüfen, indem man versuchte, die Sicherheitsmaßnahmen zu unterlaufen, wo man nur konnte. Das DHS verteilte viele solcher Aufträge; bei einem jährlichen Budget von 40 Milliarden Dollar musste man das Geld ja irgendwie unter die Leute bringen. Finns Firma bekam nur wenig aus diesem Topf, doch selbst ein winziger Bruchteil von 40 Milliarden war ein schönes regelmäßiges Einkommen.
Normalerweise hätte Finn den Flughafen verlassen, ohne zu enthüllen, was er getan hatte, und den Dingen ihren Lauf gelassen. Doch das DHS hatte offensichtlich die Nase voll vom Zustand der Sicherheitsvorkehrungen auf Flughäfen und wollte ein deutliches Zeichen setzen. Daher hatte man ihn angewiesen, sich in das Büro zu begeben und ein falsches Geständnis abzulegen, damit die DHS-Agenten ihren dramatischen Auftritt hatten. Den Medien würde das Wasser im Mund zusammenlaufen, die Fluggesellschaften würden schäumen vor Wut, und das DHS würde als sehr effizient und heldenhaft dastehen. Finn selbst gab keine Interviews, und sein Name stand niemals in den Zeitungen. Er erledigte nur unauffällig seinen Job.
Er würde jedoch ein abschließendes Briefing für das Sicherheitspersonal des Flughafens, das er soeben aufgescheucht hatte, vornehmen und dabei versuchen, bei der Einschätzung ihrer Leistung ermutigend und diplomatisch vorzugehen und Veränderungen für die Zukunft vorzuschlagen. Diese Briefings waren mitunter das Gefährlichste an seinem Job. Die Leute konnten sehr angefressen sein, wenn sie herausfanden, dass man sie hereingelegt und bloßgestellt hatte. Finn hatte sich mehr als einmal buchstäblich aus einem Besprechungsraum herauskämpfen müssen.
»Wir werden die Leute schon irgendwie in Form bringen«, sagte der Mann vom DHS.
»Ich hab meine Zweifel, dass das in diesem Leben noch klappt«, erwiderte Finn.
»Sie können mit uns nach D. C. zurückfliegen«, sagte der Mann. »Wir haben einen Falcon des Ministeriums bereitstehen.«
»Danke, aber ich möchte hier noch jemanden besuchen. Ich fliege morgen zurück.«
»Okay. Dann bis zum nächsten Mal.«
Als der Mann gegangen war, besorgte Finn sich einen Leihwagen, fuhr in einen Vorort von Detroit und hielt an einem Einkaufszentrum. Aus seinem Rucksack holte er eine Mappe und eine Aktenmappe mit einem Foto darin. Der Mann auf dem Foto war dreiundsechzig Jahre alt, glatzköpfig, hatte mehrere auffällige Tätowierungen und war als Dan Ross bekannt.
Das war nicht sein richtiger Name – aber Finn hieß auch nicht Finn.
KAPITEL 3
Arthritis. Darüber hinaus der verdammte Lupus. Das war ein hübsches Duo, perfekt aufeinander abgestimmt, sein Leben zu einer schmerzhaft pochenden Hölle zu machen. Jeder Knochen knarrte, jede Sehne kreischte, und jede Bewegung fühlte sich an, als würde ihm ein Maultier in den Bauch treten. Dennoch ging er weiter, denn wenn man stehen blieb, blieb man für immer stehen. Er schluckte starke Tabletten, die er eigentlich gar nicht hätte haben dürfen, stülpte sich eine Baseballkappe auf den haarlosen, bleichen Kopf, zog die Krempe tief über die Augen und setzte sich eine Sonnenbrille auf. Er mochte es nicht, wenn die Leute sahen, wohin er schaute. Und er wollte nicht, dass die Leute einen guten Blick auf ihn werfen konnten.
Er stieg in seinen Wagen und fuhr zum Laden. Unterwegs setzte die Wirkung der Medikamente ein, und er fühlte sich besser, was zumindest ein paar Stunden so bleiben würde.
»Danke, Mr. Ross.« Der Verkäufer las den Namen von der Kreditkarte, ehe er sie ihm zusammen mit den Einkäufen zurückgab. »Schönen Tag noch.«
»Ich habe keine schönen Tage mehr«, erwiderte Dan Ross. »Ich habe nur noch letzte Tage.«
Der Verkäufer warf einen Blick auf den Hut, der den haarlosen Kopf bedeckte.
»Kein Krebs«, las Ross die Gedanken des Mannes. »Auch wenn’s vielleicht sogar besser wäre. Würde schneller gehen, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Der Verkäufer, Anfang zwanzig und natürlich noch unsterblich, sah nicht so aus, als wüsste er, was Ross meinte. Er nickte unbeholfen und wandte sich dem nächsten Kunden zu.
Ross verließ den Laden und überlegte, was er nun tun sollte. Geldsorgen hatte er nicht. Vater Staat kümmerte sich in seinen alten, elenden Tagen um ihn. Die Pension war erstklassig, die Krankenversicherung ebenso. Wenigstens das bekamen die Bundesbehörden auf die Reihe, wenn schon sonst nichts.
Ross’ Sorgen waren akuter Natur: Er hatte zu viel freie Zeit. Das war sein Hauptproblem. Was als Nächstes unternehmen? Nach Hause fahren und an die Decke starren? Sich ins Restaurant setzen und sich den Bauch vollschlagen? Den Sportsender ESPN gucken und mit den hübschen Kellnerinnen flirten, die ihm dann doch nicht den Tag verschönten? Na ja, träumen durfte er noch – Träume von einer Vergangenheit, als die Ladys ihm mehr als ihre Zeit geschenkt hatten.
Ein tolles Leben führte Ross nicht mehr, das musste er sich eingestehen, während sein Blick unauffällig in sämtliche Richtungen schweifte: Selbst heute konnte er noch immer nicht dem Verlangen widerstehen, seine Umgebung zu beobachten, um festzustellen, ob er beschattet wurde. So wurde man nun mal, wenn über Jahrzehnte hinweg jemand versuchte, einen umzubringen. Gott, wie sehr sehnte er das Ende herbei, einen Schlussstrich unter diese erbärmlichen Tage des ausweglosen Dilemmas, sich zwischen Restaurant und Zuhause entscheiden zu müssen, das seine »Goldenen Jahre« ausfüllte. Mehr als dreißig Jahre lang hatte er sich jeden Monat in einem anderen Bundesstaat aufgehalten. Mit dem Flugzeug, frischem Mut und einer Waffe seiner Wahl die Welt sehen – das war seine Maxime gewesen. Ross erlaubte sich ein wehmütiges Lächeln. Erinnerungen waren alles, was ihm geblieben war. Und der beschissene Lupus. Vermutlich gibt es doch einen Gott. Eine ziemliche Scheiße, das jetzt auf die harte Tour zu erfahren.
Zu Ross’ Pech war sein Beobachtungsvermögen zwar noch gut, aber nicht mehr unfehlbar. Ein Stück entfernt saß Harry Finn in einem Leihwagen und behielt den unverwechselbaren Mr. Ross im Auge. Wohin, Danny? Nach Hause oder ins Restaurant? Ins Restaurant oder nach Hause? Wie tief du gesunken bist.
Finn beobachtete diesen inneren Widerstreit bei Dan Ross schon seit längerer Zeit, und in drei Vierteln aller Fälle hatte Ross sich für das Restaurant entschieden. So auch heute wieder. Er machte kehrt, ging die Straße hinunter und betrat das Edsel Deli, das glänzend lief – seit 1954 schon, wie das Reklameschild über dem Eingang besagte, womit es das Automodell, nach dem es benannt war, eine berüchtigte Schrottmühle aus dem Fünfzigern, um Jahrzehnte überlebt hatte.
Mindestens eine Stunde lang würde Ross im Edsel Deli bleiben, seine Mahlzeit zu sich nehmen und die niedliche Kellnerin mit Blicken verschlingen. Für die anschließende Autofahrt nach Hause brauchte er zwanzig Minuten. Dort setzte er sich in den Garten hinter dem Haus und las Zeitung; danach ging er hinein, machte ein Nickerchen, bereitete sich ein bescheidenes Abendessen zu, sah fern und spielte dann Solitär an dem Tischchen am Vorderfenster, wo ihm eine Lampe die Karten beleuchtete. Damit klang sein Abend aus. Um 21 Uhr erlosch in dem Häuschen das Licht. Dan Ross legte sich schlafen, um am nächsten Morgen aufzuwachen, und dann fing alles wieder von vorne an. Finn konnte sämtliche Alltagshandlungen, mit denen der Alte sein dürftiges Leben gestaltete, im Geiste herunterbeten.
Nachdem Finn den Mann bis in diese Ortschaft verfolgt hatte, waren mehrere Fahrten zu dem Haus erforderlich gewesen, um Ross’ Routineabläufe auszukundschaften. Diese Observation hatte ihm geholfen, den perfekten Plan zur Erledigung seiner Aufgabe auszuhecken.
Ungefähr fünf Minuten bevor Ross voraussichtlich das Edsel Deli verließ, stieg Finn aus dem Wagen, überquerte die Straße, schaute durchs Fenster ins Restaurant und sah Ross hinten an seinem gewohnten Tisch sitzen, den Blick auf die soeben erhaltene Rechnung geheftet. Finn schlenderte zu der Stelle, wo Ross’ Auto parkte. Zwei Minuten später saß er wieder im Mietwagen. Nochmals drei Minuten später kam Ross aus dem Restaurant, schlurfte langsam die Straße entlang, stieg in seinen Wagen und fuhr los.
Finn fuhr in die entgegengesetzte Richtung.
Am Abend wickelte Ross seine üblichen Belanglosigkeiten ab und krönte sie mit einem drei Fingerbreit hoch gefüllten Glas Johnnie Walker Black, das er entgegen aller Warnungen der Beipackzettel mit einer starken Mischung von Schmerzmitteln kombinierte. Nur knapp schaffte er es bis zum Bett, ehe die Lähmung einsetzte. Zuerst erklärte er sie sich durch die Medikamente und empfand die Taubheit sogar als willkommen. Doch als er auf dem Bett lag, befiel ihn mit gelinder Panik der Verdacht, der Lupus könnte mittlerweile zu einer schlimmeren, bösartigeren Form ausgeartet sein. Doch als er plötzlich Atemnot bekam, begriff er, dass ihn etwas anderes ereilt hatte. Eine Herzattacke? Doch wo blieb der Druck auf der Brust, der stechende Schmerz im linken Arm? Ein Schlaganfall? Er konnte noch denken und reden. Er sprach ein paar Sätze, und sie klangen keineswegs genuschelt. Sein Gesicht fühlte sich nicht verzerrt an. Abgesehen von den ständigen Beschwerden hatte er vorher keine Schmerzen gehabt. Das war das Problem; er spürte seine Gliedmaßen nicht mehr. Ross schaute am Arm hinunter auf die linke Hand. Er wollte die Finger aneinanderreiben, doch anscheinend erreichte der Befehl des Gehirns sie nicht.
Doch er hatte im Verlauf des Tages etwas an den Fingern gehabt. Glitschig wie Vaseline war es gewesen. Er hatte gewischt und gewischt, ohne dass die Haut trocken geworden wäre. Zu Hause hatte er sich die Hände gewaschen, und das endlich schien genützt zu haben. Die Finger waren nicht mehr schlüpfrig gewesen. Ross wusste nicht, ob er den Erfolg Wasser und Seife verdankte oder ob der unbekannte Glibber verdunstet war.
Dann erkannte er die Wahrheit, als träfe ihn ein 50er Kaliber. Oder der Glibber ist von meinem Körper aufgenommen worden.
Wo hatte er sich die Finger befeuchtet? Angestrengt dachte er nach. Nicht am Morgen. Nicht im Geschäft, und auch nicht im Restaurant. Danach? Vielleicht, als er sich in den Wagen gesetzt hatte? Am Türgriff! Wäre Ross noch dazu fähig gewesen, hätte das Aha-Erlebnis ihn in die Senkrechte gescheucht. Aber er schaffte es nicht mehr. Er kriegte kaum noch Luft. Aus seinem Mund drang nur noch ein abgehackter Japser. Der Türgriff seines Autos war mit irgendetwas eingeschmiert worden, das ihn nun das Leben kostete. Ross blickte zum Telefon auf dem Nachttisch. Nur ein halber Meter trennte ihn von dem Apparat, doch er nutzte ihm jetzt so wenig, als stünde er in China.
Im Dunkeln erschien eine Gestalt an seinem Bett. Der Mann trug keine Maske. Trotz des Zwielichts konnte Ross seine Gesichtszüge erkennen. Er sah jung und ganz normal aus. Ross hatte schon Tausende solcher Gesichter gesehen und ihnen kaum Beachtung geschenkt. In seinem Beruf war es nie um Normales gegangen, immer nur um Außergewöhnliches. Nicht zu fassen, dass es jemandem wie diesem Mann gelingen sollte, ihn zu töten.
Während Ross immer gequälter atmete, zog der Fremde etwas aus der Tasche und hielt es ihm vors Gesicht. Es war ein Foto, doch Ross konnte nicht erkennen, wen es zeigte. Als Harry Finn das merkte, schaltete er eine kleine Stablampe ein und richtete den Lichtstrahl auf das Foto. Ross’ Blick erforschte das Bild. Trotzdem erkannte er die Person nicht, bis Finn ihm den Namen nannte.
»Jetzt weißt du Bescheid«, sagte Finn leise. »Jetzt weißt du’s.«
Er steckte das Foto weg, verharrte stumm an Ross’ Bett und betrachtete ihn, während die Lähmung sich im Körper des Sterbenden ausbreitete. Finns Blick ruhte auf Ross, bis dieser einen letzten, verkrampften Atemzug tat, ehe die Augen glasig wurden.
Wenige Minuten später durchquerte Finn den Wald hinter Ross’ Haus. Früh am nächsten Morgen saß er in einem Flugzeug, diesmal in der Passagierkabine. Vom Flugplatz aus fuhr er heim, küsste seine Frau, spielte mit dem Hund und holte die Kinder von der Schule ab. Am Abend gingen sie gemeinsam zum Essen aus, um zu feiern, dass die Jüngste, die achtjährige Susie, bei einer Theateraufführung an der Schule einen sprechenden Baum spielen durfte.
Gegen Mitternacht schlich Harry Finn die Treppe hinunter und ging in die Küche, wo George, der treue Labrador-Pudel-Mischling, aus seinem weich gepolsterten Hundekorb sprang und ihn begrüßte. Während er am Küchentisch saß und den Hund streichelte, strich er im Geiste Dan Ross von seiner Liste.
Nun konzentrierte er sich auf den nächsten Namen: Carter Gray, ehemaliger Chef des amerikanischen Geheimdienstimperiums.
KAPITEL 4
Annabelle Conroy streckte die langen Beine und betrachtete die Landschaft, die am Fenster des Amtrak-Acela-Waggons vorüberzog. Sie nahm fast nie die Eisenbahn; im Normalfall reiste sie in achttausend Meter Höhe, naschte Erdnüsse, schlürfte gepanschte Sieben-Dollar-Drinks und brütete den nächsten Coup aus. Heute nahm sie den Zug, weil ihr Begleiter, der eins achtzig große Milton Farb, keinen Fuß in ein Vehikel setzte, das die Fähigkeit und Absicht hatte, vom Boden abzuheben.
»Ein Flugzeug ist das sicherste Reisemittel, Milton«, hatte Annabelle ihn aufgeklärt.
»Nicht, wenn es sich in einer Spirale abwärts schraubt. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass man ins Gras beißt, satte hundert Prozent. Und diese Aussicht behagt mir überhaupt nicht.«
Mit Genies ließ sich nur schwer diskutieren, hatte Annabelle herausgefunden. Dessen ungeachtet hatte Milton, der Mann mit dem fotografischen Gedächtnis und dem blühenden Talent, Zeitgenossen auf geradezu brillante Weise anzulügen, hervorragende Arbeit geleistet. Nach einer erfolgreichen Aktion waren sie aus Boston abgereist. Ein bestimmter Gegenstand befand sich wieder da, wo er sein sollte, und niemand war auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen. In Annabelles Welt höchst riskanter Gaunereien war so etwas beinahe schon Perfektion.
Als der einzige Stromlinienzug der Amtrak auf dem verschlungenen Weg zur Ostküste dreißig Minuten später in einen Bahnhof rollte, blickte Annabelle aus dem Fenster und erschauderte unwillkürlich, als der Zugführer die Ankunft in Newark/New Jersey bekannt gab. Jersey war Jerry-Bagger-Land, doch zum Glück hielt der Acela nicht in Atlantic City, wo der brutale Kasinokönig seinen Stammsitz hatte. Andernfalls hätte Annabelle den Zug nicht genommen.
Außerdem hatte sie genug Verstand, um zu wissen, dass Jerry Bagger allen Grund hatte, Atlantic City zu verlassen und ihr nachzujagen, ganz gleich, wo sie steckte. Wenn man einen Verrückten wie Bagger um 40 Millionen Dollar beschiss, musste man damit rechnen, dass er keine Kosten und Mühen scheute, einen in die Hände zu bekommen, um ihm tausend Fetzen Fleisch gleichzeitig aus dem Leib zu reißen.
Annabelle sah Milton an, der mit seinem jungenhaften Gesicht und längeren Haaren einem Achtzehnjährigen glich. In Wirklichkeit ging der Mann auf die fünfzig zu. Er beschäftigte sich an seinem Notebook und stellte Berechnungen an, die weder Annabelle noch sonst jemand begreifen konnte, der unter dem geistigen Niveau eines Genies blieb.
Gelangweilt stand Annabelle auf, wechselte hinüber in den Bordimbiss und kaufte ein Bier sowie eine Tüte Chips. Als sie wieder gehen wollte, sah sie auf einem Tischchen eine herrenlose New York Times liegen. Sie setzte sich, trank das Bier und aß Chips, während sie gemächlich die Seiten durchblätterte und nach irgendeiner Information suchte, die der Auslöser zu ihrem nächsten Abenteuer sein könnte. Sobald sie in Washington eintraf, musste sie wichtige Entscheidungen treffen, darunter die, ob sie im Lande bleiben oder ins Ausland verschwinden sollte. Sie wusste genau, wie die Antwort lauten müsste. Derzeit wäre eine unbekannte Insel im Südpazifik der richtige Aufenthaltsort für sie; dort ließe sich der Tsunami namens Jerry Bagger in aller Ruhe aussitzen. Bagger war Mittsechziger, und da sie, Annabelle, eine solche Riesensumme bei ihm abgezockt hatte, war sein Blutdruck wahrscheinlich gewaltig in die Höhe geschnellt. Mit ein bisschen Glück gab er demnächst bei einem Herzinfarkt den Löffel ab, und dann wäre Annabelle wieder frei wie ein Vogel. Aber sie durfte nicht darauf bauen, dass es so kam: Bei jemandem wie Jerry musste man stets damit rechnen, dass einen das Glück verließ.
Die Entscheidung hätte ihr nicht schwerfallen dürfen, und doch hatte sie ihre Probleme damit. Annabelle war mit einem sonderbaren Grüppchen von Männern vertraut geworden – zumindest so vertraut, wie jemand ihres Schlages es sich erlaubte –, das sich Camel Club nannte. Beim Gedanken an dieses Quartett schmunzelte sie vor sich hin. Einer der Männer trug den Namen Caleb Shaw und arbeitete in der Kongressbibliothek. Caleb erinnerte sie stark an den feigen Löwen im Zauberer von Oz. Plötzlich aber schwand das Lächeln aus ihrem Gesicht. Oliver Stone, der Anführer dieses kleinen Klüngels von Außenseitern, war ein gänzlich anderes Kaliber. Er musste eine höllische Vergangenheit hinter sich haben, eine Lebensgeschichte, die sogar Annabelles Werdegang übertraf, der sehr bewegt und ungewöhnlich war, zumal für eine Sechsunddreißigjährige. Sie bezweifelte, dass sie je wieder einem Mann wie ihm begegnen würde.
Annabelle hob den Blick zu einem jungen Mann, der eben an ihr vorüberging und sich keine Mühe gab, seine Bewunderung für ihre hochgewachsene, kurvenreiche Gestalt, die langen blonden Haare und das hübsche Gesicht zu verhehlen, dessen Attraktivität auch nicht von der kleinen, fischförmigen Narbe unter dem Auge beeinträchtigt wurde, ein Andenken an ihren Vater Paddy Conroy, den besten Kleinbetrüger seiner Generation und – jedenfalls nach dem Urteil seines einzigen Kinds – miesesten Vater der Welt.
»Hallo«, sagte der junge Mann. Mit seiner schlanken, sportlichen Figur, dem zerzausten Haar und den teuren Klamotten, die allerdings schon vom Design her billig aussahen, hätte der Bursche einer Reklame von Abercrombie & Fitch entsprungen sein können. Annabelle durchschaute ihn sofort als privilegierten College-Jungen mit weit mehr Geld, als ihm guttat, und dementsprechendem unerträglich schnöselhaften Benehmen.
»Hallo«, antwortete sie und blickte wieder in die Zeitung.
»Wohin fahren Sie?«, fragte er und setzte sich neben sie.
»Nicht dahin, wohin Sie fahren.«
»Aber Sie wissen doch gar nicht, wohin ich fahre«, entgegnete er verschmitzt.
»Genau das ist der springende Punkt, oder?«
Er kapierte gar nicht, was sie meinte, und es interessierte ihn auch nicht. »Ich bin Student. In Harvard.«
»Oh! Darauf wäre ich nie gekommen.«
»Aber ich stamme aus Philly. An der Main Line. Meine Eltern haben dort ein Anwesen.«
»Hui, hui«, gab Annabelle eindeutig desinteressiert zur Antwort. »Es ist nett, Eltern mit einem Anwesen zu haben.«
»Ja, vor allem, wenn die Eltern die halbe Zeit außer Landes sind. Ich gebe heute Abend eine kleine, aber wilde Party. Haben Sie Lust zu kommen?«
Annabelle spürte, wie der Blick des Bürschchens sie von oben bis unten musterte. Na gut. Also ist es wieder mal so weit. Sie wusste, dass es klüger wäre, sich zusammenzureißen, doch bei solchen Typen konnte sie sich einfach nicht zurückhalten.
Sie faltete die Zeitung zusammen. »Keine Ahnung. Wenn Sie wild sagen, wie wild meinen Sie?«
»Wie wild möchten Sie’s denn haben?«
Annabelle sah dem Jungen an, dass ihm das Wort »Schätzchen« auf der Zunge lag, doch er verkniff es sich; auf jeden Fall jetzt noch, am Anfang der Konversation.
»Ich erlebe ungern Enttäuschungen.«
Er berührte sie am Arm. »Ich glaube nicht, dass Sie enttäuscht sein werden.«
Sie lächelte und tätschelte ihm die Hand. »Wovon reden wir eigentlich? Schnaps und Sex?«
»Versteht sich von selbst.« Er drückte ihren Arm. »Übrigens, ich reise Erster Klasse. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?«
»Geht da noch mehr ab außer Schnaps und Sex?«
»Sie wüssten vorher gerne Einzelheiten?«
»Auf die Details kommt es nun mal an, äh …«
»Steve. Steve Brinkman.« Er lachte gekünstelt auf. »Einer von den Brinkmans. Mein Vater ist Vorstandsvorsitzender einer der größten Banken des Landes.«
»Damit Sie Bescheid wissen, Steve, sollte es auf Ihrer Party bloß Coke geben – und ich meine nicht den Softdrink –, wäre ich bitter enttäuscht.«
»Auf was stehen Sie denn? Ich kann es garantiert besorgen. Ich habe Beziehungen.«
»Goofballs, Dollys, Hog, dazu anständiges Zubehör. Bloß keine Limonade.« Mit dieser Einschränkung meinte sie Drogen minderwertiger Qualität. »Limonade zieht mich immer runter.«
»Wow, Sie kennen sich ja gut aus«, sagte Steve und ließ den Blick nervös über die anderen Fahrgäste im Bordimbiss streifen.
»Schon mal auf Drachenjagd gewesen, Steve?«, fragte Annabelle.
»Äh … nein.«
»Das ist ’ne irre Methode, sich Heroin reinzuziehen. Falls es einen nicht umbringt, geht man auf den tollsten Trip der Welt.«
Er nahm die Hand von ihrem Arm. »Klingt nicht besonders verlockend.«
»Wie alt sind Sie?«
»Zwanzig. Warum?«
»Eigentlich suche ich mir lieber jüngere Männer. Ich finde, wenn ein Typ achtzehn wird, hat er Saft und Kraft schon zum Großteil verspritzt. Kommen auch Minderjährige zu der Party?«
Steve stand auf. »Vielleicht war mein Vorschlag doch nicht so toll.«
»Ach, ich bin nicht wählerisch. Es dürfen gern auch Mädels sein. Ich meine, wen stört es, wenn man vom Crystal Meth nicht mehr richtig aus der Wäsche gucken kann?«
»Ich glaube, wir lassen es lieber gut sein«, sagte Steve ernüchtert. »Tja, dann will ich mal wieder …«
»Eins noch.« Annabelle zückte die Damenbrieftasche und zeigte einen gefälschten Dienstausweis vor. »Kennen Sie das Kürzel DEA?«, fragte sie halblaut. »Drogenfahndung?«
»O Gott!«
»Dank der Angaben, die Sie mir über das Anwesen der Brinkmans an der Main Line gemacht haben, fällt es meinem Einsatzteam bestimmt nicht schwer, diesen Wohnsitz zu finden. Das heißt, sollten Sie noch immer die Absicht verfolgen, Ihre geile Party zu schmeißen.«
»Scheiße … oh, bitte, ich schwör’s bei Gott, ich hab bloß …« Er hob eine Hand, um sich an den Kopf zu fassen. Annabelle packte sie und quetschte ihm die Finger zusammen.
»Studier in Harvard, Steve. Sobald du fertig bist, kannst du dir von mir aus nach Lust und Laune das Leben versauen. Aber sei in Zukunft vorsichtig, wenn du in der Eisenbahn fremde Frauen anbaggerst.«
Annabelle sah ihm nach, während er durch den Gang hastete und endlich wohlbehalten in der Ersten Klasse verschwand. Sie leerte das Bier und las gelassen die letzten beiden Seiten der Zeitung. Dann war plötzlich sie diejenige, der das Blut aus dem Gesicht wich.
In einer Villa an der portugiesischen Küste war ein halbtot geprügelter Amerikaner aufgefunden worden, den man als Anthony Wallace identifiziert hatte. Drei weitere Personen hatte man ermordet in der Villa aufgefunden, die an einem einsamen Strandabschnitt lag. Man hielt Raub für das Motiv. Zwar lebte Wallace noch, befand sich aufgrund schwerer Hirnverletzungen jedoch im Koma, und die Ärzte hatten keine große Hoffnung, dass er durchkam.
Annabelle riss den Bericht aus der Zeitung und kehrte unsicheren Schrittes an ihren Platz zurück.
Jerry Bagger hatte Tony erwischt, einen ihrer Komplizen bei der Das-Große-Geld-Nummer! In einer Villa? Annabelle hatte Tony ausdrücklich eingeschärft, sich bedeckt zu halten und nicht mit Geld um sich zu werfen. Der Trottel hatte nicht auf sie gehört, und jetzt war er hirntot. Normalerweise ließ Jerry keine Zeugen am Leben.
Was hatte Jerry aus Tony herausprügeln können? Annabelle kannte die Antwort auf diese Frage. Alles.
Milton hörte auf, die Tasten des Notebooks zu quälen, und hob den Blick zu Annabelles Gesicht, als sie zurückkam. »Fühlen Sie sich nicht wohl?«
Sie sagte nichts. Während der Zug in Richtung D. C. jagte, schaute sie wieder aus dem Fenster, sah die Landschaft von Jersey aber nicht mehr. All ihre Zuversicht war verflogen, all ihre Gedanken kreisten nur noch um die drastischen Einzelheiten des qualvollen Todes, den Jerry Bagger für sie plante.
KAPITEL 5
Es gelang Oliver Stone, den alten, bemoosten Grabstein in die Senkrechte zu stemmen. Anschließend drückte er ringsum Erde in den Untergrund, damit der Stein aufrecht stehen blieb. Stone kauerte sich hin und wischte sich den Schweiß von der Stirn. In der Nähe stand ein Kofferradio, das einen Lokalsender empfing. Stone lechzte so sehr nach Informationen, wie andere Menschen Sauerstoff benötigten. Während er den Meldungen lauschte, durchfuhr ihn unerwartet ein Ruck. Am Nachmittag sollte im Weißen Haus feierlich eine Auszeichnung, der höchste zivile Orden, verliehen werden, die Presidential Medal of Freedom, und zwar an Carter Gray, den kürzlich zurückgetretenen Chef der US-Geheimdienste. Gray habe fast vier Jahrzehnte lang dem Vaterland hervorragende Dienste geleistet, erklärte der Sprecher und zitierte den Präsidenten dahingehend, Carter Gray sei ein Mann, auf den ganz Amerika stolz sein dürfe, ein wahrer Patriot und Mann des Volkes.
Dieser Einschätzung stimmte Stone nicht gerade zu. In der Tat war er sogar dafür verantwortlich gewesen, dass Carter Gray unvermittelt von seinem Posten als Geheimdienstzar der Nation zurückgetreten war.
Wenn der Präsident doch nur wüsste, dachte Stone, dass der Mann, dem er heute den Orden verleiht, derselbe ist, der ihm eine Kugel in den Kopf jagen wollte.
Aber für diese Wahrheit war die Nation keinesfalls reif.
Stone blickte auf die Uhr. Sicherlich kamen die Toten ein Weilchen ohne ihn zurecht.
Als er eine Stunde später geduscht und sich umgezogen hatte, verließ er das Friedhofsgärtnerhäuschen in seiner besten Kleidung, die einem Secondhandladen der Heilsarmee entstammte, denn als Friedhofsgärtner des Mt. Zion Cemetery, der letzten Ruhestätte berühmter Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts, waren Stones Einkünfte nicht gerade üppig. Den Weg vom Rande Georgetowns bis zum Weißen Haus legte Stone dank der langen Schritte seiner hageren Hünengestalt zügig zurück.
Trotz seiner einundsechzig Jahre hatte er nur wenig von seiner Vitalität und Spannkraft verloren. Mit seinem kurzen weißen Haar hätte er ein pensionierter Kompaniechef der Marines sein können, und in gewisser Weise war er das auch, bloß hatte sein buntscheckiges Regiment, das sich Camel Club nannte, einen vollkommen inoffiziellen Status. Es bestand aus ihm und drei anderen Männern: Caleb Shaw, Reuben Rhodes und Milton Farb.
Mittlerweile könnte Stone einen weiteren Namen hinzufügen: Annabelle Conroy. Das letzte Abenteuer hätte nicht nur die Clubmitglieder, sondern auch Annabelle beinahe das Leben gekostet. Sie war die geistig flexibelste, tüchtigste und verwegenste Frau, die Stone je kennengelernt hatte. Doch sein Gefühl sagte ihm, dass diese Frau, die sich derzeit mit Milton Farb um eine unerledigte Angelegenheit kümmerte, ihnen in Kürze den Rücken zukehren würde. Jemand hatte es auf Annabelle abgesehen; das wusste Stone – jemand, vor dem sie schreckliche Angst hatte. Unter solchen Umständen war es das Klügste, das Weite zu suchen; eine derartige Reaktion konnte Stone nachvollziehen.
Vor ihm befand sich nun das Weiße Haus. Niemals würde man ihm gestatten, das beinahe heilige Eingangstor zu durchqueren; er durfte nicht einmal die dortige Straßenseite der Pennsylvania Avenue betreten. Aber er konnte auf der gegenüberliegenden Seite im Lafayette Park lauern. Dort hatte er sogar ein Zelt stehen gehabt, bis er vor Kurzem vom Secret Service genötigt worden war, selbiges zu entfernen. Doch sein Schild stand noch da: Zwischen zwei in den Rasen gerammten Eisenstangen prangte nach wie vor die Aufschrift: Ich will die Wahrheit wissen. Gerüchten zufolge dürsteten vor Ort noch ein paar andere Leute nach der Wahrheit. Allerdings hatte Stone bislang nie gehört, dass jemand sie in der Welthauptstadt des Lugs und Trugs gefunden hätte.
Er vertrieb sich die Zeit, indem er mit einigen ihm bekannten, uniformierten Secret-Service-Agenten ein Schwätzchen hielt. Als das Tor des Weißen Hauses geöffnet wurde, beendete er das Gespräch und beobachtete die schwarze Limousine, die das Gelände verließ. Durch die dunklen Fahrzeugfenster konnte er nichts erkennen, doch aus irgendeinem Grund wusste er, dass in dem Viertürer Carter saß. Vielleicht lag es am Geruch, den der Kerl verströmte.
Stones Gespür erwies sich als richtig, als sich das Seitenfenster senkte und er sich mit einem Mal Auge in Auge mit dem ehemaligen Geheimdienstchef, neuen Medal-of-Freedom-Träger und ausgesprochenen Oliver-Stone-Hasser sah.
Als das Auto verlangsamte, um auf die Straße einzubiegen, starrte Grays bebrilltes Mondgesicht Stone ausdruckslos an. Dann hob Gray die große, glänzende Medaille hoch, um sie Stone zu zeigen.
Da er mit keinem eigenen Orden kontern konnte, beschloss Stone, mit dem Stinkefinger zu antworten. Grays Lächeln verwandelte sich in ein Zähnefletschen, und das Seitenfenster schloss sich.
Stone wandte sich ab und trat den Rückweg zum Friedhof mit dem Gefühl an, dass der Ausflug sich gelohnt hatte.
Als Carter Grays Wagen in die Siebzehnte Straße abbog, nahm ein anderes Auto die Verfolgung auf. Es gehörte Harry Finn, der am Morgen in den D. C. gefahren war. Auch er hatte von Grays großem Tag im Weißen Haus gehört, und so wie Oliver Stone hatte er sich dort eingefunden, um den Mann zu beobachten. Doch während Stone dem verabscheuten Politfunktionär bloß seinen Trotz bekunden wollte, wollte Finn weiter daran arbeiten, ein geeignetes Vorgehen zur Liquidierung Grays zu ersinnen.
Die Fahrt führte aus dem D. C. nach Maryland, zum Küstenort Annapolis an der Chesapeake Bay, die unter anderem bekannt war für ihre Krabbenkuchen und den Sitz der US-Marineakademie. Kürzlich hatte Carter Gray seinen Wohnsitz im fernen Virginia veräußert und stattdessen ein abgelegenes Haus an der Bucht erworben, idyllisch auf einer Klippe gelegen. Da er nicht mehr zum Regierungsstab zählte, genoss er heute erheblich weniger Personenschutz als früher. Allerdings erhielt er als vormaliger Chef der Central Intelligence nach wie vor täglich Lageberichte. Und man hatte ihm zwei Bodyguards zugeteilt, da er durch seine einstige Tätigkeit viele Feinde Amerikas vor den Kopf gestoßen hatte, die ihm nun nur allzu gern eine Kugel ins Hirn gejagt hätten.
Finn war sich bewusst, dass es wesentlich schwieriger sein würde, Gray zu töten, als jemanden wie Dan Ross. Eben wegen dieser erhöhten Anforderungen war seine heutige Fahrt nur eine von unzähligen, die er unternommen hatte, um Gray zu observieren. Jedes Mal hatte er ein anderes Fahrzeug benutzt, alle unter falschen Namen gemietet, und Verkleidungen getragen, um der Erstellung eines Bewegungsprofils vorzubeugen. Selbst wenn er hin und wieder im Stadtverkehr den Anschluss an die Limousine verlor, kannte er deren Ziel doch genau. Er brach die Verfolgung erst ab, als der Wagen auf einen privaten Kiesweg abbog, an dessen Ende Grays Haus und die Klippe standen, an deren Fuß, zehn Meter tiefer, die Brandung gegen den Fels anrollte.
Später observierte Finn, während er in einem Baum kauerte, durch ein Fernglas gewisse Vorgänge in Grays Villa, deren Kenntnis es ihm vielleicht ermöglichten, den Mann zu töten. Er schmunzelte vor sich hin, als ziemlich schnell ein brauchbarer Plan in ihm heranreifte.
Am Abend fuhr er seine Tochter Susie zum Schwimmunterricht. Während er auf der Zuschauerbank saß und voller Stolz ihren kleinen Körper mit vollendeten Bewegungen durchs Schwimmbecken gleiten sah, malte er sich die letzten Sekunden in Carter Grays Leben aus. Sie sollten ihm all die Mühe wert sein.
Er kehrte mit seiner Tochter nach Hause zurück, half dabei, sie und ihren zehnjährigen Bruder Patrick ins Bett zu bringen, hatte anschließend Streit mit seinem älteren Sohn David, dem Teenager, und spielte später auf der Zufahrt zum Haus mit dem Jungen Basketball, bis sie beide schwitzten. Danach schlief er mit seiner Frau Amanda, die alle nur Mandy nannten. Um Mitternacht stand er aus Ruhelosigkeit wieder auf und machte die Pausenbrote für den nächsten Schultag. Außerdem unterschrieb er für seinen Ältesten eine Einverständniserklärung für die Teilnahme an einer Klassenfahrt zum Capitol und anderen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Im nächsten Jahr sollte David zur High School gehen. Der Junge beschäftigte sich gerne mit Mathematik und anderen wissenschaftlichen Fächern. Vielleicht, überlegte Finn, wird er mal Ingenieur. Da er ebenfalls entsprechende Neigungen besaß, hätte er beinahe selbst diese Laufbahn eingeschlagen, hätte sein Leben nicht einen ganz anderen Verlauf genommen: Er war zur Marine gegangen, zu einer Eliteeinheit.
Finn war ehemaliger Navy-SEAL und konnte auf heikle Spezialaufträge und gefährliche Kampfeinsätze zurückblicken. Zudem verfügte er dank der Immersionsschule in Kalifornien über einzigartige Fremdsprachenkenntnisse, darunter Arabisch, sogar in mehreren Dialekten, die er sich angeeignet hatte, als er später in verschiedenen Teilen der arabischen Welt eingesetzt worden war. In seinem derzeitigen Beruf reiste er viel, war aber auch häufig zu Hause. Er versäumte kaum ein sportliches Großereignis und selten eine wichtige Schulveranstaltung. Er war stets für seine Kinder da und hoffte, dass sie später für ihn da sein würden.
Nachdem er die Pausenbrote geschmiert hatte, zog er sich in sein kleines Arbeitszimmer zurück und machte sich daran, seine Planung bezüglich Carter Gray zu konkretisieren. Schon aus praktischen Erwägungen durfte sein Vorhaben keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Vorgehen gegen Dan Ross aufweisen. Doch Finn hatte noch nie Äpfel mit Birnen verwechselt. Als Killer musste man besonders flexibel sein.
Finns Blick fiel auf die Fotos seiner drei Sprösslinge, die am Schreibtischrand aufgereiht standen. Geburt und Tod. Für jeden lief es gleich ab. Am Anfang begann man zu atmen, zum Schluss hörte man damit auf. Was man in der Zwischenzeit tat, bestimmte darüber, wer und was man war. Doch Harry Finn hätte Probleme gehabt, sich in eine bestimmte Kategorie einzuordnen. Manchmal verstand er sich selbst nicht richtig.
KAPITEL 6
Der Leihwagen hielt vor dem Friedhofstor, als Oliver Stone gerade mit der Arbeit fertig war. Als er sich die Hose abklopfte, wobei er das Auto im Auge behielt, hatte er ein Déjà-vu-Erlebnis: Schon einmal hatte sie sich so verhalten und war schließlich zurückgekehrt. Irgendwie hatte Stone nicht damit gerechnet, dass dies noch einmal geschehen würde.
Annabelle Conroy stieg aus dem Wagen und ging durch das offene Friedhofstor. Ihr langer schwarzer Mantel wogte im Wind und gab den Blick frei auf ein knielanges braunes Kleid und Stiefel; ihr Haar blieb unter einem breitrandigen Schlapphut verborgen. Stone machte die Tür des kleinen Schuppens zu, der nahe seines Friedhofsgärtnerhäuschens stand, und verriegelte das Vorhängeschloss.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!