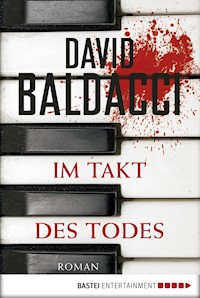9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Evan Waller ist ein Monster. Dank seiner Bereitschaft, alles und jeden zu verkaufen, hat er ein gewaltiges Vermögen angehäuft. Nun baut er ein neues Geschäft auf - ein Geschäft, das zu Millionen von Toten führen wird. Aber Shaw, der mysteriöse Agent aus "Die Kampagne", ist ihm auf den Fersen. Er hat Waller bis in die Provence verfolgt und muss verhindern, dass der letzte Deal unter Dach und Fach gebracht wird. Dann kommt ihm jedoch eine unbekannte Agentin in die Quere. Auf ihrer Jagd nach Waller entbrennt ein tödliches Duell zwischen ihnen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Kapitel siebenundvierzig
Kapitel achtundvierzig
Kapitel neunundvierzig
Kapitel fünfzig
Kapitel einundfünfzig
Kapitel zweiundfünfzig
Kapitel dreiundfünfzig
Kapitel vierundfünfzig
Kapitel fünfundfünfzig
Kapitel sechsundfünfzig
Kapitel siebenundfünfzig
Kapitel achtundfünfzig
Kapitel neunundfünfzig
Kapitel sechzig
Kapitel einundsechzig
Kapitel zweiundsechzig
Kapitel dreiundsechzig
Kapitel vierundsechzig
Kapitel fünfundsechzig
Kapitel sechsundsechzig
Kapitel siebenundsechzig
Kapitel achtundsechzig
Kapitel neunundsechzig
Kapitel siebzig
Kapitel einundsiebzig
Kapitel zweiundsiebzig
Kapitel dreiundsiebzig
Kapitel vierundsiebzig
Kapitel fünfundsiebzig
Kapitel sechsundsiebzig
Kapitel siebenundsiebzig
Kapitel achtundsiebzig
Kapitel neunundsiebzig
Kapitel achtzig
Kapitel einundachtzig
Kapitel zweiundachtzig
Kapitel dreiundachtzig
Kapitel vierundachtzig
Kapitel fünfundachtzig
Kapitel sechsundachtzig
Kapitel siebenundachtzig
Kapitel achtundachtzig
Kapitel neunundachtzig
Kapitel neunzig
Kapitel einundneunzig
Kapitel zweiundneunzig
Kapitel dreiundneunzig
Kapitel vierundneunzig
Kapitel fünfundneunzig
Kapitel sechsundneunzig
Kapitel siebenundneunzig
Kapitel achtundneunzig
Kapitel neunundneunzig
Kapitel einhundert
Kapitel einhunderteins
Kapitel einhundertzwei
Danksagung
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit Der Präsident seinen ersten Roman veröffentlichte, der sofort zum Bestseller wurde; ebenso wie alle folgenden Romane, die weltweit regelmäßig unter den Top 10 zu finden sind. David Baldacci lebt mit seiner Familie in der Nähe von Washington, D. C.
David Baldacci
DOPPELSPIEL
Thriller
Aus dem Amerikanischen vonRainer Schumacher
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by David Baldacci
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Deliver Us from Evil«
Originalverlag: Grand Central, Hachette Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Titelgestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano unter Verwendung von Motiven von © Nik Keevil/Arcangel
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2474-4
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Alli und Anshu,Catherine und David,Marilyn und Bob,Amy und Craig:
Ihr seid alle gute Freunde.
Kapitel eins
Der sechsundneunzig Jahre alte Mann saß in seinem bequemen Sessel und genoss ein Buch über Josef Stalin. Kein Publikumsverlag würde solch ein wahnhaftes Manuskript auch nur anfassen, denn der Autor feierte den sadistischen Sowjetführer unverhohlen; doch dem alten Mann gefiel das im Selbstverlag veröffentlichte Buch. Er hatte es direkt vom Autor erstanden, kurz bevor dieser in die Psychiatrie eingewiesen worden war.
Keine Sterne waren über dem großen Grundstück des alten Mannes zu sehen, denn vom Meer her zog ein Sturm auf. Der Mann war zwar reich und lebte in großem Luxus, doch seine persönlichen Bedürfnisse waren verhältnismäßig schlicht. Er trug einen jahrzehntealten Pullover; den Kragen hatte er bis zu dem dicken, von Flechten überwucherten Hals zugeknöpft, und seine billige Hose war viel zu weit für die dürren, nutzlosen Beine. Das hypnotische Trommeln der Regentropfen auf dem Dach hatte bereits eingesetzt. Der Mann lehnte sich zurück und genoss es, seine Gedanken auf die Karriere eines Wahnsinnigen zu richten, der Millionen von Menschen ermordet hatte, die das Pech gehabt hatten, unter seiner eisernen Faust gelebt zu haben.
Gelegentlich lachte der alte Mann über eine besonders grausame Stelle und nickte zustimmend, wenn einer von Stalins Jüngern wieder einmal die radikalen Methoden erklärte, mit denen der Georgier die Menschen- und Bürgerrechte außer Kraft gesetzt hatte. Für den alten Mann war Stalin das Paradebeispiel schlechthin dafür, wie man ein Land zu neuer Größe führte und gleichzeitig dafür sorgte, dass der Rest der Welt vor Angst erzitterte. Der alte Mann zog seine dicke Brille ein Stück herunter und schaute auf seine Uhr. Es war fast elf. Um Punkt neun Uhr war automatisch das Sicherheitssystem angesprungen und hatte sämtliche Türen und Fenster verriegelt. Seine Festung war gesichert.
Plötzlich ließ ein Donnerschlag die Lichter flackern, und schließlich erloschen sie ganz. Doch der Sturm hatte nichts mit dem Stromausfall zu tun. Unten, dort wo die gesamte Elektronik untergebracht war, hatte jemand die Batterie des Sicherheitssystems herausgenommen, sodass die gesamte Stromversorgung zusammengebrochen war. Als Folge davon wurde sofort jede Tür und jedes Fenster entsichert. Zehn Sekunden später sprangen die Notfallgeneratoren an und schalteten das Sicherheitssystem wieder ein. Doch in diesen zehn Sekunden hatte sich ein Fenster geöffnet. Eine Hand war vorgeschossen, um die Digitalkamera aufzufangen, die ins Erdgeschoss geworfen worden war, und eine Sekunde, bevor das Sicherheitssystem wieder ansprang, schloss sich das Fenster erneut.
Der alte Mann merkte nichts davon. Er rieb sich den kahlen, wettergegerbten Kopf. Sein Gesicht hatte schon vor langer Zeit der Schwerkraft nachgegeben. Augen, Nase und Mund waren heruntergezogen, sodass er permanent mürrisch dreinzublicken schien. Sein Körper – oder besser gesagt, das, was von ihm übrig geblieben war – war ebenso verfallen. Inzwischen war er selbst für die einfachsten Dinge auf die Hilfe anderer angewiesen.
Aber wenigstens lebte er noch, während seine Waffenbrüder gestorben waren, viele durch Gewalt. Das machte ihn wütend. Die Geschichte bewies, dass das einfache Volk schon immer neidisch auf jene gewesen war, die das Schicksal zu Höherem bestimmt hatte.
Schließlich legte der alte Mann das Buch beiseite. In seinem Alter brauchte er zwar nur noch drei, vier Stunden Schlaf, aber jetzt war es so weit. Er rief nach seiner Pflegerin, indem er den blauen Knopf auf dem kleinen, runden Gerät drückte, das er ständig um den Hals trug. Es hatte drei Knöpfe. Einer rief die Pflegerin, einer den Arzt und einer den Sicherheitsdienst. Der alte Mann hatte Feinde und war schwer krank, doch die Pflegerin diente hauptsächlich seinem Vergnügen.
Die Frau betrat den Raum. Barbara hatte blondes Haar und trug einen engen weißen Minirock sowie ein Tanktop, das dem alten Mann einen guten Blick auf ihre Brust gewährte, als sie sich vorbeugte, um ihm in den Rollstuhl zu helfen. Dass sie sich besonders offenherzig kleidete, war eine der Einstellungsvoraussetzungen gewesen. Alte, reiche, perverse Männer konnten tun und lassen, was sie wollten. Nun drückte der alte Mann sein faltiges Gesicht in ihr Dekolleté, und als Barbara ihn mit ihren starken Armen auf den Stuhl zog, glitt seine Hand unter ihren Rock, und seine Finger tasteten sich die Schenkel bis zu dem festen Hintern hinauf. Er zwickte sie einmal fest in jede Backe. Dann stöhnte er anerkennend. Barbara reagierte nicht darauf, denn sie wurde gut dafür bezahlt, sich begrapschen zu lassen.
Barbara schob den alten Mann zum Aufzug, und gemeinsam fuhren sie zum Schlafzimmer. Sie half ihm beim Ausziehen und achtete dabei sorgfältig darauf, nicht auf seinen eingefallenen Leib zu starren. Trotz all seines Geldes konnte der alte Mann Barbara nicht dazu zwingen, seine Nacktheit zu betrachten. Vor Jahrzehnten wäre das noch anders gewesen. Damals hätte sie ihn nicht nur angeschaut, sondern noch viel mehr für ihn getan … wenn sie denn hätte weiterleben wollen. Doch jetzt half sie ihm nur in seinen Schlafanzug, wie einem Baby. Und am Morgen würde sie ihn dann auch wieder wie ein Kleinkind waschen und füttern. Der Kreis hatte sich geschlossen. Von Wiege zu Wiege und schließlich ins Grab.
»Setz dich zu mir, Barbara«, befahl der alte Mann. »Ich möchte dich anschauen.« All das sagte er auf Deutsch. Das war der andere Grund, warum er Barbara eingestellt hatte: Sie sprach seine Muttersprache. Das war in diesem Land inzwischen eine Seltenheit.
Barbara setzte sich, schlug ihre langen, braun gebrannten Beine übereinander und legte die Hände in den Schoß, während sie den alten Mann gelegentlich anlächelte, denn dafür wurde sie bezahlt. Dabei sollte sie ihm dankbar dafür sein, dass sie hier arbeiten durfte, dachte der alte Mann, denn sie konnte entweder hier in diesem schönen Haus wohnen und sich einen Lenz machen oder ihren Körper auf den Straßen des nahe gelegenen Buenos Aires für ein paar Cent am Tag verkaufen.
Schließlich winkte der alte Mann ab, und Barbara stand auf und schloss die Tür hinter sich. Der alte Mann lehnte sich auf den Kissen zurück. Barbara würde jetzt wahrscheinlich sofort in ihr Zimmer gehen, unter die Dusche springen und sich so hart wie möglich schrubben, um das ekelige Gefühl seiner Finger loszuwerden. Der Gedanke ließ den alten Mann leise lachen. Selbst in seinem jetzigen Zustand hatte er noch eine gewisse Wirkung auf die Menschen.
Der alte Mann erinnerte sich noch lebhaft an die glorreiche Zeit, als er mit kniehohen Offiziersstiefeln in einen Raum marschiert war. Allein das Geräusch hatte schon Panik bei den Lagerinsassen erzeugt. Das war Macht gewesen. Jeden Tag hatte er das Privileg genossen, sich unbesiegbar zu fühlen. Alle seine Befehle waren ohne zu zögern ausgeführt worden. Auf sein Wort hin hatten seine Männer das Ungeziefer zusammengetrieben, und in langen, dreckigen Reihen waren sie mit gesenkten Köpfen vor ihm angetreten und hatten auf seine prächtigen Stiefel gestarrt und vor der Macht gezittert, die seine Uniform repräsentierte. Damals war er ein Gott gewesen und hatte über Leben und Tod entschieden. Dabei war es nicht wirklich ein Vorteil gewesen, am Leben gelassen zu werden, denn die Lebenden hatten die Hölle auf Erden ertragen müssen.
Der alte Mann rutschte ein Stück nach links und drückte auf ein Paneel am Kopfende seines Bettes. Das Paneel schwang auf, und der alte Mann gab zitternd die Kombination des Safes ein, der sich dahinter verbarg. Dann holte er ein Foto heraus, lehnte sich wieder zurück und schaute es sich an. Es war auf den Tag genau vor achtundsechzig Jahren aufgenommen worden. In Gedanken war der alte Mann noch immer dort, auch wenn sein Körper ihn schon längst im Stich gelassen hatte.
Auf dem Bild war er erst Ende zwanzig; trotzdem hatte man ihm bereits eine große Verantwortung übertragen, denn er war klug und gnadenlos gewesen. Er war groß und schlank gewesen und hatte hellblondes Haar gehabt, das im Zusammenspiel mit seinem sonnengebräunten, kantigen Gesicht einfach fantastisch ausgesehen hatte. Dazu kam dann noch seine Uniform mit all den Orden, obwohl er zugeben musste, dass er sich nur die wenigsten davon wirklich verdient hatte. Er war nie im Kampf gewesen, denn an persönlichem Mut hatte es ihm stets gemangelt. Aber sollten ruhig die talentfreien Massen in den Schützengräben sterben, hatte er sich schon damals gedacht; seine Fähigkeiten hatten ihn an einen sichereren Ort geführt. Dem alten Mann traten die Tränen in die Augen, als er sah, was er einst gewesen war, und neben ihm stand der Mann höchstpersönlich. Er war von kleiner Statur, doch in jeder anderen Hinsicht ein Koloss. Sein schwarzer Schnurrbart war für alle Zeit über dem ausdrucksstarken Mund wie eingefroren.
Der alte Mann küsste erst sein jüngeres Ich auf dem Foto und dann die Wange seines wunderbaren Führers. Das war sein Gutenachtritual. Er legte das Foto wieder in sein Versteck und dachte an all die Jahre zurück, seit er kurz vor dem Einmarsch der Alliierten und dem Fall von Berlin aus Deutschland geflohen war. Er hatte seine Flucht schon weit im Voraus geplant, denn er hatte das Ende des Krieges kommen sehen und das lange vor seinen Vorgesetzten. Jahrzehntelang hatte er im Verborgenen gelebt, sich mit seinen ›Talenten‹ ein neues Imperium aus Erz- und Holzexporten aufgebaut und dabei jede Konkurrenz gnadenlos zerschlagen. Dennoch sehnte er sich noch immer nach der guten, alten Zeit, als er der alleinige Richter über Leben und Tod gewesen war.
Trotzdem würde er auch heute gut schlafen, wie jede Nacht, denn sein Gewissen war rein. Seine Augenlider wurden gerade langsam schwer, als er plötzlich hörte, wie die Tür sich wieder öffnete. Der alte Mann versuchte, etwas im Zwielicht zu erkennen, und da stand sie. Ihre Silhouette war deutlich in der Tür zu sehen.
»Barbara?«
Kapitel zwei
Barbara trat vor, nachdem sie die Tür hinter sich abgeschlossen hatte. Als sie näher ans Bett kam, sah der alte Mann, dass sie nur einen Morgenmantel trug, der ihre Schenkel kaum bedeckte und viel von ihrer Brust enthüllte. Ihre sonnengebräunte Haut war aus mehreren Winkeln zu sehen, außer am Saum; dort konnte man die bleiche Haut ihrer Hüfte nur erahnen. Ihr Haar hatte sie gelöst, sodass es nun über ihre Schultern fiel.
Und sie schlüpfte neben ihm ins Bett.
»Barbara?«, fragte er, und sein Herz schlug immer schneller. »Was machen Sie hier?«
»Ich weiß doch, dass Sie mich wollen«, sagte sie auf Deutsch. »Das sehe ich in Ihren Augen.«
Der alte Mann wimmerte, als Barbara seine Hand nahm und sie neben ihrer Brust in der Mantel schob. »Aber ich bin ein alter Mann. Ich kann Sie nicht befriedigen. Ich … Ich kann nicht.«
»Ich werde Ihnen helfen. Wir werden es ganz langsam angehen lassen.«
»Aber was ist mit dem Wachmann? Der steht draußen vor der Tür. Ich will nicht, dass er …«
Sanft streichelte Barbara ihm über den Kopf. »Ich habe ihm gesagt, heute sei Ihr Geburtstag und ich sei Ihr Geschenk.« Sie lächelte. »Ich habe ihm gesagt, er soll uns zwei Stunden geben … mindestens.«
»Aber mein Geburtstag ist erst nächsten Monat.«
»Ich konnte es nicht erwarten.«
»Aber ich kann nicht. Ich will Sie ja, Barbara; aber ich bin zu alt. Viel zu alt, verdammt.«
Barbara rückte näher an ihn heran und berührte ihn dort, wo er schon seit Jahrzehnten nicht mehr berührt worden war. Er stöhnte. »Tun Sie mir das nicht an. Ich habe Ihnen doch gesagt, das wird nicht funktionieren.«
»Ich habe viel Geduld.«
»Aber warum wollen Sie ausgerechnet mich?«
»Sie sind sehr reich und mächtig, und es ist noch immer deutlich zu erkennen, wie gut Sie einmal ausgesehen haben.«
Das gefiel ihm. »Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch ein Bild.«
»Zeigen Sie es mir«, stöhnte Barbara ihm ins Ohr, während sie seine Hand in ihren Mantel auf und ab schob.
Der alte Mann öffnete das Paneel wieder, holte das Foto heraus und gab es Barbara.
Sie betrachtete das Bild, das ihn und Adolf Hitler zeigte. »Sie sehen wie ein Held aus. Waren Sie ein Held?«
»Ich habe meine Pflicht getan«, erklärte er stolz. »Ich habe getan, was man mir befohlen hat.«
»Und ich bin sicher, dass Sie sehr gut darin waren.«
»Ich habe dieses Bild noch nie jemandem gezeigt. Niemals.«
»Ich fühle mich geschmeichelt. Und jetzt … Legen Sie sich zurück.«
Das tat er dann auch, und Barbara kletterte auf ihn und öffnete den Morgenmantel, sodass er noch mehr von ihr sehen konnte. Und sie nahm ihm das Rufgerät mit den drei Knöpfen ab, das er um den Hals trug.
Der alte Mann öffnete den Mund, um dagegen zu protestieren.
»Wir wollen doch nicht, dass aus Versehen ein Knopf gedrückt wird«, sagte Barbara und hielt das Gerät so, dass er es nicht mehr erreichen konnte. Dann beugte sie sich vor, bis ihre Brüste fast sein Gesicht berührten. »Wir wollen doch nicht gestört werden.«
»Ja, da haben Sie recht. Keine Störungen.«
Barbara griff in ihre Tasche und holte eine Pille heraus. »Die habe ich für Sie mitgebracht. Die wird Ihnen dabei helfen.« Sie deutete auf seinen Schritt.
»Ich bin nicht sicher, ob das gut wäre. Meine anderen Medikamente …«
Barbara senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Damit werden Sie Stunden durchhalten. Sie werden mich zum Schreien bringen.«
»Gott, wenn das nur möglich wäre.«
»Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, die zu schlucken«, wieder hielt sie die Pille in die Höhe, »und mich dann nehmen.«
»Funktioniert die Pille wirklich?« Vor lauter Aufregung erschien ein Speicheltropfen auf den Lippen des alten Mannes.
»Sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Und jetzt … Schlucken Sie.«
Barbara gab dem alten Mann die Pille, schenkte ein Glas Wasser aus einer Karaffe ein, die auf dem Nachttisch stand, und schaute zu, wie der alte Mann gierig die Tablette runterspülte.
»Und? Wird er schon größer?«, verlangte er aufgeregt zu wissen.
»Geduld. In der Zwischenzeit gibt es da auch noch etwas, was ich Ihnen zeigen will.« Sie holte eine schmale Kamera aus der Tasche ihres Mantels. Es war die, die jemand Barbara zugeworfen hatte, als kurz der Strom gekappt und das Sicherheitssystem lahmgelegt worden war, sodass man ein Fenster hatte öffnen können.
»Barbara, ich fühle mich so komisch.«
»Kein Grund, sich Sorgen zu machen.«
»Rufen Sie den Arzt. Drücken Sie den Knopf. Sofort.«
»Alles wird gut. Das ist nur die Pille.«
»Aber ich spüre meinen Körper nicht mehr. Und meine Zunge …«
»… fühlt sie sich irgendwie größer an? O mein Gott. Dann hat die Pille also Auswirkungen auf Ihre Zunge und nicht auf den Teil da unten. Ich werde mich beim Hersteller beschweren.«
Der alte Mann gurgelte laut. Er versuchte, auf seinen Mund zu deuten, doch seine Gliedmaßen wollten ihm nicht mehr gehorchen. »Drücken Sie … den …«
Barbara legte das Rufgerät noch ein Stück weiter weg, knöpfte ihren Mantel zu, stieg von dem alten Mann herunter und setzte sich neben ihn. »Nun denn … Das hier sind die Bilder, die ich Ihnen zeigen wollte.«
Sie drehte die Kamera. Auf dem kleinen Display erschien das alte Schwarzweißbild eines Gesichts.
»Dieser Junge hieß David Rosenberg«, erklärte sie und deutete auf das jugendliche, aber hagere Gesicht. Die hohlen Wangen und die glasigen Augen verrieten, dass der Tod nicht weit entfernt war. »Er hat seine Bar-Mitzwa nie feiern können. Haben Sie das gewusst, als Sie seinen Tod befohlen haben, Herr Standartenführer Huber? Er war bereits über dreizehn, aber natürlich wurden jüdische Übergangsriten im Lager nicht befolgt.«
Der alte Mann gurgelte leise weiter und starrte entsetzt das Foto an.
Barbara drückte eine Taste, und das Gesicht einer jungen Frau erschien auf dem Display. Sie sagte: »Das ist Frau Helene Koch. Sie wurde von einer Gewehrkugel getötet, die sie in den Bauch getroffen hat, noch bevor Sie morgens Ihre erste Zigarette geraucht hatten. Berichten zufolge hat sie ›lediglich‹ drei Stunden leiden müssen, bis sie gestorben ist, während Ihre Männer verhinderten, dass Frau Kochs jüdische Brüder und Schwestern ihr helfen konnten. Tatsächlich haben Sie an diesem Morgen sogar zwei Menschen getötet, denn Frau Koch war schwanger.«
Während der Rest seines Körpers noch immer gelähmt war, krallte sich der alte Mann mit den Fingern in die Bettdecke. Sein Blick war auf das Rufgerät fixiert, aber obwohl es nur zwei Fuß entfernt lag, konnte er es nicht erreichen. Barbara fasste ihn am Kinn und drehte seinen Kopf so, dass er auf das Display schauen konnte.
»Sie müssen sich konzentrieren, Herr Standartenführer. Sie erinnern sich doch an Frau Koch, nicht wahr? Und an David Rosenberg? Nicht wahr?«
Schließlich blinzelte der alte Mann zur Bestätigung.
»Ich würde Ihnen ja gerne noch die Bilder der anderen Menschen zeigen, die Sie zum Tode verurteilt haben, aber uns fehlt schlicht die Zeit dafür; schließlich handelt es sich um mehr als hunderttausend.« Sie holte ein Foto aus ihrer Tasche. »Das hier habe ich aus dem Bilderrahmen auf dem Klavier in Ihrer wunderbaren Bibliothek.« Sie hielt dem alten Mann das Bild vors Gesicht. »Wir haben Ihren Sohn, Ihre Tochter, Ihre Enkel und Ihre Urenkel gefunden. All die unschuldigen Menschen. Schauen Sie sich Ihre Gesichter an. Genau wie David Rosenberg, Helene Koch und all die anderen. Hätte ich die Zeit, würde ich Ihnen erzählen, wie jeder von ihnen noch heute Nacht sterben wird. Tatsächlich sind sieben von ihnen bereits abgeschlachtet worden und das nur wegen ihrer Verbindung zu Ihnen. Aber Sie verstehen sicher, dass wir sicherstellen müssen, dass ein Monster wie Sie sich nicht mehr fortpflanzen kann, Herr Standartenführer.«
Der alte Mann begann zu weinen und wimmerte leise vor sich hin.
»Gut, gut. Das sind sicher Freudentränen, nicht wahr, Herr Standartenführer? Vielleicht wird man ja denken, unser Sex sei so gut, dass Sie vor Rührung weinen mussten. Doch jetzt ist es erst einmal an der Zeit zu schlafen … Aber schauen Sie weiter auf das Bild. Schauen Sie nicht weg. Immerhin ist das Ihre Familie.« Als der alte Mann die Augen schloss, schlug Barbara ihm ins Gesicht und zwang ihn so, sie wieder zu öffnen. Dann beugte sie sich vor und flüsterte ihm in einer anderen Sprache etwas ins Ohr.
Er riss die Augen auf.
»Erkennen Sie das, Herr Standartenführer? Das ist Jiddisch. Ich bin sicher, Sie haben diese Phrase häufig im Lager gehört. Aber für den Fall, dass Sie die Übersetzung nicht kennen, das heißt: ›Du sollst in der Hölle brennen.‹«
Barbara legte ein Kissen auf Nase und Mund des alten Mannes, doch nicht auf seine Augen. Das Letzte, was er in diesem Leben sah, sollte seine dem Tod geweihte Familie sein. Dann drückte sie mit bemerkenswerter Kraft zu. Der alte Mann konnte nichts tun, als er immer weniger Sauerstoff bekam. »Eigentlich ist dieser Tod viel zu leicht für Sie«, bemerkte Barbara, während der alte Mann verzweifelt nach Luft rang.
Schließlich hob seine Brust sich ein letztes Mal. Barbara nahm das Kissen wieder weg und steckte das Bild des jungen Huber in Uniform zusammen mit der kleinen Kamera in die Tasche. Sie hatten seine Familie nicht getötet, und sie hatten das auch nicht vor; aber sie hatten gewollt, dass Huber mit seinem letzten Atemzug glaubte, dass er die Menschen, die er liebte, zum Tode verurteilt hatte. Und sie wussten, dass sein Tod kein Ausgleich für die Schrecken war, die er zu verantworten hatte, aber es war das Beste, was sie tun konnten.
Barbara bekreuzigte sich und flüsterte: »Möge Gott verstehen, warum ich das getan habe.«
Später kam sie auf dem Weg zu ihrem Zimmer an einem Wachmann vorbei, einem frechen, jungen Argentinier. Er starrte sie lüstern an. Barbara lächelte ihm zu, schwang verspielt die Hüften und gestattete ihm einen kurzen Blick auf die blasse Haut unter ihren dünnen Morgenmantel. »Sag mir Bescheid, wenn du Geburtstag hast«, neckte sie ihn.
»Morgen«, erwiderte er rasch und griff nach ihr, doch sie sprang geschickt beiseite.
Sehr gut, dachte sie, denn dann bin ich nicht mehr hier.
Barbara ging noch kurz zur Bibliothek und steckte das Foto in den Rahmen. Eine Stunde später flackerten die Lichter wieder und gingen aus, und erneut dauerte es zehn Sekunden, bis das Notstromaggregat ansprang. Barbaras Fenster öffnete und schloss sich wieder. Ganz in Schwarz gekleidet und mit einer Strickmütze auf dem Kopf kletterte sie eine Regenrinne hinunter, schlich am Rand des Grundstücks entlang und stieg über die hohe Mauer. Auf der anderen Seite erwartete sie ein Auto. Das alles war nicht allzu schwer, denn die Sicherheitsmaßnahmen am Grundstück dienten vor allem dazu, Leute draußen zu halten, nicht drinnen. Der Fahrer, Dominic, ein schlanker, junger Mann mit dunklem, lockigem Haar und großen, traurigen Augen, sah erleichtert aus.
»Das war hervorragende Arbeit«, bemerkte Barbara mit britischem Akzent. »Das Timing für den Stromausfall war auf den Punkt.«
»Wenigstens hat der Wetterbericht recht behalten, was den Sturm betrifft. So konnte ich meinen kleinen technischen Trick ungestört durchziehen. Was hat er gesagt?«
»Er hat mit den Augen gesprochen. Er wusste es.«
»Ich gratuliere. Das war der Letzte, Reggie.«
Regina Campion, Reggie für ihre Freunde, lehnte sich auf dem Sitz zurück, zog die Mütze aus und befreite so ihr blond gefärbtes Haar. »Da irrst du dich. Das war nicht der Letzte.«
»Was meinst du damit? Es lebt kein Nazi mehr, der wie er schuldig war. Huber war der Letzte von diesen Bastarden.«
Regina holte das Foto von Huber und Adolf Hitler aus ihrer Tasche und schaute es sich an, während der Wagen durch die dunklen Straßen in den Außenbezirken von Buenos Aires fuhr.
»Aber es wird immer wieder Monster geben, und wir müssen jedes Einzelne von ihnen zur Strecke bringen.«
Kapitel drei
Shaw hoffte, dass der Mann versuchen würde, ihn zu töten, und er wurde nicht enttäuscht. Wenn man mit dem Verlust der Freiheit oder gar der Hinrichtung rechnen musste, dann war manch einer schon recht pikiert. Ein paar Augenblicke später lag der Kerl bewusstlos auf dem Boden, und auf seiner Wange war der Abdruck von Shaws Faust zu sehen. Und eine Minute später kam Shaws Verstärkung, um den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Im Geiste hakte Shaw einen weiteren Namen auf seiner Liste von herzlosen Bastarden ab, die unschuldige Kinder dazu verleiteten, andere Menschen in die Luft zu jagen, und das nur, weil die nicht an denselben Gott glaubten wie sie.
Und weitere zehn Minuten später saß er im Wagen und fuhr zum Flughafen von Wien, und neben ihm saß Frank Wells, sein Boss. Frank sah aus wie der übelste Hurensohn, den man sich vorstellen konnte, und das war er auch. Er besaß den Brustkorb eines Mastiffs und knurrte auch so. Am liebsten trug er billige Anzüge, die schon zerknittert waren, bevor man sie anzog, und dazu einen scharfkantigen Hut, bei dessen Anblick man sich modisch um Jahrzehnte zurückversetzt fühlte. Shaw hatte schon immer geglaubt, dass Frank schlicht zur falschen Zeit geboren worden war. Er hätte hervorragend in die 20er-, 30er-Jahre gepasst, wo er Verbrecher wie Al Capone und John Dillinger mit einer Tommy Gun statt mit einem Haftbefehl hätte jagen können, und ihre Miranda-Rechte hätte er ihnen auch nicht vorlesen müssen. Frank war unrasiert, und sein zweites Kinn klebte an seinem Hals. Er war Mitte fünfzig, sah aber dank all der Wut und der Bitterkeit, die sich über die Jahre hinweg in seiner Psyche aufgestaut hatten, deutlich älter aus. Er und Shaw waren durch eine Art Hassliebe miteinander verbunden, und im Augenblick schien der Hass wieder die Oberhand gewonnen zu haben … jedenfalls Franks mürrischem Gesichtsausdruck nach zu urteilen.
Ein Teil von Shaw konnte das verstehen. Frank trug den Hut in Autos und Innenräumen nicht nur, um seinen kahlen Eierkopf zu verstecken, sondern auch um die Delle in seinem Schädel zu verbergen, die von einer Pistolenkugel stammte – von einer Pistolenkugel, die Shaw abgefeuert hatte. So etwas war nicht gerade der Beginn einer wundervollen Freundschaft; trotzdem war diese fast tödliche Konfrontation der Grund dafür, warum sie jetzt zusammen waren.
»Du warst ein wenig langsam, als du mit Benny zugange warst«, bemerkte Frank und kaute auf einer nicht brennenden Zigarre.
»In Anbetracht der Tatsache, dass ›Benny‹ bin Alamen auf Platz drei der Liste der meistgesuchten Terroristen stand, denke ich, ich habe mir ein wenig Schulterklopfen verdient.«
»Ich wollte es ja nur einmal erwähnt haben, Shaw. Man weiß ja nie. Nächstes Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück.«
Shaw erwiderte nichts darauf; dafür war er viel zu müde. Er schaute aus dem Fenster auf die schönen Straßen Wiens. Er war schon oft in der österreichischen Hauptstadt gewesen, der Heimat einiger der größten Genies der Musikgeschichte. Doch unglücklicherweise waren seine Besuche stets beruflicher Natur gewesen, und seine lebhafteste Erinnerung an die Stadt hatte leider nichts mit einem Konzertbesuch zu tun, sondern mit einem großkalibrigen Geschoss, das unangenehm nah an seinem Kopf vorbeigeflogen war.
Shaw rieb sich das Haar. Es war endlich wieder nachgewachsen. Für eine seiner letzten Missionen hatte er sich den Kopf kahl rasieren müssen. Shaw war erst Anfang vierzig, sechseinhalb Zoll groß und absolut durchtrainiert; doch als sein Haar wieder nachgewachsen war, da hatte er einen Hauch von Grau an den Schläfen bemerkt und einen winzigen kahlen Fleck am Hinterkopf. Selbst für ihn waren die letzten sechs Monate schwierig gewesen.
Als hätte er Shaws Gedanken gelesen, fragte Frank: »Und? Was war mit dir und Katie James?«
»Sie arbeitet wieder als Journalistin, und ich mache das Gleiche wie immer.«
Frank ließ das Fenster herunter, zündete sich die Zigarre an und blies den Rauch nach draußen. »Dann war’s das also, ja?«
»Warum hätte da denn auch mehr sein sollen?«
»Ihr zwei habt eine Menge gemeinsam durchgestanden. Da kommt man sich schon näher.«
»Sind wir aber nicht.«
»Wie auch immer … Sie hat mich übrigens angerufen.«
»Wann?«
»Vor einer Weile. Sie hat mir erzählt, du hättest noch nicht einmal Auf Wiedersehen gesagt, sondern seiest einfach in den Sonnenaufgang davongeritten.«
»Ist das etwa verboten? Und warum hat sie dich und nicht mich angerufen, um mir das zu sagen?«
»Sie hat gesagt, das hätte sie versucht, doch du hättest deine Nummer geändert.«
»Ja, gut, das könnte stimmen.«
»Und warum?«
»Weil mir danach war. Hast du sonst noch irgendwelche persönlichen Fragen?«
»Habt ihr miteinander geschlafen?«
Bei dieser Frage versteifte sich Shaw. Frank hatte das Gefühl, vielleicht zu weit gegangen zu sein, und so schaute er rasch in die Akte auf seinem Schoß und sagte: »Okay, in dreißig Minuten sind wir in der Luft. Zum nächsten Job können wir fliegen.«
»Toll«, knurrte Shaw. Er ließ das Fenster herunter und atmete die frische Morgenluft ein. Zumeist arbeitete er nachts, und viele seiner ›Jobs‹ waren am frühen Morgen bereits vorbei.
Ich arbeite für eine Organisation, die offiziell nicht existiert, und mache Dinge auf der ganzen Welt, von denen nie jemand etwas erfahren wird.
Die ›Organisation‹ gestattete es ihren Mitarbeitern, am Rande der Legalität zu operieren; oft überschritten sie diese Linie aber auch oder ignorierten sie gleich ganz. Die Länder, die Shaws Organisation unterstützten, waren die alten G8-Staaten, und somit technisch gesehen die ›zivilisiertesten‹ Nationen der Welt. Ihre eigenen Organisationen konnten unmöglich zu brutalen oder gar tödlichen Mitteln greifen. Also hatten sie insgeheim eine Bestie herangezüchtet, für die der alte Leitsatz galt: Der Zweck heiligt die Mittel. Ergebnisse waren alles, was zählte. Dinge wie die Menschenrechte oder andere juristische Zwänge waren dabei unbedeutend.
Frank musterte Shaw. »Ich habe ein paar Blumen für Annas Grab geschickt.«
Überrascht drehte Shaw sich zu ihm um. »Warum?«
»Sie war eine gute Frau, und aus irgendeinem Grund war sie bis über beide Ohren in dich verliebt. Das war der einzige Fehler, den ich je bei ihr habe finden können.«
Shaw schaute wieder aus dem Fenster.
»So jemanden wie sie wirst du nie wieder finden.«
»Deshalb suche ich auch gar nicht erst, Frank.«
»Ich war auch einmal verheiratet.«
Shaw schloss das Fenster und lehnte sich zurück. »Was ist passiert?«
»Sie ist tot. Sie war Anna recht ähnlich. Ich habe weit über meine Verhältnisse geheiratet. So etwas passiert einem nur einmal im Leben.«
»Wenigstens hast du es bis in die Kirche geschafft. Ich habe diese Chance nie bekommen.«
Frank sah aus, als wolle er etwas darauf erwidern, doch er schwieg. Tatsächlich sagte keiner der beiden Männer mehr ein Wort, bis sie am Flughafen eintrafen.
Kapitel vier
Die Gulfstream ließ sich von dem gleichmäßigen Wind in die Höhe tragen. Als sie ihre Reiseflughöhe erreicht hatte, holte Frank die übliche Akte hervor: Fotos, Hintergrundberichte, Analysen und Einsatzempfehlungen.
»Evan Waller«, begann Frank. »Kanadier. Dreiundsechzig Jahre alt.«
Shaw nahm sich mit einer Hand eine Tasse schwarzen Kaffee und mit der anderen die Akte. Er schaute auf einen Mann mit kahl rasiertem Kopf. Er sah durchtrainiert und stark aus, und seine Gesichtszüge waren scharf und kantig wie das Bild auf einem hochauflösenden LCD-Bildschirm. Selbst auf dem Foto schienen die Augen förmlich Funken zu sprühen und der Mann in der Lage zu sein, Shaw mit einem Blick zu töten. Die lange Nase des Mannes begann mitten auf der Stirn und reichte bis zum Mund hinunter. Es war ein grausamer Mund, dachte Shaw. Und dieser Mann war ohne Zweifel tatsächlich grausam, böse und gefährlich, denn wäre er das alles nicht, dann würde Shaw sich jetzt sein Bild nicht ansehen. Schließlich jagte er keine Heiligen, sondern gewalttätige Sünder.
»Für sein Alter sieht er noch verdammt gut aus«, bemerkte Shaw und warf das Foto auf den kleinen Tisch.
»In den letzten zwei Jahrzehnten hat er sich mit allem beschäftigt, womit sich viel Geld verdienen lässt«, erklärte Frank. »Nach außen hin hat er eine weiße Weste. Er macht nur legitime Geschäfte, bleibt weitgehend aus der Öffentlichkeit, spendet für wohltätige Zwecke und hilft Ländern der Dritten Welt beim Aufbau ihrer Infrastruktur.«
»Aber?«
»Aber wir haben herausgefunden, dass er sich den Großteil seines Vermögens mit Menschenhandel verdient, vor allem mit jungen Asiatinnen und Afrikanerinnen, die in Massen von Wallers Leuten entführt und im Westen an Bordelle verkauft werden. Deshalb engagiert er sich auch so in der Dritten Welt. Das ist seine Pipeline. Er benutzt seine Kontakte, um zu bekommen, was er will, und mit seinen legalen Geschäften wäscht er das Geld.«
»Okay, damit hat er sich wohl einen Besuch von mir verdient.«
Frank stand auf, mixte sich eine Bloody Mary an der kleinen Flugzeugbar und steckte eine Selleriestange ins Glas. Dann setzte er sich wieder und rührte das Ganze mit einem langen Löffel um. »Waller hat die Einzelheiten gut verborgen. Wir haben einige Zeit gebraucht, bis wir ihn durchschaut haben, doch das wenige, das wir haben, hätte vor Gericht keinen Bestand. Der Kerl ist übel, richtig übel. Daran besteht kein Zweifel; aber es zu beweisen, ist etwas vollkommen anderes.«
»Warum machen wir uns dann überhaupt die Mühe, ihn zu jagen, wenn wir ihn ohnehin nicht wegsperren können? Das wird ihn doch nur warnen.«
Frank schüttelte den Kopf. »Hier geht es nicht darum, ihn zu verknacken. Er soll reden. Wir schnappen ihn uns und überzeugen ihn davon, dass es in seinem besten Interesse liegt, uns von seinen neuesten Geschäften zu erzählen.«
»Und was wären das für Geschäfte?«
»Der Verkauf von nuklearem Material an islamistische Fundamentalisten, die auf der ganzen Welt gesucht werden. Wenn er sie verpfeift, bekommt er einen Deal.«
»Was für einen Deal?«
»Er kann gehen.«
»Damit er weiter junge Mädchen versklaven kann?«
»Wir reden hier davon, eine nukleare Katastrophe zu vermeiden, Shaw. Auf so einen Handel lassen sich die da oben nur allzu gerne ein. Zumindest werden wir seine Organisation so für eine Weile aus dem Verkehr ziehen. Aber er behält seine Freiheit und all sein Geld, das er ohne Zweifel überall auf der Welt versteckt hat.«
»Dann wird er seinen Laden also einfach neu eröffnen. Weißt du, manchmal bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wer in diesem Spiel der Böse ist.«
»Das sind wohl alle, nur jeder auf seine eigene Art.«
»Okay, wie lautet der Plan?«
»Wir haben erfahren, dass er nach Südfrankreich unterwegs ist, um dort ein wenig Urlaub zu machen. Er hat eine Villa in Gordes gemietet. Warst du schon mal dort?« Shaw schüttelte den Kopf. »Wie ich gehört habe, ist es dort sehr schön.«
»Das sagt man auch von Wien. Nur leider sehe ich von den meisten Städten nur die Kanäle, die Notaufnahmen und die Leichenhalle.«
»Er reist schwer bewacht.«
»Das tun diese Typen immer. Wie hast du dir die Aktion vorgestellt?«
»Schnell und sauber natürlich. Aber die Franzosen haben nicht den blassesten Schimmer von der Aktion; also können wir auch nicht mit ihrer Hilfe rechnen. Wenn man dich erwischt, bist du am Arsch.«
»Ist das nicht immer so?«
»Der Zeitplan ist eng.«
»Wie immer.«
»Stimmt«, gab Frank zu.
»Fassen wir mal zusammen«, sagte Shaw. »Wir entführen ihn, bearbeiten ihn und hoffen, dass es uns gelingt, ihn zu brechen, korrekt?«
»Unser Job ist es nur, ihn zu schnappen. Das Brechen übernehmen andere.«
»Okay … Und dann lassen sie ihn laufen?« Shaw war seine Abscheu deutlich anzuhören.
»Die Regeln werden nun mal von den Jungs in den Anzügen gemacht.«
»Du trägst auch einen Anzug.«
»Ich korrigiere mich: Die Regeln werden von den Jungs in den teuren Anzügen gemacht.«
»Okay, aber wie du dich vielleicht erinnerst, lief es nicht gerade gut, als ich zum letzten Mal in Frankreich gewesen bin.«
Frank zuckte mit den Schultern. »Wenden wir uns mal den Details zu.«
Shaw leerte seine Tasse. »Ja, die Details sind immer das Entscheidende, Frank … die Details und pures Glück.«
Kapitel fünf
Reggie Campion fuhr mit ihrem zehn Jahre alten Smart City-Coupé von ihrer Londoner Wohnung vorbei an Leavesden in Richtung Norden und von dort noch ein paar Meilen weiter. Nachdem sie sich durch eine Reihe Landstraßen geschlängelt hatte, bog sie auf einen Feldweg ein, der gerade breit genug für ein Fahrzeug war, und schließlich erreichte sie die von Flechten überwucherten Steinsäulen, auf denen ›Harrowsfield‹ zu lesen stand, der Name des Besitzes, auf dem sie sich nun befand. Wie immer wanderte ihr Blick die mit Kies befestigte Auffahrt zu dem alten, in sich zusammenfallenden Herrenhaus hinauf.
Einige behaupteten, Rudyard Kipling hätte das Landgut einst gemietet. Reggie bezweifelte das, obwohl sie sich durchaus vorstellen konnte, dass solch ein Ort einem Autor gefallen hätte, der so fantastische Abenteuergeschichten voller Intrigen verfasst hatte. Harrowsfield war ein riesiger Ort mit Geheimtüren und -gängen, Türmen voll kalter Kammern, einer großen Bibliothek, Gängen, die in Sackgassen endeten, einem Dachspeicher, der zu gleichen Teilen mit Antiquitäten von Museumsformat und Müll vollgestopft war, einem labyrinthartigen Keller voller schimmeliger Flaschen mit inzwischen untrinkbarem Wein, einer uralten Küche mit löchrigem Dach und genügend Nebengebäuden, um ein ganzes Bataillon darin unterzubringen. Harrowsfield war uralt, fiel allmählich auseinander, war größtenteils unbewohnbar, und Reggie liebte es. Hätte sie das Geld gehabt, sie hätte das Gut sofort gekauft; doch Reggie würde nie das Geld dafür besitzen.
Reggie blieb hier oft über Nacht. Da sie ohnehin nie schlafen konnte, pflegte sie dann stundenlang durch das dunkle Haus zu wandern. In diesen Augenblicken glaubte sie auch, die Gegenwart anderer zu fühlen, die Harrowsfield einst ihr Heim genannt hatten, auch wenn sie nicht mehr unter den Lebenden weilten. Sie hätte gern hier gewohnt. Ihre Wohnung war klein, spartanisch eingerichtet und lag in einem wenig beliebten Teil der Stadt; trotzdem kostete sie mehr, als sie sich leisten konnte. Reggie musste sich mit solchen Luxusgütern wie Essen und Kleidung einschränken, um über die Runden zu kommen. Ihren Beruf hatte sie sich definitiv nicht wegen der Verdienstmöglichkeiten ausgesucht.
Reggie parkte vor dem alten Kutschenhaus, das nun Garagen und eine Werkstatt beherbergte, und sah, dass bereits mehrere Leute vor ihr eingetroffen waren. Mit ihrem Schlüssel öffnete sie die Tür des Schmutzraums, und eine kleine Glocke ertönte. Einen Augenblick später kam ein breitschultriger, muskulöser Mann Mitte dreißig aus dem angrenzenden Raum. In der einen Hand trug er eine Tasse Tee, und in der anderen hielt er eine 9-mm-Pistole, deren Lauf er auf Reggies Brust richtete. Er trug eine enge Cordhose, ein weißes Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und elegante schwarze Slipper, aber keine Socken, obwohl es in Harrowsfield selbst im Sommer kühl war. Seine dichten schwarzen Augenbrauen trafen sich in der Mitte fast, und sein zotteliges braunes Haar fiel ihm weit über die Stirn.
Als der Mann Reggie sah, steckte er die Waffe wieder weg, grinste und nippte an seinem Tee. »Hey, Reg«, sagte Whit Beckham, »du hättest dich melden sollen, als du durchs Tor gefahren bist. Ich hätte dich fast abgeknallt, und dann hätte ich wochenlang nichts als Ärger gehabt.« Im Laufe der Jahre, da Reggie ihn kannte, hatte Whit seinen harten irischen Akzent schon ein wenig abgelegt. Inzwischen brauchte sie sogar keinen Übersetzer mehr … meistens jedenfalls.
Reggie zog ihre Jacke aus und hängte sie an einen Wandhaken. Sie trug eine ausgeblichene Jeans, einen burgunderroten Rollkragenpullover und schwarze Stiefeletten. Ihr Haar hatte wieder seine normale dunkelbraune Farbe und wurde im Nacken von einer Klammer gehalten. Sie hatte kein Make-up aufgelegt, und als sie nun ins Licht trat, das durch die Fenster fiel, konnte man feine Falten um ihre Augen sehen, obwohl sie erst achtundzwanzig war.
»Mein Handy hat hier noch nie funktioniert, Whit.«
»Dann ist es wohl an der Zeit, dass du dir einen neuen Provider suchst«, riet Whit ihr. »Tee?«
»Kaffee. Je stärker, desto besser. Es war ein langer Flug, und ich habe nicht viel geschlafen.«
»Schon unterwegs.«
»Toll. Danke. Ist Dom hier? Ich habe sein Motorrad nicht gesehen.«
»Ich glaube, er hat es in einer der Garagen abgestellt. Und es ist kein Motorrad.«
»Was dann?«
»Eine ›Sackrakete‹. Das hat was mit den PS zu tun und so, weißt du?«
»Jaja, wie interessant. Männer und ihre Spielzeuge.«
Whit schaute sie besorgt an. »Alles okay mit dir?«
Sie täuschte ein Lächeln vor. »Klar. Ich habe mich nie besser gefühlt. Es wird mit jedem Mal leichter.«
Whit legte die Stirn in Falten. »Das ist Scheiße, und das weißt du.«
»Ach ja?«
»Vergiss nicht, dass Huber ein paar hunderttausend Menschen ermordet hat und sechzig Jahre lang nicht dafür zur Verantwortung gezogen worden ist.«
»Ich habe das Briefing auch gelesen, Whit.«
Whit rümpfte die Nase. »Wie auch immer … Vielleicht solltest du dir mal ein wenig freinehmen, um deinen Akku aufzuladen.«
»Mein Akku ist voll. Der lange Flug und ein paar Drinks waren alles, was ich gebraucht habe. Ich habe Herrn Standartenführer Huber schon vergessen.«
Whit grinste. »Nicht dass du mir plötzlich durchdrehst.«
»Keine Sorge. Aber nett, dass du an mich denkst. So … Wer ist nun hier?«
»Die üblichen Verdächtigen.«
Reggie schaute auf ihre Uhr. »Geht’s früh los?«
»Wir haben einen neuen Job. Da ist jeder aufgeregt.«
»Mich eingeschlossen.«
»Bist du dir wirklich sicher?«
»Jetzt lass mich doch mal. Hol mir einfach den verdammten Kaffee.«
Kapitel sechs
Reggie ging durch Flure, die nach Schimmel rochen, bis sie eine große Doppeltür erreichte, in die Bilder von Büchern eingraviert waren. Reggie öffnete einen der beiden Türflügel und betrat die Bibliothek. Drei Wände waren bis oben hin mit Regalen vollgestellt, und Bibliotheksleitern liefen an Messingstangen entlang, damit man die Bücher weiter oben erreichen konnte. An der vierten Wand wiederum hingen die Fotos und Porträts von Männern und Frauen, die schon lange tot waren. Den Mittelpunkt des Raums bildete ein großer Kamin, der bis unter die Decke reichte. Es war einer der wenigen im Haus, die noch richtig funktionierten; doch auch aus ihm quoll ständig Rauch in den Raum. Reggie nahm sich einen Moment Zeit, um sich vor den Flammen aufzuwärmen, bevor sie zu den Leuten schaute, die an dem großen Tisch mitten im Raum saßen.
Reggie nickte jedem von ihnen zu. Alle waren sie älter als sie mit Ausnahme von Dominic, der gut ausgeruht wirkte. Schließlich blieb Reggies Blick an dem älteren Mann am Kopfende haften. Miles Mallory trug einen Tweedanzug mit klassischen Ellbogenflicken, eine schief sitzende Fliege, ein zerknittertes Hemd, dessen eine Kragenspitze gen Decke zeigte, und Kniestrümpfe, die viel zu kurz waren, um die fleischigen, kahlen Schienbeine des Mannes zu bedecken. Mallory besaß einen riesigen Kopf und nur noch einen Kranz zotteligen grauen Haars, das schon seit Monaten keine Friseurschere mehr gesehen hatte. Sein Bart hingegen war perfekt gestutzt und passte farblich zu den Haaren mit Ausnahme eines cremefarbenen Fleckens von der Größe eines Pennys am Kinn. Die Augen waren grün und stechend, die Brille davor dick und schwarz, das Kinn breit, der Mund klein und trotzig und die Zähne schief und vom Tabak gelb. Mallory hielt eine kleine Pfeife in der rechten Hand und stopfte sie gerade eifrig mit der widerlichsten Tabakmischung, die man sich vorstellen konnte, um den Raum auch noch des letzten Restes Sauerstoff zu berauben.
»Sie sehen aufgeregt aus, Professor Mallory«, bemerkte Reggie freundlich.
»Wie schon bei unserem jungen Dominic, so möchte ich auch bei Ihnen der Erste sein, der Ihnen zu Ihrer hervorragenden Arbeit in Argentinien gratuliert.«
»Tut mir leid, Prof, da war ich wohl schneller«, sagte Whit, als er den Raum betrat und Reggie eine frische Tasse Kaffee reichte. Der Kaffee dampfte sogar noch, obwohl die Küche fast eine Meile von der Bibliothek entfernt lag.
»Na ja«, sagte Mallory gut gelaunt, »dann bin ich eben der Zweite.«
Reggie trank einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie hatte es noch nie gemocht, über das zu reden, was sie getan hatte, noch nicht einmal mit Leuten, die ihr dabei geholfen hatten. Doch wenn man jemanden tötete, der so viele Menschen ermordet hatte, dann weckte das nicht die in so einem Fall typischen menschlichen Emotionen. Für Reggie und ihre Kollegen am Tisch hatten diese Menschen durch ihre furchtbaren Taten jegliches Recht auf Leben verwirkt. Sie hätten genauso gut über die Tötung eines tollwütigen Hundes diskutieren können; aber mit diesem Vergleich tat man dem Hund wohl unrecht, sinnierte Reggie.
»Danke«, sagte sie. »Aber unglücklicherweise bin ich sicher, dass Herr Huber trotzdem in Frieden ruhen wird.«
»Das wage ich stark zu bezweifeln«, erwiderte Mallory steif. »Das Höllenfeuer ist bestimmt nicht angenehm.«
»Wenn Sie das sagen. Theologie war noch nie meine Stärke.« Reggie setzte sich. »Aber wie auch immer, Huber ist Geschichte. Machen wir einfach weiter.«
»Ja«, sagte Mallory eifrig. »Ja. Genau. Machen wir einfach weiter.«
Whit grinste schelmisch. »Dann schauen wir mal, ob wir das Monster noch mal reiten können, ohne von ihm zertrampelt zu werden.«
Mallory nickte der schlanken, blonden Frau zu seiner Rechten zu. »Liza, wenn Sie so freundlich wären.«
Liza verteilte dicke Umschläge mit Kopien von Dokumenten, die von roten Gummibändern zusammengehalten wurden.
»Wissen Sie, Prof«, sagte Whit, »all das könnte man auch auf einen USB-Stick und von dort auf unsere Laptops packen. Das ist wesentlich angenehmer, als all das Zeug in meinem Kofferraum zu bunkern.«
»Laptops können verloren gehen, Daten beschädigt oder gar gestohlen werden. Ich glaube, das nennt man ›Hacken‹«, erwiderte Mallory leicht verärgert, aber auch mit der Unsicherheit von jemandem, für den Computer ein ewiges Rätsel bleiben würden.
Whit hielt den Umschlag hoch. »Na ja, Papier kann man auch klauen, und unauffällig ist das auch nicht gerade … besonders wenn man zehn Kilo von dem Zeug mit sich herumschleppt.«
»Wenden wir uns also der Arbeit zu«, erklärte Mallory brüsk und ignorierte den Kommentar. Er hielt das Foto eines älteren Mannes in den Sechzigern in die Höhe. Der Kerl hatte eine lange Nase, einen kahl rasierten Kopf, und sein Gesichtsausdruck löste nur ein Gefühl aus: Furcht.
»Das ist Evan Waller«, sagte Mallory. »Es heißt, er sei vor dreiundsechzig Jahren in Kanada geboren worden, doch das stimmt nicht. Er genießt den Ruf eines angesehenen Geschäftsmanns; aber …«
»Aber was hat er für einen Ruf bei den Leuten, die ihn wirklich kennen?«, meldete Whit sich zu Wort. Er zog die Pistole aus dem Holster und legte sie auf den Tisch.
Wenn Mallory sich darüber ärgerte, dass Whit ihn unterbrochen und offen eine Waffe auf den Tisch gelegt hatte, dann ließ er sich das zumindest nicht anmerken. Stattdessen funkelten seine Augen, als er sagte: »Evan Waller heißt in Wirklichkeit Fedir Kuchin.«
Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, doch als er keinerlei Reaktion bei seinen Leuten bemerkte, machte sich Enttäuschung in ihm breit. »Kuchin ist gebürtiger Ukrainer und diente zunächst im Militär und dann bei der ukrainischen Geheimpolizei, die direkt dem KGB unterstand.« Als auch darauf niemand reagierte, hakte Mallory in scharfem Ton nach: »Haben Sie alle denn noch nie vom Holodomor gehört?« Er schaute zur anderen Seite des Tischs. »Dominic, an der Universität haben Sie doch sicher etwas darüber gelernt, oder?«, fragte er flehentlich.
Dominic schüttelte den Kopf. Ihm war deutlich anzusehen, wie leid es ihm tat, den alten Mann zu enttäuschen.
Reggie meldete sich zu Wort. »Holodomor ist der ukrainische Begriff für ›Tötung durch Hunger‹. Anfang der 30er-Jahre hat Stalin fast zehn Millionen Ukrainer mittels Hungertod ermordet. Darunter war allein ein Drittel der Kinder des Landes.«
»Wie zum Teufel hat er das denn geschafft?«, verlangte ein angewiderter Whit zu wissen.
Mallory antwortete: »Stalin hat die Rote Armee und die Geheimpolizei geschickt, um alles Vieh, alles Korn und alle Werkzeuge zu requirieren. Besonders hart hat es das Land am Dnjepr getroffen, das lange als Brotkorb Europas gegolten hat. Dann hat er die Grenzen schließen lassen, um zu verhindern, dass die Menschen fliehen oder Versorgungsgüter einschmuggeln konnten. Außerdem erfuhr der Rest der Welt auf diese Weise so gut wie nichts von den Ereignissen. Damals gab es ja noch kein Internet. Ganze Städte verhungerten, und nach noch nicht einmal zwei Jahren war ein Viertel der Landbevölkerung tot.«
»An Grausamkeit konnte Stalin es problemlos mit Hitler aufnehmen«, bemerkte Liza Kent. Liza war Ende vierzig und sah mit ihrem langen Rock, den schweren Schuhen und der weißen Rüschenbluse recht altmodisch aus. Ihr hellblondes und von silbernen Strähnen durchsetztes Haar war ungewöhnlich fein und reichte ihr bis auf die Schulter, doch sie hatte es stets zu einem Dutt gebunden. Ihr Gesicht hatte nichts an sich, woran man sich erinnern würde, und ihre bernsteinfarbenen Augen verbarg sie zumeist hinter dicken Gläsern in einer konservativen Fassung. Liza konnte problemlos in nahezu jeder Menschenmenge untertauchen. Tatsächlich hatte sie jedoch über zwölf Jahre lang für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Sie hatte Spionageabwehraktionen auf drei Kontinenten geleitet und als Souvenir aus dieser Zeit eine in Rumänien gefertigte Kugel gefährlich nah an ihrem Rückgrat. Diese Verletzung hatte dann auch dazu geführt, dass sie mit einer kleinen Rente frühzeitig in den Ruhestand hatte gehen müssen. Doch sie war es rasch leid geworden, sich nur noch um ihren kleinen Garten zu kümmern, und so hatte sie sich dem Professor angeschlossen.
»Warum hat er das getan?«, fragte Dominic.
»Meinen Sie, warum Stalin gemordet hat?«, schnappte Mallory. »Warum beißt eine Schlange? Warum verschlingt ein weißer Hai seine Opfer mit nahezu unvorstellbarer Wildheit? So war er einfach. Das war seine Art. Und er hat seine Mordlust in einem Maßstab ausgelebt, wie man es zuvor so gut wie nie gesehen hat. Er war ein Irrer.«
»Stalin mag zwar ein Irrer gewesen sein, aber er hatte auch ein Motiv«, warf Reggie ein und ließ ihren Blick über die Anwesenden schweifen. »Er hat versucht, den ukrainischen Nationalismus auszurotten. Und er wollte den Widerstand der Bauern gegen die Kollektivierung brechen. Es heißt, es gebe noch heute nicht einen Ukrainer, der nicht mindestens einen Angehörigen während des Holodomor verloren hat.«
Mallory lächelte anerkennend. »Ich wusste ja gar nicht, dass Sie Geschichte studieren, Regina.«
Sie schaute ihn mit hartem Blick an. »Nicht Geschichte, Professor, ihre Schrecken.«
Whit war verwirrt. »Habe ich hier irgendwas verpasst? Das Ganze war doch in den Dreißigern. Aber wenn dieser Waller – oder Fedir Kuchin oder wie auch immer er heißt – erst dreiundsechzig ist, dann war er damals doch noch gar nicht geboren.«
Mallory faltete die Hände. »Glauben Sie etwa, der Völkermord hat aufgehört, nur weil Stalin gestorben ist, Beckham? Das kommunistische Regime hat noch Jahrzehnte überdauert, nachdem dieses Monster seinen letzten Atemzug getan hat.«
»Und da kommt dann auch Fedir Kuchin ins Spiel, korrekt?«, sagte Reggie leise.
Mallory lehnte sich zurück und nickte. »Er ist schon in jungen Jahren zur Armee gegangen und rasch aufgestiegen. Er war ungewöhnlich klug und gnadenlos, und schon bald orientierte er sich in Richtung Geheimdienstarbeit. Schließlich trat er in die Geheimpolizei ein, wo er bis in eine Position aufstieg, die ihm despotische Macht verlieh. Das war zu der Zeit, als die Rote Armee in Afghanistan gegen ihren Untergang ankämpfte. Dazu kam, dass zur gleichen Zeit sowjetische Satellitenstaaten wie Polen ihre Freiheit einforderten und auch nicht damit aufhören wollten, bis der Kommunismus gestürzt war. Kuchin erhielt direkt aus dem Kreml den Befehl, alles zu tun, um jedwede Opposition zu zerschlagen. Und während seine Vorgesetzten die Lorbeeren kassierten, war er derjenige, der dafür sorgte, dass Kiew auf einer Linie mit Moskau blieb. Und fast hätte er auch dauerhaft Erfolg damit gehabt.«
»Wie das?«, wollte Whit wissen.
Zur Antwort öffnete Mallory seine Aktenmappe und winkte den anderen, es ihm gleichzutun. »Bitte, lesen Sie den ersten Bericht, und schauen Sie sich die dazugehörigen Bilder an. Wenn das Ihre Frage nicht beantwortet, dann weiß ich auch nicht.«
Mehrere Minuten lang herrschte Stille im Raum. Nur dann und wann war ein Schnappen nach Luft zu hören, wann immer jemand ein Foto sah. Schließlich schloss Reggie die Akte wieder, und ihre Hand zitterte ein wenig. Sie hatte schon vielen zweibeinigen Monstern gegenübergestanden, doch das Böse im Menschen erschreckte sie bisweilen immer noch. Sie hatte Angst, irgendwann selbst ihre Menschlichkeit zu verlieren … Manchmal glaubte sie sogar, das sei längst geschehen.
»Kuchin hat seine eigene Version des Holodomor durchgezogen«, bemerkte Whit mit leiser Stimme. »Nur hat er nicht Hunger, sondern Gas benutzt sowie Gift in der Wasserversorgung, und er hat Tausende von Menschen in Gruben gejagt, wo sie bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Der Bastard.«
»Und Kuchin hat auch die Sterilisation Tausender von jungen Mädchen organisiert«, fügte Reggie hinzu. Die feinen Falten um ihre Stirn vertieften sich, als sie das sagte. »Sie sollten keine männlichen Kinder mehr bekommen, die irgendwann gegen die Sowjets kämpfen könnten.«
Mallory tippte auf die Akte. »Und hundert weitere Grausamkeiten kommen noch dazu. Wie es bei so verschlagenen Menschen oft der Fall ist, hat Kuchin den Fall der Sowjetunion lange vor seinen Vorgesetzten vorausgesehen. Er hat seinen Tod fingiert und ist nach Asien geflohen. Von dort ging es dann nach Australien und schließlich nach Kanada, wo er sich mit gefälschten Papieren und einem Charisma, das seine sadistische Natur verdeckt, ein neues Leben aufgebaut hat. Die Welt sieht ihn als einen ehrlichen und ungewöhnlich erfolgreichen Geschäftsmann und nicht als den Massenmörder und Verbrecher, der er wirklich ist. Wir haben drei Jahre gebraucht, um diese Akte zusammenzustellen.«
»Und wo ist er jetzt?«, fragte Reggie, den Blick fest auf ein Foto gerichtet, das sie aus der Akte geholt hatte. Es zeigte ein freigelegtes Massengrab mit kleinen Skeletten, alles Kinder.
Mallory zündete sich seine Pfeife an, und eine stinkende Rauchwolke stieg über seinen Kopf. »Diesen Sommer wird er die Ferien in der Provence verbringen, in einem kleinen Städtchen mit Namen Gordes, um genau zu sein.«
»Ich frage mich, wie sich das wohl anfühlen wird«, sagte Reggie zu niemandem im Besonderen.
»Wie sich was anfühlen wird, Reg?«, hakte Whit neugierig nach.
Reggie schaute noch einmal auf das Bild mit den kleinen Knochen. »Ich frage mich, wie es sich wohl anfühlen wird, an einem so schönen Ort wie der Provence zu sterben.«
Kapitel sieben
Das lange Meeting war vorbei. Es dämmerte bereits, doch Reggie hatte noch immer viel zu tun. Sie schlich sich aus dem baufälligen Gebäude und nahm sich ein paar Minuten Zeit, um sich das Gelände einmal im Zwielicht anzusehen. Seit Miles Mallorys Organisation hier ihr Hauptquartier bezogen hatte, hatte Reggie alles über die Geschichte dieses Ortes gelesen, was sie hatte finden können. Ursprünglich hatte sich eine mittelalterliche Burg an der Stelle erhoben, wo heute das Herrenhaus stand. Die umliegenden Ländereien waren das Lehen des wohlhabenden Burgherrn gewesen, eines schwer gepanzerten Ritters, jederzeit bereit, falls nötig ein, zwei Schädel mit seinem Schlachtbeil zu spalten.
Später war die Burg dann geschleift worden, und an ihrer Stelle hatte man das Haus gebaut. Das Feudalsystem war abgeschafft worden, und die Ritter hatten ihre Rüstungen abgelegt und ihren Bauern statt mit dem Schwert mit dem Schuldschein gedroht. Das Land war über Generationen hinweg im Besitz ein und derselben Familie geblieben bis hin zu entfernten Vettern der ursprünglichen Eigentümer, deren Einkommen jedoch nicht mehr für den Erhalt des Gutes gereicht hatte. In den beiden Weltkriegen hatte Harrowsfield – Reggie hatte nie herausgefunden, woher der Name kam – als Lazarett gedient. Anschließend hatte es mehrere Jahrzehnte lang leer gestanden, bis die Regierung sich gezwungen gesehen hatte, es zu übernehmen und die notwendigsten Reparaturen durchzuführen. Dann hatte Mallory den Ort entdeckt und es irgendwie organisiert, dass er ihn benutzen durfte. Nach außen hin handelte es sich lediglich um einen informellen Versammlungsort für exzentrische Akademiker, deren Arbeit genauso esoterisch wie harmlos war.
Reggie kam an zu Säulen gestutzten Buchsbäumen vorbei und roch ihren leichten Uringestank. Obwohl der Frühling sich bereits seinem Ende zuneigte, wehte ihr eine kühle Brise in den Rücken. Reggie schloss ihre verschlissene Lederjacke, die einst ihrem älteren Bruder gehört hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes war er zwar erst zwölf Jahre alt gewesen, aber schon über sechs Fuß groß. Am Boden zerstört hatte die kleine Reggie sich damals in eine Ecke verkrochen und sich die Jacke über den Kopf gezogen. Seitdem hütete sie sie wie einen Schatz. Doch auch heute noch fühlte sie sich bei der Erinnerung so zerbrechlich wie Glas.
Nachdem Reggie eine Viertelmeile weit gegangen war, öffnete sie die Tür von dem, was einst das Gewächshaus des Anwesens gewesen war. Der Geruch von Torf, Mulch und verrottenden Pflanzen stieg ihr in die Nase, obwohl schon seit Jahrzehnten kein Gärtner mehr hier gewesen war. Sie ging an Glassplittern und losen Brettern vorbei, die aus der Decke gefallen waren. Schatten fielen in alle Richtungen, als die Sonne sich immer höher über die englische Landschaft erhob, und die kühle Brise wurde sogar noch kälter, als sie durch kleine Öffnungen in Fenstern und Wänden pfiff und die Spinnweben in diesem verfallenden Gartenparadies flattern ließ.
Reggie erreichte eine Doppeltür in der Ecke des Gebäudes. Sie steckte ihren Schlüssel in das schwere Vorhängeschloss, öffnete die Tür und zog an der Kette, mit der die Glühbirne an der Decke eingeschaltet wurde. Einen Augenblick später wurde der Gang, den sie betrat, schwach beleuchtet, und der starke Geruch von feuchter Erde stieg ihr in die Nase. Reggie wurde leicht übel. Der Boden war unbefestigt. Sie ging fünfzehn Schritt und in einem Winkel von zwanzig Grad nach unten; dann wurde der Tunnel wieder eben. Reggie hatte keine Ahnung, wer ihn in die Erde gegraben hatte und warum, aber er war praktisch.
Sie erreichte das Ende des Gangs, wo ein paar Matratzen an der Wand lagen. Es gab auch einen kleinen Tisch. Papier stapelte sich darauf, und daneben stand ein kleiner, batteriebetriebener Ventilator. Reggie nahm sich das oberste Blatt und befestigte es mit einer Klammer an einer Kordel, die zwischen den beiden Seitenwänden des Tunnels hing. Neben dem Papierstapel lagen mehrere Gehörschutze und Schutzbrillen. Reggie legte sich einen Gehörschutz um den Hals und setzte eine Schutzbrille auf.
Auf dem Papier war das geschwärzte Bild eines Mannes zu sehen mit schwarzen Ringen darum herum. Reggie ging dreißig Schritt zurück, drehte sich um, zog die Pistole aus dem Holster, prüfte, ob sie geladen war, setzte den Gehörschutz auf, nahm ihre bevorzugte Schießhaltung ein, zielte und leerte das komplette Magazin. Die Lüftung war schlecht hier unten, und der brennende Gestank des Pulvers stieg ihr in die Nase. Von der Druckwelle der Schüsse gelöst rieselte Dreck zwischen den alten Brettern heraus, die die Tunneldecke bildeten. Reggie hustete, wedelte Staub und Rauch beiseite und ging wieder nach vorne, um das Ergebnis ihrer Schießkunst zu begutachten. Auf dem Weg schaltete sie den Ventilator ein, doch es dauerte einen Moment, bis er den Dunst weggeblasen hatte. So viel zum Thema erstklassige Schießanlagen.
Sieben ihrer elf Kugeln waren genau dort eingeschlagen, wo sie sie haben wollte: im Torso. Wäre das ein echtes Ziel gewesen, so hätten die Geschosse gleich mehrere lebenswichtige Organe durchschlagen. Zwei Kugeln hatten in den Kopf getroffen, und auch das hatte Reggie genau so gewollt. Eine Kugel hatte die Trefferzone um einen Millimeter verfehlt, und der letzte Schuss war inakzeptabel weit danebengegangen.
Reggie ersetzte die Zielscheibe durch eine neue, lud nach und schoss erneut. Zehn von elf. Noch einmal. Elf von elf. Und noch ein letztes Mal. Neun von elf. Trotz des auf vollen Touren laufenden Ventilators war der Tunnel inzwischen voller Rauch, und Reggie konnte kaum noch atmen.
»Verdammte Scheiße!«, bellte sie, hustete und wedelte den Rauch weg. Vermutlich konnte sie die letzten Fehlschüsse damit erklären, dass sie nicht mehr richtig hatte atmen können. Auch konnte sie das verdammte Ziel kaum noch sehen. Reggie schlurfte durch den Tunnel wieder zurück und wünschte sich, sie hätten eine richtige Schießanlage; doch der Tunnel war der einzige Ort auf dem Anwesen, wo ein Schuss nicht von einem zufällig vorbeikommenden Passanten gehört werden konnte, der dann die örtliche Polizei verständigt hätte. Von tattrigen Akademikern erwartete man keine Vorliebe für Feuerwaffen. Überrascht sah Reggie, dass Whit an der Tür zum Gewächshaus stand.
»Ich dachte mir schon, dass du hier unten bist«, sagte er. »Und? Gut geschossen?«
»Nein. Mies.« Reggie trat ins Gewächshaus und schloss die Doppeltür hinter sich ab.
Whit lehnte an einem gläsernen Schrank, in dem einst die Setzlinge aufbewahrt worden waren. In der wieder kälter werdenden Luft kondensierte sein Atem. »Mach dir deswegen keinen Kopf. Normalerweise arbeitest du ja eh nicht mit Knarren. Du bist mehr das Messer- und Kissenmädchen. Der 9-mm-Kerl bin ich.«
Reggie runzelte ob seiner Offenheit die Stirn. »Manchmal bist du wirklich ein Arsch, Whit.«
»Ich wollte dich nur ein wenig aufheitern. Du bist der angespannteste Mensch, den ich je gesehen habe.«
»Dann solltest du mal öfter vor die Tür gehen. Ich bin nämlich eigentlich ziemlich locker.«
»Und was denkst du von diesem Fedir Kuchin?«
»Ich denke, dass wir ihn schon bald in der Provence sehen werden.«
»Das geht alles ein wenig schnell. Ich hätte gerne ein wenig mehr Zeit zur Planung gehabt.«
Reggie zuckte mit den Schultern. »So wie der Professor es uns erklärt hat, verlässt die Viper ihr Nest nur selten. Das könnte unsere einzige Chance sein.«