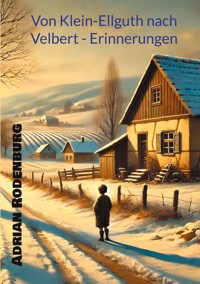Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Inquisitor von Knechtsteden
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1348, als die Pest wie ein dunkler Schatten über Europa liegt, erschüttert ein grausamer Mord das Land entlang des Rheins. In einem Dorf in der Nähe des Klosters Knechtsteden wird eine junge Frau namens Aleid der Hexerei beschuldigt, nachdem Vieh stirbt und Kinder erkranken. Die Wut der Bevölkerung wächst, und der Abt des Klosters, Severinus, verlangt ein schnelles Urteil. Doch der Inquisitor des Klosters, Bruder Gerlach, glaubt nicht an Hexerei. Er ist überzeugt, dass hinter der Angst ein menschliches Verbrechen steckt. Gegen den Widerstand seines Abtes beginnt er zu ermitteln und stößt bald auf Hinweise, die in die Reihen der Mächtigen führen. Heinrich von Lintorf, Vogt und Verwalter des Klosters, scheint alles zu gewinnen, wenn Aleid verschwindet: Land, Einfluss, Frieden. Doch sein frommes Auftreten und seine Position machen ihn unantastbar. Während die Dorfbewohner nichts lieber sähen, als die "Hexe" auf dem Scheiterhaufen verbrannt, betrachtet Gerlach Aleid nicht als Sünderin, sondern als eine Frau, die mehr weiß, als sie preisgibt. Ihre geheimnisvollen Worte führen ihn tiefer in die Intrigen um Macht, Besitz und alte Rechnungen. Im Kreuzgang von Knechtsteden, zwischen den Fresken und der Pietà "Not Gottes" (Pietà der Gottesmisere), muss Gerlach einen Weg finden: Die Wahrheit ans Licht bringen, ohne selbst in Ketzerei zu verfallen. Das unschuldige Mädchen retten, bevor der Pöbel über sie richtet. Und beweisen, dass die größte Gefahr nicht von Hexen ausgeht, sondern von Menschen. Am Ende steht er zwischen Abt Severinus, der Gehorsam und Bestrafung fordert, und Heinrich von Lintorf, der vor nichts zurückschreckt, um sein Ziel zu erreichen. Nur Gerlachs Mut, sein scharfer Verstand und sein Glaube an die Vernunft können entscheiden, ob Gerechtigkeit siegt oder Aberglaube triumphiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
01 Nebel über Knechtsteden
02 Die Anklage
03 Der Abt ruft zur Ordnung
04 Das Dorf in Aufruhr
05 Die Begegnung mit Aleid
06 Spuren im Stall
07 Der Vogt tritt auf
08 Ein dunkles Gerücht
09 Der Brunnen
10 Im Kapitelsaal
11 Die geheime Begegnung
12 Das Buch des Albertus
13 Ein zweiter Mord
14 Druck von oben
15 Im Schatten des Kreuzgangs
16 Die Nacht im Dorf
17 Die Enthüllung
18 Das Tribunal
19 Die Anklage des Inquisitors
20 Die Entscheidung
01 NEBEL ÜBER KNECHTSTEDEN
Die tote Stunde vor den Laudes: Er stand am Rand des Kreuzgangs und kauerte sich gegen das erste Licht der Morgendämmerung. Bruder Gerlach, der Größte unter den verhüllten Seelen von Knechtsteden, ließ seine Sandalen über die kalten Steine kratzen, als wolle er die Welt vor seinem Vergehen warnen. Die Bögen wölbten sich über ihm, warfen Schatten entlang ihrer Rippen, und durch die Luft schlängelten sich Nebelbänder, schlau wie Schlangen, und versilberten, was die Nacht nicht preisgeben wollte. Selbst die Krähen schwiegen.
Seine Hände, die er in den weiten Ärmeln seiner Kutte gefaltet hatte, verrieten ihn. Sie zitterten nicht vor Kälte, obwohl der Flussnebel durch Leinen und Haut drang, sondern vor Erinnerung. In seiner Brust zitterten noch immer Schreie, klebrig wie Eiweiß, zu dick, um sie hinunterzuschlucken. Er sah wieder die Lichtung hinter Zons, das nasse, schwarz getretene Moos, den zersplitterten Scheiterhaufen, den Haken des Henkers. Schreie, dann Stille. Der Geschmack von Asche im Mund. Er presste Luft durch die Zähne. Sie hinterließ einen Hauch in der Kälte.
Er schritt die Länge des Kreuzgangs auf und ab zwei Schritte, drei, Pause, seine Schritte gebremst durch Unentschlossenheit, durch eine Angst, die sich in seinem Mark festgesetzt hatte. Über ihm hallten seine Schritte dumpf von der Gewölbedecke wider, als würde der Stein selbst ihn verurteilen. Er presste seine Handfläche gegen eine Säule: knochenweiß, von Jahrhunderten zerfressen, kälter, als Fleisch ertragen konnte. Die Welt war in dem Augenblick vor Sonnenaufgang erstarrt.
Es war nicht erlaubt, zu verweilen. Die Glocke, die schief in dem gedrungenen romanischen Turm hing, schlug mit eiserner Zunge die Stunde. Einmal, zweimal, dreimal: Zeit zum Beten, Zeit zum Rechenschaft ablegen, Zeit zum Bericht. Gerlach atmete scharf aus, beschwor die Stille eines Schädels herauf und begann den langsamen Gang zum Kapitelsaal.
Im Durchgang verdichtete sich der Nebel und verwandelte die Bögen in bucklige Gestalten. Er erinnerte sich an ein Gesicht, oder vielmehr an eine Maske aus Knochen, deren Augenhöhlen mit Ruß verkrustet waren und deren Zähne in einem letzten Anfall von Schrecken entblößt waren. Den Namen hatte er vergessen. Die Sünde jedoch blieb. Er zählte seine Schritte: sechsundzwanzig bis zum Türsturz. Jeder Schritt war ein widerwilliges Geständnis.
Auf halbem Weg blieb er stehen. Etwas bewegte sich im Nebel. Eine Gruppe Novizen in weißen Gewändern schritt schweigend vorbei wie ein Schwarm blinder Tauben. Der jüngste Junge ein blasser, sommersprossiger Geist blickte zu ihm auf. Nicht vorwurfsvoll. Nicht einmal ängstlich. Nur eine leere, unverfälschte Neugier, die Gerlach am liebsten hätte verschwinden lassen wollen. Er neigte den Kopf und segnete das Kind im alten Dialekt „Deus geleit di, min lüttje“ und der Junge huschte davon, die Last von Gerlachs Segen mit sich tragend.
Er ging weiter. Die Glocke läutete erneut, die Luft zitterte um ihren Klang herum. Gerlachs Finger umklammerten die Perlen an seinem Gürtel, jede einzelne glänzend von den Ölen vergangener Verzweiflung. Er erinnerte sich an die Gesichter der Angeklagten: meist Frauen, manchmal Männer, niemals Kinder, immer Ausgestoßene. Er erinnerte sich, wie sie gefleht hatten, wie sie geflucht hatten, wie sie gestorben waren. Er sah sie in jedem vorbeigehenden Mönch, hörte ihre Bitten im Gemurmel der Matutin und der Prim.
Vor dem Kapitelsaal hielt Gerlach noch einmal inne. Die große Eichentür ragte schwarz vor Alter und Eisen vor ihm auf. Licht drang durch die Ritzen darunter. Er holte tief Luft, hielt den Atem an und zwang seine Hände, still zu bleiben. Er presste die Kiefer aufeinander nicht aus Wut, nicht aus Entschlossenheit, sondern um die alte Angst daran zu hindern, aus seinem Mund zu entweichen.
Hinter ihm lag das Kloster still, ein Nest voller Geheimnisse. Vor ihm wartete der Tagesablauf, streng wie der Stab des Abtes, kalt wie die Knochen unter dem Kreuzgang.
Er klopfte, und der Klang hallte wider, ein einziger Schlag wie das Schließen eines Grabes.
Die Tür gab nach, und Gerlach trat aus der Friedhofskälte in eine Gruft anderer Art. Der Kapitelsaal war ein dunkler Raum ohne Fenster, bis auf einen kleinen Schlitz hoch oben in der Apsis, der jedoch kaum Licht hereinließ. Die Luft roch schwach nach altem Talg und Schimmel. Stille, dick wie Wolle, lag zwischen den Wänden.
Am anderen Ende des Raumes saß Abt Severinus auf seinem Thron, seine Kutte makellos vor dem ruinenhaften schwarzen Holz seines Sitzes. Das Gesicht des Abtes, flach und blass, blickte unter einer silbernen Haarkrone hervor, die Tonsur an der Krone eine offene Wunde. Seine Hände, die er über den Kopf eines gekrümmten Stabes gefaltet hatte, verrieten kein Zittern, nur eine bis zur Bosheit gereichte Geduld.
„Bruder Gerlach.“ Die Stimme war wie eine Klinge: leise, kalt, ohne die Gnade eines Echos. „Du bist pünktlich. Gut.“
Gerlach verbeugte sich, die formelle Neigung knapp unterhalb der Unterwürfigkeit. Er senkte demonstrativ den Blick, wie es sich für einen Mann unter Beobachtung gehörte.
Der Blick des Abtes durchdrang die Dunkelheit und ließ Gerlach bis auf die Knochen erschauern. „Das Kapitel ist noch nicht versammelt. Setz dich.“ Er deutete mit zwei Fingern auf eine Bank nicht mehr, als man einen Hund rufen würde.
Gerlach gehorchte. Das Holz war härter als jede Buße. Er verschränkte die Hände vor der Hüfte und umklammerte die Gebetsperlen, als könnten sie ihn im Hier und Jetzt verankern.
Severinus wartete und ließ die Stille wirken, bis die Sekunden über Gerlachs Haut krochen. Endlich: „Es gibt ... Berichte.“ Der Abt verdrehte das Wort, als wäre es ein Fluch. „Unsere Brüder in Straberg berichten von Unruhen.“ Er ließ das Wort hängen wie ein Ketzer am Strick.
Gerlach sagte nichts.
„Vieh ist verendet. Kinder haben Fieber. Kreuze wurden aus Gräbern gerissen. Das ist nicht das Werk Gottes.“
„Oder des Teufels“, sagte Gerlach, bevor er den Gedanken unterdrücken konnte.
Die Augen des Abtes verengten sich zu schmalen Schlitzen. „Du hast zu viel in den alten Schriften gelesen, Bruder. Unser Feind ist nicht so subtil.“ Er schlug einmal mit seinem Stab gegen den Stein. „Es gibt Gerüchte ...“ (und hier wandte er den Blick ab, als wolle er Gerlach die Sünde ersparen) „... dass sich Frauen im Wald versammeln. Von Schatten an den Türschwellen. Von Flüchen und Schlimmerem.“
Gerlach rollte die Perlen zwischen Daumen und Fingerknöchel. „Wer hat diese Anschuldigungen erhoben?“
Severinus antwortete nicht. Stattdessen sagte er: „Du wirst nach Straberg gehen. Du wirst Nachforschungen anstellen. Du wirst alles ausmerzen, was dort gärt.“ Der Ton seiner Stimme war unnachgiebig; Gerlach konnte darunter das Knirschen der Räder der Macht und der Erwartungen hören. „Und du wirst die Angelegenheit zu einem Ende bringen.“
Gerlach blickte auf und begegnete dem Blick des Abtes für den Bruchteil einer Sekunde. „Ich werde mit der Sorgfalt ermitteln, die Sie von mir erwarten, Vater.“
Severinus presste die Lippen zusammen, als seien die Worte selbst ein Versagen. „Du wirst die Weisheit der Kirche in dieser Angelegenheit nicht in Frage stellen. Ich kenne deine Zweifel, Bruder. Ich bete, dass du den Verstand hast, sie für dich zu behalten.“
Gerlachs Kiefer schmerzte. Er zwang sich zur Ruhe. „Natürlich.“
Der Abt musterte ihn, als suche er nach der Ketzerei, die er vermutete, nach dem Verfall unter der Oberfläche. „Du wurdest wegen deiner Intelligenz ausgewählt, Bruder. Nicht wegen deiner Meinung.“ Seine Stimme wurde sanfter, was sie nur noch gefährlicher machte. „Unser Herr liebt nicht die Klugen. Er liebt die Gehorsamen.“
Dann herrschte Stille. Nicht einmal der Wind draußen wagte sich herein.
„Du brichst zur Prim auf“, sagte Severinus und erhob sich von seinem Sitz mit der Anmut eines Mannes, der sich noch nie vor jemandem oder etwas verbeugt hatte. „Der Prior wird dir die Unterlagen und Vorräte geben. Der Rest ist deine Sache.“ Er kam so nah, dass Gerlach seinen Atem riechen konnte: würzig, rein und doch irgendwie faul, als würde etwas in ihm alle Süße vergären.
„Wenn du versagst“, sagte der Abt, „werde ich es erfahren.“
Gerlach nickte. Er traute seiner Zunge nicht.
Severinus kehrte zu seinem Thron zurück, richtete seine Robe und entließ Gerlach mit einer Handbewegung. „Geh. Bete. Und vergiss nicht, wer dich beobachtet.“
Die Tür fiel hinter ihm mit einem Knall zu, der laut genug war, um Tote zu wecken.
Seine Zelle war eine Zelle im wahrsten Sinne des Wortes: eine karge Pritsche, ein Kruzifix, ein Holzschreibtisch, der von jahrelanger stiller Buße zerkratzt war. Durch den Spalt in der Wand drang lichtloses, trübes Licht herein, kaum genug, um die Staubkörner zu zählen, die über dem Steinboden schwebten. Gerlach bewegte sich durch den Raum wie ein Geist, der seine eigene Spuknummer einstudierte.
Er legte die Schriftrollen Kirchenrecht, eine handgeschriebene Abhandlung über Inquisitionsmethoden, ein Bündel bereits vergilbter Pergamente eine nach der anderen in seine Tasche. Jedes Bündel fühlte sich schwerer an als die Summe seiner Seiten. Er zählte sie laut, die Zahl wie eine Beschwörungsformel gegen den Zusammenbruch der Ordnung.
Als Nächstes kamen die Messer, die Tinte des Schreibers und die dünne Schnur zum Binden der Aussagen. Zuletzt zog er aus dem Boden der Truhe ein Buch, das in fettiges schwarzes Leder gebunden war und dessen Titel von einer nervösen Hand abgekratzt worden war. Albertus Magnus De Causis Naturalibus. Eine Abhandlung über die Wirkungsweise von Krankheiten, darüber, wie Fäulnis aus Wasser entsteht, wie Fieber aus Schmutz entsteht und nicht aus Hexerei oder Teufelswerk.
Er fuhr mit einem Finger über die erste Seite, fast wie eine Liebkosung. Die Worte selbst konnten ihn verdammen. Er wog das Buch in seiner Hand und dachte an die Gesichter, die er gesehen hatte pockennarbig, fiebrig, dem Aberglauben verfallen und wusste, dass er die Sünde des Wissens mit sich tragen würde, wohin auch immer die Kirche ihn schicken würde.
Er wickelte das Buch in ein Tuch und schob es zwischen die anderen Bände. Seine Hände ruhten auf dem Deckel der Tasche, die Knöchel wurden weiß. Er schloss die Augen und versuchte zu beten, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken zu viele Stimmen drängten sich zwischen ihm und Gott.
Er griff nach dem Kruzifix an seinem Hals und drückte es so fest, dass es eine Spur hinterließ. „Ave Maria, gratia plena“, flüsterte er. „Sancta Maria, ora pro nobis.“ Der Rhythmus beruhigte ihn nicht.
Die Glocken läuteten zur Prim. Im Flur huschten Schritte: Novizen mit Besorgungen, alte Mönche, die zur Kapelle schlurften, das Kloster erwachte aus seinem flachen Grab. Gerlach verschloss die Tasche, zog seine Kutte über und starrte sich im eisigen Spiegel der Fensterscheibe an. Er sah aus wie ein Büßer oder ein Verurteilter.
Die Tür zum Flur quietschte, als er sie öffnete, das eisenbeschlagene Gewicht widerstand jedem Zentimeter. Er ging den Gang entlang, seine Stiefel schlugen nass auf die Steine. Am Ende des Flurs wartete eine Gestalt: der Prior, das Gesicht staubgrau, einen versiegelten Brief in der Hand.
„Bruder Gerlach.“ Die Stimme war kaum zu hören, als ob die Wände selbst sprachen. „Der Abt wünscht Ihnen Gottes Segen. Und Fleiß.“
Der Brief, schwer von Wachs und Bändern, wechselte zwischen ihren Händen.
Gerlach nickte und steckte die Nachricht in seinen Ärmel. Er traute sich nicht zu sprechen.
Er ließ den Prior zurück, stieg die Treppe hinunter, und die Welt wurde kälter, je näher er dem Haupttor kam. Zwei Laienbrüder standen Wache, ihre Gesichter unlesbar, den Blick in die Ferne gerichtet. Einer von ihnen spuckte in den Schlamm. Der andere machte das Kreuzzeichen, als Gerlach vorbeiging.
Er trat hinaus in den Morgen. Der Nebel hatte sich verdichtet, saugte die Farbe aus der Luft und tauchte die Welt in Blei und Talg. Sein Atem bildete eine Wolke, die sich mit dem Dunst vermischte, bis sie verschwand. Über ihm kreiste ein Rabe, krächzte einmal, dann noch einmal ein Riss in der Stille, hart und absolut.
Gerlach blickte nach oben und suchte in dem Flattern der schwarzen Flügel nach einer Bedeutung. „Ist das ein Omen?“, murmelte er und spürte sofort, wie kindisch das war. Er zwang sich zu einem Lächeln, einem Grinsen der Vernunft gegen die Tyrannei der Angst.
Er nahm die nördliche Straße, seine Stiefel rutschten auf dem nassen Kies, und mit jedem Schritt schrumpfte das Kloster hinter ihm. Nach der ersten Kurve verschwand es vollständig, verschluckt vom Nebel. Alles, was blieb, war das ferne Läuten der Glocken und die Erinnerung an Severinus' Augen, scharf wie Nadeln in der Dunkelheit.
Er marschierte weiter, die Tasche schlug gegen seine Hüfte, ein totes Gewicht aus Tinte und Geheimnissen. Er würde nach Straberg gehen. Er würde tun, was ihm befohlen worden war. Und wenn die Zeit gekommen war, sich zwischen Dogma und Wahrheit zu entscheiden, betete er, dass er den Mut oder die Feigheit
haben würde, den Unterschied zu erkennen.
Der Rabe landete auf einem Pfosten vor ihm und beobachtete ihn. Er neigte den Kopf, als würde er bereits um ihn trauern.
Gerlach biss die Zähne zusammen und ging weiter, hinein in das Grau, hinein in den wartenden Mund des Waldes, hinein in die Frage, die sein Leben war.
02 DIE ANKLAGE
Die Morgendämmerung breitete sich langsam über den Himmel aus und tauchte die alten Steine von Knechtsteden in ein blutiges Violett. Der Flussnebel lag dicht und zäh in jeder Vertiefung und dämpfte sogar den Klang der Glocken. Irgendwo hinter der Mauer ertönte eine Stimme kein Gesang, kein Gebet, sondern ein rauer, hoher Schrei, der in die Luft stieg, bis er in den Bögen über ihnen hängen blieb. Dann ertönte ein Klopfen zuerst verzweifelt, dann methodisch an dem Haupttor des Klosters.
Bruder Gerlach, der sich in diesen Stunden vor Tagesanbruch immer am wohlsten fühlte, stand in den Schatten des westlichen Kreuzgangs gehüllt. Er bewegte sich nicht, nur die Muskeln in seinem Hals spannten sich langsam an. Er wusste, was das Klopfen an der Tür bedeutete. Er hätte die gesamte Liturgie der folgenden Ereignisse auswendig rezitieren können: das Krachen der Riegel, das Brüllen der Wachen, den ersten Hauch von feuchter Wolle und Panik, als die Außenwelt in das Allerheiligste eindrang.
Die großen, mit Eisen beschlagenen Türen zitterten in ihren Angeln, jeder Schlag hallte mit der dumpfen Autorität einer Begräbnistrommel durch die Arkade. Der Torwächter, ein gedrungener, schweigsamer Beamter, hatte bereits den Querriegel zurückgeworfen.
Nun, da die Türen aufsprangen, fiel ein grauer Lichtstreifen in den Hof, gefolgt von einer Menge Bauern dreißig, vielleicht vierzig, die sich zusammenkauerten, als wollten sie sich wärmen oder verteidigen. Ihr Atem dampfte in der neuen Kälte, jeder Ausatemzug war von dem Geruch ungewaschener Zähne durchzogen. An ihrer Spitze stand ein Mann, den Gerlach nur an seiner Not erkannte. Er war kein Einheimischer.
Sein Gesicht blass, breit, von alten Pockennarben übersät trug die Spuren der Armut im Niederrhein, aber in seinen Augen war noch etwas anderes zu sehen: eine Raserei, eine wilde Logik, die sich nicht um Autoritäten oder die Grenzen von Stein und Ritualen scherte. Er trug die Überreste einer roten Mütze, deren Krempe schwarz war, und seine Hände waren in Lumpen gewickelt. Sein Mund öffnete und schloss sich, aber das Geräusch, das herauskam, war weniger Sprache als vielmehr eine Beschwörungsformel:
„Meine Sau ist tot, und die Ferkel mit ihr verflucht sei der Bastard! Meine Kinder schwitzen nachts ihre Bettwäsche nass, und morgens ist Blut auf den Laken. Jemand hat den Brunnen vergiftet, das schwöre ich bei der Heiligen Jungfrau, und jetzt kann mein Sohn vor Schmerzen nicht pinkeln“
Seine Tirade wurde von der Menge hinter ihm verschluckt, jede Stimme wetteiferte in Tonhöhe und Entsetzen:
„Mein Nachbar er liegt im Grab, aber gestern stand er noch da und sprach mit mir“
„Das Brot ist innen schwarz“
„– Ihr Haar ist nach dem Feuer wieder gewachsen“
„– Der Mund meiner kleinen Anna ist voller blauer Fliegen“
Gerlach drückte seinen Rücken gegen den kalten Pfeiler. Er sah, wie die Menge vorwärts drängte, die Stiefel schmatzten auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Vor Tagesanbruch hatte es heftig geregnet, und der Hof war nun ein Schlachtfeld aus Schlamm und Hufabdrücken, bereits zerfurcht von der Invasion. Am Rand tauchten Mönche auf, ihre weißen Gewänder mit Schwarz umgürtet, aber keiner wagte sich an die Flut der Dorfbewohner heran.
Und unter den Bauern, nie ganz vorne, aber auch nie weit zurück, bewegte sich eine Gestalt, die so präzise wirkte, dass sie die Farbe aus der Luft zu saugen schien. Heinrich von Lintorf Vogt, Landvogt, Gesandter der weltlichen Macht trug einen dunklen Wollmantel mit silberner Schließe, einen Hauch von Purpur am Ärmel, und seine Stiefel glänzten, obwohl der Tag kaum begonnen hatte. Sein Bart war geölt, seine Augen lagen tief wie Flusssteine. Er schrie nicht und drohte nicht, sondern legte seine Hand sanft auf die Schultern des Lautesten, neigte den Kopf und sprach mit einer Stimme, die zu leise war, um sie zu hören.
Gerlach bemerkte, wie innerhalb eines einzigen Atemzugs die Flüche des wildäugigen Bauern an Details und Gift zunahmen. Heinrich flüsterte etwas, der Mann nickte, dann verdoppelte sich das Geschrei an Lautstärke und Entschlossenheit. Gerlach verfolgte den Rhythmus: Anschuldigung, Zustimmung, Eskalation ein Katechismus der Angst.
Ein Novize huschte über den offenen Platz, die Arme an den Seiten, und verschwand durch eine Seitentür. Sekunden später läutete eine Glocke aus dem Refektorium, nicht zum Gebet, sondern mit dem harten Klang, der für Feuer, Krieg oder Seuchen reserviert war. Die Menge wich vor dem Klang zurück und erstarrte dann. In der Pause konnte Gerlach sie als das erkennen, was sie waren: keine Armee, sondern eine Herde, die nicht wusste, in welche Richtung sie fliehen sollte.
Dann zerriss die Luft mit chirurgischer Grausamkeit: der Abt.
Severinus trat aus dem Kapitelsaal, den Stab in der Hand, seine Robe makellos wie Altartuch. Er war kein großer Mann, aber er hatte die Würde eines Felsens. Das Silber seiner Tonsur glänzte im fahlen Licht. Er schrie nicht, um sich gegen den Lärm der Menge zu Gehör zu verschaffen, sondern ließ die Stille wachsen wie Unkraut, bis selbst die Kinder verstummten.
Er blieb am Rand des Kreuzgangs stehen, überblickte den Schaden und ließ eine kleine, präzise Falte an seinem Mundwinkel entstehen.
„Brüder. Kinder Christi. Was ist dieser Lärm?“ Seine Stimme war messerscharf, geschärft durch jahrelanges Ansprechen von Ungehorsamen und Verdammten. „Warum zerstört ihr zu solcher Stunde das Haus Gottes?“
Der Mann mit den wilden Augen taumelte vorwärts und stieß gegen die Würde des Abtes. „Herr Abt! Der Teufel hat in Straberg sein Lager aufgeschlagen. Meine Anna liegt im Sterben, die Felder sind verdorben, und es gibt Hexen“
Bei diesem Wort ging ein Raunen durch die Menge, und mehr als ein Gesicht wandte sich um, um die Schatten des Hofes abzusuchen, als könnte der Angeklagte hinter dem nächsten Pfeiler hervorspringen.
Severinus zuckte nicht mit der Wimper. Er hob seinen Stab und schlug mit der eisernen Spitze auf den Stein, sodass es an den Wänden widerhallte. „Der Teufel ist schlau, mein Freund. Er sät Verwirrung, Gerüchte und Verleumdungen. Hast du Beweise? Oder nur die feuchten Träume der Ängstlichen?“
Heinrich trat vor, die Hände höflich gefaltet. „Abt, diese Leute haben Dinge gesehen. Zeichen. Dutzende sterben, Kreuze auf dem Friedhof umgestürzt. Das ist mehr als nur Gerüchte.“
Severinus musterte ihn von Kopf bis Fuß, als würde er überlegen, ob er ihm ein krankes Maultier abkaufen sollte. „Herr von Lintorf. Ich nehme an, Sie haben Nachforschungen angestellt? Schließlich werden Sie dafür bezahlt, für Ordnung unter den Lebenden zu sorgen.“
Heinrichs Mund zuckte, fast zu einem Lächeln. „Das habe ich, Eure Ehrwürdigkeit. Ich habe sogar eine Liste mit Namen mitgebracht.“
Der Abt musterte ihn einen langen, eiskalten Moment lang, dann ließ er seinen Blick über die Bauern schweifen. „Ihr sucht Gerechtigkeit. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Aber es wird hier keinen Mob geben und keine Rache ohne Grund. Der Inquisitor wird eure Beschwerden anhören, und wenn er sie für wahr befunden, werden die Schuldigen benannt und bestraft werden. Bis dahin werdet ihr warten.“
Er hob das Kinn, seine Augen waren wie gefrorenes Silber. „Ist das klar?“
Die Menge bewegte sich, murmelte, verstummte dann unter dem Gewicht von Severinus' Blick.
Gerlach, der von dem Kirchenschiff aus zusah, empfand eine seltsame Bewunderung und Abscheu. Der Abt hätte mit dieser Stimme einen Aufstand niederschlagen können. Er fragte sich, wie viele Menschen über wie viele Jahrhunderte hinweg auf Befehl einer solch unerbittlichen Vernunft gestorben waren.
Severinus ließ seinen Blick über die Versammlung schweifen, dann fand er Gerlach im Schatten. Er hielt seinen Blick fünf Sekunden lang fest. Gerlach spürte, wie sich sein Magen zusammenzog.
„Die Stunde ist gekommen“, sagte Severinus laut genug, dass alle ihn hören konnten, „das Böse auszurotten und Gottes Ordnung wiederherzustellen.“ Seine Stimme klang nicht triumphierend, sondern traurig.
Er zeigte mit dem Stab auf Gerlach, als würde er ihn in einer Litanei der Verdammten nennen. „Bruder Gerlach wird die Zeugenaussagen aufnehmen. Er wird die Ursache dieser Unruhen aufdecken. Er wird euer Fürsprecher und euer Richter sein. Er wird für die Kirche sprechen, wie er es immer getan hat.“
Es folgte eine weitere Stille, dichter und bedrohlicher als zuvor.
Heinrich wandte sich mit einem halben Lächeln an die Menge. „Hört ihr, meine Freunde? Die Kirche ist mit uns.“
Der wildäugige Bauer sank auf die Knie in den Schlamm. „Gott segne Sie, Herr Abt. Gott segne Sie, Bruder. Nur retten Sie uns“ Seine Hände krallten sich in den Boden, als würde er sein eigenes Grab schaufeln.
Severinus nickte einmal, wandte sich von der Versammlung ab und verschwand in der Dunkelheit des Kapitelsaals.
Die Bauern standen unsicher da, nicht mehr als Mob, aber auch noch nicht wieder als Schafe. Sie starrten Gerlach mit einer Gier an, die an Gewalt grenzte. Er blieb unter dem Torbogen stehen, den Kopf gesenkt, die Hände um seine Tasche geklammert. Seine Finger zitterten nicht vor Kälte, sondern vor der alten, vertrauten Angst: dem Wissen, dass, wenn sich Menschen in großer Zahl versammelten, die Wahrheit als Erstes lebendig verbrannt wurde.
Am Tor blieb Heinrich stehen, die Hand auf der Schulter des wildäugigen Mannes. Er flüsterte etwas kurz, scharf, endgültig und das Gesicht des Bauern verzog sich, dann nahm es eine Maske aus Hoffnung und Hass an.
Der Morgen hellte sich allmählich auf. Vögel sangen, ohne etwas zu ahnen. Endlich kamen die Krähen hervor, schwarz vor dem blutroten Himmel, und kreisten über dem Kloster, wartend auf das, was als Nächstes kommen musste.
Gerlach machte das Kreuzzeichen, mehr als Entschuldigung, denn als Segen.
Und der Tag begann offiziell.
Es gab einen Moment nicht länger als ein flacher Atemzug, in dem Gerlach überlegte, sich zurückzuziehen. Er hätte sich wieder in den Kreuzgang zurückziehen können, die Maschinerie des Glaubens und der Angst ohne ihn weiterlaufen lassen können. Aber Severinus' öffentliche Nennung hatte ihn bereits gebunden, wie einen Hund an der Leine. Also trat er in den Hof, seine Stiefel schmatzten im Schlamm, seine Hände waren so fest geballt, dass die Knochen weiß durch die Haut schimmerten.
Er spürte sofort die Blicke auf sich, hungrig, ungeduldig und irgendwo dahinter bereits voller Groll. Die Menge hatte sich verändert: Was einst eine Ansammlung von Bauern gewesen war, war nun ein einziger Organismus, dessen Hunger sich nach außen richtete und nach einem Sündenbock suchte, den er verschlingen konnte. Sie starrten Gerlach an, als würde er gleich Hörner bekommen, Feuer speien oder sie an Ort und Stelle verfluchen.
Er räusperte sich. „Männer und Frauen von Straberg. Ich habe eure Anschuldigungen gehört, eure Ängste.“ Er bemühte sich um Ruhe, um einen Tonfall, der beruhigte statt aufwieglerisch wirkte. „Lasst uns ehrlich reden. Krankheit, Hungersnot das sind alte Feinde. Sie kommen nicht immer durch Hexerei oder Bosheit. Manchmal verdirbt das Wasser durch natürliche Fäulnis. Manchmal sind die Felder“
Er kam nicht zu Ende. Ein Mädchen, dessen Gesicht von Pocken übersät war und dessen Augen zu Schlitzen geschwollen waren, schrie: „Lügner! Mein Bruder war stark wie ein Ochse, und jetzt liegt er tot da!“ Ihre Mutter, ein Schatten hinter ihr, spuckte in den Schlamm.
Eine andere Stimme, diesmal hoch und dünn: „Hexe! Hexe im Wald! Sie hat den Schatten auf unsere Felder geworfen“ Das Wort selbst zischte wie ein Blitz durch die Menge, und bald schrien alle: „Hexe!“ „Verbrennt sie!“ „Bringt die Schuldige heraus!“
Gerlach hob die Hände, die Handflächen nach oben, als wolle er seine Unschuld beweisen. „Niemand wird verbrannt. Nicht ohne Beweise. Nicht aufgrund von Gerüchten oder durch einen Mob.“ Er versuchte, lauter zu sprechen, aber seine Worte gingen im Chaos unter.
Heugabeln tauchten auf, wie Zähne in einem Kiefer. Fackeln, primitiv und zischend, flammten gegen den grauen Himmel. Der wildäugige Bauer derjenige, der den Morgen in solcher Verzweiflung begonnen hatte schäumte nun vor Aufregung und umklammerte einen Holzpfahl, als wäre es eine heilige Reliquie. Überall waren Gesichter zu sehen, die vor Angst und etwas Dunklerem verzerrt waren. Es war keine Hoffnung, sondern ein Hunger danach, die Welt erklärt zu bekommen, selbst wenn das Blutvergießen bedeutete.
Heinrich drängte sich durch die Menge, ohne zu schreien, immer in Bewegung. Er fand die Zitternden und Unzufriedenen, flüsterte ihnen zu und sah, wie ihre Panik sich in Gewissheit verwandelte. Er legte seine Hand auf die Schulter des pockennarbigen Mädchens, beugte sich zu ihr hinunter und ließ ihren Schrei anwachsen, bis er die Luft zu zerreißen drohte.
Gerlach erinnerte sich mit einer Klarheit, die ihn erschauern ließ, an die anderen Feuer. Er sah den Scheiterhaufen, die Seile, die Schreie, die selbst dann nicht verstummten, als das Fleisch bereits geschmolzen war. Er sah die Gesichter der Toten meist Frauen, einige Männer, alle von Angst gezeichnet und erschöpft und hörte ihre letzten Worte: „Gnade“, „Ich gestehe“, „Gott hilf mir“.
Er spürte es bis ins Mark: Der Mob wollte keine Wahrheit, nicht einmal Gerechtigkeit. Er wollte die süße, wahnsinnige Gewissheit, die nur ein Spektakel bieten konnte.
Verzweifelt erhob er seine Stimme. „Hört mir zu! Es gibt keine Hexen. Die Kirche wird Ermittlungen anstellen. Aber wenn ihr das Gesetz in eure eigene Hand nehmt, verdammt ihr euch selbst. Ist es das, was ihr wollt?“
Für einen Moment verstummte der Tumult. In die Stille trat Severinus, den Stab in der Hand, seine Robe selbst im schmutzigsten Teil der Menge noch sauber. Er sprach nicht, sondern hob nur seine Handfläche, und mit dieser kleinen Geste erstickte er die Wut der Menge. Es war eine Stille wie vor einem Sturm.
Er wandte sich an Gerlach, seine Stimme war leise, aber ohne jedes Mitleid: „Bruder Gerlach, als unser Inquisitor wirst du diese Vorwürfe der Hexerei untersuchen. Bring uns die Wahrheit, wie auch immer sie aussehen mag.“ Er hielt inne, und das Wort „Wahrheit“ schwebte wie eine Drohung in der Morgenluft. „Lass mich das nicht wiederholen.“
Gerlach blickte in die Augen des Abtes und sah keinen Glauben, sondern die kalte Maschinerie der Ordnung. Er senkte den Kopf, nicht in Unterwerfung, sondern in Resignation. Seine Finger fanden die Perlen an seinem Gürtel und drückten sie so fest, dass sie sich in seine Haut gruben. „Ich werde es tun“, sagte er so leise, dass er nicht sicher war, ob selbst Severinus ihn hören konnte.
Die Menge, ihrerem Höhepunkt beraubt, verstummte und starrte mürrisch vor sich hin. Heinrich sammelte den wildäugigen Bauern und den lautesten der Ankläger ein und führte sie mit leiser, beruhigender Stimme zur Außenmauer. Andere folgten ihnen, immer noch ihre provisorischen Waffen umklammernd, den Blick zwischen Gerlach und der leeren Stelle, an der Severinus gestanden hatte, hin und her schwenkend.
Einige blieben zurück: das pockennarbige Mädchen, ihre Mutter, ein alter Mann mit einer Sense und ein Kind, das sich an sein Bein klammerte. Sie sahen Gerlach nicht mit Hoffnung an, sondern mit der Erwartung einer Enttäuschung. Er wollte ihnen sagen, dass alles ein Irrtum war, dass nichts ihr Dorf heimsuchte außer schlechtem Wasser und noch schlechterem Glück. Er wollte ihnen sagen, dass er sie retten würde, aber er wusste, dass das eine Lüge wäre.
Stattdessen nickte er einmal, drehte sich um und ging zurück durch den Kreuzgang, während das Echo der Rufe der Menge ihm wie ein Blutfleck folgte. Er spürte weder die Kälte noch die Nässe oder die Last der Blicke, die ihm folgten. Er spürte nur die alte, hungrige Angst.
An der Tür zum Kapitelsaal hielt er inne, holte tief Luft und ließ seine Hand auf dem Holz ruhen. Von der anderen Seite hörte er das leise, trockene Husten von Severinus und wusste, dass der Abt wartete. Er trat ein, schloss die Tür und ließ sich von der Dunkelheit verschlucken.
Draußen flackerten die Fackeln und erloschen. Die Morgensonne, zu schwach, um zu wärmen, tauchte den Hof in ein Licht, das jeden Makel offenbarte.
Die ersten Krähen ließen sich auf dem Tor nieder. Sie beobachteten still und geduldig, als wüssten sie, wie dies enden würde.
Die Menge, um ihr Spektakel betrogen, verweilte im Hof. Sie drängten sich in Dreier- und Vierergruppen zusammen, murmelten und spähten gelegentlich zum Kapitelsaal, als hofften sie, die Türen könnten aufspringen und neue Schrecken hervorbringen. Doch vorerst, der Gewalt beraubt, lösten sie sich langsam in den Nebel auf und kehrten in ihre Hütten und Scheunen zurück, wobei sie immer wieder über die Schulter blickten, um sich zu vergewissern, dass die Tore des Klosters offenblieben.
Gerlach beobachtete das Geschehen von einem Fenster im Obergeschoss aus, dessen Glas wellig und kalt war. Er zählte die weggehenden Köpfe und merkte sich diejenigen, die zurückblieben: den Mann mit den wilden Augen, der sich immer noch mit weiß gekniffenen Fingern an seinem Pfahl festhielt; das pockennarbige Mädchen und ihre Mutter; und neben dem Brunnen den Vogt Heinrich, der mit verschränkten Armen und zum Himmel gerichtetem Gesicht dastand, als würde er auf ein Wort Gottes selbst warten.
Die Stille, die auf den Exodus folgte, war fast luxuriös. Für ein paar Atemzüge ließ Gerlach die Leere auf sich wirken, die Art, wie die Steine Erleichterung auszuatmen schienen. Aber der Luxus war nur von kurzer Dauer. Aus dem Seitentor zerrten zwei Wachen in der schwarz-weißen Livree der Abtei eine Frau ins Freie. Sie war jung vielleicht sechzehn, vielleicht älter, die Gesichtszüge von Hunger und Entbehrung gezeichnet. Ihr Kleid war kaum mehr als ein Sack, der Saum steif von altem Blut und frischem Schlamm, aber sie bewegte sich mit einer Steifheit, die Gerlach als Stolz erkannte, oder zumindest als die Hartnäckigkeit, die manchmal dafürgehalten wird.
Sie schrie nicht. Die Wachen, mit roten Gesichtern und schweißgebadet, zerrten sie über den Hof, als wiege sie nichts. Ihre Hände waren gefesselt, aber sie hielt den Kopf hoch, das Haar offen und verfilzt. Sie starrte geradeaus, ohne zu blinzeln, und Gerlach spürte die Kraft ihres Willens quer über den Hof.
Er konnte nicht wegsehen. Nicht zum ersten Mal war er von der Umkehrung der Rollen beeindruckt: Die Angeklagte war die Einzige hier, die sich ihrer Sache sicher zu sein schien.
Die Wachen schoben sie zur Tür des Speisesaals. Sie stolperte, fing sich wieder und hob für einen kurzen Moment den Kopf. Ihr Blick traf den von Gerlach in der Glasscheibe. Darin lag keine Anklage kein Flehen, kein Hass, nicht einmal Angst. Stattdessen: Anerkennung, als hätte sie ihn bereits zu den Männern gezählt, die sie verraten würden.
Er zuckte zusammen, obwohl das Fenster sie um die Hälfte der Länge des Kirchenschiffs trennte.
Sie war verschwunden, in den Bauch der Abtei verschwunden. Gerlach atmete aus, sein Atem beschlug das Glas.
„Name?“, murmelte er zu niemandem.
„Aleid“, sagte eine Stimme hinter ihm, dünn wie eine Schnur. Der Prior, dessen Gesicht im Morgenlicht aschfahl war, hielt in der einen Hand ein Hauptbuch und in der anderen eine zitternde Feder. „Aleid, Tochter des Müllers aus Straberg. Diejenige, deren Mutter nachts umherwandert.“
Gerlach nickte, als würde dies etwas bestätigen, was er schon lange vermutet hatte. „Was noch?“
Der Prior zögerte. „Es gibt Gerüchte. Sie spricht mit sich selbst. Sie geht nicht zur Messe. Ihr Vater ist letzten Winter ertrunken, und seitdem ist ihre Mutter ... besessen.“
Gerlach dachte an den Mob, wie schnell sie sich auf ihr Ziel konzentriert hatten. „Und jetzt ist sie hier.“
„Es ist, was sie wollten“, sagte der Prior mit kaum hörbarer Stimme. „Es ist auch, was der Abt will.“
Gerlach entließ den Prior mit einer Handbewegung, nicht bereit, seine eigene Schwäche durch die eines anderen zu verkomplizieren. Er wartete, bis die Tür ins Schloss gefallen war, dann kehrte er zum Fenster zurück.
Der Hof war fast leer. Nur Heinrich stand noch da, die Stiefel im Schlamm, die Arme verschränkt wie ein Richter am Ende der Welt. Gerlach sah, wie der Gerichtsdiener langsam eine behandschuhte Hand hob und mit schrecklicher Geduld einen Finger über seine eigene Kehle zog.
Ein Versprechen oder eine Warnung. Vielleicht beides.
In dieser Nacht kniete Gerlach in seiner Zelle vor einem ramponierten Kruzifix, dessen Holzfläche von Jahrhunderten flehender Hände glatt geschliffen war. Er hatte eine einzige Kerze angezündet, mehr um sich selbst etwas Trost vorzugaukeln als um Licht zu haben, und ließ die Schatten zu zitternden Insektenformen an die Wände tanzen.
Er betete, obwohl die Worte ob Latein oder Niederdeutsch, das spielte keine Rolle immer weniger Bedeutung für ihn hatten. Er betete um Führung, um die Befreiung von Aleid, um seine eigene Absolution, von der er wusste, dass sie niemals kommen würde. Er betete auch um den Mut, die Dinge so zu sehen, wie sie waren, und nicht so, wie Severinus oder Heinrich oder die Menge es verlangten.
Seine Hände zitterten, als er das Kreuz umklammerte. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob das Zittern Ausdruck seines Glaubens oder nur seiner Angst war.
Aus dem Labyrinth des Klosters hallte ein Schrei. Kurz, erstickt, aber laut genug, um die Kerzenflamme zittern zu lassen.
Gerlach bekreuzigte sich, stand auf und schlich zum schmalen Fensterschlitz. Die Nacht hatte sich dicht wie Wolle um die Abtei gelegt. Nur die Sterne durchbrachen die Dunkelheit. Er lehnte seine Stirn gegen den feuchten Stein und versuchte, sich die Welt jenseits der Tore vorzustellen.
Ein Geräusch. Leise, aber eindringlich.
Eine schwarze Gestalt ließ sich auf dem Fensterbrett nieder ein Rabe oder eine Krähe, deren Augen im Kerzenlicht feucht und hell leuchteten. Sie beobachtete ihn mit geneigtem Kopf, so wie Menschen manchmal einen Leichnam bei einer Totenwache betrachten.
„Geh weiter“, flüsterte Gerlach, mehr zu sich selbst als zu dem Vogel. „Sag ihnen, dass ich schon tot bin.“
Der Rabe sagte nichts, krächzte nur einmal und war dann verschwunden.
Es folgte absolute Stille.
Er kehrte zu seiner Pritsche zurück, konnte aber nicht schlafen. Stattdessen lag er regungslos da und lauschte auf den nächsten Schrei, die nächste Glocke, den nächsten Befehl.
Draußen frischte der Wind auf, und irgendwo in der Dunkelheit wartete ein gefiederter Schatten, geduldig wie die Wahrheit.
03 DER ABT RUFT ZUR ORDNUNG
Die Hallen von Knechtsteden waren nie wirklich still. Selbst in den dunkelsten Nachtstunden schienen die Steine zu flüstern, alte Stimmen, gefangen in Mörtel und Knochen. Gerlach ging instinktiv auf und ab, jeder Schritt ein gemessener Verstoß gegen die Stille. Die Kälte des Korridors drang durch Wolle und Haut, aber er bewegte sich ohne Eile und widerstand dem Drang zu zittern.
Er hatte nicht geschlafen. Die Kerze, die er neben seinem Bett hatte flackern lassen, war schließlich erloschen, ausgelöscht von Zugluft, die wie hungrige Hunde durch den Kreuzgang kreiste. Die erfolglose Nacht stand ihm in den Augenhöhlen geschrieben und zeigte sich darin, wie seine Hand unaufhörlich zur Holzperlenkette an seinem Gürtel wanderte. Während er ging, rollte er die Perlen eine nach der anderen zwischen den Fingern. Nicht im Gebet das Gebet hatte er aufgegeben, sondern als physische Gedächtnisstütze: in Bewegung bleiben, zählen, den Verstand nicht abschweifen lassen.
Der Weg zum Kapitelsaal kam ihm länger vor als sonst. Entlang des Ganges waren Lampen angezündet, deren Flammen in rußigen Gläsern erstickt wurden und jeden Schatten in eine Versammlung wartender Geister verwandelten. Als er sich der Tür näherte, hörte er leise Stimmen eine scharf und dünn wie eine Säge, die anderen nur ein konsonantisches Summen von Männern, die Konflikte vermieden.
Er nahm all seinen Mut zusammen und trat ein.
Die Luft im Inneren war schwer, dick von den Ausdünstungen der Körper und dem widerlichen Geruch von altem Talg. Der gewölbte Raum war so, wie Gerlach ihn von tausend ähnlichen Versammlungen in Erinnerung hatte: Die Wände waren mit Kerzenflecken übersät, die Steinplatten von Jahrhunderten von Füßen zerkratzt. Am anderen Ende des Raumes, unter dem gewölbten Chor, stand der lange Tisch wie ein Altar für die Verwaltung. Severinus, der in seinem Schatten thronte, schien aus demselben weißen Stein wie die Wände geschnitten zu sein, nur der eiserne Kopf seines Bischofsstabs glänzte in der Dunkelheit.
Er erhob sich nicht, als Gerlach eintrat, ebenso wenig wie die beiden älteren Mönche zu seiner Linken und Rechten alte Männer mit eingefallenen Gesichtern, die Hände auf leeres Pergament gefaltet, als wären sie auf ihre letzte Ölung vorbereitet.
An der Seite, kaum im Lichtkreis, lehnte eine Gestalt an einer Säule: breit, mit wolfsähnlichen Schultern, das Gesicht halb im Dunkeln verborgen. Heinrich von Lintorf. Seine Stiefel waren auf Hochglanz poliert, sein Umhang kunstvoll drapiert, sein Bart kunstvoll gestutzt. Sein Blick traf den von Gerlach, und für einen Augenblick huschte ein Grinsen über sein Gesicht ein kaum merkliches Zucken um den Mundwinkel, dann war alles wieder normal.