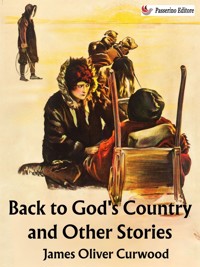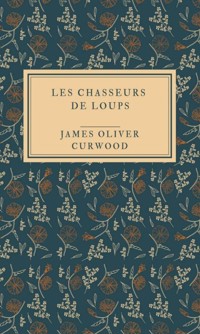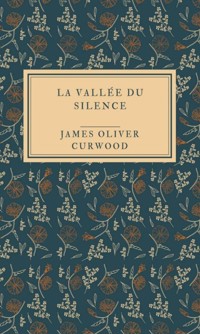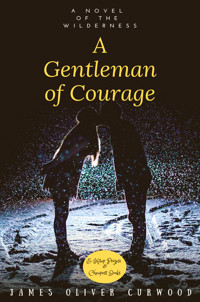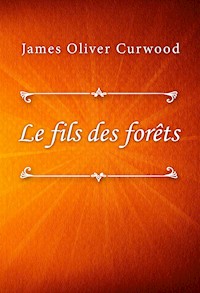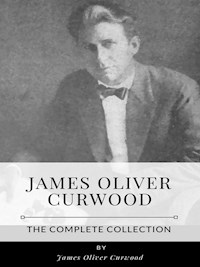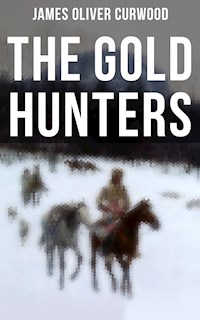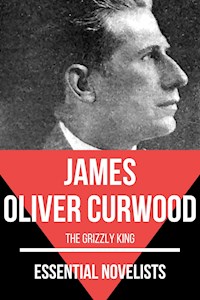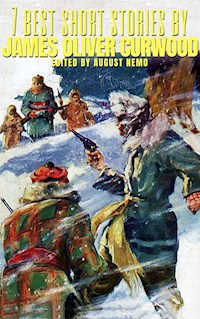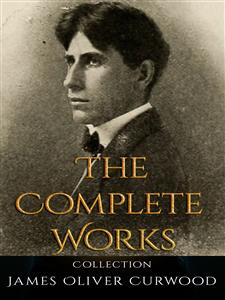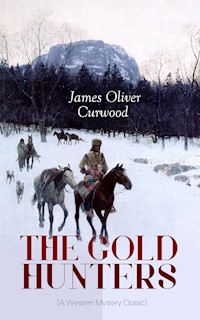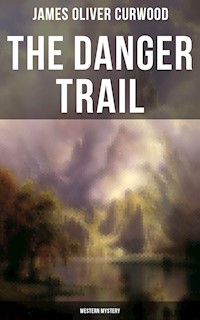0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Die Schatzsucher" entführt uns James Oliver Curwood in die unberührte Wildnis Nordamerikas, wo Abenteuer und Menschlichkeit aufeinanderprallen. Der Roman erzählt die Geschichte einer Gruppe von Schatzsuchern, die in den unerforschten Weiten des kanadischen Territoriums auf der Suche nach Ruhm und Reichtum sind. Curwoods kraftvoller, bildreicher Stil und seine ausgeprägte Liebe zur Natur verleihen der Erzählung sowohl Spannung als auch Tiefe, während er die zeitlosen Themen von Freundschaft, Loyalität und dem unermüdlichen Streben nach dem Unerreichbaren behandelt. Vor dem Hintergrund einer unverfälschten Landschaft verschmilzt die dramatische Handlung mit philosophischen Reflexionen über den Wert des menschlichen Lebens und die Pflege der Natur. James Oliver Curwood, ein Pionier des amerikanischen Abenteuerromans und ein leidenschaftlicher Naturfreund, nutzt seine Erfahrungen als Reisender und Naturbeobachter, um in "Die Schatzsucher" eine authentische Kulisse zu schaffen. Seine enge Verbindung zur Wildnis war nicht nur Inspirationsquelle für seine Werke, sondern auch Antrieb für sein Engagement für den Naturschutz und die Wertschätzung der wilden Schönheit. Curwoods Schriften sind nicht nur Ausdruck seiner kreativen Fantasie, sondern auch Zeugnis seiner tiefen Verbundenheit zur Natur und seiner Ansichten über die menschliche Natur. "Die Schatzsucher" ist ein Muss für jeden, der das Abenteuer liebt und zugleich in die philosophischen Abgründe der menschlichen Sehnsucht eintauchen möchte. Curwoods meisterhafte Erzählweise fesselt und inspiriert, während er die Leser dazu einlädt, ihre eigene Beziehung zur Wildnis und zur Suche nach dem Sinn des Lebens zu reflektieren. Dieses Buch ist eine zeitlose Einladung, die Geheimnisse der Natur und des menschlichen Herzens zu entdecken. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Schatzsucher
Inhaltsverzeichnis
Der lieblichen, dunkeläugigen kleinen Halb-Cree-Maid aus Lac-Bain, die die Minnetaki dieser Geschichte ist, und „Teddy“ Brown, Führer und Fallensteller und treuer Kamerad des Autors bei vielen seiner Abenteuer, ist dieses Buch liebevoll gewidmet.
KAPITEL I DIE JAGD NACH DER HUDSON BAY MAIL
Inhaltsverzeichnis
Die tiefe Stille des Mittags hing über der weiten Einsamkeit des kanadischen Waldes. Die Elche und Karibus hatten seit dem frühen Morgen gefressen und ruhten sich nun friedlich in der Wärme der Februarsonne aus; der Luchs hatte es sich in seiner Nische zwischen den großen Felsen gemütlich gemacht und wartete darauf, dass die Sonne weiter nach Norden und Westen sank, bevor er seine Beutezüge wieder aufnahm; der Fuchs hielt seinen Mittagsschlaf und die unruhigen Elchvögel plusterten sich träge im warmen Licht auf, das den Schnee des Spätwinters zum Schmelzen brachte .
Es war jene Stunde, in der der alte Jäger auf der Fährte seinen Rucksack ablegt, schweigend Holz für ein Feuer sammelt, sein Abendessen isst und seine Pfeife raucht, Augen und Ohren wachsam; – jene Stunde, in der er, wenn du lauter als flüsterst sprichst, zu dir sagen wird:
„Pssst! Sei leise! Du kannst nicht sagen, wie nah wir am Wild sind. Alles hat seine morgendliche Fütterung erhalten und liegt auf der Lauer. Das Wild wird sich erst in ein oder zwei Stunden wieder bewegen, und vielleicht sind Elche oder Karibus nur einen Schuss entfernt. Wir konnten sie nicht hören – jetzt!“
Und doch löste sich nach einer Weile etwas aus dieser leblosen Einsamkeit. Zuerst war es nichts weiter als ein Fleck auf der Sonnenseite eines schneebedeckten Bergrückens. Dann bewegte es sich, streckte sich wie ein Hund, mit weit nach vorne ausgestreckten Vorderpfoten und tief gebeugten Schultern – und war ein Wolf.
Ein Wolf schläft nach einem Festmahl tief und fest. Ein Jäger hätte gesagt, dass dieser Wolf sich in der Nacht zuvor den Bauch vollgeschlagen hatte. Dennoch hatte ihn etwas aufgeschreckt. Ganz schwach kam zu diesem Gesetzlosen der Wildnis das Aufregendste, was es für die Bewohner des Waldes gab – der Geruch von Menschen. Er kam den Bergrücken hinunter mit der langsamen Gleichgültigkeit eines satten Tieres und mit nur der Hälfte seiner alten Gerissenheit; er trottete über den weich gewordenen Schnee einer Lichtung und blieb stehen, wo der Menschengeruch so stark war, dass er den Kopf gerade in den Himmel hob und an seine Kameraden im Wald und auf der Ebene das Warnsignal aussandte, dass er eine menschliche Spur entdeckt hatte. Ein Wolf wird dies tun, und nicht mehr, am helllichten Tag. Nachts könnte er folgen, und andere würden sich ihm bei der Jagd anschließen; aber bei Tageslicht gibt er die Warnung und schleicht sich dann ein wenig von der Spur weg.
Aber irgendetwas hielt diesen Wolf zurück. Ein Geheimnis lag in der Luft, das ihn verwirrte. Geradeaus verlief die breite, glatte Spur eines Schlittens und die Fußabdrücke vieler Hunde. Irgendwann innerhalb der letzten Stunde war die „Hundepost“ von Wabinosh House auf ihrem langen Weg in die Zivilisation hier vorbeigekommen. Aber es war nicht der schnelle Durchzug von Mensch und Hund, der den Wolf in starrer Alarmbereitschaft hielt, bereit zur Flucht – und doch zögernd. Es war etwas aus der entgegengesetzten Richtung, aus dem Norden, aus der der Wind kam. Zuerst war es ein Geräusch, dann ein Geruch – dann beides, und der Wolf rannte in schnellem Flug den sonnenbeschienenen Bergrücken hinauf.
In der Richtung, aus der der Alarm kam, erstreckte sich ein kleiner See, und an seinem anderen Ende, eine Viertelmeile entfernt, schoss plötzlich ein Gewirr aus Hunden, Schlitten und Menschen aus dem dichten Balsamwald. Für einige Augenblicke schien die Masse der Tiere in eine Art Wrack verwickelt zu sein oder in einen dieser heftigen Kämpfe verwickelt zu sein, in die die halbwilden Schlittenhunde des Nordens häufig verwickelt sind, selbst auf dem Trail. Dann ertönten die scharfen, befehlenden Rufe einer menschlichen Stimme, das Knallen einer Peitsche, das Jaulen der Huskys, und das ungeordnete Gespann richtete sich auf und kam wie ein gelblich-grauer Streifen über die glatte Oberfläche des Sees. Neben dem Schlitten lief der Mann. Er war groß und dünn, und selbst aus dieser Entfernung hätte man ihn als Indianer erkannt. Kaum hatten das Gespann und sein wild aussehender Fahrer ein Viertel der Strecke über den See zurückgelegt, als weiter hinten ein Schrei ertönte und ein zweiter Schlitten aus dem dichten Wald auftauchte. Auch neben diesem Schlitten rannte ein Fahrer mit verzweifelter Geschwindigkeit.
Der Mächtige dieser Welt sprang nun auf seinen Schlitten, seine Stimme erhob sich in scharfen Ermahnungsrufen, seine Peitsche wirbelte und knallte über den Rücken seiner Hunde. Der zweite Fahrer lief immer noch und holte so das vorausfahrende Gespann ein, sodass die zwölf Hunde der beiden Gespanne fast auf gleicher Höhe waren, als sie auf der gegenüberliegenden Seite des Sees ankamen, wo der Wolf den Warnruf an seine Leute ausgesandt hatte.
Schnell ließ der führende Hund jedes Teams in seinem Tempo nach und eine halbe Minute später blieben die Schlitten stehen. Die Hunde warfen sich keuchend und mit klaffenden Kiefern in ihre Geschirre, und der Schnee unter ihren blutenden Füßen färbte sich rot. Auch die Männer zeigten Anzeichen schrecklicher Anstrengung. Der Ältere von ihnen war, wie gesagt, ein Indianer, ein reinrassiges Tier aus der großen Wildnis des Nordens. Sein Begleiter war ein junger Mann, der noch nicht zwanzig war, schlank, aber mit der Kraft und Beweglichkeit eines Tieres in seinen Gliedern, sein hübsches Gesicht gebräunt vom freien Leben im Wald, und in seinen Adern reichlich von dem Blut, das seinen Kameraden zu Verwandten machte.
In diesen beiden haben wir wieder unsere alten Freunde Mukoki und Wabigoon getroffen: Mukoki, der treue alte Krieger und Pfadfinder, und Wabigoon, der abenteuerlustige halbindianische Sohn des Faktors von Wabinosh House. Beide befanden sich auf dem Höhepunkt einer großen Aufregung. Für einige Momente, während sie verschnauften, blickten sie sich schweigend ins Gesicht.
„Ich fürchte, wir können sie nicht einholen, Muky“, keuchte der Jüngere. „Was meinst du ...“
Er hielt inne, denn Mukoki war ein paar Meter vor den Gespannen auf die Knie in den Schnee gefallen. Von diesem Punkt an verlief direkt vor ihnen die Spur der Hundepost. Etwa eine Minute lang untersuchte er die Abdrücke der Hundepfoten und die glatte Spur, die der Schlitten hinterlassen hatte. Dann blickte er auf und sagte mit einem dieser unnachahmlichen Kichern, das so viel bedeutete, wenn es von ihm kam:
„Wir fangen sie ein – sicher! Siehst du – Schlitten fahren tief. Beide fahren. Große Last für Hunde. Wir fangen sie ein – sicher!“
„Aber unsere Hunde!“, beharrte Wabigoon, dessen Gesicht immer noch voller Zweifel war. „Sie sind völlig erschöpft und mein Mächtiger dieser Welt lahmt. Sieh nur, wie sie bluten!“
Die Huskies, wie die großen wolfsähnlichen Schlittenhunde des hohen Nordens genannt werden, waren tatsächlich in einem bedauernswerten Zustand. Die warme Sonne hatte die harte Schneedecke aufgeweicht, sodass die Tiere bei jedem Sprung mit den Pfoten durchbrachen und sich an den scharfen, messerartigen Kanten verletzten. Mukokis Miene wurde ernster, als er die Teams sorgfältig untersuchte.
„Schlecht – sehr schlecht“, grunzte er. „Wir Narren – Narren!“
„Weil wir keine Hundeschuhe mitgebracht haben?“, sagte Wabigoon. „Ich habe ein Dutzend Schuhe auf meinem Schlitten – genug für drei Hunde. Bei George ...“ Er sprang schnell zu seinem Schlitten, holte die Hundemokassins und wandte sich wieder dem alten Indianer zu, der vor neuer Aufregung nur so sprühte. „Wir haben nur eine Chance, Muky!“, rief er halb.
„Such die stärksten Hunde aus. Einer von uns muss allein weitergehen!“
Die scharfen Befehle der beiden Abenteurer und das Knallen von Mukokis Peitsche brachten die müden und blutenden Tiere auf die Beine. Über die Ballen von drei der größten und stärksten wurden die Mokassins aus Wildleder gezogen, und zu diesen drei, die an Wabigoons Schlitten gespannt waren, kamen sechs weitere hinzu, die anscheinend noch ein wenig Ausdauer übrig hatten. Wenige Augenblicke später raste die lange Reihe der Hunde schnell über den Pfad der Hudson-Bay-Post, und neben dem Schlitten lief Wabigoon.
So ging diese aufregende Verfolgung der Hundepost seit dem frühen Morgengrauen weiter. Denn es gab nie mehr als ein oder zwei Minuten Pause am Stück. Über Berge und Seen, durch dichte Wälder und über karge Ebenen jagten Mensch und Hund ohne Essen und Trinken und schnappten sich hier und da einen Bissen Schnee – immer mit den Augen auf der frischen Spur der fliegenden Post. Selbst die wilden Huskies schienen zu verstehen, dass es bei der Jagd um Leben und Tod ging und dass sie der Spur vor ihnen folgen mussten, unermüdlich und ohne Abweichung, bis das Ende ihrer Herren erreicht war. Der menschliche Geruch wurde in ihren wolfsähnlichen Nasenlöchern immer stärker. Irgendwo auf dieser Spur waren Menschen und andere Hunde, und sie mussten sie einholen!
Selbst jetzt, blutend und stolpernd, während sie rannten, war das Blut der Schlacht, die Aufregung der Jagd, heiß in ihnen. Halb Wolf, halb Hund, ihre weißen Fangzähne fletschten sich, als stärkere Gerüche des Menschen zu ihnen kamen, waren sie erfüllt von der wilden Verzweiflung der Jugend, die sie antrieb. Der scharfe Instinkt der Wildnis wies ihnen den Weg, und sie brauchten keine führende Hand. Bis zuletzt schleppten sie ihre Last, ihre Zungen hingen immer weiter aus ihren Kiefern heraus, ihre Herzen wurden schwächer, ihre Augen blutunterlaufen, bis sie wie rote Kugeln glühten. Und dann, wenn er so lange gerannt war, bis seine Ausdauer erschöpft war, warf sich Wabigoon auf den Schlitten, um wieder zu Atem zu kommen und seine Glieder auszuruhen, und die Hunde zogen stärker, wobei sie ihr Tempo unter dem erhöhten Gewicht kaum verlangsamten. Einmal stürmte ein riesiger Elch hundert Schritte entfernt durch den Wald, aber die Huskys beachteten ihn nicht; ein Stück weiter rollte ein Luchs, der von seinem Sonnenbad auf einem Felsen aufgeschreckt wurde, wie ein großer grauer Ball über den Weg – die Hunde zuckten nur einen Augenblick lang zusammen, als sie ihren Todfeind sahen, und zogen dann weiter.
Das Tempo wurde immer langsamer. Der hinterste Hund war nur noch eine Last und als Wabi ein scharfes Messer weit über das Ende des Schlittens hinausstreckte, durchtrennte er seinen Brustriemen und das erschöpfte Tier rollte sich neben dem Pfad frei. Zwei andere Hunde des Gespanns zogen kaum ein Pfund, ein anderer lief lahm und der Pfad hinter ihnen war mit Blutflecken übersät. Jede Minute steigerte die Verzweiflung, die sich im Gesicht des jungen Mannes ausbreitete. Seine Augen waren, wie die seiner treuen Hunde, rot von der schrecklichen Anstrengung des Rennens, seine Lippen waren geöffnet, seine Beine, so unermüdlich wie die eines Rotwildes, wurden unter ihm schwach. Immer häufiger warf er sich keuchend auf den Schlitten, und die Laufintervalle zwischen diesen Ruhephasen wurden immer kürzer. Das Ende der Verfolgungsjagd war fast erreicht. Sie konnten die Hudson Bay-Post nicht einholen!
Mit einem letzten Schrei der Ermutigung sprang Wabi vom Schlitten und stürzte sich an die Spitze der Hunde, um sie zu einem letzten, verzweifelten Kraftakt anzutreiben. Vor ihnen lag eine Lücke im Waldpfad, und dahinter erstreckte sich Meile um Meile die weite, weiße Fläche des Nipigon-Sees. Und weit draußen, im grellen Licht von Sonne und Schnee, bewegte sich ein Objekt, etwas, das für Wabis geblendete Augen nicht mehr als ein dünner schwarzer Strich war, von dem er jedoch wusste, dass es die Hundepost auf ihrem Weg zur Zivilisation war. Er versuchte zu rufen, doch der Laut, der über seine Lippen kam, hätte nicht einmal hundert Schritte weit gehört werden können; seine Glieder wankten unter ihm; seine Füße schienen plötzlich zu Blei zu werden, und er sank hilflos in den Schnee. Das treue Gespann drängte sich um ihn, leckte sein Gesicht und seine Hände, ihr heißer Atem entwich zwischen ihren weit geöffneten Kiefern wie zischender Dampf. Für einen Augenblick schien es dem jungen Indianer, als hätte sich der Tag plötzlich in Nacht verwandelt. Seine Augen schlossen sich, das Hecheln der Hunde drang immer schwächer an sein Ohr, als würden sie sich entfernen; er fühlte, wie er sank, langsam und unaufhaltsam hinab in völlige Dunkelheit.
Verzweifelt kämpfte er darum, wieder ins Leben zurückzukehren. Es gab noch eine Chance – nur eine! Er hörte die Hunde wieder, er spürte ihre Zungen an seinen Händen und im Gesicht, und er schleppte sich auf die Knie und tastete mit den Händen wie ein Blinder. Ein paar Meter weiter stand der Schlitten, und dort draußen, weit außerhalb seiner Sichtweite, befand sich die Post von Hudson Bay!
Fuß für Fuß zog er sich aus dem Gewirr der Hunde heraus. Er erreichte den Schlitten und seine Finger griffen krampfhaft nach dem kalten Stahl seines Gewehrs. Noch eine Chance! Noch eine Chance! Die Worte – der Gedanke – erfüllten sein Gehirn, und er hob das Gewehr an seine Schulter und richtete die Mündung zum Himmel, damit er den Hunden nichts antun würde. Und dann, einmal, zweimal, fünfmal schoss er in die Luft, und am Ende des fünften Schusses zog er frische Patronen aus seinem Gürtel und schoss wieder und wieder, bis der schwarze Streifen weit draußen in der Wildnis aus Eis und Schnee in seinem Vorwärtskommen stoppte – und umkehrte. Und immer noch ertönten die scharfen Signale wieder und wieder, bis der Lauf von Wabis Gewehr heiß wurde und sein Patronengürtel leer war.
Langsam lichtete sich die Dunkelheit vor seinen Augen. Er hörte einen Schrei, stand taumelnd auf, streckte die Arme aus und rief einen Namen, als die Hunde mit der Post etwa 50 Meter vor seinem eigenen Gespann anhielten.
Mit einem Schrei, der zwischen einem Freudenschrei und einem Schrei des Erstaunens lag, sprang ein Jugendlicher in Wabis Alter aus dem zweiten Schlitten und rannte zu dem Indianerjungen, der ihn in die Arme nahm, als er zum zweiten Mal ohnmächtig im Schnee zusammensackte.
„Wabi – was ist los?“, rief er. „Bist du verletzt? Bist du ...?“
Einen Augenblick lang kämpfte Wabigoon gegen seine Schwäche an.
„Rod...“, flüsterte er, „Rod... Minnetaki...“
Seine Lippen bewegten sich nicht mehr und er sank schwer in die Arme seines Begleiters.
„Was ist los, Wabi? Schnell! Sprich!“, drängte der andere. Sein Gesicht war seltsam blass geworden, seine Stimme zitterte. „Was ist mit – Minnetaki?“
Wieder rang der junge Indianer darum, sich ins Leben zurückzuholen. Seine Worte kamen schwach:
„Minnetaki – wurde gefangen genommen – von – den – Woongas!“
Dann schien sogar sein Atem anzuhalten und er lag wie tot da.
KAPITEL II MINNETAKI IN DEN HÄNDEN DER GESETZLOSEN
Inhaltsverzeichnis
Für kurze Zeit glaubte Roderick, dass das Leben tatsächlich aus dem Körper seines jungen Freundes gewichen war. Wabi lag immer noch da und die seltsame Blässe in seinem Gesicht war so furchterregend, dass der weiße Junge seinen Kameraden mit erstickter Stimme um Hilfe bat. Der Fahrer der Hundepost ließ sich neben den beiden jungen Jägern auf die Knie fallen. Er fuhr mit der Hand unter Wabis dickes Hemd, hielt sie einen Augenblick dort und sagte: „Er lebt!“
Schnell zog er eine kleine Metallflasche aus einer seiner Taschen, schraubte den Verschluss auf und drückte dem jungen Indianer das Mundstück an die Lippen, um ihm etwas von dem Inhalt in den Rachen zu zwingen. Der Alkohol zeigte fast sofort Wirkung, und Wabigoon öffnete die Augen, blickte in das raue Gesicht des Kuriers und schloss sie dann wieder. Erleichterung spiegelte sich im Gesicht des Kuriers, als er auf die Hunde von Wabinosh House zeigte. Die erschöpften Tiere lagen ausgestreckt auf dem Schnee, die Köpfe zwischen den Vorderpfoten hängend. Selbst die Anwesenheit eines rivalisierenden Teams konnte sie nicht aus ihrer Lethargie reißen. Man könnte meinen, der Tod hätte sie auf dem Weg ereilt, wären da nicht ihre hechelnden Seiten und heraushängenden Zungen gewesen.
„Er ist nicht verletzt!“, rief der Fahrer aus. „Seht euch die Hunde an! Er ist gerannt – gerannt, bis er auf der Strecke liegen blieb!“
Diese Gewissheit spendete Rod nur wenig Trost. Er konnte spüren, wie das Leben in Wabis Körper zurückkehrte, aber der Anblick der erschöpften und blutenden Hunde und die Erinnerung an die letzten Worte seines Kameraden hatten ihn mit einer neuen und schrecklichen Angst erfüllt. Was war mit Minnetaki geschehen? Warum war der Sohn des Faktors den ganzen Weg für ihn gekommen? Warum hatte er die Post verfolgt, bis seine Hunde fast tot waren und er selbst auf der Strecke das Bewusstsein verloren hatte? War Minnetaki tot? Hatten die Woongas Wabis schöne kleine Schwester getötet?
Wieder und wieder flehte er seinen Freund an, mit ihm zu sprechen, bis der Kurier ihn zurückstieß und Wabi zum Postschlitten trug.
„Beeil dich und geh zu der Gruppe von Fichten und mach ein Feuer“, befahl er. „Wir müssen etwas Heißes in ihn hineinbekommen, ihn abreiben und in Pelze wickeln. Das ist schlimm genug, schlimm genug!“
Rod wartete, bis er nichts mehr hörte, lief aber zu dem Fichtenbusch, zu dem der Kurier ihn geschickt hatte. Zwischen den Fichten fand er eine Reihe von Birken, und nachdem er einen Arm voll Rinde abgezogen hatte, loderte ein Feuer auf dem Schnee, als der Hund mit seiner bewusstlosen Last ankam. Während der Fahrer Wabis Kleidung lockerte und ihn in schwere Bärenfelle wickelte, legte Rod trockene Äste nach, bis das Feuer einen warmen Schein in einem Umkreis von etwa zwölf Schritten verbreitete. Innerhalb weniger Minuten schmolz ein Topf mit Eis und Schnee über den Flammen und der Kurier öffnete eine Dose Kondenssuppe.
Die tödliche Blässe war aus Wabis Gesicht gewichen, und Rod, der dicht neben ihm kniete, war erfreut zu sehen, dass der Atem immer regelmäßiger zwischen seinen Lippen hervorkam. Doch während er sich freute, wuchs die andere Angst in seinem Herzen. Was war mit Minnetaki geschehen? Er stellte sich die Frage wieder und wieder, während er zusah, wie Wabi langsam wieder zum Leben erwachte, und so schnell, dass es in ein oder zwei Minuten vergangen war, schoss ihm eine Vision von allem, was in den letzten Monaten geschehen war, durch den Kopf. Für einige Augenblicke, während seine Gedanken zurückreisten, war er wieder in Detroit bei seiner verwitweten Mutter; er dachte an den Tag, an dem er Wabigoon, den Sohn eines englischen Faktors und einer schönen indischen Prinzessin, zum ersten Mal getroffen hatte, der weit in die Zivilisation hinabgekommen war, um sich weiterzubilden; an die Freundschaft, die darauf folgte, an ihre gemeinsamen Wochen und Monate in der Schule und dann an jene freudigen Tage und Nächte, in denen sie einen Winter voller aufregender Abenteuer in Wabis Heimat im hohen Norden.
Und was für Abenteuer es gegeben hatte, als er, Wabi und Mukoki als Wolfsjäger den Gefahren der gefrorenen Einsamkeit getrotzt hatten! Als Wabigoons Atem immer regelmäßiger wurde, dachte er an diese wunderbare Kanufahrt vom letzten Stück Zivilisation hinauf in die Wildnis; an seinen ersten Anblick eines Elchs, den ersten Bären, den er getötet hatte, und an seine Begegnung mit Minnetaki.
Seine Augen verschwammen und sein Herz wurde kalt, als er daran dachte, was ihr zugestoßen sein könnte. Eine Vision des Mädchens schob sich zwischen ihn und Wabis Gesicht, in der das Leuchten des Lebens immer wärmer wurde, eine Vision des kleinen halbindianischen Mädchens, wie er sie zum ersten Mal gesehen hatte, als sie ihnen in ihrem Kanu von Wabinosh House entgegenkam, die Sonne auf ihrem dunklen Haar schien, ihre Wangen vor Aufregung gerötet waren, ihre Augen und Zähne vor Freude über das Wiedersehen mit ihrem geliebten Bruder und dem weißen Jüngling, von dem sie so viel gehört hatte, funkelten – dem Junge aus der Zivilisation – Roderick Drew. Er erinnerte sich daran, wie seine Mütze ins Wasser geweht worden war und sie sie für ihn gerettet hatte. Blitzartig tauchten vor ihm all die Ereignisse auf, die danach passiert waren: die Tage, an denen er und Minnetaki gemeinsam durch den Wald gestreift waren, die wütende Schlacht, in der er sie im Alleingang vor den wilden, gesetzlosen Indianern des Nordens, den Woongas, gerettet hatte; und danach dachte er an die Wochen voller aufregender Abenteuer, die sie drei – Mukoki, Wabigoon und er – in der Wildnis weit weg von der Postzustellung in Hudson Bay verbracht hatten, an ihre Monate des Fallenstellens, ihren verzweifelten Krieg mit den Woongas, die Entdeckung der jahrhundertealten Hütte und ihrer uralten Skelette und das Auffinden der Birkenrinden-Karte zwischen den Fingerknochen eines der Skelette, auf der, vom Alter verblasst, der Weg in ein Land des Goldes eingezeichnet war.
Instinktiv, als diese Karte für einen Augenblick in sein geistiges Bild kam, steckte er eine Hand in eine seiner Innentaschen, um zu fühlen, dass seine eigene Kopie dieser Karte dort war, die Karte, die ihn einige Wochen später in diese Wildnis zurückbringen sollte, wenn sie drei sich auf die romantische Suche nach dem Gold machen würden, zu dem die Skelette in der alten Hütte ihnen den Schlüssel gegeben hatten.
Die Vision verließ ihn, als er sah, wie ein krampfhafter Schauer durch Wabigoon fuhr. Einen Augenblick später hatte der junge Indianer die Augen geöffnet und als er in Rods erwartungsvolles Gesicht blickte, lächelte er schwach. Er versuchte zu sprechen, aber die Worte fehlten ihm und seine Augen schlossen sich wieder. Roderick hatte einen Ausdruck des Schreckens im Gesicht, als er sich dem Kurier zuwandte, der an seine Seite trat. Weniger als vierundzwanzig Stunden zuvor hatte er Wabigoon in der vollen Kraft seiner prächtigen Jugend in Wabinosh House verlassen, ein geschmeidiger junger Riese, abgehärtet durch ihre monatelangen Abenteuer, zitternd vor lebhafter Lebensfreude, voller Vorfreude auf den Frühling, dass sie sich wieder treffen könnten, um eine weitere Spur in den unerforschten Norden zu verfolgen.
Und nun, was für eine Veränderung! Der flüchtige Blick, den er auf Wabis blutunterlaufene Augen erhascht hatte, das schrecklich magere Gesicht des jungen Indianers, die eisige Leblosigkeit seiner Hände ließen ihn vor Furcht erschauern. War es möglich, dass nur wenige Stunden diese bemerkenswerte Veränderung bewirken konnten? Und wo war Mukoki, der treue alte Krieger, dessen Obhut Wabigoon und Minnetaki nur selten entkommen durften?
Es schien eine Stunde zu dauern, bis Wabi wieder die Augen öffnete, und doch waren es nur ein paar Minuten. Diesmal hob Rod ihn sanft in seine Arme und der Kurier hielt ihm eine Tasse mit heißer Suppe an die Lippen. Die Wärme der Flüssigkeit erfüllte den ausgehungerten jungen Indianer mit neuem Leben. Zuerst trank er langsam, dann gierig, und als er die Tasse ausgetrunken hatte, bemühte er sich, sich aufzusetzen.
„Ich nehme noch einen“, sagte er schwach. „Die ist wirklich gut!“
Er trank den zweiten Becher mit noch größerer Begeisterung. Dann setzte er sich kerzengerade hin, streckte die Arme aus und schwankte mit der Hilfe seines Begleiters auf die Beine. Seine blutunterlaufenen Augen brannten vor seltsamer Aufregung, als er Rod ansah.
„Ich hatte Angst, dich nicht zu erwischen!“
„Was ist los, Wabi? Was ist passiert? Du sagst – Minnetaki –“
„Wurde von den Woongas gefangen genommen. Häuptling Woonga selbst ist ihr Entführer, und sie bringen sie in den Norden. Rod, nur du kannst sie retten!“
„Nur ich kann sie retten?“ keuchte Rod langsam. „Was meinst du damit?“
"Hör zu!", rief der Indianerjunge und packte ihn am Arm. "Du erinnerst dich doch, dass wir nach unserem Kampf mit den Woongas und unserer Flucht aus der Schlucht nach Süden geflohen sind und dass du am nächsten Tag, als du nicht im Lager warst, um nach einem Tier zu suchen, das uns Fett für Mukokis Wunde geben würde, eine Spur entdeckt hast. Du hast uns erzählt, dass du den Schlittenspuren gefolgt bist und dass die Gruppe nach einiger Zeit von anderen auf Schneeschuhen getroffen wurde und dass unter den Abdrücken im Schnee einer war, der dich an Minnetaki erinnerte. Als wir die Postzustellung erreichten, erfuhren wir, dass Minnetaki und zwei Schlitten zum Kenegami-Haus gegangen waren, und kamen sofort zu dem Schluss, dass diese Schneeschuhspuren von den Kenegami stammten, die ausgesandt worden waren, um sie zu treffen. Aber das waren sie nicht! Sie stammten von Woongas!
„Einer der Führer, der mit einer schweren Wunde entkommen ist, hat uns gestern Abend die Nachricht überbracht, und der Arzt bei der Postzustellung sagt, dass seine Verletzung tödlich ist und dass er keinen weiteren Tag überleben wird. Alles hängt von dir ab. Du und der sterbende Führer seid die einzigen, die wissen, wo der Ort des Angriffs zu finden ist. Es taut seit zwei Tagen und der Pfad könnte verwischt sein. Aber du hast Minnetakis Fußspuren gesehen. Du hast die Schneeschuhspuren gesehen. Du – und nur du – weißt, in welche Richtung sie gegangen sind!“
Wabi sprach schnell und aufgeregt und ließ sich dann, von der Anstrengung geschwächt, auf den Schlitten sinken.
„Wir haben dich seit dem Morgengrauen mit zwei Teams verfolgt“, fügte er hinzu, „und dabei fast die Hunde umgebracht. Als letzte Chance haben wir die Teams verdoppelt und ich bin allein weitergefahren. Ich habe Mukoki ein Dutzend Meilen hinter mir gelassen.“
Rod wurde es eiskalt bei dem Gedanken, dass Minnetaki in den Klauen von Woonga selbst war. Die schreckliche Veränderung in Wabi war kein Rätsel mehr. Sowohl Minnetaki als auch ihr Bruder hatten ihm mehr als einmal von der unerbittlichen Fehde erzählt, die dieser blutrünstige Wilde gegen das Wabinosh-Haus führte, und im letzten Winter war er persönlich damit in Kontakt gekommen. Er hatte gekämpft, hatte Menschen sterben sehen und war fast selbst Opfer von Woongas Rache geworden.
Aber an all das dachte er jetzt nicht. Er dachte an den Grund für die Fehde, und etwas stieg in seiner Kehle auf und würgte ihn, bis er sich nicht mehr bemühte zu sprechen. Viele Jahre zuvor war George Newsome, ein junger Engländer, nach Wabinosh House gekommen und hatte dort eine schöne Indianerprinzessin kennengelernt und sich in sie verliebt. Sie erwiderte seine Liebe und wurde seine Frau. Woonga, der Häuptling eines kriegerischen Stammes, war sein Rivale gewesen, und als der weiße Mann den Kampf um die Liebe gewann, flammte in seinem wilden Herzen das Feuer des Hasses und der Rache auf. Von diesem Tag an begann der unerbittliche Kampf gegen das Volk von Wabinosh House. Die Anhänger Woongas wurden von Fallenstellern und Jägern zu Mördern und Gesetzlosen und wurden in der gesamten Wildnis als die Woongas bekannt. Jahrelang dauerte die Fehde an. Wie ein Falke lauerte Woonga auf seine Gelegenheiten, tötete hier, raubte dort und wartete immer auf eine Gelegenheit, dem Faktor seine Frau oder seine Kinder zu rauben. Nur wenige Wochen zuvor hatte Rod Minnetaki in diesem schrecklichen Kampf im Wald gerettet. Und nun war sie hoffnungsloser als zuvor in die Fänge ihrer Feinde geraten und wurde allein mit Woonga in das Land im hohen Norden getragen, in diese weiten, unerforschten Regionen, aus denen sie wahrscheinlich nie zurückkehren würde!
Rod wandte sich mit geballten Fäusten und funkelnden Augen an Wabi.
„Ich kann die Spur finden, Wabi! Ich kann die Spur finden – und wir werden ihr bis zum Nordpol folgen, wenn es sein muss! Wir haben die Woongas in der Schlucht besiegt – wir werden sie auch jetzt besiegen! Wir werden Minnetaki finden, und wenn es bis zum Jüngsten Tag dauert!“
Von weit hinten im Wald ertönten die schwachen, pistolenartigen Knalle einer Peitsche und das ferne Rufen einer Stimme.
Für einige Augenblicke lauschten die drei.
Die Stimme kam wieder.
„Das ist Mukoki“, sagte Wabigoon, „Mukoki und die anderen Hunde!“