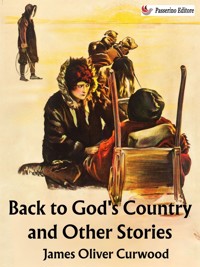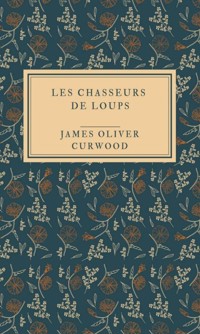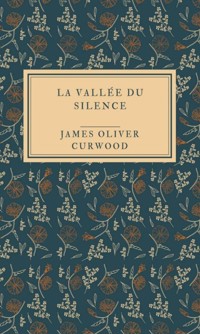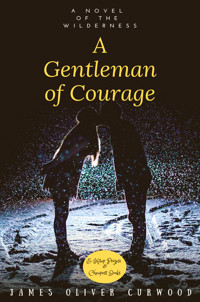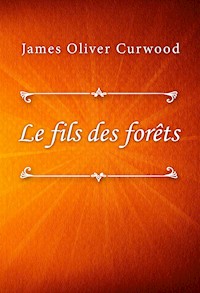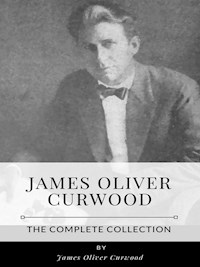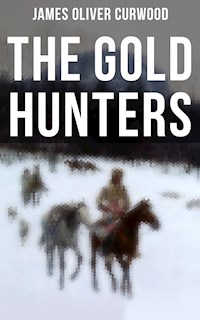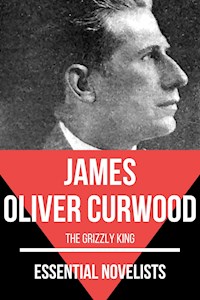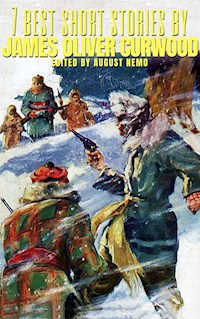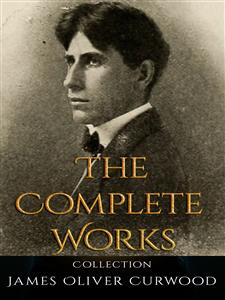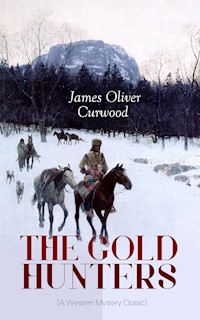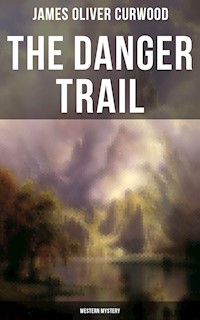0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In "Die Wolfsjäger" entführt James Oliver Curwood die Leser in die raue Landschaft Kanadas, wo sich die dramatische Konfrontation zwischen Mensch und Natur entfaltet. Der Roman schildert das leidenschaftliche Streben des Protagonisten, die Schöne und die Wildnis zu schützen, während er gleichzeitig mit der Menschheit und ihren destruktiven Impulsen konfrontiert wird. Curwoods ausgefeilter, bildgewaltiger Stil umfasst sowohl poetische Beschreibungen der Natur als auch tiefgreifende psychologische Einblicke in die Charaktere, was dem Werk eine besondere emotionale Tiefe verleiht. Die Erzählung thematisiert nicht nur die Jagd und den Artenverlust, sondern zugleich auch die ethischen Fragen, die mit der Eroberung der Wildnis verbunden sind. James Oliver Curwood, ein passionierter Naturfreund und engagierter Umweltschützer, wurde durch seine intensiven Erfahrungen in der Wildnis und seine Reisen in Kanada geprägt. Diese Erlebnisse beeinflussten seine literarischen Arbeiten und führten dazu, dass er die Herausforderungen der Wildnis und die Beziehung zwischen Mensch und Tier in den Mittelpunkt seiner Geschichten stellte. Durch sein Werk sensibilisierte er die Leser für den Wert der Natur und den dringenden Schutz der bedrohten Arten. "Die Wolfsjäger" ist ein zeitloses Werk, das nicht nur den Leser fesseln wird, sondern auch zum Nachdenken über unsere Verantwortung gegenüber der Natur anregt. Curwoods meisterhafte Erzählkunst und seine tiefen Einsichten in die Wildnis machen dieses Buch zu einer unverzichtbaren Lektüre für alle, die sich für Umweltschutz und den Kampf um die Erhaltung der Artenvielfalt interessieren. Lassen Sie sich von dieser fesselnden Geschichte mitreißen und erleben Sie die ungebändige Kraft der Natur! Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Wolfsjäger
Inhaltsverzeichnis
Meinen Kameraden in der großen Wildnis des Nordens, diesen treuen Gefährten, mit denen ich die Freuden und Mühen des „langen, stillen Pfades“ geteilt habe, und insbesondere Mukoki, meinem roten Führer und geliebten Freund, widmet der Autor diesen Band in Dankbarkeit.
KAPITEL I DER KAMPF IM WALD
Inhaltsverzeichnis
Tief lag der kalte Winter über der kanadischen Wildnis. Darüber ging der Mond auf, wie eine rote pulsierende Kugel, die die weite weiße Stille der Nacht in einem schimmernden Glanz erleuchtete. Kein Laut durchbrach die Stille der Ödnis. Es war zu spät für das Leben am Tag, zu früh für die nächtlichen Streifzüge und Stimmen der Geschöpfe der Nacht. Wie das Becken eines großen Amphitheaters lag der zugefrorene See im Licht des Mondes und einer Milliarde Sterne offen da. Dahinter erhob sich der Fichtenwald, schwarz und bedrohlich. An seinen näheren Rändern standen stille Tamarack-Wände, gebeugt unter der erdrückenden Umklammerung von Schnee und Eis, eingeschlossen von undurchdringlicher Finsternis.
Eine riesige weiße Eule huschte aus diesem Rand der Schwärze heraus und dann wieder zurück, und ihr erster zitternder Schrei ertönte leise, als ob die mystische Stunde der Stille für das Nachtvolk noch nicht vorüber wäre. Der Schnee des Tages hatte aufgehört, kaum ein Luftzug bewegte die eisbedeckten Zweige der Bäume. Dennoch war es bitterkalt – so kalt, dass ein Mensch, der bewegungslos verharrte, innerhalb einer Stunde erfroren wäre.
Plötzlich wurde die Stille durchbrochen, ein seltsames, aufregendes Geräusch, wie ein Seufzer, aber nicht menschlich – ein Geräusch, das das Blut in Wallung bringt und die Finger am Gewehrschaft zucken lässt. Es kam aus der Dunkelheit der Tamarackbäume. Danach herrschte eine noch tiefere Stille als zuvor, und die Eule schwebte wie eine lautlose Schneeflocke über den zugefrorenen See. Nach einigen Augenblicken kam sie wieder, leiser als zuvor. Ein Kenner der Waldkunst wäre tiefer in den Rand der Dunkelheit geschlichen, hätte gelauscht, sich gewundert und beobachtet; denn in dem Geräusch hätte er den wilden, halb besiegten Ton des Leidens und der Qual eines verwundeten Tieres erkannt.
Langsam, mit aller Vorsicht, die aus den Erfahrungen dieses Tages geboren wurde, schritt ein riesiger Elchbulle in den Schein des Mondes hinaus. Sein prächtiger Kopf, der unter dem Gewicht des massiven Geweihs nach unten hing, war neugierig über den See nach Norden gerichtet. Seine Nasenlöcher waren geweitet, seine Augen funkelten, und er hinterließ eine Blutspur. Eine halbe Meile entfernt erreichte er den Rand des Fichtenwaldes. Dort sagte ihm etwas, dass er dort in Sicherheit sein würde. Ein Jäger hätte gewusst, dass er tödlich verwundet war, als er sich in den fußhohen Schnee des Sees schleppte.
Ein Dutzend Ruten von den Tamaracken entfernt blieb er stehen, den Kopf hoch erhoben, die langen Ohren nach vorne gerichtet und die Nasenlöcher halb zum Himmel gerichtet. In dieser Haltung lauscht ein Elch, wenn er eine Forelle in einer Entfernung von einer Dreiviertelmeile platschen hört. Jetzt herrschte nur noch die unendliche Stille, die nur durch den klagenden Schrei der Schnee-Eule auf der anderen Seite des Sees unterbrochen wurde. Das große Tier stand unbeweglich da, und unter seinen Vorderbeinen bildete sich eine kleine Blutlache auf dem Schnee. Was war das Geheimnis, das in der Dunkelheit des Waldes lauerte? War es Gefahr? Das schärfste menschliche Gehör hätte nichts wahrgenommen. Doch in den langen, schlanken Ohren des Elchbullen, die schräg über die schweren Platten seiner Hörner hinausragten, war ein Geräusch zu hören. Das Tier hob seinen Kopf noch höher zum Himmel, schnupperte nach Osten, nach Westen und zurück zu den Schatten der Tamaracks. Aber es war der Norden, der ihn festhielt.
Von jenseits dieser Fichtenbarriere kam bald ein Geräusch, das ein Mensch hätte hören können – weder der Anfang noch das Ende eines Wehklagens, aber so etwas in der Art. Von Minute zu Minute wurde es deutlicher, mal lauter, mal fast verhallend, aber jeden Augenblick näher kommend – der ferne Jagdschrei des Wolfsrudels! Was die Schlinge des Henkers für den Mörder ist, was die auf ihn gerichteten Gewehre für den verurteilten Spion sind, das ist der Jagdschrei der Wölfe für das verwundete Tier der Wälder.
Der Instinkt hat dies dem alten Bullen beigebracht. Er ließ den Kopf hängen, sein riesiges Geweih richtete sich auf und er trottete langsam in Richtung Osten. Er ging das Risiko ein, das offene Gelände zu durchqueren, aber für ihn war der Fichtenwald die Heimat, und dort könnte er Zuflucht finden. In seinem animalischen Gehirn rechnete er sich aus, dass er dort ankommen könnte, bevor die Wölfe aus der Deckung kamen. Und dann –
Wieder blieb er stehen, so plötzlich, dass seine Vorderbeine unter ihm nachgaben und er in den Schnee fiel. Diesmal ertönte aus der Richtung des Wolfsrudels der schallende Bericht eines Gewehrs! Es könnte eine oder zwei Meilen entfernt gewesen sein, aber die Entfernung minderte nicht die Angst, die es dem sterbenden König des Nordens einjagte. An diesem Tag hatte er dasselbe Geräusch gehört, und es hatte geheimnisvolle und schwächende Schmerzen in seinen Eingeweiden verursacht. Mit äußerster Anstrengung richtete er sich auf, schnupperte noch einmal nach Norden, Osten und Westen, wandte sich dann ab und vergrub sich in der schwarzen und gefrorenen Wildnis der Tamarack-Wälder.
Mit dem Klang des Gewehrschusses kehrte wieder Stille ein. Es könnte fünf oder zehn Minuten gedauert haben, als ein langes, einsames Heulen über den See wehte. Es endete mit dem scharfen, schnellen Jaulen eines Wolfes auf der Fährte und wurde einen Augenblick später von anderen aufgenommen, bis das Rudel wieder in vollem Gebrüll war. Fast gleichzeitig schoss eine Gestalt vom Waldrand auf das Eis. Nach einem Dutzend Schritten hielt sie inne und wandte sich wieder der schwarzen Fichtenwand zu.
„Kommst du, Wabi?“
Eine Stimme antwortete aus dem Wald. „Ja. Beeil dich – lauf!“
So aufgefordert, wandte der andere sein Gesicht wieder dem See zu. Er war ein Jugendlicher von nicht mehr als achtzehn Jahren. In seiner rechten Hand trug er eine Keule. Sein linker Arm war, als wäre er schwer verletzt, in einer Schlinge aus dem schweren Schal eines Holzfällers verbunden. Sein Gesicht war zerkratzt und blutete, und sein ganzes Aussehen zeigte, dass er sich der völligen Erschöpfung näherte. Für einige Momente rannte er durch den Schnee, dann hielt er an und ging taumelnd weiter. Sein Atem kam in schmerzhaften Stößen. Der Schläger entglitt seinen nervösen Fingern, und im Bewusstsein der tödlichen Schwäche, die ihn überkam, versuchte er nicht, ihn wiederzugewinnen. Fuß für Fuß kämpfte er sich weiter, bis ihm plötzlich die Knie unter dem Körper nachgaben und er im Schnee versank.
Vom Rand des Fichtenwaldes lief nun ein junger Indianer auf die Oberfläche des Sees hinaus. Sein Atem ging schnell, aber eher vor Aufregung als vor Erschöpfung. Hinter ihm, weniger als eine halbe Meile entfernt, konnte er den sich schnell nähernden Schrei des Jagdhundes hören, und für einen Augenblick beugte er seinen geschmeidigen Körper dicht über den Schnee und schätzte mit der Schärfe seiner Rasse die Entfernung der Verfolger ab. Dann suchte er nach seinem weißen Gefährten, konnte aber den regungslosen Fleck nicht sehen, der die Stelle markierte, an der der andere gefallen war. Ein Ausdruck der Besorgnis schoss in seine Augen, und er legte sein Gewehr zwischen die Knie, legte die Hände trompetenartig an den Mund und stieß einen Signalruf aus, der in einer stillen Nacht wie dieser eine Meile weit zu hören war.
„Wa-hoo-o-o-o-o-o! Wa-hoo-o-o-o-o-o!“
Bei diesem Schrei richtete sich der erschöpfte Junge im Schnee auf und setzte seinen Weg über den See mit einem Antwortschrei fort, der nur schwach an das Ohr des Indianers drang. Zwei oder drei Minuten später kam Wabi neben ihm zum Stehen.
„Schaffst du es, Rod?“, rief er.
Der andere bemühte sich zu antworten, aber seine Antwort war kaum mehr als ein Keuchen. Bevor Wabi ihm die Hand reichen konnte, um ihn zu stützen, hatte er seine letzte Kraft verloren und war zum zweiten Mal in den Schnee gefallen.
„Ich fürchte, ich kann es nicht, Wabi“, flüsterte er. „Ich bin zu schwach.“
Der junge Indianer ließ sein Gewehr fallen und kniete sich neben den verwundeten Jungen, wobei er seinen Kopf auf seine eigenen bebenden Schultern stützte.
„Es ist nur noch ein kleines Stück, Rod“, drängte er. „Wir können es schaffen und uns an einen Baum lehnen. Wir hätten uns schon dort an einen Baum lehnen sollen, aber ich wusste nicht, dass es dir so schlecht ging; und es gab eine gute Chance, ein Lager aufzuschlagen, mit drei Patronen für den offenen See.“
„Nur drei!“
„Das ist alles, aber ich sollte bei diesem Licht zwei davon nutzen. Hier, halt dich an meinen Schultern fest! Schnell!“
Er verdoppelte sich wie ein Klappmesser vor seinem halb am Boden liegenden Begleiter. Von hinten ertönte plötzlich ein Chor von Wölfen, lauter und deutlicher als zuvor.
„Sie haben die offene Stelle erreicht und wir haben sie in zwei Minuten auf dem See“, rief er. „Gib mir deine Arme, Rod! So! Kannst du das Gewehr halten?“
Er richtete sich auf, taumelte unter dem Gewicht des anderen und machte sich im Trab auf den Weg zu den entfernten Tamaracken. Jeder Muskel seines kräftigen jungen Körpers war bis zum Äußersten angespannt. Noch mehr als seine hilflose Last spürte er die Gefahr in ihrem Rücken.
Noch drei Minuten, noch vier Minuten, und dann ...
Ein schreckliches Bild brannte sich in Wabis Gehirn ein, ein Bild, das er seit seiner Kindheit von einem anderen Kind in sich trug, das von diesen Gesetzlosen des Nordens vor seinen Augen zerrissen und verstümmelt wurde, und er schauderte. Wenn er die drei verbleibenden Kugeln nicht ins Ziel bringen würde, wenn der Tamarack-Saum nicht rechtzeitig erreicht würde, wusste er, was ihr Schicksal sein würde. Da schoss ihm ein letzter Ausweg durch den Kopf. Er könnte seinen verwundeten Begleiter fallen lassen und sich selbst in Sicherheit bringen. Aber es war ein Gedanke, der Wabi grimmig lächeln ließ. Dies war nicht das erste Mal, dass diese beiden ihr Leben gemeinsam riskierten, und an diesem Tag hatte Roderick tapfer für den anderen gekämpft und war derjenige gewesen, der leiden musste. Wenn sie starben, dann in Gesellschaft. Wabi fasste diesen Entschluss und umklammerte die Arme des anderen fester. Er war sich ziemlich sicher, dass der Tod sie beide erwartete. Sie könnten den Wölfen entkommen, aber die Zuflucht eines Baumes, mit dem gefräßigen Rudel auf der Lauer darunter, bedeutete nur ein schmerzloseres Ende durch Kälte. Doch solange es Leben gab, gab es Hoffnung, und er eilte weiter durch den Schnee, lauschte auf die Wölfe hinter sich und spürte mit jedem Moment deutlicher, dass seine eigenen Ausdauerfähigkeiten schnell ein Ende fanden.
Aus irgendeinem Grund, den Wabi nicht erklären konnte, hatte das Jagdrudel aufgehört zu bellen. Nicht nur die zugeteilten zwei Minuten, sondern fünf davon vergingen, ohne dass die Tiere auf dem See auftauchten. War es möglich, dass sie! die Spur verloren hatten? Dann kam dem Indianer der Gedanke, dass er vielleicht einen der Verfolger verwundet hatte und dass die anderen, die seine Verletzung entdeckten, ihn angegriffen hatten und nun an einem der kannibalistischen Feste teilnahmen, die sie bisher gerettet hatten. Kaum hatte er an diese Möglichkeit gedacht, als er von einer Reihe langer Heulen aufgeschreckt wurde, und als er sich umdrehte, erkannte er ein Dutzend oder mehr dunkle Objekte, die sich schnell über ihre Spur bewegten.
Keine 130 Meter weiter lag der Tamarackwald. Rod würde diese Strecke sicher schaffen!
„Lauf, Rod!“, rief er. „Du bist jetzt ausgeruht. Ich bleibe hier und halte sie auf!“
Er lockerte die Arme des anderen, und dabei fiel das Gewehr aus dem kraftlosen Griff des weißen Jungen und versank im Schnee. Als er sich seiner Last entledigte, sah er zum ersten Mal die tödliche Blässe und die halb geschlossenen Augen seines Gefährten. Mit einem neuen Schrecken, der sein eigenes treues Herz erfüllte, kniete er neben der Gestalt, die so schlaff und leblos dalag, und seine flammenden Augen wanderten von dem grässlichen Gesicht zu den herannahenden Wölfen, sein Gewehr schussbereit in den Händen. Er konnte nun die Wölfe erkennen, die wie Ameisen aus dem Fichtenwald herauskamen. Ein Dutzend von ihnen war fast in Schussweite. Wabi wusste, dass er es mit dieser Vorhut des Rudels aufnehmen musste, wenn er die nachfolgenden Tiere aufhalten wollte. Er ließ sie näher und näher kommen, bis die ersten kaum noch sechzig Meter entfernt waren. Dann sprang der Indianer mit einem plötzlichen Schrei auf und stürmte furchtlos auf sie zu. Diese unerwartete Bewegung brachte die vordersten Wölfe, wie er beabsichtigt hatte, für einen Augenblick zum Stehen, und in diesem günstigen Moment richtete Wabi sein Gewehr aus und feuerte. Ein langes Schmerzensgeheul zeugte von der Wirkung des Schusses. Kaum hatte es begonnen, als Wabi wieder feuerte, diesmal mit solch tödlicher Präzision, dass einer der Wölfe hoch in die Luft sprang und leblos zwischen die anderen zurücktaumelte, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben.
Wabi rannte zu dem am Boden liegenden Roderick, drehte ihn schnell auf den Rücken, umklammerte sein Gewehr mit dem Griff seines Arms und machte sich wieder auf den Weg zu den Tamaracken. Nur einmal schaute er zurück und sah, wie sich die Wölfe in einer knurrenden, kämpfenden Menge um ihre getöteten Kameraden versammelten. Erst als er den Schutz der Tamaracken erreicht hatte, legte der junge Indianer seine Last ab und fiel vor Erschöpfung auf den Schnee, seine schwarzen Augen vorsichtig auf die sich labende Meute gerichtet. Ein paar Minuten später bemerkte er hier und da dunkle Flecken auf dem weißen Schnee, und bei diesen Anzeichen für das Ende des Festmahls kletterte er in die niedrigen Äste einer Fichte und zog Roderick hinter sich her. Erst dann zeigte der verwundete Junge sichtbare Lebenszeichen. Langsam erholte er sich von der Ohnmacht, die ihn übermannt hatte, und nach einer Weile konnte er sich mit etwas Hilfe von Wabi sicher auf einen höheren Ast setzen.
„Das ist das zweite Mal, Wabi“, sagte er und legte liebevoll eine Hand auf die Schulter des anderen. „Einmal vor dem Ertrinken, einmal vor den Wölfen. Ich habe noch eine Menge mit dir zu klären!“
„Nicht nach dem, was heute passiert ist!“
Der Indianer hob das Gesicht, bis die beiden einander mit einem Blick voller Liebe und Vertrauen in die Augen sahen. Nur einen Augenblick lang, dann wandte sich ihr Blick instinktiv dem See zu. Das Wolfsrudel war in Sichtweite. Es war das größte Rudel, das Wabi in seinem ganzen Leben in der Wildnis je gesehen hatte, und er schätzte, dass es mindestens ein halbes Hundert Tiere umfasste. Wie ausgehungerte Hunde, denen ein paar Fleischbrocken zugeworfen wurden, rannten die Wölfe umher und schnüffelten hier und da, als hofften sie, ein Stückchen zu finden, das vielleicht unentdeckt geblieben war. Dann blieb einer von ihnen auf dem Pfad stehen, warf sich halb auf die Hüften, den Kopf zum Himmel gerichtet wie ein bellender Hund, und stieß den Jagdschrei aus.
„Es sind zwei Rudel. Ich dachte, es wäre zu groß für eines“, rief der Indianer aus. „Seht! Ein Teil von ihnen nimmt die Spur auf, und die anderen bleiben zurück und nagen an den Knochen des toten Wolfes. Wenn wir nur unsere Munition und das andere Gewehr hätten, das uns diese Mörder abgenommen haben, würden wir ein Vermögen verdienen. Was ...“
Wabi hielt mit einer Plötzlichkeit an, die Bände sprach, und der unterstützende Arm, den er um Rods Taille gelegt hatte, zog sich zusammen, bis der verwundete Junge zusammenzuckte. Beide Jungen starrten in starrer Stille. Die Wölfe drängten sich um eine Stelle im Schnee auf halbem Weg zwischen der Tamarack-Zuflucht und dem Ort des jüngsten Festmahls. Die ausgehungerten Tiere zeigten ungewöhnliche Erregung. Sie waren auf die Blutlache und die rote Spur des sterbenden Elchs gestoßen!
„Was ist los, Wabi?“, flüsterte Rod.
Der Indianer antwortete nicht. Seine schwarzen Augen leuchteten mit einem neuen Feuer, seine Lippen waren in ängstlicher Erwartung geöffnet, und er schien in seiner angespannten Aufmerksamkeit kaum zu atmen. Der verwundete Junge wiederholte seine Frage, und wie zur Antwort schwenkte das Rudel nach Westen und bewegte sich in einer schwarzen, stillen Masse in eine Richtung, die sie in die Tamaracks bringen würde, hundert Meter von den jungen Jägern entfernt.
„Eine neue Spur!“, flüsterte Wabi. „Eine neue Spur, und eine heiße! Hört! Sie machen kein Geräusch. Das ist immer so, wenn sie kurz vor der Jagd stehen!“
Als sie hinschauten, verschwand der letzte Wolf im Wald. Für einige Augenblicke herrschte Stille, dann ertönte ein Chor von Heulen tief aus dem Wald hinter ihnen.
„Jetzt ist unsere Chance“, rief der Indianer. „Sie sind wieder ausgebrochen und ihr Wild ...“
Er war teilweise von seinem Ast gerutscht und zog seinen stützenden Arm von Rods Taille zurück. Er wollte gerade zu Boden sinken, als sich die Meute wieder in ihre Richtung wandte. Ein schweres Krachen im Unterholz, keine zehn Stangen entfernt, ließ Wabi hastig auf seinen Sitzplatz klettern.
„Schnell – höher hinauf!“, warnte er aufgeregt. „Sie kommen hierher – direkt unter uns! Wenn wir nach oben klettern, können sie uns nicht sehen oder riechen ...“
Die Worte waren kaum aus seinem Mund, als eine riesige, schattenhafte Masse nicht mehr als fünfzig Fuß von der Fichte entfernt, in der sie Zuflucht gesucht hatten, an ihnen vorbeiraste. Beide Jungen erkannten ihn als einen Elchbullen, obwohl keinem von ihnen in den Sinn kam, dass es dasselbe Tier war, auf das Wabi am selben Tag ein paar Meilen weiter einen Weitschuss abgegeben hatte. In unmittelbarer Verfolgung kam die ausgehungerte Meute. Ihre Köpfe hingen dicht über der blutigen Spur, hungrige, knurrende Schreie kamen zwischen ihren klaffenden Kiefern hervor, und sie fegten über die kleine Öffnung fast zu den Füßen der jungen Jäger. Es war ein Anblick, den Rod nie erwartet hatte, und einer, der selbst den erfahreneren Wabi faszinierte. Keiner der beiden Jugendlichen brachte einen Ton hervor, als sie auf die wilden, hungrigen Gesetzlosen der Wildnis hinabstarrten. Für Wabi erzählte dieser Anblick des Rudels eine schicksalhafte Geschichte; für Roderick Drew bedeutete er nichts weiter als die Tragödie, die sich vor seinen Augen abspielen sollte. Der scharfe Blick des Indianers sah im weißen Mondlicht lange, dünne Körper, die fast bis auf Haut und Knochen abgemagert waren; für seinen Gefährten schien das herannahende Rudel nur aus agilen, kraftvollen Bestien zu bestehen, die durch die Nähe ihrer Beute zu fast teuflischen Anstrengungen getrieben wurden.
Blitzschnell waren sie verschwunden, aber in diesem Moment ihres Vorbeiziehens entstand ein Bild, das Roderick Drew sein Leben lang nicht vergessen sollte. Und es sollte noch eine folgen, die noch tragischer und noch spannender war. Für den benommenen, halb ohnmächtigen jungen Jäger schien es nur ein weiterer Augenblick zu sein, bis die Meute den alten Bullen eingeholt hatte. Er sah, wie sich das todgeweihte Monster umdrehte, hörte in der Stille das Knacken der Kiefer, das Knurren der hungrigen Tiere und ein Geräusch, das ein großes, wogendes Stöhnen oder ein sterbendes Brüllen sein könnte. In Wabis Adern tanzte das Blut vor Aufregung, die seine Vorfahren zum Kampf anstachelte. Nicht eine Zeile der Tragödie, die sich vor seinen Augen abspielte, entging diesem Eingeborenen, der in der Wildnis aufgewachsen war. Es war ein großartiger Kampf! Er wusste, dass der alte Bulle in dem einseitigen Duell langsam sterben würde und dass es, wenn es vorbei war, mehr als einen Kadaver geben würde, an dem sich die Überlebenden sattfressen konnten. Leise streckte er die Hand aus und berührte seinen Begleiter.
„Die Zeit ist reif“, sagte er. „Komm schon – immer noch – und auf dieser Seite des Baumes!“
Er rutschte Fuß für Fuß nach unten und half Rod dabei. Als beide den Boden erreicht hatten, beugte er sich wie zuvor vor, damit der andere auf seinen Rücken klettern konnte.
„Ich schaffe es allein, Wabi“, flüsterte der verwundete Junge. „Hilf mir auf den Arm, ja?“
Der Indianer legte seinen Arm um die Taille des Jungen und gemeinsam machten sie sich auf den Weg durch die Tamarack-Wälder. Eine Viertelstunde später erreichten sie das Ufer eines kleinen zugefrorenen Flusses. Auf der gegenüberliegenden Seite, hundert Meter weiter unten, bot sich ihnen ein Anblick, den beide wie durch einen gemeinsamen Impuls mit einem Freudenschrei begrüßten. In Ufernähe, geschützt durch einen dichten Fichtenbewuchs, brannte ein helles Lagerfeuer. Als Reaktion auf Wabis weitreichenden Ruf erschien eine schemenhafte Gestalt im Schein des Feuers und erwiderte den Ruf.
„Mukoki!“, rief der Indianer.
„Mukoki!“, lachte Rod, glücklich, dass das Ende nahe war.
Noch während er sprach, schwankte er benommen, und Wabi ließ sein Gewehr fallen, damit er seinen Begleiter davor bewahren könnte, in den Schnee zu fallen.
KAPITEL II WIE WABIGOON EIN WEISssER WURDE
Inhaltsverzeichnis
Hätten die jungen Jäger die Macht, in die Zukunft zu blicken, könnte ihr Lagerfeuer an jenem Abend am zugefrorenen Ombabika eines ihrer letzten gewesen sein, und ein paar Tage später wären sie wieder am Rande der Zivilisation gewesen. Hätten sie vielleicht den glücklichen Höhepunkt der Abenteuer voraussehen können, die vor ihnen lagen, wären sie vielleicht trotzdem weitergezogen, denn die Liebe zur Aufregung ist im Herzen einer robusten Jugend stark. Aber diese Fähigkeit zur Unterscheidung wurde ihnen verwehrt, und erst Jahre später, als sie sich mit ihren Liebsten am heimischen Herd versammelten, offenbarte sich ihnen das ganze Bild. Und in jenen Tagen, wenn sie sich mit ihren Familien um die prasselnden Holzscheite des Winters versammelten und ihre frühe Jugend noch einmal durchlebten, wussten sie, dass sie sich für alles Gold der Welt nicht von ihren Erinnerungen an das Leben, das sie zuvor geführt hatten, trennen würden.
Etwa dreißig Jahre vor der Zeit, von der wir hier schreiben, verließ ein junger Mann namens John Newsome die große Stadt London, um in die Neue Welt aufzubrechen. Das Schicksal hatte ein hartes Spiel mit dem jungen Newsome getrieben – es hatte ihm zunächst beide Eltern genommen und ihn dann mit einer einzigen launischen Wendung seines Rades um das wenige Vermögen gebracht, das er geerbt hatte. Wenig später gelangte er nach Montreal, und da er ein junger Mann mit guter Bildung und beträchtlichem Ehrgeiz war, fand er leicht eine Anstellung und erwarb sich das Vertrauen seiner Arbeitgeber. Schließlich erhielt er eine Position als Faktor am Wabinosh-Haus, einem Handelsposten tief in der Wildnis des Lake Nipigon.
Im zweiten Jahr seiner Herrschaft in Wabinosh – ein Faktor ist in seinem Bereich praktisch König – kam ein Indianerhäuptling namens Wabigoon zur Postzustellung, und mit ihm seine Tochter Minnetaki, nach deren Schönheit und Tugend eine Stadt benannt wurde. Minnetaki war gerade erst in das frühe Frausein ihrer Rasse eingetreten und besaß eine Schönheit, die man bei indianischen Mädchen selten sah. Wenn es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gibt, dann entstand sie in dem Moment, als John Newsomes Blick auf diese schöne Prinzessin fiel. Danach besuchte er Wabigoons Dorf, das dreißig Meilen tiefer in der Wildnis lag, häufig. Von Anfang an erwiderte Minnetaki die Zuneigung des jungen Faktors, aber ein sehr gewichtiger Grund verhinderte ihre Heirat. Minnetaki wurde lange Zeit leidenschaftlich von einem mächtigen jungen Häuptling namens Woonga umworben, den sie zutiefst verabscheute, von dessen Gunst und Freundschaft jedoch die Herrschaft ihres Vaters über seine Jagdgründe abhing.
Mit dem Auftauchen des jungen Mannes entstand die erbittertste Rivalität zwischen den beiden Verehrern, die zu zwei Mordanschlägen auf Newsome und einem Ultimatum von Woonga an Minnetakis Vater führte. Minnetaki selbst antwortete auf dieses Ultimatum. Es war eine Antwort, die in Woongas Brust das Feuer des Hasses und der Rache zu fieberhafter Hitze entfachte. Eines Nachts fiel er mit einer Gruppe von zwanzig Kriegern seines Stammes über das Lager der Wabigoon her, um die Prinzessin zu entführen. Der Angriff war zwar erfolgreich, verfehlte jedoch sein eigentliches Ziel. Wabigoon und ein Dutzend seiner Stammesangehörigen wurden getötet, aber am Ende wurde Woonga vertrieben.
Ein schneller Bote brachte die Nachricht vom Angriff und vom Tod des alten Häuptlings zum Haus der Wabinosh, und mit einem Dutzend Männern eilte Newsome seiner Verlobten und ihrem Volk zu Hilfe. Es wurde ein Gegenangriff auf Woonga unternommen, und er wurde mit großen Verlusten tief in die Wildnis zurückgedrängt. Drei Tage später wurde Minnetaki in der Hudson Bay Postzustellung Newsomes Frau.
Von dieser Stunde an begann eine der blutigsten Fehden in der Geschichte der großen Handelsgesellschaft; eine Fehde, die, wie wir sehen werden, sogar bis in die zweite Generation hinein andauern sollte.
Woonga und sein Stamm wurden nun nicht besser als Gesetzlose und machten so effektiv Jagd auf die Überreste des verstorbenen Wabigoons Volkes, dass diese beinahe vollständig ausgelöscht wurden. Die wenigen Überlebenden zogen in die Nähe des Handelspostens. Jäger vom Wabinosh-Haus wurden in Hinterhalte gelockt und getötet. Indianer, die zum Posten kamen, um Handel zu treiben, wurden als Feinde betrachtet, und der Lauf der Jahre schien daran kaum etwas zu ändern. Die Fehde bestand weiterhin. Die Gesetzlosen wurden bald nur noch als „Woongas“ bezeichnet, und ein Woonga galt als ein rechtmäßiges Ziel für das Gewehr eines jeden Mannes.