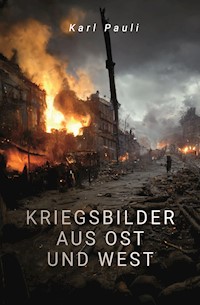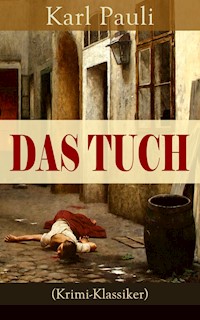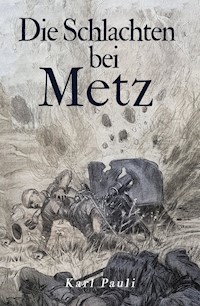
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Das Feuer am linken Flügel wird stärker, der Deubel scheint mal los zu sein — aller Augenblicke kommen mal wieder so ein paar Brummer angesaust und schlagen vor und hinter unseren Schützengräben ein oder krepieren darüber. Mit einem kühnen Satz verschwindet dann alles im Graben, um wenigstens einigermaßen Deckung zu haben. Das Gemeinste ist, daß so eine Granate langsamer fliegt als der Schall, man hört zuerst den Knall des Schusses, dann kommt der Brummer hergesaust und man fühlt es ganz genau, jetzt muß er krepieren. Dabei streckt zuerst immer alles den Kopf weg, ob Major oder General oder Musketier — da ist jeder eben Mensch. Viel angenehmer ist die Flintenkugel, die pfeift blitzschnell vorbei und ist schon längst einen Kilometer weiter, wenn man das Pfeifen hört — aber Tod und Verderben bringen beide.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schlachten bei Metz
und die Vertreibung der Franzosen
aus Elsaß-Lothringen
Selbsterlebtes
Nach Berichten von Feldzugsteilnehmernbearbeitet
von
Karl Pauli
_______
Erstmals erschienen in:
Vaterländische Verlagsanstalt Wilhelm Köhler,
Minden in Westfalen, 1916
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
Buchbearbeitung: Nadja Mondy
© 2018 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-147-9
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Wir und die Welt.*)
Die Schlachten in Lothringen.
Aus den Lazaretten.
Die Schlachten in Lothringen.
Schlusswort.
Vorwort
m Laufe des Monats August 1914 waren die deutschen Heere im Verfolg einer langen Reihe siegreicher Kämpfe zu Herren des größten Teiles von Belgien geworden und trieben das in mehreren Schlachten nach tapferer Gegenwehr besiegte französische Heer in dessen eigenem Lande bis in die Nähe von Paris zurück.
Schon im deutsch-französischen Kriege 1870 war es ein Lieblingsgedanke der französischen Kriegführung gewesen, durch einen schnellen Vormarsch über den Oberrhein in Süddeutschland einzubrechen, um so die Länder südlich des Mains von Norddeutschland zu trennen. Man zweifelte in Paris nicht daran, dass alsdann die süddeutschen Staaten das nur widerwillig mit Preußen geschlossene Bündnis preisgeben und sich mit den Franzosen vereinigen würden. Auch in dem neuen Kriege musste man deutscherseits mit ähnlichen Erwägungen der französischen Heeresleitung rechnen. Ist doch allen Ernstes in Paris behauptet worden, der Krieg werde von den deutschen Bundesstaaten nur mit halbem Herzen geführt. In Bayern und in Sachsen wäre die Frage aufgeworfen worden, ob es überhaupt nötig sei, an den bevorstehenden Kämpfen mit teilzunehmen. Die Tatsachen berichtigten indes diesen Irrtum sehr bald. Von den deutschen Grenztruppen in Deutsch-Lothringen waren die ersten französischen Angriffe sehr entschieden zurückgewiesen und die Deutschen waren an mehreren Stellen selbst in das französische Gebiet eingedrungen. Als dann die Vorwärtsbewegungen bedeutender französischer Heeresmassen von Nancy der sich in der Richtung auf Saarburg geltend machten, wichen die unterlegenen deutschen Truppen, um sich keiner unnötigen Niederlage auszusetzen, zunächst gegen die Saar zurück. Auch weiter nach Nordwesten gingen französische Abteilungen von Verdun auf Longwy vor. Westlich der Maas drang eine französische Gruppe in den Winkel zwischen Maas und Sambre gegen Namur vor in dem Bestreben, den weichenden Belgiern, wenn möglich, noch zu helfen.
Aus diesem Bilde ergibt sich somit, dass um den 25. August herum die Franzosen auf der ganzen Linie in der Vorwärtsbewegung waren. Aber so sehr man sich auch in Frankreich einen schnellen Vormarsch des mobilen Heeres gedacht hatte, und damit rechnete, den Deutschen hierin zuvorzukommen, so hatte man sich doch verrechnet. Der Zusammenstoß der beiden feindlichen Armeen erfolgte schneller, als man auf der Seite des Feindes geglaubt, und in der zweiten Hälfte des August kennzeichnete sich der Krieg als eine Reihe von Kämpfen in größeren Massen in dem Raume zwischen den Vogesen und der Sambre südwestlich Namur. Wie Gewitterschwüle lag es in jenen Tagen über dem deutschen Vaterlande. An der Westgrenze des Reiches, das fühlte ein jeder, standen ungeheure Mengen von Kämpfern einander gegenüber, um sich mit dem Feinde zu messen. In breiter Front, von Belgiens Hauptstadt an, Durch Luxemburg hindurch, an der deutschen Grenze entlang, bis an die Schweizer Berge, welch eine Ansammlung von Streitkräften! Ein jeder fühlte, dass entscheidende Schläge dicht bevorstehen müssten. Bei einer so ungeheuren Ausdehnung des Kampffeldes war nicht darauf zu rechnen, dass alle Teile des deutschen Heeres siegreich gegen den Feind vorgehen würden. Das ließ schon das französische Landesverteidigungssystem nicht zu, das bekanntlich ausgedehnte Gebiete der französischen Nordostgrenze einem feindlichen Vormarsch entzieht. In peinlicher Ungewissheit erwartete Deutschland zuverlässige Nachrichten vorn westlichen Kriegsschauplatz und von seinen Grenzen.
In der Nacht vom 27. zum 28. August verbreitete sich, von der Bevölkerung überall mit stürmischen Jubel begrüßt, eine zusammenfassende Nachricht des Großen Hauptquartiers, um von dort aus durch Wolffs Telegraphen-Bureau in kürzester Frist überallhin verbreitet zu werden. In mutigen Sätzen enthüllte sich der staunenden Welt ein Stück gewaltigster Kriegsgeschichte. Es lautete seinem Hauptinhalt nach folgendermaßen:
„Das deutsche Westheer ist neun Tage nach Beendigung seines Aufmarsches unter fortgesetzten siegreichen Kämpfen in französisches Gebiet von Cambrai bis zu den Südvogesen eingedrungen. Der Feind ist überall geschlagen und befindet sich im Rückzug. Die Größe seiner Verluste an Gefallenen, Gefangenen und Trophäen lässt sich bei der gewaltigen Ausdehnung der Schlachtfelder in zum Teil unübersichtlichem Wald- und Gebirgsgelände noch nicht annähernd übersehen.“ Weitere Einzelheiten aus dem ungeheuren mehrtägigen Ringen vermochte die Oberste Heeresleitung am 27. August noch nicht mitzuteilen, aber bereits einen Tag später konnte sie über weitere Fortschritte auf dem gesamten westlichen Kriegsschauplatz berichten. Danach war es gelungen, am 28. August die englische Armee, der sich drei englische Territorialdivisionen angeschlossen hatten, nördlich von St. Quentin vollständig zu schlagen. Die hohe strategische Bedeutung dieses Sieges ergab sich daraus, dass die englische Armee nunmehr ihren Rückzug auf St. Quentin, d. h. nach Süden zu richten genötigt war. Dadurch war eine völlige operative Trennung der französisch-englischen Armee von den noch im Felde verbliebenen Teilen der belgischen Armee erreicht. Am 1. September standen die Deutschen in einer Linie, die nordwestlich bei Combles in Frankreich begann, über St. Quentin, Rethel bis Stenay an der Maas lief und von dort halbwegs zwischen Metz und Verdun sich über Luneville bis an die Vogesen bei dem Donon zog. Auf dieser ganzen Strecke waren die Franzosen überall gewichen und nirgends imstande gewesen, dem deutschen Vordringen Halt zu gebieten.
In Paris herrschte große Überraschung und Enttäuschung. Das Ministerium fiel. Millerand übernahm das Kriegsministerium und am 2. September wurde der Sitz der Regierung von Paris nach Bordeaux verlegt.
Major Viktor v. Strantz.
Wir und die Welt.*)
Wir haben geschwiegen im Völkerrat
Einmal und zweimal und mehr;
Und standen zur Seite und mieden die Tat —
Einmal und zweimal und mehr!
Wir haben uns nimmermehr beeilt,
Als man die Erde aufgeteilt.
Wir hörten der anderen heiseren Schrei —
Wir wollten den Frieden — und standen dabei
Zweimal und dreimal und mehr.
Und dennoch gaben sie keine Ruh,
keinen Tag und nimmermehr,
Und sahen uns scheel und neidisch zu
Einmal und zweimal und mehr!
Sie haben gehöhnt und haben gehetzt
Und Säbel geschliffen und Messer gewetzt,
Den Deutschen zu schimpfen, war keiner zu faul!
Wir wollten den Frieden! — Wir hielten das Maul
Einmal und zweimal und mehr!
Sie trieben durch Jahre das frevle Spiel
Mehr noch und immer mehr!
Bis Der Tag anbrach, der Gott gefiel,
Einmal und nimmermehr.
Bis die Erde war von Lügen krank,
Bis der Hasser Heulen zum Himmel stank.
Bis der Deutsche sprach: „Nun ist es genug,
Nun duld´ ich die Lügen und dulde den Trug
Nimmer und Nimmermehr!“
Und er fuhr empor wie ein Wetterstrahl,
Und er blickte rings umher.
Und er sah seiner Neider Überzahl,
Einen und manchen mehr!
Sah im Ost den Feind und im West den Feind,
Mit den Russen den Franzmann eng vereint;
*) Dieses Gedicht mußte auf Befehl des Kaisers den Truppen ausgehändigt werden.
Und den Serben dann und den Belgier dann,
Und den Briten und alles, was lügen kann,
Mehr und manche mehr!
Der Feinde Hohn und der Übermacht Spott
Rast durch die Welt daher.
und der Deutsche betet: „Nun helfe mir Gott
Einmal, mir einmal mehr!“
Und es fiel seine Faust, und es fiel sein Streich,
Da sank der Belgier zu Boden gleich,
Und ein neuer Tag und ein neuer Schlag —
Bis dass der Franzos auf den Knien lag!
Recht so! Und mehr noch! Noch mehr!
Nun zittere Brite! Wie ein Taifun stark
Ist des Deutschen blanke Wehr,
Es trifft sein Schlag, und er trifft ins Mark
Einmal und zweimal und mehr!
Nun zittere, Russe! Und denke daran:
Auch Deine Stunde naht schon heran.
Nur ein Atemholen! Nur Zeit, nur Zeit!
Auch dir ist ein heißes Süpplein bereit,
Einmal und zweimal und mehr!
Ein Schlag erdröhnt durch die ganze Welt
Einmal und zweimal und mehr!
Wo der Deutsche trifft, ist ein Heer zerschellt,
Eines und noch eins mehr!
Still lauscht die Welt und atemlos,
Denn dies Ringen ist so gewaltig groß;
Und in dem wilden, dem letzten Krieg,
Pflückt sich der Deutsche den ewigen Sieg:
Er allein — und keiner mehr!
Die Schlachten in Lothringen.
it großen Worten, glänzenden Versprechungen zogen die Franzosen in Elsass-Lothringen in echt französischer Weise ein. Flieger flogen dem Heere voran, über Städte und Dörfer Flugblätter auswerfend, auf denen zu lesen stand:
„Kinder des Elsass! Nach 44 Jahren schmerzlichen Wartens betreten französische Soldaten wiederum den Boden Eures edlen Landes. Sie sind die ersten Arbeiter des großen Werkes der Revanche, das sie mit Rührung und Stolz erfüllt. Um dieses Werk zu vollbringen, geben sie ihr Leben dahin, die französische Nation steht einmütig hinter ihnen und auf ihren Fahnen steht zu lesen: Recht und Freiheit! Es lebe Elsass — es lebe Frankreich! Der Französische Generalissimus Joffre.“
Ob die auf diese Weise beglückten Elsässer den Worten der Franzosen ohne weiteres Glauben schenkten, bleibe dahingestellt, jedenfalls taten es nicht alle, denn ein Teil der Bewohner der Grenzdistrikte ergriff die Flucht und rettete sich in die Städte oder das Innere des Landes, um sich der Berührung mit den einrückenden Truppen zu entziehen, nur einer blieb, ein in der ganzen Umgegend beliebter Gastwirt in Lauchensee, und an dessen Schicksal konnte man erkennen, wie sehr es den Franzosen ernst war, ihre Versprechungen bezüglich des Schutzes der Einwohner des Elsass zu erfüllen, und gleich zu Anfang zu zeigen, was man von den einziehenden Befreiern zu erwarten hatte.
Wohl hatte man dem Papa Kreischer dann und wann zu verstehen gegeben, vorsichtig zu sein, und nicht von menschlicher Hilfe stundenweit entfernt allein auf der Höhe zu bleiben. Allein jene Naturmenschen, die ihr Leben mit dem Berg und mit dem Wald verkettet hatten, lächelten über die besorgten Freunde. Wer sollte wohl ihren Frieden stören? Der Krieg war hart und auch von ihnen tief empfunden. Allein sie glaubten, dass er eine Angelegenheit der Heere wäre, die harmlose Zivilpersonen respektieren würden.
„Die lieben, netten Französchen“, wie Heine sie zu seiner Zeit nannte, waren ja oft hier zu Gaste gewesen, man hatte sie als Menschen und als Freunde schätzen gelernt, und würden sie ins Land eindringen, du lieber Gott, so würden sie doch unmöglich ihre Kultur verleugnen können. Im Übrigen, wie oft war es ausgesprochen worden: kämen die Franzosen wieder über den Vogesenkamm, so würden sie la terre sainte de l’Alsace (die heilige Erde Elsass-Lothringens) wie ihren Augapfel behüten, und nichts erführe das „Brudervolk“ von den Schrecken des Krieges...
Das haben nämlich viele Menschen im Elsass geglaubt, und sie waren vertrauensselig und vermeinten ihr Privateigentum außer Gefahr, mochte sich das Blatt wenden, wie immer es wollte.
Der Lauchenseewirt blieb mit seiner Sippe oben, mutterseelenallein. Wohin auch rasch mit dem Gesinde, mit Pferden und Wagen und Rinden- und Kleinvieh und beweglicher habe.
Als am Freitagabend die Schatten länger wurden und die Sonne sich hinter dem Belchen verkrümelte, unterbrach den Bergesfrieden eine ungewöhnliche Bewegung. Oben auf dem Jungfrauenkopf kribbelte es und krabbelte es, wusselig wie ein Ameisenhaufen, und wie man mit dem Fernstecher hinaufsah, da waren es unzählige rote Hosen, mit Eifer beflissen, Gräben zu bauen und sich einzunisten. Da mag dem Lauchenseewirt doch eigen zu Mut geworden sein und sein Herz der Gedanke „armes Vaterland!“ bewegt haben. War es denkbar, die Franzosen kamen ins Elsass? Herr der Heerscharen, steh‘ uns bei!
Aber die Franzosen arbeiteten weiter und richteten ihre Kugelläufe ins Land. Von dem untenliegenden Gasthaus schienen sie keine Notiz zu nehmen. Man wiegte sich in Vertrauen und Sicherheit. Der nächste Tag brach an, leuchtend und schön. Die Franzosen bauten am Jungfrauenkopf weiter. Doch was bewegte sich da vom See her dem Gasthaus zu? Wirklich, zwei feindliche Militärs, Offiziere vom Regiment Chasseurs à pied. Nun die Fassung nicht verlieren. Sie traten ins Gasthaus ein, lächelten, bestellten, aßen und tranken und zahlten. Je nun, mehr konnte man nicht verlangen. Als die beiden Offiziere fort waren, wollte sich der Lauchenseewirt nicht mehr beirren lassen. Man würde die Zivilbewohner verschonen, davon war er überzeugt. Er wollte auf seinem Posten bleiben, den See nicht verlassen und sein Amt als Wärter fortführen. Seiner vorgesetzten Behörde aber wollte er über die militärischen Maßnahmen am See berichten, und er verfasste ein diesbezügliches Schreiben, nach dem er das Telefon in Bewegung gesetzt hatte. Dann kam der Nachmittag. In seinem Gefolge 14 Chasseurs à pied, die mit Draufgängertum ins Haus traten. Sie wollten zu essen und zu trinken haben. Dazu ist ein Gasthaus da, und das Verlangen ist des Krieges Brauch. Die Herren Chasseurs waren übermütiger Laune. Die Anwesenheit der bedienenden Mädchen erhöhte ihre gute Stimmung. Über ihren Appetit brauchten sie sich nicht zu beklagen. Auch nicht über den Durst. Der war archiprêt, mehr wie ihre Equipierung. Besonders bunt präsentierte sich ihre Fußbekleidung. Das war kein Märchen, das man vorher hier und da erzählt hatte, die Franzosen kamen zum Teil in Lackschuhen! Aber welcher Kontrast dazu waren die ramponierten Monturen, Uniformen, die eher Arbeitskleidern als Kriegsgarnituren glichen! Nun, des beschaulichen Verweilens bei diesen Kriegern war nicht allzu lange Zeit. Der Wein erhöhte ihren Mut. Bald waren sie an den betroffenen Lauchenseewirt geraten. Im Handumdrehen wuchs dessen Situation zur Schwüle an! Wohl, er war ein muskulöser Herr, indes bei 14 Mann und 14 Bajonetten — da muss man wohl bedenken . . . Man wurde unverschämt und brutal. Man drangsalierte den Wirt, in dessen Innerem, wie ich ihn kenne, es gebrandet, gebrodelt und gezischt haben muss. Man zwang ihn zu unwürdigen Handlungen. Sie verlangten, dass er auf Frankreich ein Hoch ausbringe und sein Glas auf den Sieg der französich-russisch-serbisch-montenegrinisch-englisch-belgischen Armeen leere. Das war unerhört und für den wackeren Alten fast zu viel. Zitternd standen auf dem Flur und in den Ecken die Frauen des Hauses umher. Da, in einer mehr als schwierigen Situation für den Lauchenseewirt, klingelte das Telefon! Der Wirt glaubte am klügsten zu tun, ruhig klingeln zu lassen und gar nicht hinzutreten. Da fasten ihn auch schon roh eine Anzahl Soldatenfäuste und schleppten ihn zum Apparat. Es fiel ihnen ein, dass ein Telefon unter Umständen für sie recht nachteilig sein möchte. „Avant tout, ne dites pas un mot que nous sommes arrives ici! „ (Vor allem, verraten Sie kein Wort, dass wir oben angekommen sind!) Und dabei setzte sich ihm eine Bajonettspitze auf die Brust. Unser Lauchenseewirt stand Höllenqualen aus. Tatsächlich wurden telefonisch Erkundigungen eingezogen, ob Truppen hinaufgekommen wären. Und unter dem Zwang, der ihn mit dem Leben bedrohte, gab der Wirt eine ausweichende Antwort ins Telefon hinein, die von den scheinbar des Deutschen gar nicht mächtigen Soldaten kaum richtig verstanden wurde. — Nach diesem telefonischen Intermezzo entfernten sich die Chasseurs rasch, versprachen, bis in einer Stande wiederzukommen und dann mit Patronen zu zahlen!! Sie durchstürmten hierauf das Haus und wühlten die ganze Einrichtung durcheinander. Der Wirt wurde gezwungen, sie zu verproviantieren; besonders mit Rauchmaterial konnten sie sich nicht genug versehen. Hierauf legten sie ihre Äxte an die Telegraphenstangen in der Umgebung. Aber keine derselben wich den kleinen Äxten. Da erkletterten sie die Veranda des Hauses und zerschnitten die Telefondrähte. „Wehe Ihnen, wenn wir wiederkommen und Sie sollten versucht haben, die Leitung wieder herzustellen.“ Damit zogen sie endgültig ab, und die bedrohten Wirtsleute atmeten auf. „Nun fort!“ war ihre Parole. Keine Minute langer mehr unter diesen Vandalen.
Die notwendigsten Gegenstände waren bald zusammengerafft und in Koffer gepackt, zu denen die Frauen rüstig griffen.
Der Knecht wusste Veranlassung zu nehmen, oben zu bleiben, während auch der Lauchenseewirt sich zum Abstieg bereit machte. Die Frauen zu Fuß vorausschickend, denn die Bergstraße war durch Verhaue gesperrt und gestattete nicht die Wagenfahrt, versprach Papa Kreischer, nachzukommen und suchte vor allem die Frauen unter Schutz in bringen. Mehr fliegend als gehend, langten die Frauen unten an, kamen bis nach Gehweiler hinab. Wer aber nicht hinterherkam, das war der Lauchenseewirt.
Bange Stunden vergingen für seine Gattin. Bald ihre große Ungeduld nicht mehr meisternd, unternahmen es Freunde, den See wieder zu ersteigen und nach dem Vermissten Umschau zu halten. Inzwischen wurde es Sonntag, von dem Vermissten zeigte sich nirgendwo eine Spur. Lassen wir die Lauchenseewirtin in ihrer Not und Bedrängnis über das Verschwinden des Gatten und sehen wir zu, wie es diesem inzwischen ergangen war.
Schauplatz der Hauptkämpfe der ersten Kriegswochen im Westen.
Herr Kreischer hatte die dringendsten Besorgungen vor seinem Abstieg ins Tal noch nicht beendet, als die Horde vom Nachmittag wieder erschien, das wüste Treiben in der Wohnung fortsetzte, den Wirt zwang, alle Kästen und Schränke, Schreibtische usw. zu öffnen, die sie dann durchwühlte, worauf sie endlich den einsamen Mann nebst seinem Knecht packte und wegführte. Der Weg zwischen stetig drohend und spottend geschwungenen Bajonetten führte zur wohlbekannten Drehe, einer Meierei, wo einige Melkerburschen ebenfalls mitgenommen und der ganze Troß dann weitergetrieben wurde. Auf das Alter des Lauchenseewirtes gab es keine Rücksichtnahme durch die Chasseurs. Als hätten sie einen Sieg und eine wundervolle Gefangennahme mit diesen friedfertigen Bergbewohnern gemacht, stürmten sie vorwärts, dem Tempo der Gefangenen durch Kolbenstöße nachhelfend. Die Reise endigte oben auf dem Jungfrauenkopf im Lager der Franzosen. Auf flacher Erde liegend, brachten die Gefangenen die Nacht zu, mit Brot und Sardinien verpflegt. Beim Morgengrauen war es unnötig, die Gefangenen erst zu wecken. Man nahm den geduldig in ihr Schicksal ergebenen und der Dinge, die da kommen sollten, harrenden Vogesenbewohnern alles weg, was sie besaßen, Uhr, Brieftasche, Geldbeutel, sogar den Zwicker des Lauchenseewirtes, und trieb sie dann nach Krüth. Nach einem Verhör, das man mit dem Lauchenseewirt anstellte, wurde er der Spionage bezichtigt und auf Grund des Schreibens an das Ministerium von Elsass-Lothringen, das man bei ihm vorfand, weitertransportiert, nach Thann, ins Gefängnis.
Das deutsche Städtchen Thann im Süden des Landes befand sich zu jener Zeit auf einige Stunden in französischem Besitz. Die Franzosen hatten sich dort als neue, ehemalige Herren des Landes aufgeführt und die Einwohnerschaft zum Teil in die wirkliche Besorgnis versetzt, als habe es mit der deutschen Herrschaft im Oberelsass ein Ende!
Nur so kann man sich die Willfährigkeit der Gemeindeverwaltung in Thann erklären, die den Deutschen, den im ganzen Oberlande wohlbekannten Lauchenseewirt, in ihr Ortsgewahrsam einsperren ließ und den französischen Truppen das Ehrenwort gab, den Gefangenen, der als Spion zu behandeln sei, sorgsam zu hüten.
Diese brutale Vergewaltigung des Einen zeigte deutlich, was das ganze Land von den französischen Befreiern zu erwarten hatte. Hier sollte sich glücklicherweise bald ein Retter finden, aber ob derselbe stets zur Stelle sein werde, ließ sich nicht bestimmen. Doch Kreischer wurde gerettet; am anderen Tage rückte eine Kompagnie Deutscher in das Städtchen Thann ein und befreite den Gefangenen. Es kam dabei zu einem heftigen Gefecht mit den Franzosen, in welchem dieselben so geschlagen wurden, dass sie, wie Augenzeugen versichern, alles was sie am Laufen hinderte, von sich warfen, sogar das Lederzeug und Uniformstücke. Der Rückzug habe sich in größter Hast und Unordnung vollzogen. Es sei ein unaufhaltbares Zurückfluten der zahlreichen französischen Truppenmassen gewesen. Kleinere deutsche Abteilungen hätten dabei ganze Haufen von fliehenden Franzosen vor sich hergetrieben. Stundenlang war man in Mülhausen Zeuge des für die Franzosen so kläglichen Schauspiels. Einen großartigen Eindruck hat es auf die Bevölkerung gemacht, als nach der Flucht der Franzosen die deutschen Truppen in der bekannten Strammheit in die Stadt einmarschierten und die Bevölkerung mit frohen Zurufen begrüßten. Vielfach habe man den Ruf gehört: „Wo geht der Weg nach Paris?“ Lachend und singend zogen sie davon.
. . . Der Rückzug vollzog sich in größter Hast und Unordnung . . .
Aber die Franzosen lachten und sangen nicht — sie lugten — wie es ins Liede heißt — zusammen, sannen Trug und Verrat! Wie die Straßenräuber fielen sie, noch vor der Kriegserklärung, im Elsass ein. Über einen solchen Überfall berichtet ein Schriftsteller in einer seiner Skizzen folgendes:
Über dem schwarzblauen Rotenbacher Kopf, der wie ein mächtiger Riegel das Münstertal in den Südvogesen gegen Frankreich absperrt, verglomm das Abendrot in lodernden Bränden.
Der deutsche Maler, der unter dem Gipfel des Kastenberges sein einsames Künstlerhaus hatte, spähte mit scharfem Auge in die Dämmerung, als ihn das Zeichen seines Haustelefons in seiner Beschäftigung störte. Aus einem der Münsterländer Städtchen verlangte man dringend Auskunft, ob auf der Kammhöhe oben, die das Reich vom Welschland trennt, sich feindliche Patrouillen gezeigt hätten. Der Maler hatte die Frage zunächst für einen Scherz gehalten.
Was sollten mitten im Frieden französische Truppen in unseren Bergen wohl zu suchen haben? Die Nachricht von der Deutschen Mobilmachung war noch nicht in die Welteinsamkeit des Kastenberges gedrungen, und dem sonstigen politischen Gezänk und Geplänkel in den Blättern hatte der Künstler, wie so oft, keine ernstere Bedeutung beigemessen.
„Halten Sie sich jedenfalls bereit“, hatte die Stimme im Telefon noch gesagt, „Sie werden heute Abend Besuch bekommen.“
Nun stand der Maler an der Brüstung seines kleinen Hauses und haftete den Blick auf die Hochmatt, um die der Weg in scharfen Kurven vom Tal zur Kammhöhe führte.
Dort unten war alles still. Nur die Tannen in seinem Berggärtchen orgelten ihr altes, dumpfes Lied, und aus den Klippenhängen zur Linken pfiff ein Steinkauz den Abend ein.
Mit einem Mal war es dem Einsamen auf seinem vorgeschobenen Posten, als ob auf dem Berggrat drüben sich geisterhafte Schatten bewegten. In dunklen, unbestimmten Massen stieg es auf und drängte von Westen her über den freien, vom Sternenlicht nur matt beleuchteten Kamm. Immer neue Geisterschwadronen tauchten auf, und dazwischen klang es wie fernes Klappern zahlloser Hufe auf hartem Fels.
Der Künstler schreckte zusammen. Während seine Blicke dem seltsamen Zug noch verwundert folgten, stand plötzlich — wie aus der Erde gewachsen — ein junger deutscher Offizier dicht neben ihm und legte grüßend die Hand an den Helm.
„Wir kommen offenbar zur rechten Zeit, um das Schauspiel dort drüben mit eigenen Augen zu sehen. Die Herrschaften haben es zweifellos eilig. Noch keine Kriegserklärung und doch schon Feindesbesuch! Die schönste Grenzverletzung, die man sich denken kann…“
„Das wären dort? . . .“
„Natürlich Franzosen! Nicht etwa eine lumpige Fernpatrouille, sondern dicke, volle Regimenter — Chasseurs à cheval. Infanterie und Geschütze . . . sehen Sie nur . . .“
Am nahen Grenzkamm, der vom Schluchtpass gegen den Belchen läuft, hielt das gespenstische Treiben an. In schweren dunklen Wolken quoll es empor, sog auf der Höhe hin und sank in die Schatten der Nachbarberge zurück. Hunderte, Tausende mussten es sein. Von Frankreich rückten sie heran, wie die Diebe in der Nacht, um ins Elsass einzubrechen.
„Mit meinen zwölf Mann da unten an der Ferme kann ich natürlich nichts ausrichten. Wir haben nur feststellen wollen, was wir jetzt wissen. Nun wird es ernst! Die Kerle dort oben setzen sich fest; die werden durch keine diplomatische Note mehr hinausgeschmissen.“
Der Leutnant drückte abschiednehmend dem Maler die Hand: „Ich denke, Sie schließen Ihre Bude und bringen sich selbst in Sicherheit. Wer weiß, was morgen kommt . . .“
Der Künstler sah dem jungen, schlanken Menschen nach, der behänd und leise über den Grasboden glitt und unten bei den Buchenhecken verschwand. Dann trat er in sein Haus, nahm den Revolver von der Wand und packte ruhig Bilder und Malzeug zusammen. Vieles, sehr vieles, was in all den Jahren einsamen Schaffens ihm lieb und wert geworden war, musste er oben zurücklassen. Am meisten schmerzte ihn das unvollendete Bild, das der nassen Farben wegen nicht mitgenommen werden konnte.
* *
Über die weißbereiften Matten des Kastenberges schritt ein preußisches Landwehrbataillon in den frühen, glashellen Septembermorgen hinaus.
Im Rheintal unten waren die schweren Gefechte mit deutschen Siegen zu Ende gegangen. Nun galt es, den fremden Eindringling aus den Vogesen zu werfen, in dessen Schluchten und Wäldern er hartnäckig standhielt.
Die braven Landwehrleute hatten Arbeit in Hülle und Fülle. Kuppe um Kuppe musste stürmend genommen werden. Von allen Seiten, sogar von den Bäumen, wo die Chasseurs alpins sich festgeschnallt hatten, prasselten die kleinen Geschosse wie Hagelkörner auf die Vordringenden, und zwischenhinein warfen die Schrapnells ihren Kugelsegen in die Luft.
Doch es ging vorwärts, Schritt für Schritt. In den Mittelvogesen war der Feind schon über die Grenze, nur hier im Süden hatte das tod- und verderbenbringende Aufräumen noch kein Ende.
Als die Vorhut die Höhe des Kastenberges erreicht hatte, wandte der Hauptmann der dritten Kompagnie sich an den neben ihm schreitenden Offizier: „Jetzt kommen wir wohl in Ihr Gelände, Herr Oberleutnant. Dort drüben steht doch Ihr Haus, wenn ich nicht irre.“
Die scharfen Augen des Künstlers hatten die strohbedeckte Hütte längst entdeckt. Nach jener gespenstischen Sommernacht war er trotz seiner Jahre freiwillig unter die Fahnen getreten, um an den Vogesenkämpfen teilzunehmen. Jetzt kam er zum ersten Male wieder auf seinen Berg, wo er in stillen Friedensjahren der Kunst als ein einsam Schaffender aus vollem Herzen gedient hatte.
„Zum Teufel, was ist das? . . .“
Ein hässlich heulender Ton durchschnitt die Luft, und gleich darauf prasselte ein Schauer zerrissener Tannenäste auf das erste Glied der anrückenden Kolonne.
Hauptmann und Offizier wussten sofort Bescheid.
„Erster Zug . . . in Schützenlinie ausschwärmen . . . Marsch, marsch! . . .“ In raschem Lauf stob die Landwehr auseinander, und warf sich, Deckung suchend, ins reifnasse Gras.
Vom Grenzkamm drüben feuerte eine feindliche Batterie auf die anrückenden Deutschen. Die graubraunen Wölkchen der Schrapnells tanzten wie Mückenschwärme durch den jungen Morgen und barsten dann krachend auseinander.
Nun wurde auch das geschwätzige Tack-Tack-Tack der Maschinengewehre und das surrende Pfeifen des Infanteriefeuers lebendig. Die Kugeln gingen zu hoch und schlugen splitternd in Baum und Busch.
Am Boden kriechend, den kleinsten Block zur Deckung nehmend, zog die deutsche Linie sich mehr und mehr in die Breite.
Schon gab es Verwundete und Tote.
Der Maler führte die Leute seines Zuges zum Wald zurück und strebte — von einer Geländewelle gedeckt — in flachem Bogen zu seinem Haus. Dort kannte er jeden Fels und jeden Graben. Von dort ließ der linke Flügel der feindlichen Infanterie sich besonders gut unter Feuer nehmen.
Noch waren sie dreihundert Meter von der Hütte entfernt.
Bestimmt und ruhig gab der Künstler seine Befehle.
„Nur Deckung, Leute, und keinen Schuss, bis das Kommando kommt.“
Die Landwehr folgte in musterhafter Disziplin.
Plötzlich dröhnte ein dumpfer Schlag über die Vorrückenden hin. Ein zweiter folgte dann, und ein dritter.
Keine zehn Meter von dem Maler wirbelten Gras und Erde empor. Ein klaffendes Loch war in den Boden gerissen. Drei Mann wälzten sich in ihrem Blut.
Der Feind auf dem Kamm hatte den Schützenzug beim Malerhaus entdeckt und warf Granaten gegen das sichtbare Ziel.
„Vorwärts, Landwehr, dort hinten gibt’s guten Schutz.“
Ein neues Dröhnen und Poltern folgte. Ein Donner, als bräche der Tannenforst in Blitz und Wetter zusammen.
„Die Hütte. . . Herr Oberleutnant . . .“
Der Künstler blickte hinüber.
Das trauliche Strohdach war in Brand geschossen. In blutroter Lohe schlugen die Flammen zum hellen Septemberhimmel empor. Ein zweiter Treffer riss die Ostwand in Stücke. Nun brannte das Haus — sein Haus, das er mit so viel Liebe und Fleiß errichtet hatte — an allen Ecken und Enden!. . .
„Vorwärts, ihr Leute, das sollen die Schufte uns büßen!“
Bald lagen sie alle in fester Deckung und gaben bedachtsam Schuss auf Schuss ab.
Die anderen Kompagnien fasten den Gegner beim Bühlkopf in der Flanke an.