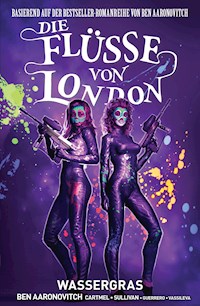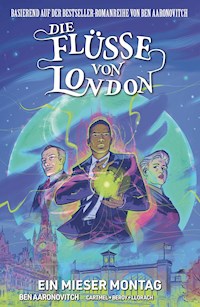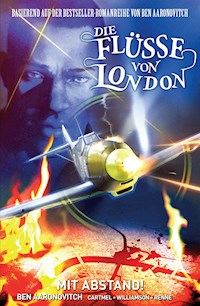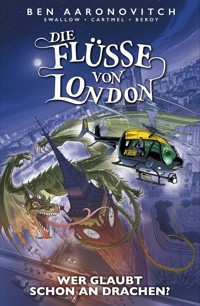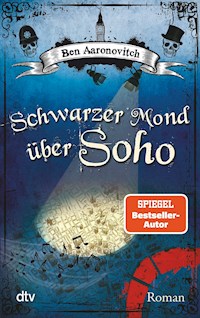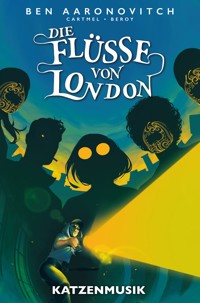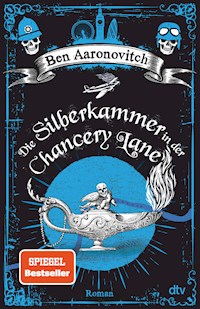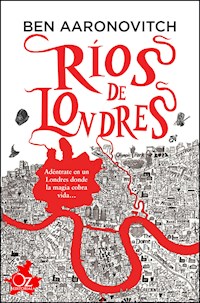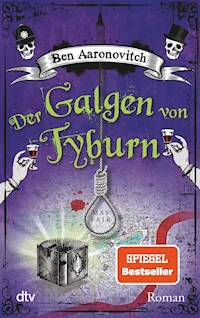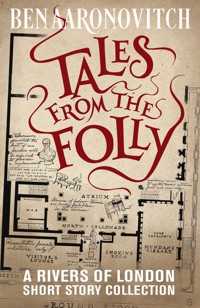9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Gestatten: Kimberley Reynolds, FBI. Zuständig für Magie. Agentin Kimberley Reynolds arbeitet in einer Spezialabteilung des FBI, zuständig für seltsame, übernatürliche und schlichtweg okkulte Dinge. Nach dem rätselhaften Hilferuf ihres Exkollegen Henderson muss Reynolds abrupt nach Eloise, Wisconsin, reisen. Die Situation dort ist dramatisch: Ein Eistornado hat Stadtverwaltung und Polizeirevier in einen Trümmerhaufen verwandelt. Henderson ist spurlos verschwunden. Alles deutet darauf hin, dass er gewaltsam entführt wurde – von etwas, das kein Mensch war. Und unversehens hat Reynolds einen Fall am Hals, gegen den jede ›Akte X‹ wie ein Kinderspiel aussieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ben Aaronovitch
Die schlafenden Geister des Lake Superior
Eine Kimberley-Reynolds-Story
Deutsch von Christine Blum
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Sabrina und Andreas,
die immer für mich da waren,
wenn ich sie brauchte.
Proprium humani ingenii est
odisse quem laeseris.
Es liegt in der menschlichen Natur,
jene zu hassen, denen man weh getan hat.
Publius Cornelius Tacitus
1
Am Nachmittag des 11. September 2001 rief meine Mama mich im Wohnheim an und flehte mich an, nicht zu den Marines zu gehen. Bis zu ihrem Anruf hatte ich, wie die meisten meiner Mitbewohnerinnen, den Tag damit verbracht, ungläubig und wie betäubt auf den Fernseher zu starren. Aber meine Mama dachte schon weiter, an den Krieg, den sie unweigerlich auf uns zukommen sah, und sie wollte nicht, dass mein Bruder, der damals in der neunten Klasse war, womöglich auf den Gedanken kam, in die Army einzutreten. Ich rede mir ein, dass Mama klar war, dass ich zu vernünftig war, um mich in einem fremden Krieg umbringen zu lassen. Manchmal glaube ich es sogar.
Sie ließ mich auf meine Bibel schwören, die ich noch nicht mal ausgepackt hatte.
An jenem Abend betete ich zu Jesus, er möge mich leiten, und er muss mich wohl getröstet haben, denn gegen Morgen schlief ich ein, und in der nächsten Woche ging ich wie gewohnt zu meinen Vorlesungen. Sobald der Schock sich gelegt hatte, kehrte ich wie die meisten anderen zum normalen Leben zurück.
Viele Leute wären wahrscheinlich erstaunt zu hören, dass die Mehrheit der späteren FBI-Agenten, wenn sie mit der Schule oder sogar dem College fertig sind, noch keineswegs den Plan haben, zum Geheimdienst zu gehen. Das liegt daran, dass das FBI am liebsten Personen einstellt, die, um es im modernen Management-Jargon auszudrücken, eigenständig arbeiten können, oder, wie Mama es ausdrückt: Erwachsene. Das FBI sucht Leute, die eine Ausbildung und Lebenserfahrung und idealerweise nützliche Fähigkeiten mitbringen. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, zum FBI zu gehen, arbeiten Sie erst mal eine Weile in einem MINT-Beruf, dann werden Sie mit Kusshand genommen.
Ich machte meinen Abschluss in Gesundheitswesen mit Strafrecht im Nebenfach. Im zweiten Semester hatte ich »Theorien kriminellen Verhaltens« belegt, weil ich wissen wollte, wie eine Bande gut ausgebildeter junger Männer auf die Idee kommen konnte, ein Flugzeug in einen Wolkenkratzer zu steuern – und das Seminar war dann der Auslöser für mein Interesse an der Materie.
Nach dem College wurde ich vom Fleck weg von einer Krankenversicherung angeheuert, genau wie es mein Karriereplan vorsah, und zwar für ihre Betrugsabteilung; von dort aus war es ein Katzensprung zur Leitung eines Ermittlungsteams einer Agrarversicherung. Mit eigenem Büro und eigenem Parkplatz auf dem Firmengelände.
Aber irgendwann begann mir das alles so kleinkariert vorzukommen.
Außerdem setzte meine Mama sich in den Kopf, ich würde im Namen liberaler Eliten und Großkonzerne anständige, hart arbeitende Menschen schikanieren. Das Wort »woke« war damals noch nicht an ihre Ohren gedrungen, und ich werde es meinem Bruder ewig nachtragen, dass er damit ankam. Hätte ich ihn mal zur Air Force gehen lassen, wie er damals gedroht hatte. Jetzt ist er Prediger in der Gemeinde meiner Mama und über jede Kritik erhaben.
Die Idee, mich als Special Agent zu bewerben, beschlich mich irgendwann zwischen dem Fall des Traktors, der einer spontanen Selbstentzündung zum Opfer fiel, und den Kühen, die Paris, Arkansas, auffraßen.
Ich sagte meiner Mama, Jesus habe mich zum FBI geleitet. Als sie fragte, warum, sagte ich, man dürfe doch den Willen des HErrn nicht in Frage stellen. Sie bedachte mich mit einem komischen Blick – man sollte Leute wie meine Mama niemals für dumm halten –, aber dann machte sie mir einen Pfirsichauflauf, der nicht zu toppen war, und gab mir ihren Segen.
Wer weiß, vielleicht hat Jesus tatsächlich zu meinem Herzen gesprochen; das hieße, dass London, die Magie, die sprechenden Bären und alles andere auch zu Seinem Plan gehörten. Mama sagt mir schließlich, seit ich denken kann, dass Gott uns permanent Botschaften schickt, nur überhören wir sie oft, weil uns der Lärm unseres alltäglichen Lebens dazwischenkommt. Sie sagt, wir sollten Jesus die Telefonzentrale unserer Seele sein lassen und stets bereit sein, Seinen Anruf entgegenzunehmen.
Aber ich glaube, selbst Jesus hätte seine liebe Mühe mit den Tausenden ungebetener Anrufe, die täglich in der Telefonzentrale des FBI eingehen … und von denen ein kleiner, aber nicht unbedeutender Anteil darum bittet, zu den »X-Akten« durchgestellt zu werden. All diese Anrufe werden protokolliert, aufgezeichnet und überprüft, selbst die von Leuten, die glauben, die Regierung würde von außerirdischen Echsenwesen kontrolliert. Vermutlich vor allem die – könnte ja sein, dass der Anrufer zu der Sorte Irrer gehört, die zwei Tonnen düngerbasierten Sprengstoff im Keller haben und nur darauf warten, sie zum Einsatz zu bringen.
Den Weizen von der Spreu zu trennen ist ziemlich zeitaufwändig. Daher war es bereits Montagmorgen, als mich die Nachricht von Ex-Agent Patrick Henderson per E-Mail über den Sicherheitsserver an meinem Arbeitsplatz in der Critical Incident Response Group erreichte.
Die Mail kam von Jan, Assistent* meines Chefs, des Stellvertretenden Direktors der CIRG Lane Harris, und enthielt die Aufforderung, um 9.30 Uhr zu einer Besprechung in dessen Büro zu erscheinen, sowie zu Referenzzwecken ein Transkript des Telefonats.
Die Besprechung war schon in einer Viertelstunde, zum Glück war das Transkript kurz.
Der Anrufer hatte sich, sobald er mit einem echten Menschen verbunden worden war, als Patrick Henderson, ehemaliger FBI-Agent, wohnhaft in Eloise, Wisconsin, vorgestellt.
ZENTRALE: Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Henderson?
ANRUFER: Geben Sie eine Nachricht in den Keller weiter – ich weiß nicht, wer da momentan die Leitung hat. Sagen Sie ihnen, hier entwickelt sich möglicherweise gerade ein X-RAYSIERRAINDIA. Genaue Informationen gebe ich dem Einsatzteam persönlich, wenn es kommt.
ZENTRALE: Entschuldigung, Sir, ich weiß nicht genau, was Sie …
ANRUFER: Nein, Sie wissen nicht, was das bedeutet, Ma’am. Geben Sie es einfach weiter, an der richtigen Stelle wird man es wissen.
Dann gibt Patrick Henderson seine Adresse in Eloise sowie seine Festnetz- und Mobilnummer durch. Ehe er auflegt, fügt er hinzu:
ANRUFER: Die Sache ist dringend, es muss wirklich sofort jemand kommen und eine Einschätzung vornehmen.
Ich hatte noch genug Zeit, um mich zu vergewissern, dass Patrick Henderson in der Tat ein ehemaliger Kollege war, der schon mit zweiundvierzig in Ruhestand gegangen war. Da die meisten Agenten erst in ihren Dreißigern bei uns anfangen, bedeutet ein so frühes Ausscheiden, dass einem der Großteil der Pension entgeht. Bei meiner weiteren Suche las ich, dass Henderson gesundheitliche Probleme gehabt hatte; nähere Details waren nicht angegeben. Immerhin stimmte die Adresse in seiner Akte mit seinen Angaben überein: Eloise in Nord-Wisconsin, 521 Einwohner, ein kleiner Touristenort, der vor allem für gute Angelmöglichkeiten und im Winter für die Eisstraße zum Apostle Islands National Lakeshore bekannt war.
Bevor ich zur Besprechung ging, suchte ich noch nach X-RAYSIERRAINDIA, fand aber keine Referenz, weder intern noch in Google.
Was es mit dem »Keller« auf sich hatte, wusste ich bereits. So lautete der interne Spitzname meiner Unterabteilung, eine Anspielung auf die erwähnte Fernsehserie Akte X, deren Protagonistenteam im Keller des J. Edgar Hoover Building angesiedelt ist, von wo aus es Jagd auf Außerirdische, übernatürliche Wesen und Monster macht.
In Wirklichkeit arbeite ich bei der IOSS, der Investigations & Operations Support Section der CIRG, und bin eine von vielen speziellen MitarbeiterInnen des Stellvertretenden Direktors, der diese Sektion leitet.
Aber ich fand Patrick Hendersons »Keller«-Anspielung interessant. Er war 1999 pensioniert worden – also musste schon damals, fast zehn Jahre bevor ich zum FBI gekommen war, hier jemand meine Arbeit gemacht haben. Ich fragte mich, wo die Akte dieser Person wohl war. Ich hatte sie nie zu Gesicht bekommen.
Da mein Arbeitsplatz nur ein paar Schritte vom Büro des Stellvertretenden Direktors entfernt lag, gab es fürs Zuspätkommen keine Ausrede, also sah ich zu, dass ich um exakt 9.29 Uhr bei ihm vor der Tür stand.
Jan sah vom Computer auf, musterte mich einen Augenblick neugierig über den Rand der Hornbrille hinweg und winkte mich weiter ins Büro. Ohne mir nach drinnen zu folgen, was ungewöhnlich war. Normalerweise schreibt Jan sogar bei Routinebesprechungen mit.
Assistant Director Lane Harris sah aus wie ein gut gekleideter Buchhalter Mitte fünfzig. Sein Haaransatz hatte sich schon vor Jahren bis ins Genick zurückverlagert, übrig geblieben war lediglich links und rechts je ein Streifen kurz rasierter graumelierter Haarstoppeln, mit denen er ein bisschen aussah wie eine Comic-Eule. Er hatte eine gerade Nase, kleine blaue Augen, dünne Lippen, und sein Gesicht war wie geschaffen für eine kleine runde Nickelbrille, nur trug er keine. Sein Büro wirkte teilmöbliert und zweckmäßig wie die der meisten leitenden Beamten in Quantico. Robuster kaffeebrauner Standard-Teppichboden, zwei Wände mit Holz verkleidet, an den beiden anderen stabile hölzerne Schränke und Regale. Das Fenster ging auf den Parkplatz hinaus, und ich bemerkte, dass die Schallschutzvorhänge, die auch Laserabhörtechnik unterbanden, vorgezogen waren.
Als ich eintrat, stand er hinter seinem Metallrahmen-Schreibtisch. »Kimberley. Setzen Sie sich.«
Wir setzten uns einander gegenüber. Er lehnte sich zurück und faltete die Hände vor dem Bauch.
»Ihre erste Frage?«, sagte er.
»Was bedeutet X-Ray Sierra India?«
Harris nickte – anscheinend war es die richtige Frage. »Das ist ein altes Fallkürzel aus den neunziger Jahren. Ich habe nie selbst mit einem solchen Fall zu tun gehabt, aber es ist ziemlich bekannt – oder war es jedenfalls. Es wird verwendet, wenn seitens des zuständigen Agenten die Vermutung besteht, der Fall könnte ungewöhnliche Charakteristika aufweisen.«
»Ungewöhnliche Charakteristika« oder UC war der FBI-Euphemismus für seltsame, übernatürliche und schlichtweg okkulte Dinge. Außerdem waren sie mein momentaner Zuständigkeitsbereich und, wie ich zu befürchten begann, womöglich das bestimmende Element meiner künftigen Laufbahn.
»Wofür steht es?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Harris. »Aber es sollte ausschließlich auf dringliche Situationen angewandt werden. Sie haben sich Patrick Hendersons Akte angeschaut. Halten Sie ihn für glaubwürdig?«
Ich sagte, ich hätte zwar gern erfahren, aus welchen medizinischen Gründen er so früh aus dem Dienst ausgeschieden war, aber nach den übrigen Informationen schien er seine Arbeit unauffällig und gewissenhaft gemacht zu haben. Und es gab keine Hinweise darauf, dass er etwa schon früher Scherzanrufe bei uns getätigt hätte, also hielt ich ihn tendenziell für vertrauenswürdig.
»Das entspricht auch meiner Einschätzung«, sagte Harris.
»Ich denke, wir sollten zumindest hören, was er zu sagen hat«, sagte ich.
Harris nickte. Uns beiden war bewusst, dass in den Akten des FBI besorgniserregende Lücken klafften, wenn es um »ungewöhnliche Charakteristika« ging. Dass in einer Institution, deren Hauptaufgabe die Beschaffung von Informationen war, solche zurückgehalten wurden, gefiel uns gar nicht.
»Er scheint zu erwarten, dass wir jemanden zu ihm raufschicken«, sagte Harris.
Dringend, hatte Henderson gesagt. Es muss wirklich sofort jemand kommen und eine Einschätzung vornehmen.
»Wenn wir ihn schon ernst nehmen«, sagte ich, »dann sollten wir ihn wirklich ernst nehmen. Ich könnte morgen hinfliegen und eine ›Einschätzung‹ machen. Falls ich feststelle, dass UC im Gange sind, bin ich vor Ort und kann weitere Schritte einleiten.«
Harris nickte. »Das ist das Mindeste. Und angesichts der beklagenswerten Mängel in unseren Akten könnte es sinnvoll sein, eine Quelle mit ›Keller‹-Erfahrung zu konsultieren, die vielleicht ein paar Lücken schließen kann.«
Quellen sind ungemein wichtig für uns. Das FBI rühmt sich, eine informationsfokussierte Organisation zu sein, und Agenten werden ebenso nach Menge und Qualität ihrer Informanten bewertet wie nach der Güte ihrer Fallbearbeitungen. Harris drängt zwar schon lange auf mehr Ressourcen, das Übernatürliche hat in der Führungsetage aber immer noch keinen sonderlich hohen Stellenwert, deshalb müssen wir einstweilen mit dem auskommen, was wir kriegen können.
Zum Glück ist Washington ein ebensolcher Anziehungspunkt für Spinner wie Los Angeles. Ich habe hier schon einige nützliche Informationsquellen aufgetan, seit ich in der, wie Mama so schön sagt, Jauchegrube der Nation arbeite. Mama kann staatlichen Institutionen nicht viel abgewinnen; Ausnahmen sind nur das Militär, die Post und in jüngster Zeit Medicare.
Meine Quelle Cymbeline Moonglum (tatsächlich ihr Geburtsname, ich habe das verifiziert) war dem FBI gegenüber ebenso misstrauisch wie meine Mama, aber aus diametral entgegengesetzten politischen Überzeugungen. Sie arbeitete bei einer Umweltschutzorganisation in der Nähe des McPherson Square, und ich bezeichne sie als Informantin, weil es nicht gern gesehen wird, wenn wir notorische Klatschbase auf unsere Spesenabrechnungen setzen. Außerdem war sie eine Hexe, also, eine echte. Und deshalb rief ich sie an, sobald ich wieder an meinem Schreibtisch saß, und verabredete mich mit ihr zum Mittagessen.
»Wenn ich gewusst hätte, dass das FBI zahlt«, sagte Cymbeline, »hätte ich ein schickeres Lokal vorgeschlagen.«
Gerade war es uns gelungen, in einem Coffeeshop an der 14th Street trotz des Mittagsandrangs, von dem sämtliche Fenster beschlagen waren, einen der gebeizten Kiefernholztische zu ergattern. Es war so ein Laden mit Avocadotoast auf der Speisekarte, und der Kaffee kam in der eigenen kleinen Cafetière samt Kärtchen, woher er stammte und wie fair gehandelt er war. Man bekam zwar auch einen anständigen Hamburger Royal, ohne dass sie Grünkohl oder Quinoa reintaten, aber man spürte, dass sie sich nur mühsam zurückhielten.
Und für meine Verhältnisse war der Laden teuer genug, danke auch.
»Erst mal muss ich es selber auslegen«, sagte ich.
Cymbeline Moonglum war Ende dreißig, hochgewachsen und, wenn man sah, wie sie ihren Cheeseburger mit Fritten hinunterschlang, absurd dünn. Gekleidet war sie im klassischen Washington-Outfit, dunkelblaues Kostüm und pinke Bluse, aber hinzu kam die silberne Kette mit dem keltischen Knotenanhänger. Er strahlte Macht aus. Das spürte ich, weil ich darin geschult bin, das zu erkennen, was unter Eingeweihten Vestigia genannt wird – die Spuren, die das Magische hinterlässt.
Cymbeline streckte die Hand nach meinen Fritten aus. »Darf ich?«
»Bedienen Sie sich«, sagte ich. Sie bediente sich. »Was wissen Sie über Wisconsin?«
»Furchtbar belastetes Wasser«, sagte sie. »Vor allem PFOS, das aus alten Mülldeponien sickert. Hochgiftig, nicht biologisch abbaubar, reichert sich in Lebewesen an. Gehen Sie bloß nicht in den Seen dort schwimmen.«
»Und sonst?«, fragte ich.
»In den letzten Jahren wieder vermehrt Pumasichtungen. Gibt Hoffnung.«
Dieses Spielchen lief bei jedem unserer Treffen ab. Keine Ahnung warum, anscheinend verschaffte es Cymbeline eine Art seltsamer Befriedigung, mich auf die Folter zu spannen. Ich nahm es gelassen, da ich wusste, dass sie ebenso scharf darauf war, mir den neuesten Klatsch und Tratsch zu erzählen, wie ich, ihn zu hören.
»Interessanter für Sie ist vielleicht«, sagte sie, »es gibt Gerüchte, dass die Tiergeister zurückkehren.«
»Zum Beispiel diese Pumas?« Ich brachte meine Fritten außer Reichweite ihrer lauernden Finger.
»Die wohl eher nicht«, sagte sie. »Aber eine alte Freundin von mir in New Hampshire …« So wie sie »alte Freundin« betonte, war zu ahnen, dass sie eine Hexenkollegin meinte. »… meinte, es gebe Anzeichen, dass manche der Bären dort Manifestationen sein könnten.«
Manifestation, das hieß auf Cymbelinisch so viel wie Geist oder Gottheit eines Ortes. Genius loci würde mein britischer Kollege Peter Grant sagen – auch nur ein abgehobener Name für »Ortsgeist«.
»Sie sagt, man erkennt deutlich, dass sie von anderen Bären als Autorität angesehen werden. Und vielleicht sogar von manchen der Menschen dort. Man bringt ihnen Opfer, die zu guten Ernten und gesunden Tierbeständen führen.« Cymbeline behauptete, solche Geister schössen plötzlich überall in Nordamerika aus dem Boden. »Überall, wo die Bevölkerungsdichte niedrig ist. Und eins sag ich Ihnen, wenn Sie mit denen Streit suchen, sind Sie am Arsch.«
Ich muss das Gesicht verzogen haben oder so, denn sie lachte auf. »Kaum zu glauben, dass Sie beim FBI sind. Oder sagen die Verbrecher etwa nicht mehr ›am Arsch‹?«
»Kraftausdrücke mag ich einfach nicht«, sagte ich. »Das ist so unnötig.«
»Und klassisches Fluchen?«
Aber solche Diskussionen – über Paganismus, Christentum und das, was Cymbeline meine haarsträubende Doppelmoral nennt – hatten wir schon früher gehabt, also lenkte ich das Gespräch wieder auf Genii locorum und Manifestationen. »Gibt’s in Wisconsin sonst noch was Besonderes?«
»Abgesehen von den Pumas?«
»Abgesehen von den sprechenden Tieren.«
»Wer hat gesagt, dass sie sprechen können?«
Ich schob Cymbeline meine Fritten wieder hin. Sie grinste und griff zu. »Agent Reynolds, glauben Sie wirklich, Sie können mich mit Ihren übriggebliebenen frittierten Kartoffelsnacks bestechen?«
»Wisconsin«, sagte ich.
Cymbeline verleibte sich ruckzuck die restlichen Fritten ein. »In letzter Zeit nichts. Ich kenne nur Geschichten aus den alten Zeiten, also damals, als da die Grenze war.« Nämlich über Zusammenstöße zwischen britischen Magiepraktizierenden und einheimischen Medizinmännern während des Krieges von 1812, auch wenn sie ziemlich vage blieb, wer da eigentlich gegen wen gekämpft hatte und wann überhaupt der Staat Wisconsin gegründet worden war. Ich muss zugeben, ich hatte auch eine halbe Stunde im Internet gebraucht, um es nachzulesen. Wisconsin, ursprünglich Teil des Northwest Territory, war im Verlauf eines halben Jahrhunderts nacheinander den Territorien Indiana, Illinois und Michigan zugeschlagen worden, ehe es 1836 zum eigenen Territory und 1848 zum Staat erklärt wurde. Die Gemeinde Eloise, zwischen Bayfield im Süden und dem Red-Cliff-Reservat im Norden gelegen, wurde erst in den 1850er Jahren gegründet.
»Es gibt Gerüchte, dass eine Expedition der Virgins dort spurlos verschwand«, sagte Cymbeline. »Wann, weiß ich nicht mehr genau. Soll ich ein bisschen herumfragen?«
»Das wäre schön«, sagte ich. Virgins, so nannte man salopp die Virginia Gentlemen’s Company, ins Leben gerufen von niemand Geringerem als Thomas Jefferson persönlich. Sie hatten als magischer Arm der US-Regierung gedient, ähnlich wie die Pinkertons als inoffizieller Geheimdienst und Bundespolizei.
»Hab gehört, in London wäre den Virgins ganz schön der Arsch aufgerissen worden«, sagte Cymbeline.
»Soweit ich weiß, ja.« Das war nicht ganz die Wahrheit. Tatsächlich war ich hingeschickt worden, um das klägliche Häuflein wieder nach Virginia zurückzuholen. Eigentlich hatte ich gehofft, die Briten würden ihnen den Prozess machen, aber die hatten mir in Gestalt von Peter Grant erklärt, dass sich die Mühe nicht lohnte.
Ich glaube ja eher, sie wollten nicht eingestehen, dass auf den Straßen von London ein regelrechter magischer Krieg ausgebrochen war.
»Früher waren das mal richtige Zauberer«, sagte Cymbeline. »Jetzt sind sie nur noch ein Großkonzern.«
Die bösen Auswirkungen der schleichenden Privatisierung staatlicher Organisationen und ihrer Umwandlung in Big Business waren eines von Cymbelines Steckenpferden. Um sie abzulenken, fragte ich, ob sie Genaueres über die vermisste Expedition der VGC wüsste.
»Nur, dass es am Lake Superior passiert sein muss, weil sie per Boot unterwegs waren. Sie waren in Sault Ste. Marie gestartet – halt, gerade fällt mir ein, das muss irgendwann in den 1840er Jahren gewesen sein, falls Ihnen das was nützt – und kehrten nie zurück.«
»Das ist alles?«
»Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich stimmt.«
»Warum nicht?«
»Weil es angeblich eine große Expedition gewesen war, mehrere Boote, Pferde, Späher, einheimische Führer. Da sollte man doch denken, seit damals hätte irgendwer mal eine Spur davon finden müssen. So große Expeditionen verschwinden nicht einfach komplett.«
2
Am nächsten Morgen flog ich nach Minneapolis-Saint-Paul und mietete mir einen Toyota 4Runner, dasjenige der verfügbaren Modelle, bei dem mir das Risiko am niedrigsten schien, vom Highway geweht zu werden. Es war ein eiskalter und strahlend sonniger Tag, und bis Spooner behielt ich wegen des grellen Lichts die Sonnenbrille auf. Dort holte ich mir in einem exzentrischen kleinen Restaurant am Weg, dessen Tresen von einem ausgestopften Bären bewacht wurde, einen Kaffee und ein sehr anständiges Po’Boy-Sandwich. In der halben Stunde, während ich drin war, bezog sich der Himmel, und es begann zu schneien.
Der Highway 63 war geräumt und gestreut, und der Toyota hatte Ganzjahresreifen, daher konnte ich trotz des zunehmenden Schneefalls konstant bei 80 km/h bleiben und erlebte nur eine Schrecksekunde, als ein Idiot in einem Chevy Malibu mich überholte, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und an die Leitplanke prallte. Ich fuhr ganz langsam vorbei und spähte hin, ob er Hilfe brauchte, aber er stieg sofort aus dem Wagen; im Rückspiegel sah ich ihn noch eine Weile trübsinnig herumstehen.
Nach dem Essen mit Cymbeline hatte ich mit Special Agent Sean Doughty von der Außenstelle Wausau telefoniert und ausgemacht, dass er ebenfalls nach Eloise kommen und mich dort treffen würde. »Nehmen Sie unbedingt warme Sachen mit«, sagte er. »Für Red Cliff und Bayfield gibt es eine Unwetterwarnung.«
Was vielleicht erklärte, warum sowohl Patrick Hendersons Festnetznummer als auch die der Polizei von Eloise sofort auf die Mailbox umgeleitet wurden. Ich kontaktierte den County Sheriff der Region Bayfield; er sagte mir, das Telefonnetz sei wegen des heftigen Schneefalls zusammengebrochen, und versicherte, das sei im Januar nichts Ungewöhnliches.
Auf dem zweispurigen Highway, der am Seeufer entlang verlief, wurde mir klar, was die beiden meinten. Der Schnee fiel zwar leicht, aber unaufhörlich, man sah nur noch dreißig Meter weit. Ich verlangsamte immer mehr. Schon Bayfield erreichte ich deutlich später als geplant und konnte mir nur einen kurzen Stopp erlauben, um den Waschraum aufzusuchen und einen Kaffee zu trinken, dann ging es weiter.
Hinter Bayfield wurde es abrupt hügelig. Der Highway führte steil bergan auf einen Sattel zwischen zwei Kuppen. Garantiert war die Straße heute Vormittag schon geräumt worden, trotzdem verschwand sie bereits wieder unter Neuschnee, und an den steileren Stellen war ich heilfroh über den Allradantrieb.
Jenseits des Sattels betrug die Sichtweite noch höchstens sechs, sieben Meter, so dass ich von dem laut Website des Ortes malerischen Panoramablick nichts mitbekam. Falls der Berg Eloise Point, nach dem der Ort vermutlich benannt war, außer es war andersherum, irgendwo nördlich des Hafens majestätisch aufragte, dann sah ich jedenfalls nichts davon. Alles, was ich sah, war Schnee und nochmals Schnee, der mit jedem Augenblick mehr wurde.
Auf der Durchgangsstraße des Orts war der Schneepflug erst kürzlich gefahren; die abzweigenden Wohnstraßen waren ebenfalls irgendwann geräumt worden, inzwischen aber wieder unter Schnee begraben. Zum Glück wird in Nord-Wisconsin frühzeitig gestreut und das Räumen und Streuen dann mit grimmiger Entschlossenheit weiterbetrieben, komme, was wolle. Ich folgte der leicht abfallenden, gut befahrbaren Hauptstraße bis zum Seeufer und bog dann links ab, wo laut Navi das Gebäude liegen musste, in dem das Polizeirevier zusammen mit der übrigen Ortsverwaltung untergebracht war.
Das Gebäude war weg.
Später erfuhr ich, dass es sich um einen einstöckigen Backsteinbau gehandelt hatte, schlicht und robust. Ich habe schon Häuser gesehen, die von Bomben oder einem Lastwagen getroffen oder von einem sogenannten atypischen Erdfall verschluckt worden waren. Das hier sah einfach nur nach Tornado aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es im Winter überhaupt Tornados gab, aber Backsteinwände, die einfach im Ganzen umgeworfen wurden, das schrie nach Tornado.
Ich sprach ein kleines Gebet für diejenigen, die sich vielleicht darin befunden hatten, als es passierte. Nach meinem letzten Informationsstand waren noch immer weder der Polizeichef noch die Deputys erreichbar. Aber wenn sie da drin gewesen waren, warum wimmelte es hier nicht von Rettungskräften?
Nur ein Mann in einem schweren blauen Parka mit oranger Reflektorweste darüber machte Fotos von den Rathausüberresten.
Trotz der Kälte hatte er die Kapuze zurückgeschlagen. Er hatte im Nacken zusammengebundenes dichtes schwarzes Haar, ein schmales, gutaussehendes Gesicht und einen dunklen Teint.
Als er den Toyota kommen hörte, drehte er sich um, bedeutete mir mit erhobener Hand anzuhalten und deutete auf den Boden ein Stück vor dem Auto. Ich hielt an und stieg aus. Worauf er gezeigt hatte, war ein Trümmerstück aus weißem Material mit gesplitterten Rändern. Mit Schrecken erkannte ich, dass ich einen Teil des Rumpfs eines kleinen Segelboots vor mir hatte, das offensichtlich aus dem Wasser gehoben und auf die Straße geschmettert worden war. Nun, da ich wusste, worauf ich achten musste, bemerkte ich unter dem Schnee weitere Trümmer.
Gut, dass ich nicht hineingefahren war. Das FBI wäre nicht erfreut gewesen, wenn die Kaution für den Wagen futsch gewesen wäre.
Ich wartete, während der Mann sich zwischen dem Schutt zu mir durchschlängelte. Auch ich trug meinen Parka, spürte nun aber sehr deutlich, dass ich weder meine Thermounterwäsche noch Stiefel und noch nicht einmal Handschuhe angezogen hatte. Die Luft war eisig – wäre ein Wind aufgekommen, es wäre gefährlich kalt geworden.
»Sind Sie vom FBI?«, fragte er. »Pat meinte, es käme ein Fed direkt aus Washington.«
Ich sagte, ich sei Special Agent Reynolds vom FBI, und beließ es dabei, auch wenn ich mich fragte, wer Pat sein mochte. Der Mann streckte mir eine behandschuhte Hand hin. »William Boyd. Meteorologe. Aus Madison; ich bin hier, um das verrückte Wetter zu untersuchen. Aber keine Sorge, ich bin kein Hobbit.« Er grinste, als müsste ich darauf irgendwie reagieren, aber mir war ein Rätsel, was er meinte.
»Wer ist Pat?«, fragte ich nun doch.
»Deputy Patricia Larson. Vom Bayfield County Sheriff Office in Washburn. Sie koordiniert die Behelfseinsatzzentrale.«
»Könnten Sie mir sagen, wo die ist?« Ich musste schreien, weil vom See her plötzlich ein frostiger Wind aufheulte.
Boyd zeigte nach links auf ein Areal, das möglicherweise ein Parkplatz war. »Da hinten«, brüllte er zurück.
Ich stieg wieder ins Auto. Boyd ging mir zu Fuß voraus und lotste mich auf eine durch ein großes Bootshaus windgeschützte Fläche. Am Rand befand sich eine Reihe von dicht nebeneinander stehenden, vorn offenen Schuppen, die derzeit als Garagen dienten. Am Ende stand ein leuchtend oranger Bagger mit Schneeketten und anmontiertem Schneepflug, daneben ein weißer Ford Explorer mit dem Logo des County Sheriffs. Ich parkte meinen Mietwagen zwischen ihm und einem Ford F150, der aussah, als hätte er sich in seinem ereignisreichen Leben schon mindestens zweimal überschlagen.
Dann nahm ich mir die Zeit, meine Stiefel anzuziehen. Ich hatte sie schon bestimmt drei Jahre nicht mehr getragen, und sie knarrten ein bisschen, als ich sie über die dicken Wollsocken zog, von denen mir meine Mama beharrlich zu jedem Weihnachten ein Paar schickt. Nach kurzem Zögern setzte ich mir auch die dazu passende Bommelmütze aus demselben Weihnachtspaket auf und zog sie tief über die Ohren. Ich hasse kalte Ohren.
Draußen sah ich Boyd vor dem Bootshaus stehen und mit zusammengekniffenen Augen zum Himmel spähen; Schneeflocken fielen auf sein aufwärtsgewandtes Gesicht. Ich persönlich bemerkte nur die schweren sturmgrauen Wolken, die die Dächer der umliegenden Gebäude zu streifen schienen. Mit dem festen Vorsatz, so bald wie möglich meine Thermounterwäsche anzuziehen, stieg ich aus. Wenigstens war der Wind wieder abgeflaut.
»Wissen Sie, was passiert ist?«, fragte ich Boyd, als ich bei ihm angelangt war.
»Eistornado«, sagte er. »Kam heute Morgen um etwa Viertel nach sieben vom See herein.«
Ich sah zu den Überresten der Gemeindeverwaltung hinüber. »Ich wusste gar nicht, dass es im Winter Tornados geben kann.«
Boyd grinste – er hatte ein ansteckendes Grinsen. »Die sind auch unwahrscheinlich selten. Eigentlich dürfte bei Kälte gar nicht genug Energie in der Umgebung vorhanden sein, um die richtigen Bedingungen zu schaffen. Und auf den Satellitenbildern war keine Superzelle zu sehen.«
Eine Windbö erfasste uns, und meine Nase wurde taub. Seine auch, nahm ich an, denn er nickte in Richtung eines solide wirkenden Gebäudes neben dem Bootshaus. »Gehen wir lieber rein.«
Er führte mich zu dem großen spitzgiebeligen Schuppen, der vollkommen unversehrt wirkte, obwohl er sich keine zehn Meter neben der Gemeindeverwaltung befand, öffnete eine Seitentür und winkte mich hinein. Drinnen kam es mir nicht viel wärmer vor als draußen. An einer Wand stand unter schmutzigorangen Planen etwas, was aussah wie ein großer Bootsrumpf. In der Mitte des Raums waren einige Klapptische aufgestellt, auf denen ordentlich aufgereiht mehrere Stapel Ausrüstung lagen, darunter ein halbes Dutzend Schrotflinten und ein Ladegerät für Walkie-Talkies. Vor einem Gas-Heizofen standen Klappstühle, über die nasse, dampfende Kleider gebreitet waren, weshalb es intensiv nach feuchter Wolle roch. Neben dem verhüllten Bootsrumpf standen mehrere Reserve-Gasflaschen, in sicherer Entfernung von dem Heizofen und anderen potenziell feuergefährlichen Dingen. Eine junge Frau in der Uniform eines Deputy Sheriff ging gerade die Vorräte durch und machte sich Notizen auf einem Klemmbrett.
»Pat«, rief Boyd, und sie drehte sich um. Sie hatte zu einem praktischen französischen Zopf geflochtenes blondes Haar und blaue Augen und sah aus, als sollte sie eigentlich beim Cheerleadertraining in der High School sein. Als sie uns sah, hellte sich ihre Miene auf. »Mr. Bear.«
»Boyd«, sagte Boyd. »Und das ist Special Agent Reynolds.«
»Deputy Patricia Larson«, sagte die Frau und streckte mir die Hand hin. Sie trug dünne Innenhandschuhe aus weichem Stretchmaterial. Ich war sofort neidisch und wünschte, ich hätte mir auch so ein Paar besorgt.
»Kimberley«, ergänzte ich.
»Bill«, gab Boyd zurück.
»Hören Sie, Billy«, sagte Deputy Larson und ignorierte seinen Seufzer, »gerade habe ich aus Washburn erfahren, dass der 13 von der Princes Ridge bis südlich des Red-Cliff-Reservats gesperrt wurde.«
Boyd sah mich an. »Da waren Sie wahrscheinlich eine der Letzten, die durchkamen.«