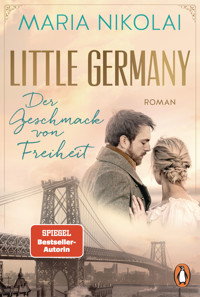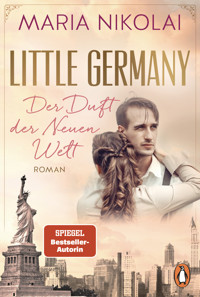9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schokoladen-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine Zeit voller Verführungen. Eine Familie, die ihren Traum retten muss.
Stuttgart, 1926: Die junge, abenteuerlustige Serafina zieht zu ihrem Halbbruder Victor in dessen prächtiges Familienanwesen, das alle nur »Die Schokoladenvilla« nennen. Denn die Rothmanns sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für ihre feinen Schokoladenkreationen, von denen sich auch Serafina nur zu gern verführen lässt. Mit ganzem Herzen stürzt sie sich in die Verlockungen der aufregenden neuen Zeit, und als sie den attraktiven Anton kennenlernt, verliebt sie sich Hals über Kopf. Doch Anton ist im Begriff, sich mit einer anderen zu verloben. Derweil wird das Schokoladenimperium der Rothmanns durch heimtückische Sabotageakte bedroht – und Serafina von einem dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit eingeholt ...
Der verführerische 2. Teil der erfolgreichen Bestsellersaga.
Das Taschenbuch in hochwertiger, veredelter Romance-Ausstattung.
Lesen Sie gleich weiter ...
Band 3: »Die Schokoladenvilla. Zeit des Schicksals«
... und ganz neu erschienen:
»Töchter der Hoffnung. Die Bodensee-Saga« – Der Auftakt von Maria Nikolais neuer Trilogie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Schokoladenvilla in der Presse:
»Unheimlich gut recherchiert. Man bekommt sehr viele Informationen darüber, wie in Stuttgart zu dieser Zeit gelebt wurde. Auch was fürs Herz, ein richtig schöner Sofaschmöker.« SWR
»Leidenschaft zum Lesen.« Closer
»Liebevoll erzählt und genau das Richtige für kuschelige Stunden.« Neue Welt
»Der perfekte Mix aus Schokolade, Historie und Liebesgeschichte.« Nürtinger Zeitung
»Süßer Auftakt einer verführerischen Familiensaga.«TV für mich
Außerdem von Maria Nikolai lieferbar:
Die Schokoladenvilla
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
MARIA NIKOLAI
GOLDENEJAHRE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 by Penguin Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Cover: Favoritbüro
Covermotiv: © Ildiko Neer/Trevillion Images; Valery Shanin/Shutterstock,
sakdam, Nadiia Korol, BK foto, Bokic Bojan, PRILL/Shutterstock
Redaktion: Sarvin Zakikhani
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23712-7V006
www.penguin-verlag.de
Den Abenteuern des Lebens
1. Kapitel
Stuttgart, Ende April 1926
»Fräulein, wachen Sie auf!«
Die freundliche Stimme des Schaffners drängte sich ungebeten in Serafinas Träume. Verschlafen blinzelte sie ihn an. »Sind wir schon da?« Es erschien ihr unwahrscheinlich, das Quietschen der Bremsen überhört und das holpernde Ruckeln nicht bemerkt zu haben, das zuverlässig anzeigte, dass der Zug zum Stillstand kam.
Der Schaffner schmunzelte. »Wir sind in Stuttgart, das stand als Ziel auf Ihrer Fahrkarte. Und wenn Sie nicht aussteigen, fahren Sie mit uns weiter an den Bodensee.«
»Oh!« Serafina war nun schlagartig wach, stand auf, strich notdürftig ihr Kleid zurecht und schüttelte ihr zu einem akkuraten Bubikopf geschnittenes, rabenschwarzes Haar.
»Ich helfe Ihnen mit dem Gepäck«, bot der Schaffner an und holte Serafinas Koffer aus der Gepäckablage. Währenddessen zog sie rasch ihre Handschuhe an, nahm Handtasche und Mantel und verließ das Abteil. Der Schaffner folgte mit den beiden Koffern, stieg hinter ihr aus dem Waggon und reichte ihr das Gepäck.
»Vielen Dank«, sagte Serafina und nahm ihm die Koffer ab.
»Gern geschehen«, antwortete der Schaffner, »ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, Fräulein.« Er tippte sich an die Schirmmütze.
Serafina nickte ihm noch einmal dankend zu und folgte anschließend dem Strom der Mitreisenden, die den Bahnsteig entlang zum Kopfende der Gleise eilten. Der rauchige Dampf der Lokomotive lag noch in der Luft, auch wenn er zwischen den Öffnungen der einzelnen Gleisüberdachungen rasch abzog. Durch eines der großen, runden Portale gelangte sie in eine geräumige Bahnhofshalle.
Während rechts und links von ihr die Menschen weiter den Ausgängen zueilten oder Angehörige begrüßten, blieb Serafina stehen. Sie sollte abgeholt werden, konnte im Moment aber noch niemanden ausmachen, der erkennbar nach ihr suchte. Dann musste sie wohl noch warten.
Sie setzte ihre Koffer ab, die gut gefüllt und dementsprechend schwer waren. Fast schien es, als schleppe sie in ihnen nicht nur ihre Kleidung, sondern auch all den Ballast der letzten Wochen mit – den kummervollen Abschied von ihrem Vater, die schreckliche Nacht im Metropol, die Ungewissheit, was sie in Stuttgart erwartete.
Ein leichter Kopfschmerz kündigte sich an. Vermutlich hatte sie zu lange nichts gegessen und zu wenig getrunken. Sie rieb sich den Nacken und versuchte, die sorgenvollen Gedanken zu verdrängen. Irgendwie würde es weitergehen. Es musste.
Sie sah sich um.
Der Stuttgarter Bahnhof war ganz neu, wirkte mit seinen geraden, aber mächtigen Formen luftig und trutzig zugleich. Reger Lärm und eine unübersehbare Baustelle zeugten davon, dass hier noch längst nicht alles fertiggestellt war.
Ihr Blick fiel auf einen knallrot lackierten Automaten, mannshoch, der nur wenige Meter von ihr entfernt an einer Wand stand und den markanten Schriftzug Rothmann trug. Ein erster Willkommensgruß in der Fremde – denn ganz offensichtlich handelte es sich hier um einen Schokoladenautomaten aus der Firma ihres Halbbruders Victor.
Ein Stück Schokolade würde bestimmt gegen das Kopfweh helfen. Serafina trug ihr Gepäck ein Stückchen weiter, stellte es neben den Automaten und suchte dann in ihrer Handtasche nach ihrem Portemonnaie.
Sie hatte gerade ein Zehnpfennigstück herausgekramt und schickte sich an, es in den Münzschlitz zu stecken, als jemand seitlich hinter sie trat. Irritiert drehte sie sich um.
»Da hatten wir wohl beide denselben Einfall!«, meinte eine junge Frau, warf herausfordernd ein Geldstück in die Luft und fing es wieder auf. »Mais après vous – bitte, nehmen Sie sich zuerst.«
Serafina schloss intuitiv die Hand um ihre Zehnpfennigmünze und musterte ihr Gegenüber. Die dunkle, rauchige Stimme mit dem leicht französischen Akzent wollte nicht so recht zu diesem jugendlichen Gesicht, wohl aber zum schwarzen Anzug mit Weste und Krawatte passen, den die Frau trug. Auf ihrem kurz geschnittenen, glatten braunen Haar saß ein dunkler Herrenhut. Lediglich eine weiße Hemdbluse kontrastierte mit den gedeckten Farben der übrigen Kleidung.
Serafina zögerte noch kurz, zuckte dann mit den Schultern, wandte sich wieder dem Automaten zu und warf das Geld ein. Augenblicklich ertönte ein Kinderlied: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Dazu setzte sich das Rad einer Mühle in Bewegung, die in einem verglasten Schaukasten zu sehen war. Das Mühlrad drehte sich einige Male, während die emaillierte Figur eines Müllers herbeieilte und eine kleine bemalte Blechdose in das Ausgabefach schob. Serafina nahm sie heraus und öffnete den Deckel.
»Hm, die sehen lecker aus!« Die junge Frau beugte sich ebenfalls über die Dose. »Un bonbon au chocolat? Mit Füllung?«
»Woher soll ich das wissen?«, erwiderte Serafina ein wenig schroff. Sie fühlte sich in diesem Augenblick bedrängt, doch als sie den begeisterten Ausdruck in den dunkelbraunen Augen der jungen Frau sah, verschwand die unangenehme Empfindung. »Probieren wir?«, fragte sie milder.
»Gern!«
Sie nahmen sich beide eines der runden, glänzend braunen Schokoladenbonbons.
»Ja, sie sind gefüllt«, stellte die junge Frau erfreut fest. »Mit Vanille.«
»Meines schmeckt nach Frucht, leicht säuerlich«, antwortete Serafina. »Ich glaube, Johannisbeeren.«
»In jedem Fall sind sie köstlich«, schloss die junge Frau. »Übrigens: Ich bin Lilou!« Sie zwinkerte ihr zu.
»Ich bin Serafina.«
»Ein schöner Name«, meinte Lilou spontan. »Die Feurige!«
»Die Feurige?«
»Ja, das ist die Bedeutung von Serafina. Sie passt zu dir!« Lilou war formlos zum Du übergegangen.
Serafina lachte verlegen. »Sie … du kennst mich doch gar nicht!«
»Das mag sein, aber ich kenne mich mit Menschen aus.«
»Ach so … also gut. Und was bedeutet Lilou?«
»Ich heiße eigentlich Louise, das bedeutet Kämpferin. Aber Louise nennt mich niemand«, erklärte Lilou. »So, und jetzt hole ich mir auch von diesen Schokoladenbonbons. Sie sind fein!«
Serafina trat einen Schritt zur Seite, und Lilou zog sich ebenfalls eine Dose.
»Woher kommst du, Serafina?«, fragte sie, als die Musik wieder verstummt und das Mühlrad zum Stillstand gekommen war.
»Aus Berlin. Und du?«
»Ich komme aus Paris.«
»Aus Paris?« Serafina horchte auf. Sie hatte den ganz leichten französischen Akzent inzwischen herausgehört, doch dass Lilou Pariserin war, machte diese Begegnung noch einmal interessanter. »Und weshalb bist du hier in Stuttgart?«
»Kennst du Josephine Baker?«
Serafina schüttelte den Kopf.
»Non?« Lilou blinzelte ungläubig. »Sie ist Tänzerin, die Größte! Du musst sie unbedingt kennenlernen. Weißt du, wo der Friedrichsbau ist?«
»Nein. Ich bin eben erst in Stuttgart angekommen.«
Lilou sah auf Serafinas Koffer und lachte. »Ja, natürlich. Das war dumm von mir, entschuldige. Der Friedrichsbau ist ein Theater hier in Stuttgart. Dort gibt sie ein Gastspiel nächste Woche. Das musst du dir unbedingt ansehen!«
»Ich muss erst einmal abwarten …«, meinte Serafina zurückhaltend.
»Du wirst etwas verpassen, wenn du nicht kommst!« Lilou griff in die Innentasche ihrer Anzugjacke, holte einen Stift und eine weiße Karte hervor und notierte einige Dinge. »Hier«, sagte sie dann und hielt Serafina die beschriebene Karte hin, »das ist mein Name, Lilou Roche. Ich habe auch den Namen unseres Hotels vermerkt. Übrigens reisen wir übernächste Woche nach Berlin weiter.«
»Wirklich? Nach Berlin?«
»Ja. Josephine tritt seit dem Jahresanfang regelmäßig im Nelson-Theater auf.«
Jetzt erinnerte sich Serafina an eine entsprechende Ankündigung und die Berichte in den Zeitungen. »Josephine Baker – sie hat eine andere Hautfarbe, nicht wahr?«
Lilou lächelte breit. »Ah, du kennst sie doch!«
»Sie ist Stadtgespräch in Berlin!«, sagte Serafina. Sie spürte, wie eine flirrende Aufregung von ihr Besitz ergriff. Die Welt der Revuen und des Theaters besaß eine gewisse Anziehungskraft – zugleich hatte sie etwas Abstoßendes. Sie war gefährlich, die Demimonde – und ihr Vater darauf bedacht gewesen, sie davor zu schützen.
Serafina sah auf die Karte. »Hm – Hotel Marquardt in der Schloßstraße. Ich kenne mich nicht aus in Stuttgart.« Sie überlegte kurz. »Und ich weiß auch nicht, ob es passend wäre, hier eine Revue zu besuchen.«
»Warum denn nicht? Alle wollen Josephine Baker sehen!« Lilou klatschte in die Hände. »Überleg es dir, ma chère Serafina. Jetzt muss ich weiter. Bis bald!« Damit warf sie Serafina eine Kusshand zu und verschwand rasch im Bahnhofstrubel.
Serafina steckte die Karte ein und schüttelte ungläubig den Kopf. Ausgerechnet hier in Stuttgart, weit weg vom ungestümen Berlin, traf sie an einem Schokoladenautomaten im Bahnhof auf ein Mitglied von Josephine Bakers Entourage. Manchmal hielt das Leben unerwartete Überraschungen bereit. Sie nahm sich noch ein Schokoladenbonbon. Der Kopfschmerz war verflogen.
Während sie die zartbittere Süße auf ihrer Zunge schmeckte und darüber nachdachte, dass Lilous direkte und frische Art weder zu ihrem strengen Anzug noch zu ihrer Stimme passte, sah sie einen älteren Herrn auf sich zukommen.
»Fräulein Rheinberger?« Er trug eine dunkle Chauffeursuniform mit passender Schildmütze, die auf einem schlohweißen Haarkranz saß.
»Ja?« Serafina schluckte die Schokolade hinunter.
»Mein Name ist Theo, verzeihen Sie bitte die Verspätung. Ich bin der Chauffeur der Rheinbergers.«
»Guten Tag, Theo«, antwortete Serafina, froh, nicht länger warten zu müssen.
»Herr Rheinberger lässt ausrichten, dass er gern selbst gekommen wäre, aber in der Fabrik nicht abkömmlich ist«, meinte Theo und wandte sich ihren Koffern zu. »Darf ich?«
»Ja, gern.«
Serafina folgte ihm durch ein weiteres Portal, das in eine mit Sandstein verkleidete Empfangshalle führte. Durch großzügige Fenster fiel das Sonnenlicht herein und zauberte eine heitere Atmosphäre in den nahezu sakral anmutenden hohen Raum. Über eine breite und von einem geschwungenen Geländer gesäumte Treppe ging es hinunter, am Bahnhofsschalter, der Post und einem Kiosk vorbei, zum Ausgang.
Lärmen und Hupen belebte die Kulisse, als sie die Doppeltür passiert hatten und auf den Bahnhofsvorplatz traten.
»Kommen Sie!« Theo deutete nach rechts, wo vor einer imposanten Pfeilerhalle, die die blockigen Hauptgebäude des Bahnhofs verband, einige Kraftdroschken warteten.
Serafina folgte ihm und wäre beinahe über den Handkarren einer älteren Frau gestolpert, den sie inmitten des Fahrzeuggewirrs gar nicht gesehen hatte. »Passet se doch auf!«, tönte es an ihr Ohr. Ein Fahrradfahrer, der sich von der anderen Seite näherte, klingelte unwirsch.
Theo hatte zwischenzeitlich einen in dunklem Bordeauxrot lackierten Mercedes erreicht und damit begonnen, ihr Gepäck einzuladen. Als Serafina zu ihm aufschloss, hielt er ihr mit einer leichten Verbeugung den Wagenschlag auf. Sie stieg ein.
Im Innenraum des Automobils roch es nach Leder und Politur und sehr neu. Das Fahrzeug war sorgfältig gepflegt, kein Staubkorn verunzierte die Holzverkleidungen, und die Armaturen glänzten. Alles strahlte Noblesse und gediegenen Reichtum aus, genauso wie sie es erwartet hatte.
Victor war wohlhabend, das wusste Serafina. Wie oft hatte ihr Vater stolz von seinem einzigen Sohn erzählt, der in Stuttgart ein florierendes Unternehmen führte. Das wiederum hatte in ihr eine widersinnige Eifersucht ausgelöst, die sie sich selbst nie richtig erklären konnte – zumal sie sich weder für missgünstig noch für kleingeistig hielt. Dennoch war es ihr schwergefallen zu akzeptieren, dass es irgendwo auf dieser Welt außer ihr noch jemanden gab, dem ihr Vater nahestand, jemanden, den er achtete und offenkundig auch sehr liebte. Friedrich Rheinberger war sogar einen Schritt weiter gegangen: Sein Testament enthielt eine Verfügung, die Serafina nach seinem Tod in Victors Obhut gab – eine Vormundschaft, die erst mit ihrem einundzwanzigsten Geburtstag im Januar enden würde. An diesem Tag erhielte sie auch ihr Erbteil ausbezahlt.
Vater. Der Gedanke an ihn schmerzte.
Mit einem leisen Seufzen schluckte Serafina den Kloß hinunter, der plötzlich ihre Kehle zuschnürte, zog den Rock ihres hellbraunen Reisekleids zurecht, legte den Mantel über ihren Schoß und ihre Handtasche neben sich. Deren orangebraunes Kunstleder kontrastierte hübsch mit dem schwarzen Leder der Sitzbank, das sich durch die einfallende Sonne aufgeheizt hatte. Es war stickig, und nicht nur deswegen hoffte Serafina, dass die letzte Strecke ihrer Reise nicht allzu lang dauern würde. Sie fühlte sich wie gerädert, obwohl sie die letzten Stunden im Zug vornehmlich schlafend und dösend verbracht hatte.
»So, Fräulein Rheinberger.« Theo stieg nun ebenfalls ein und nahm auf dem Fahrersitz Platz. »Dann wollen wir mal. Sie werden sehen, sobald wir nach Degerloch hinaufkommen, ist es schön ruhig. Und die Luft dort ist ganz frisch. Da können Sie sich von der Reise erholen.«
Er startete den Wagen, wendete und fädelte sich geschickt in den unregelmäßigen Verkehr auf Stuttgarts Straßen ein.
Serafina lehnte sich zurück und ließ ihren Blick durch das Seitenfenster nach draußen wandern, doch die schmucken Gebäude zogen an ihr vorbei, ohne dass sie sie richtig wahrnahm. Immer wieder musste sie die erneut aufkommende Müdigkeit wegblinzeln, um nicht einzuschlafen.
Sie hatte sich gefügt in diesen letzten Willen ihres Vaters. Zunächst war der Gedanke, Berlin verlassen zu müssen, schrecklich gewesen. Inzwischen war sie froh, dadurch Abstand zwischen sich und die Ereignisse der letzten Tage dort zu bringen. In Stuttgart würde sie Ruhe finden, um darüber nachzudenken, wie ihr Leben weitergehen sollte.
Theo bog auf eine breite Panoramastraße ein, die sich bald in eleganten Kurven einen Berg hinaufzog, vorbei an gepflegten Stadthäusern, sattgrünen Weinbergen und prächtigen Villenanwesen, manche mit Türmchen. Hier wohnten zweifellos wohlhabende Bürger.
»Wir fahren gerade die Neue Weinsteige hinauf«, erklärte Theo, der ihr die Fahrt offenbar angenehm gestalten wollte. »Sehen Sie sich Stuttgart von hier oben an! So herrliche Ausblicke.«
»In der Tat«, erwiderte Serafina matt. Theo zuliebe richtete sie sich dennoch auf, um auf die Stadt zurückzuschauen, die im Licht der allmählich untergehenden Sonne anmutig und friedlich dalag. Ganz anders als das lebhafte Berlin, das niemals Ruhe zu finden schien.
Sie überholten eine gelb lackierte Straßenbahn, die ebenfalls bergauf fuhr, und als sie schließlich die Filderhöhe erreicht hatten, bog Theo links in einen Ort ein, dessen dörfliche Anmutung Serafina einen Moment lang zweifeln ließ, ob sie sich noch auf dem richtigen Weg befanden. Sie kamen an Bauernhöfen, Handwerkerhäusern und Dorfwirtschaften vorbei, querten dann einen Gürtel aus Wiesen und Bäumen und befanden sich plötzlich inmitten einer Ansiedlung herrschaftlicher Wohnsitze.
Theo fuhr noch zwei Ecken weiter, dann wurde der Wagen langsamer, bog in eine kurze Zufahrt ein und passierte ein hohes Eisentor, das in Erwartung ihrer Ankunft weit geöffnet war. Bis zum Haus waren es nur wenige Meter.
»Da sind wir«, meinte Theo nicht ohne Stolz, als er das Automobil zum Stehen gebracht hatte. »Willkommen in Ihrem neuen Zuhause, Fräulein Rheinberger!«
Serafina ließ sich von ihm aus dem Wagen helfen. Während Theo sich wieder um ihr Gepäck kümmerte, blieb sie einen Augenblick lang stehen, um ihr neues Heim in Augenschein zu nehmen. Rasch kam sie zu dem Schluss, dass der markante, weitläufige Bau zwar vornehm und großzügig wirkte, zugleich aber eine pompöse Distanz ausstrahlte. Das Abendlicht konturierte die Fassade mit ihren Erkern und Vorsprüngen und nahm ihm somit ein wenig die Strenge. Was ihr gut gefiel, war die in einem zarten Gelb gestrichene Fassade, die hübsch mit den weiß abgesetzten Fenstern und Giebeln kontrastierte.
»Na, dann gehen wir mal hinein«, sagte Theo gut gelaunt, als er mit ihren beiden Koffern neben sie trat.
In diesem Moment flog die Haustür auf.
»Sie sind da!« Ein Mädchen im Schulalter eilte ihnen entgegen. Helle Locken waren nur mühsam in einem Zopf gebändigt.
»Ach, Viktoria, mach doch langsam!«, mahnte eine Frau, die im selben Moment im Türrahmen erschien. Der Kleidung nach handelte es sich um eine Angestellte des Hauses.
Das Mädchen ignorierte den Appell und lief weiter. »Du bist also meine Tante«, stellte es sachlich fest, als es vor Serafina stand und sie gründlich musterte. »Ich bin die Viktoria.«
»Ich bin Serafina.«
»Ja, ich weiß. Papa und Mama haben schon die ganze Zeit von dir erzählt.«
»Ach …«
»Lass das Fräulein Serafina doch erst einmal ankommen, Viktoria«, wandte Theo ein. »Sie hat eine lange Reise hinter sich.« Er nickte Serafina zu und machte Anstalten, zum Haus zu gehen.
»Ja, komm rein«, sagte Viktoria sofort. »Ich zeige dir dein Zimmer!« Sie lachte Theo gut gelaunt an.
Serafina bemerkte das liebevolle Schmunzeln des Chauffeurs. Dass Viktoria ihn mühelos um den Finger wickelte, war offensichtlich.
Die forsche Art des Mädchens gefiel ihr.
»Aber Vickyle, du bist mir eine!«, tadelte nun die gepflegte Frau in den Vierzigern, die das Mädchen nicht aus den Augen gelassen hatte. »Deine Mutter hat doch gesagt, dass du unseren Gast anständig begrüßen sollst.«
»Oh, es ist doch ganz wunderbar, dass Viktoria mich so herzlich willkommen heißt«, beschwichtigte Serafina. »Ich wäre genauso neugierig gewesen wie sie.«
»Siehst du? Du brauchst gar nicht so zu schimpfen, Dora«, erklärte Viktoria selbstbewusst. »Sie ist nämlich meine Tante!«
»Der gnädige Herr und die gnädige Frau sind noch in der Firma, sie haben heute einen Kakaolieferanten aus Übersee dort, aber wir erwarten sie in Kürze«, wandte die Frau sich nun an Serafina. »Ich bin Dora, die Haushälterin.«
Sie nahm Serafina den Mantel ab. »Möchten Sie sich vor dem Abendessen noch frisch machen, Fräulein Rheinberger?«
»Gern.«
»Ich bringe Sie auf Ihr Zimmer.«
»Nein, Dora, das mache ich!«, mischte sich nun Viktoria ein. »Das hab ich ihr gerade schon versprochen!«
»Na gut«, stimmte Dora zu. »Wir nehmen das Abendessen um halb acht im Speisezimmer ein. Ich warte dann in der Halle …«
»Jaja, wir kommen rechtzeitig«, sprach Viktoria dazwischen, nahm Serafina am Ärmel und zog sie mit sich durch die geräumige Empfangshalle zu einer breit geschwungenen Treppe.
Eine gute Stunde später ging Dora mit Serafina und Viktoria durch einen breiten Flur zum Speisezimmer des großen Hauses. Das feine Mosaik der Bodenfliesen schimmerte im Schein der elektrischen Messingleuchten, die in regelmäßigen Abständen an den hell gestrichenen und mit halbhohen weißen Paneelen verkleideten Wänden angebracht waren.
»Ich hoffe, dass es etwas Gutes zu essen gibt«, meinte Viktoria.
»Unsere Köchin kocht doch nur Gutes«, entgegnete Dora.
»Meistens. Aber den Fisch esse ich nicht gern.«
»Das liegt an deinem Geschmack, Vicky, und nicht an Gertis Art, ihn zuzubereiten.«
Serafina konnte Viktoria gut verstehen. Sie mochte auch keinen Fisch.
»So, hier sind wir, Fräulein Rheinberger«, sagte Dora und blieb vor einer zweiflügeligen Tür stehen. »Die Herrschaft ist bereits anwesend.« Sie klopfte und drückte die Messingklinke.
Warmes Licht begrüßte Serafina, als sie den Raum betrat.
»Serafina! Wie schön, dass du da bist!« Judith, die Frau ihres Halbbruders, kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Obwohl nicht mehr ganz jung, wirkte sie mit ihrem weich aufgesteckten dunkelblonden Haar und den feinen Gesichtszügen sehr attraktiv. Das wadenlange hellblaue Kleid mit Plisseerock, das sie trug, passte perfekt zu ihren Augen. Klarblau wie die von Viktoria, stellte Serafina fest. Nur der übermütige Schalk darin fehlte.
»Ja, Serafina, dem kann ich mich nur anschließen«, ergänzte Victor, der in diesem Moment hinter seine Frau trat. Ein gut aussehender Mann, groß und kräftig, mit ergrauten Schläfen. Er musste inzwischen in den Fünfzigern sein. »Herzlich willkommen in der Schokoladenvilla!« Dabei zwinkerte er Viktoria zu.
»Papa sagt immer Schokoladenvilla zu unserem Haus«, erklärte Viktoria, die neben Serafina stand, und verdrehte genervt die Augen. »Dabei ist es ein ganz normales Haus.«
Serafina spürte, wie sich ganz von allein ein Lächeln auf ihr Gesicht stahl und das vage Unbehagen beiseitewischte, das sie im allerersten Moment des Zusammentreffens verspürt hatte.
»Danke, dass ich hier sein darf«, erwiderte Serafina und ließ sich von Judith umarmen.
»Wie war die Reise?«, fragte Victor.
»Lang und langweilig«, antwortete Serafina, und Victor lachte.
»Das kann ich mir denken. Langes Stillsitzen ist nichts für uns Rheinbergers.«
»Nein, gewiss nicht.« Serafina spürte eine spontane Verbundenheit mit Victor, die sie erstaunte. Die ablehnenden Gefühle, die sie so oft beim Gedanken an ihn gehegt hatte, waren verschwunden.
»Du wirst sicher hungrig sein«, meinte Judith fürsorglich und bot ihr einen Platz an der stilvoll gedeckten Tafel an.
»Serafina, du sitzt neben mir!«, rief Viktoria und zeigte auf die andere Seite des Tisches.
»Viktoria!«, maßregelte Judith ihre Tochter.
»Jaja, Mama. Ich weiß. Entschuldigung.« Trotz dieser einlenkenden Worte wirkte Viktoria keineswegs zerknirscht, und Serafina hatte den Eindruck, dass das Mädchen nicht nur die Angestellten des Hauses, sondern auch ihre Eltern nach ihren Wünschen dirigierte. Selbst Victor verfolgte das Geschehen lediglich mit mildem Blick, während er eine Flasche Sekt öffnete und das perlende Getränk in die bereitstehenden Kelche füllte.
Serafina ertappte sich bei dem Gedanken, dass Viktoria etwas mehr Erziehung gewiss guttäte. Zugleich wurde ihr klar, dass sie und Viktoria sich in ihrem freigeistigen Wesen durchaus ähnelten.
»Wie alt bist du denn, Viktoria?«, fragte sie, nachdem sie Platz genommen hatten.
»Ich bin im Januar zehn Jahre alt geworden«, antwortete Viktoria, die nun aufrecht und unerwartet anständig neben ihr saß. »Und wie alt bist du?«
»Ich bin im Januar zwanzig Jahre alt geworden«, erwiderte Serafina. »Am achten, wenn du es genau wissen möchtest.«
»Ha, ich hab am siebzehnten. Da können wir ja jetzt immer zusammen Geburtstag feiern. Für den nächsten hab ich mir auch schon was ausgedacht: Ich möchte nach Paris fahren«, erklärte Viktoria, und ein ernster, fast trauriger Ausdruck wanderte plötzlich über ihr Gesicht.
»Warum nach Paris?«, fragte Serafina, unsicher, wo Viktorias Stimmungswechsel herrührte.
»Dort wohnt mein Bruder.«
»Unser Martin studiert dort am Konservatorium«, erläuterte Judith. Serafina fing ihren Blick auf und spürte, dass er nicht nur Viktoria schmerzlich fehlte.
»Weißt du«, wandte sie sich wieder an Viktoria, »dein Bruder ist zwar nicht hier bei dir. Aber du weißt, dass er wiederkommt. Oder du zu ihm fahren kannst. Und das ist doch schön. Zu wissen, dass du ihn auf jeden Fall wiedersehen wirst.« Denn er ist am Leben und nicht tot wie der Vater, setzte sie in Gedanken dazu.
»Ja, schon«, erwiderte Viktoria, der Serafinas Antwort nur ein schwacher Trost war. »Aber es dauert einfach immer so schrecklich lange.«
Victor räusperte sich. »Ich vermisse ihn auch«, sagte er, und Serafina war sich einen Moment lang unsicher, ob er damit seinen Sohn oder seinen Vater meinte.
»Aber«, fuhr er fort und griff nach seinem Sektglas, »heute trinken wir erst einmal auf die, die hier sind. Und auf unser Wiedersehen.«
Alle hoben ihr Glas. Viktoria, der Victor ebenfalls ein wenig eingeschenkt hatte, probierte neugierig einen kleinen Schluck und sagte ausnahmsweise nichts mehr.
»Liebe Serafina«, hob Victor schließlich an. »Auch wenn der Anlass dafür, dass du zu uns gekommen bist, ein sehr trauriger ist, freuen wir uns über deine Ankunft heute. Und auch darauf, einander in den nächsten Wochen besser kennenzulernen. Unser gemeinsamer Vater hat einige Verfügungen hinterlassen, die für mich vor allem seinen innigen Wunsch zeigen, uns beide, als seine einzigen Kinder, einander familiär verbunden zu wissen. Auch wenn wir nicht gemeinsam aufgewachsen sind, ja, uns kaum kennen, fällt es mir außerordentlich leicht, diesem Wunsch nachzukommen. Auf dich, Serafina. Und auf unseren guten Vater.« Bei den letzten Worten klang Victors Stimme belegt. Er prostete ihr zu.
»Danke.« Mehr brachte Serafina nicht heraus. Gerade einmal sechs Wochen waren vergangen, seit ihr Vater plötzlich zusammengebrochen und in ihren Armen gestorben war.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür.
Judith nickte der Köchin freundlich zu, die mithilfe eines Dienstmädchens eine große Terrine hereintrug und auf den Tisch stellte. Zu der feinwürzig duftenden Pastinakencremesuppe gab es frisch gebackenes Weißbrot.
Mit dem Essen kehrten Serafinas Lebensgeister zurück. Sie fühlte sich wohl in dem schönen Speisezimmer, das von einer verspielten, mehrarmigen Hängelampe ausgeleuchtet wurde. Die Möbel aus gediegenem Nussbaumholz waren mit Schnitzereien verziert, ihr Muster fand sich in den durchbrochenen Rückenlehnen der Stühle wieder, die sich um den massiven Esstisch gruppierten. Das zarte, helle Dekor der Wandtapete stand im Einklang mit den Stuhlpolstern. Obwohl Serafina die derzeit neu aufkommenden schlichten Formen bevorzugte, empfand sie die Einrichtung als ansprechend und geschmackvoll.
Auf die Suppe folgte gefüllte Kalbsbrust mit eigenartig geformten Nudeln, von denen vor allem Viktoria nicht genug bekommen konnte, denn sie ließ sich zweimal nachgeben.
»Magst du die Spätzle nicht?«, fragte sie, als sie Serafinas überraschten Blick bemerkte.
Serafina nickte. »Doch, sie schmecken wirklich gut. Ich kann nur nicht so viel davon essen wie du.« Diese Bemerkung verursachte allgemeine Heiterkeit.
»Ich weiß gar nicht, wo die Kleine die vielen Spätzle hinsteckt«, neckte Victor seine Tochter und fing sich eine einschüchternde Grimasse von Viktoria ein.
»Die schwäbische Küche hat mich von Anfang an überzeugt«, bekannte er dann und sah von Viktoria zu Judith. »Aber natürlich nicht nur die«, schob er hinterher und drückte die Hand seiner Frau. Judith lachte, und die Atmosphäre war nach dem kurzen Gedenken an Friedrich Rheinberger wieder heiter und entspannt.
Als Victor schließlich die Tafel aufhob und einen Digestif anbot, schüttelte Serafina den Kopf.
»Du bist sicherlich sehr müde«, meinte Judith verständnisvoll.
»Ja, das bin ich wirklich«, antwortete Serafina. »Es war ein langer Tag.«
»Dann gehst du jetzt auf dein Zimmer, und ich gebe Dora Bescheid, dass man dir noch ein Bad einlässt, bevor du dich schlafen legst. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
»Danke, Judith. Das hört sich ganz wunderbar an.«
Viktoria, die bei ihrer Mutter stand, bot an, sie wieder zu begleiten, aber Judith schüttelte den Kopf. »Serafina braucht jetzt ihre Ruhe. Und auch für dich ist der Tag bald zu Ende. Am besten, du machst dich schon bettfertig. Ich komme später und sage dir Gute Nacht.«
Zu Serafinas Verwunderung kam von Viktoria kein Widerspruch.
Judith ließ Dora holen, und wenig später genoss Serafina in einer großen, weiß emaillierten Wanne ihr Bad, dem ein duftendes Badesalz zugegeben worden war.
Während sie die Anstrengung der Reise im warmen Wasser abwusch, fiel ihr ein, dass sie die Post der letzten Tage in ihren Koffer gepackt hatte, ohne sie näher anzusehen. Das sollte sie trotz ihrer Müdigkeit noch nachholen. Vielleicht war etwas Wichtiges dabei.
Nachdem sie sich abgetrocknet hatte und in einen bereitgelegten seidigen Kimono geschlüpft war, suchte sie in ihrem Koffer nach den Briefen. Dann nahm sie sich noch ein Schokoladenbonbon aus der Dose vom Bahnhof und setzte sich auf ihr Bett, um die Schreiben durchzugehen.
Die meisten waren an ihren Vater adressiert, und Serafina beschloss, diese ungeöffnet an Victor weiterzugeben.
Ein Umschlag allerdings fiel ihr auf. Er war dick, trug weder Anschrift noch Absender und roch nach kaltem Zigarettenrauch. Sie hielt ihn einige Minuten unschlüssig in den Händen, dann riss sie ihn mit dem kleinen Finger vorsichtig an einer Seite auf.
Mehrere Fotografien fielen heraus. Als sie erkannte, was auf ihnen zu sehen war, lief es ihr kalt über den Rücken.
Sie hatte eine Ahnung gehabt und doch gehofft, dass es sich nicht so verhielte. Die Erinnerungen an diese Stunden, diese furchtbare Nacht, in der sie vollkommen die Kontrolle verloren hatte, waren verworren und diffus. Es erschien ihr surreal, dass es sich bei der Person auf den Bildern um sie selbst handeln sollte. Mit zitternden Händen zog sie ein Billett heraus, das zusammen mit den Fotografien in den Umschlag gesteckt worden war, zögerte aber, es zu lesen.
Niemand durfte die Bilder je zu Gesicht bekommen. Vor allem Victor nicht, der zu Recht Anstand von ihr erwartete. Und anständig war sie, obwohl diese Fotografien einen völlig anderen Eindruck vermittelten. Sie hatte ja nicht ahnen können …
Mit brennenden Augen überflog sie schließlich die wenigen Zeilen und stieß ein leises Stöhnen aus.
Wer tat ihr so etwas an?
Die wenigen Menschen in ihrem Umfeld waren ihr wohlgesonnen, mit ihren engsten Freundinnen hatte sie kürzlich noch Abschied gefeiert. Die beiden waren ehrlich bestürzt gewesen, als sie erfuhren, dass Serafina nach Stuttgart ziehen würde. Und auch Fräulein Schmidtke, ihre Haushälterin, wäre zu einer solchen Niederträchtigkeit niemals imstande. Von der Nacht im Metropol hatte sie ohnehin niemandem erzählt.
Wer also dann?
Das Billett rutschte aus Serafinas Hand. Feucht rann es über ihre Wangen. In einer verzweifelten Bewegung wischte sie die Tränen weg.
Sie hatte einen Fehler gemacht. Geschuldet dem Tod und der Trauer um die bis dahin wichtigste Person in ihrem Leben, geschuldet ihrer Leichtgläubigkeit und einer falschen Hoffnung – und der Suche nach ihren Wurzeln.
Ihre Augen brannten.
Sie war hintergangen worden. Anders konnte es nicht sein. Irgendjemand missbrauchte sie für seine üblen Machenschaften.
In dieser Nacht wollte der Schlaf nicht kommen. Serafina wälzte sich trotz der weichen Daunendecken hin und her, stand auf, legte sich wieder ins Bett, trank aus dem Wasserkrug, den man ihr hingestellt hatte, und zerbrach sich Stunde um Stunde den Kopf.
Erst als die ersten Strahlen der Morgensonne durch einen Schlitz zwischen den bodenlangen Vorhangschals ins Zimmer fielen, hatte sie einen Entschluss gefasst.
2. Kapitel
Die Klavier- und Flügelmanufaktur A. Rothmann in Stuttgart, am 3. Mai 1926
Anton Rothmann war bereits seit dem Morgengrauen auf den Beinen. Er musste den Auftrag für einen Konzertflügel durchplanen, damit er Material bestellen und Arbeitsstunden kalkulieren konnte. Zugleich standen einige Klaviere kurz vor der Fertigstellung. Anton hatte sich auf Sonderanfertigungen spezialisiert, meistens mit ausgefallenen Korpussen, die sich entweder in der Form, meistens jedoch in Farbe oder Muster von der klassischen Klaviergestalt abhoben. Besonders bekannt war er für seine Intarsienarbeiten, die ihm sogar Aufträge aus Amerika verschafften.
In seiner geräumigen Werkstatt in der Stuttgarter Augustenstraße roch es intensiv nach Holz und ein wenig nach Leim und Lack. Noch war er allein an diesem Morgen, und nach seinem üblichen Rundgang, bei dem er das Lager, die Werkzeuge und die Raumtemperaturen überprüft hatte, blieb er vor einem Schreibtischklavier stehen, das heute Nachmittag ausgeliefert werden sollte. Zufrieden betrachtete er das Werkstück und strich sachte über das glatt lackierte Nussbaumholz. So, in geschlossenem Zustand, ahnte man kaum, dass sich unter der Schreibtischplatte ein voll funktionsfähiges Tasteninstrument verbarg.
Er betätigte den einfachen Klappmechanismus und öffnete die geteilte Platte. Dann strich er über die vor ihm liegenden Tasten aus Elfenbein, fünfundachtzig an der Zahl. Er schlug ein C an, spielte die Tonleiter, dann einige Akkorde. Schließlich zog er einen Hocker heran und entlockte dem Instrument Who’s Sorry Now, ein Stück, das er kürzlich von einem New Yorker Kunden vorgespielt bekommen und sofort gemocht hatte. Diese Art von Musik, die zunehmend aus der Neuen Welt nach Europa kam, dabei fremd und unglaublich genial zugleich klang, faszinierte Anton. Zusammen mit anderen Musikern hatte er eine kleine Jazzkapelle gegründet, um die eindrucksvolle Kraft dieser Stücke im Wechselspiel verschiedener Instrumente umzusetzen. Seit Kurzem gaben sie Konzerte, unter anderem im Café Merkur und – über die Sommermonate – im Stadtgarten.
Die Musik war Antons Leben, seit seine Schwester Judith vor mehr als fünfzehn Jahren ein Musikzimmer in der elterlichen Villa eingerichtet und mit einem gebrauchten Flügel von C. Bechstein ausgestattet hatte. Obwohl das Instrument eigentlich für ihren Sohn Martin gedacht gewesen war, der schon als kleiner Junge eine außergewöhnliche musikalische Begabung gezeigt hatte, war es auch für Anton von Anfang an ein Faszinosum gewesen. Als Judith gemerkt hatte, dass er stets versuchte, Martins Stücke nachzuspielen, hatte auch er Klavierstunden nehmen dürfen und sich die Welt der Töne zu eigen gemacht. Während Martin zu einem exzellenten Pianisten heranreifte, hatte sich Anton mehr und mehr für die Mechanik der Tasteninstrumente interessiert. Der Schritt zum Klavierbau war irgendwann nur noch ein kleiner gewesen.
Anton schloss die Augen und spielte The Charleston an, ein recht neues Stück von James P. Johnson. Während seine Finger über die Tasten flogen, stieg unvermittelt ein Bild in seinem Inneren auf – ein zartes Gesicht mit haselnussbraunen Augen und vollen Lippen, umrahmt von hellblondem Haar. Elise.
Übergangslos begann er, über Beethovens gleichnamiges Klavierstück zu improvisieren, den Schwung des Charleston mit seinen prägnanten Betonungen mitnehmend, und gab damit der Komposition, die im Original Elises zartes Wesen mit seinem verletzlichen Grundton so treffend spiegelte, einen lebensfrohen, hinreißenden Charakter.
Er war derart versunken in die Musik, dass er nicht hörte, wie jemand die Werkstatt betrat.
»Morgen, Anton!«
Anton fuhr herum. »Alois! Hast du mich erschreckt!«
Alois Eberle lachte laut. »Ha ja, du sollst auch arbeiten und net nur rumklimpern!«
»Das ist Arbeit!«, konterte Anton, verschloss zugleich aber sorgfältig das Schreibtischklavier, stand auf und stellte den Hocker neben das Instrument an die Wand. »Schön, dich zu sehen! Ich habe so viel Arbeit, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin, dich aufzusuchen. Was führt dich her, Alois?«
Eberle, ein alteingesessener Stuttgarter mit weißem Haar und gebeugter Haltung, setzte sich auf den Hocker, den Anton eben zur Seite gestellt hatte. »Du weißt, der Rücken macht mir grad Malheur«, sagte er entschuldigend.
»Ist gut, wenn du sitzt«, antwortete Anton verständnisvoll. »Ich bringe dir einen Kaffee.«
»Lass bloß sein. Ich hab schon einen getrunken heut Morgen«, erwiderte Alois. »Du, Anton, weshalb ich da bin«, fuhr er übergangslos fort. »Dein Bruder war bei mir.«
»Der Karl? Wegen neuer Schokoladenautomaten?«
»Nein, nicht wegen den Automaten. Das macht ja die neue Abteilung in der Fabrik.«
»Aber du konstruierst doch trotzdem noch Modelle für Victor.«
»Natürlich! Die ganz besonderen! Ohne die Schokoladenautomaten wär mir doch langweilig.«
»Das dachte ich mir«, sagte Anton. »Was ist denn mit Karl? Wie du weißt, kümmere ich mich eigentlich nicht mehr um die Belange der Schokoladenfabrik.«
Alois nickte. »Das hab ich gmerkt. Und auch, dass du und der Karl Probleme miteinander habt.«
»Das hast du mitbekommen?«, fragte Anton überrascht.
»In letzter Zeit redet ihr euch immer öfter die Köpfe heiß.«
»Solange wir nicht miteinander arbeiten müssen, gibt es auch keine Probleme«, meinte Anton ausweichend. Die Stimmung zwischen Karl und ihm war tatsächlich schon seit Längerem angespannt.
»Für mich sieht es so aus, als ob der Karl sich um deine Meinung nicht mehr schert und manchmal grad mit Fleiß Sachen anders macht, als du ihm geraten hast«, fuhr Alois fort. »Da ist es doch klar, dass du von ihm enttäuscht bist.«
Anton war an eines der leicht mit Holzstaub überzogenen Fenster getreten und sah hinaus. »Nein. Ich würde es nicht enttäuscht nennen«, erklärte er. »Aber was existenzielle Dinge betrifft, bin ich lieber unabhängig – vor allem von Karl. Wir sind einfach grundverschieden.«
»Ah was, so verschieden seid ihr gar nicht. Ihr habt aber so eine Art Gefecht zwischen euch, das ein bissle außer Kontrolle geraten ist.«
»Meinst du?«, fragte Anton zweifelnd und wandte den Kopf zu Alois. »Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, mit ihm in irgendeinem Kampf zu stehen.«
»Du nicht. Aber der Karl schon. Du hast was aus dir gemacht. Der Karl tut sich da schwer. Er hängt ja an eurer Schwester dran und ihrem Mann. Der Karl braucht jetzt mal einen eigenen Erfolg, und den kriegt er nicht.«
»Aber Judith und Victor unterstützen ihn doch, so gut sie können!«
»Sie unterstützen ihn viel zu viel, das denk ich jedenfalls. Er kann sich gar nicht selbst beweisen, und das müssen junge Leut.«
Anton dachte über Alois’ Worte nach.
»So habe ich das noch gar nicht betrachtet«, gab er dann zu.
»Das ist halt meine Meinung.«, sagte Alois. »Am Ende ist es Karls Sache. Er muss wissen, wohin’s für ihn gehen soll.«
»Stimmt, Alois. Aber natürlich würde ich ihm gern helfen. Damit auch er eines Tages weiß, wie es sich anfühlt, selbst etwas erreicht zu haben.« Anton ließ den Blick durch seine Werkstatt wandern und fühlte plötzlich eine große innere Zufriedenheit. Er sah zu Alois. »In der Schokoladenfabrik hätte ich es auch zu nichts gebracht.«
»Ich kann dich verstehen, Anton«, sagte Alois. »Für mich wär es auch nichts, den ganzen Tag in einem Büro zu sein, denn so wär es für dich gekommen. Da fühlt man sich wie eingesperrt. Wir beide müssen was mit den Händen machen!«
»Das auch. Aber vor allem möchte ich mein Unternehmen so führen, wie ich es für richtig halte. Und sosehr ich meine Schwester und meinen Schwager auch schätze, so genau weiß ich auch, dass sie die Dinge schlecht aus der Hand geben können.«
»Sie haben halt arg um die Fabrik kämpfen müssen. Und das prägt.«
»Das kann ich nachvollziehen«, entgegnete Anton. »Ich habe meine Konsequenzen gezogen. Vielleicht hat Karl das Gefühl, ich hätte ihn alleingelassen?«
»Möglich.«
»Trotzdem denke ich, dass jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist, Alois. Auch mein Bruder.«
»Mich macht Most glücklich«, erwiderte Alois trocken.
Anton lachte. »Wohl dem, der bescheiden bleibt.« Er ging zu Alois und legte ihm einen Augenblick lang die Hand auf die Schulter. »Warum war Karl bei dir?«, hakte er dann noch einmal nach.
»Er hat mich eine Schokoladenschallplatte machen lassen.«
»Das ist gar keine schlechte Idee, finde ich.«
»Schon, wenn’s auch gar nicht so leicht ist.«
»Du hast bisher noch alles zu einem Erfolg gemacht«, erklärte Anton zuversichtlich.
»Nein, nicht alles«, erwiderte Alois. »Und bei dieser Schokoladenschallplatte bin ich in einem Dilemma.«
»Das sollte nicht sein. Warum?«
»Das alles wird recht teuer, Anton.« Alois suchte eine andere Sitzhaltung auf dem Hocker. »Ich bräucht neue Maschinen. Und würd gern eigene Musikaufnahmen machen. So viel Geld kann ich aber net vorstrecken. Trotzdem find ich den Einfall mit der Platte gut und denk, dass der Karl sich erproben sollte damit. Und ich hab natürlich auch schon rumprobiert.«
»An einer Schokoladenschallplatte? Und?«
»Ich hab sogar schon eine fertig.« Alois’ Miene nahm einen verschmitzten Ausdruck an.
»Und? Ist sie tatsächlich abspielbar?«, fragte Anton.
»Ha, klar ist sie das!« Nun schien Alois doch ein wenig in seiner Erfinderehre gekränkt. »Aber ich bin noch net zufrieden«, schränkte er ein. »Es rauscht sehr. Und es gibt zu viele Knackgeräusche. Damit man sie wirklich verkaufen kann, muss ich noch was daran arbeiten.«
Anton überlegte. »Das ist eine tolle Sache, wenn auch nicht neu. Stollwerck hat schon einmal Ähnliches gemacht, allerdings als Spielzeug für Kinder. Ich erinnere mich an diesen Phonographen, der kleine Schokoladenschallplatten mit Kinderliedern abspielen konnte. Spätestens nach dem dritten Mal wurden die Platten natürlich aufgegessen.«
Eberle grinste. »Ein Wunder, dass ihr sie überhaupt angehört und nicht gleich aufgevespert habt.«
Anton musste lachen. »Ja, eigentlich ein Wunder, da hast du recht.« Er wurde nachdenklich. »Allerdings stellt sich die Frage, warum diese Entwicklung seit damals nicht mehr vorangetrieben wurde. Von keinem unserer Konkurrenten. Und ob Karl daraus wirklich ein Geschäft machen kann.«
»Er will diese neumodischen Sachen draufspielen, die auch du immer zusammenklimperst.«
»Also plant er diese Schokoladenschallplatten als Kombination aus Schokolade mit Swing? Das ist sehr reizvoll.« Anton dachte nach. »Weißt du was, Alois? Ich spreche mal mit meinen Musikern, die hätten bestimmt Lust, so was zu machen.«
»Schon. Man muss die Musik halt aufnehmen. Da braucht’s die Geräte dafür.«
»Das stimmt. Deshalb muss Karl sich auf jeden Fall mit Victor und Judith besprechen. Sonst plant er und gibt Geld aus, ohne dass die beiden davon wissen, geschweige denn eine vernünftige Kalkulation erstellen können.«
»Das wäre ganz gut, Anton«, antwortete Alois. »Andererseits – ich hab halt die Sorge, dass ihm das Ganze wieder aus der Hand genommen wird. Denk mal nach, wie wir das lösen können. Entweder du sprichst mit deiner Schwester. Oder du streckst ihm was vor?« Er stand mühsam auf. »Ich muss weiter. Du wirst einen Weg finden, Anton, das weiß ich.«
»Und du willst auf jeden Fall weiter an Karls Schokoladenschallplatten herumtüfteln, stimmt’s?«
»Ha, natürlich! Und nicht nur an Schokoladenschallplatten. Wenn man so etwas anfängt, dann geht es nicht nur um Schokolade, sondern vor allem um richtige Schellackplatten. Alles andere wäre Unsinn. Und du kennst mich doch. Ich kann schon gar net mehr aufhören, mir darüber Gedanken zu machen.« Alois sah Anton vielsagend an. »Und so ein Aufnahmegerät nachzubauen, das ist schon was Besonderes, das will ich unbedingt versuchen … Deshalb wäre es gut, wenn ich bald Bescheid weiß.«
»Ich verstehe.« Anton nickte. »Ich komme dann gern auf einen Most zu dir, und wir schauen, was ich machen kann.«
»Jederzeit. Das Fass ist voll!«
»Das ist gut zu wissen! Danke, dass du hergekommen bist, Alois.«
Alois Eberle stand auf, hob die Hand zum Gruß und schlurfte quer durch die Werkstatt zur Tür. »Scho recht!«
3. Kapitel
Hafen Hamburg, am selben Tag
Ein heftiger Ruck ließ ihn taumeln. Er fing sich ab und griff nach seinen beiden Koffern, um als einer der Ersten von Bord zu gehen, sobald der Ozeanfrachter vertäut war.
Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete er die Männer auf dem Kai, die die Seile um die Poller schlangen. An Deck machte man sich bereit zum Ausbringen der Gangway. Noch einige Male tanzte das Schiff unsanft gegen die Kaimauer, dann war die Reise endgültig vorbei.
Hamburg begrüßte ihn trotz der Jahreszeit mit kühlem Nieselwetter, und er begann sofort zu frösteln. Das Klima Mittelamerikas meinte es besser mit den Menschen. Während mit dem Löschen der Ladung begonnen wurde, verließ er das Schiff und versuchte, sich trotz der tief hängenden Wolken zu orientieren.
Vieles hatte sich verändert, seit er sich vor mehr als zwanzig Jahren hier in Hamburg bei Nacht und Nebel nach Mexiko eingeschifft hatte, die Häscher seiner Gläubiger auf den Fersen. Jetzt, da er wieder auf deutschem Boden stand, überfiel ihn die Erinnerung, als wären die heimlichen Pokerrunden im Hinterzimmer der Elsässer Taverne in Stuttgart erst gestern gewesen.
Unzählige Nächte hatte er dort verbracht, anfangs in der Hoffnung auf den großen Gewinn, später, um das zurückzuholen, was er verloren hatte. Irgendwann war nichts mehr zu retten gewesen.
Als auch sein Vater nicht mehr bereit gewesen war, für die Schulden des Sohnes aufzukommen, war die Luft dünn geworden für ihn. Eindeutige Drohungen eines hinterhältigen Freundes und das Auftauchen zwielichtiger Gestalten hatten ihm schließlich keine Wahl mehr gelassen. Es war nur die Flucht geblieben.
Er setzte sein Gepäck noch einmal ab, um sich umzusehen.
Zahlreiche Schiffe hatten an den Kaianlagen festgemacht, das Treiben ringsumher war hektisch und bildete einen krassen Gegensatz zu der mittelamerikanischen Gelassenheit, die er gewohnt war.
Rufe und abgehackte Gesprächsfetzen drangen an sein Ohr. Die deutsche Sprache erschien ihm ungewohnt und hörte sich doch merkwürdig vertraut an. In den vergangenen Jahren hatte er sich lediglich mit deutschen Händlern in seiner Muttersprache unterhalten, denn längst war Spanisch zu seiner Herzenssprache geworden, auch Englisch und Französisch beherrschte er recht gut durch die zahlreichen Geschäfte mit den Kakaoeinkäufern aus aller Herren Länder.
Das Tuten eines Schiffshorns erinnerte an die fortschreitende Zeit. Noch war er nicht am Ziel. Er nahm seine Koffer wieder auf, sah noch einmal auf das graue Wasser der Elbe und machte sich auf den Weg zum Hauptbahnhof.
Nach den Tagen auf See hatte er die Schaukelbewegungen des Schiffes so verinnerlicht, dass es eine Weile brauchte, bis das Gefühl des Schwankens trotz festen Bodens unter seinen Füßen nachließ und er schneller gehen konnte. Hin und wieder musste er Hafenarbeitern ausweichen, die mit ihren Elektrokarren den Kai befuhren.
Schließlich erreichte er das markante Eingangsgebäude des Tunnels, der unter der Elbe hindurch zu den St.-Pauli-Landungsbrücken führte.
Als er durch das Portal ging, rempelte ihn ein älterer Herr an.
»Entschuldigen Sie vielmals.« Dem gut gekleideten Mann tat sein Versehen sichtlich leid. »Aber man muss sich erst wieder daran gewöhnen, an Land zu sein.«
»Allerdings.«
»Sind Sie weit gereist?«, plauderte der Mann weiter, während sie gemeinsam die Treppen hinunterstiegen.
»Ich komme aus Übersee.« Eigentlich stand ihm der Sinn nicht nach einer Unterhaltung. »Und ich bin recht müde von der Reise.«
»Mein Weg war auch weit. Ich komme aus New York«, gab der Mann zurück.
»Aus New York?« Er fragte nur, um höflich zu sein. »Sind Sie geschäftlich unterwegs?«
»Sieht man mir das an?« Der Herr lachte. »Aber es stimmt tatsächlich. Ich komme aus Essen und bin für die Firma Krupp auf Reisen.«
»Dann haben Sie oft in New York zu tun?«
»In Amerika, ja. Nicht nur in New York, auch in anderen Städten. Und Sie?«
»Ich komme von Veracruz.«
»Ah, Mexiko! Ein beruflicher Aufenthalt?«
»Ich lebe dort.«
»In Veracruz? Das ist ja interessant.«
Die beiden hatten den Treppenabsatz erreicht und gingen nun durch die gekachelte Tunnelröhre.
»Ich betreibe eine Kakaoplantage.« Eigentlich hatte er nichts von sich erzählen wollen, aber der Herr kitzelte mit seiner verbindlichen Art dieses Gespräch geradezu aus ihm heraus.
»Oh, der Kakaoanbau ist eine lukrative Sache«, meinte er.
»Gewiss.«
Der Mann schien zu bemerken, dass er nichts dazu sagen wollte, und wechselte das Thema. »Wir befinden uns fast einen halben Kilometer unter der Elbe«, meinte er. »Kaum zu glauben, dass über uns wahrhaftig ein Fluss fließt.«
»Ja, eine große Leistung der Ingenieure.« Er musste seine freundliche Erwiderung geradezu aus sich herauspressen. In Wahrheit war ihm recht unbehaglich zumute angesichts der Tatsache, tief unter den Wassern eines Flusses durch eine beengte Röhre zu marschieren.
»Zu Beginn wurde er von manchen mit einem Mausoleum verglichen«, schmunzelte der Herr, als habe er seine Gedanken gelesen. »Aber die meisten haben den Tunnel gefeiert. Er erleichtert den Weg in die Stadt doch ungemein.«
»Aber in Amerika sehen Sie gewiss noch viel größere Bauten.« Das Geräusch ihrer Schritte, das die Tunnelwände zurückwarfen, erschien ihm überlaut.
»Sicherlich«, antwortete der Mann. »Man denke nur an das Woolworth Building oder den Metropolitan Life Tower. Und dennoch schmälert das nicht die Leistung der Erbauer dieses Tunnels.«
Ihm mochte keine Antwort einfallen, also nickte er beiläufig.
»Die Ingenieurskunst wird noch unglaublichere Werke hervorbringen«, fuhr sein Gesprächspartner fort. »Sehen Sie sich an, was allein in den letzten Jahrzehnten geschehen ist! Die ganze Elektrifizierung, oder das Telefon. Flugzeuge! Eines Tages landen wir auf dem Mond!«
»Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. Wie sollte das technisch gemacht werden?«
»Oh, unterschätzen Sie nicht die Wissenschaft! Diese Entwicklung steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber erst im März gab es in Massachusetts den Start einer Flüssigkeitsrakete. Sie war zwar klein und flog nur fünfzig Meter weit, aber ich halte es dennoch für einen vielversprechenden Anfang.«
»Das mag sein.« Für Technik hatte er noch nie viel übriggehabt. »Aber wir beide werden bestimmt nicht mehr erleben, dass ein Mensch auf dem Mond landet.«
»Ich gehe dennoch davon aus, dass wir in diesem Jahrhundert das Weltall erreichen«, erwiderte dieser. »Ob es gleich der Mond sein wird, sei dahingestellt.« Der Mann zügelte seinen Redefluss, denn sie hatten den Treppenaufgang bei St. Pauli erreicht, schleppten ihr Gepäck die Stufen hinauf und traten wieder ans trübe Tageslicht.
»Nun denn.« Der Herr hob seinen Hut. »Wann auch immer der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzen mag – gehen wir zunächst unserer Wege. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag!«
»Danke, den wünsche ich Ihnen auch.«
Unwillkürlich sah er dem Mann hinterher, der seinen Regenschirm aufspannte und sich rasch entfernte. Er selbst war vom Treppensteigen noch ein wenig außer Atem und gönnte sich eine kurze Verschnaufpause, bevor er sich wieder dem schlechten Wetter aussetzte.
Das Gespräch hatte einen wunden Punkt berührt. Seine Kakaoplantage.
Er hatte gute Jahre gehabt. Sehr gute Jahre, mit reichen Ernten, die sich in klingender Münze bezahlt gemacht hatten. Dank seines strengen Regiments hatte die Plantage, die er im Laufe der Zeit konsequent vergrößert hatte, große Mengen Kakaobohnen hervorgebracht und beachtliche Erträge abgeworfen.
Zudem war er ein geschickter Verkäufer. In Europa hätte man ihn wohl einen Betrüger genannt. Doch mochte dieser Titel auch fragwürdig sein, so stand er vor allem für eines: seinen Erfolg. Und das wiederum war etwas, das ihm früher niemand zugetraut hätte, vor allem nicht sein Vater, der mächtige Bankier. Für den war er nur ein fetter Taugenichts gewesen, schwach im Schreiben, schwach im Rechnen, schwach im Charakter. Ein Schandfleck auf der Ehre einer der angesehensten Stuttgarter Familien.
Nun, sein Bauch war nicht kleiner geworden, ganz im Gegenteil. Doch in Mexiko unterstrich gerade dieses Attribut, neben seiner weißen Haut und seinen hellen Augen, sein Ansehen. Er konnte es sich leisten, gut und viel zu essen, wurde hofiert, besaß ein riesiges Anwesen. Und er hatte die schönsten Frauen.
Verheiratet allerdings war er nur mit einer, Fernanda. Er hatte sie ausgesucht, als sie erst vierzehn Jahre alt gewesen war, und alsbald zu sich ins Herrenhaus geholt. Seitdem lebte sie an seiner Seite und machte ihm das Dasein recht angenehm. Zum einen schnatterte sie nicht so viel wie die anderen Weiber, zum anderen war sie eine tadellose Haushälterin. Und akzeptierte klaglos seine Affären.
Es ging ihm bestens.
Wäre da nicht Fernandas Unfruchtbarkeit, die ihm wie ein tiefer Stachel im Fleisch saß. Und gäbe es nicht den Hexenbesen. Diese grauenvolle Pilzerkrankung hatte seinen Pflanzungen in den letzten Jahren so sehr zugesetzt, dass er um seine Existenz hatte bangen müssen. Nur durch das radikale Abschneiden und Verbrennen der befallenen Äste und Früchte war der Katastrophe beizukommen gewesen. Und viel zu viele Bäume hatten ganz vernichtet und neu gesetzt werden müssen.
Allmählich erholte sich seine Plantage. Aber bis er wieder an die Gewinne früherer Jahre anknüpfen konnte, würde es eine Weile dauern.
Seine Reise nach Deutschland hatte er dennoch angetreten. Während seiner Abwesenheit sorgte sein Verwalter Marcos für Ordnung und regelte die Verkäufe. Der Mann war zwar brutal, ihm zugleich aber völlig ergeben, sodass er sichergehen konnte, nicht um Hab und Gut gebracht worden zu sein, wenn er zurückkehrte.
Denn es gab eine Sache in Stuttgart, die er oft genug aufgeschoben hatte und um die er sich endlich kümmern musste. Sie hatte ihn noch mehr gedemütigt als die Verachtung seines Vaters.
Judith Rothmann.
Der Gedanke an sie verursachte ihm noch immer einen dumpfen Schmerz – trotz der vielen Jahre, die seither vergangen waren. Niemals würde er den Augenblick vergessen, als sie ihn am Abend ihrer Verlobung vor der gesamten Stuttgarter Gesellschaft durch ihre eiskalte Ablehnung bloßgestellt hatte. Eigentlich hätte diese Ballnacht der schönste Moment seines Lebens sein sollen, denn die Verbindung zwischen ihm und Judith war unter den Vätern längst ausgehandelt gewesen. Doch kaum war es ihm gelungen, ihr trotz seiner großen Aufregung den Ring anzustecken, hatte sie ihn angesehen, als wäre er vom Aussatz befallen, und war aus dem Raum gestürmt.
Eine grässliche Blamage.
Die Väter hatten erst sich und dann ihn angeschaut, den Gästen waren Mitleid, Häme und Spott ins Gesicht geschrieben gewesen. Der Gastgeber war zu den Musikern gegangen, um sie zu bitten, rasch einen vergnügten Tanz anzustimmen und damit die peinliche Stille im Raum zu vertreiben.
Er hatte das Fest umgehend verlassen, obwohl Judiths Vater beteuert hatte, dass seine Tochter lediglich überrascht gewesen sei und sich einer Heirat letzten Endes nicht verweigern werde. Wie er letztlich aus dem Saal gekommen war, daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Sehr gut allerdings erinnerte er sich an die Zusicherung von Judiths Vater, dass seine Tochter einlenken werde.
Also hatte er gewartet. Auf einen Besuch von ihr, auf einen Brief. Endlich hatte sie ihm eine Entschuldigung überbringen lassen, allerdings durch ihren Vater als Boten – zu einem persönlichen Wort hatte sie sich nicht herabgelassen. Inzwischen war er sich sicher, dass der betreffende Brief gar nicht von ihr selbst verfasst worden war.
Und dann war da noch dieser Victor Rheinberger gewesen, ein ehemaliger Festungsgefangener, ein Reigschmeckter. Er hatte Judith einfach ein Kind gemacht und sich damit in den Rang ihres Ehemanns katapultiert. Davon hatte er allerdings erst Jahre später erfahren, in einem Brief, den ihm seine Schwester Dorothea anlässlich seiner Hochzeit mit Fernanda geschickt hatte. Vermutlich war sie davon ausgegangen, dass ihn diese Nachricht nicht mehr verletzen würde, nun, da er selbst verheiratet war.
Doch das Gegenteil war eingetreten. Dorotheas Schreiben hatte alte Wunden aufgerissen und seinen Wunsch bestärkt, eines Tages Genugtuung für all die Dinge zu fordern, die man ihm angetan hatte.
Und deshalb war er jetzt hier.
Ein Windstoß und das anhaltende Tuten eines Dampfers holten ihn in die Wirklichkeit zurück. Noch immer stand er am Südeingang des Elbtunnels an den Landungsbrücken. Er raffte sich auf, ging die wenigen Meter durch den inzwischen stärker gewordenen Regen bis zur Hafenstraße und hielt nach einer Kraftdroschke Ausschau.
»Wo soll es denn hingehen?«, fragte der Fahrer, als er das Gepäck eingeladen hatte.
Er wischte die Tropfen von seinem Hut. Sie benetzten den Innenraum des Automobils.
»Zum Hauptbahnhof.«
4. Kapitel
Stuttgart, am 4. Mai 1926
Serafina stieg am Schloßplatz aus dem Straßenbahnwagen der Linie 16. Inzwischen war sie ortskundig genug, um von Degerloch in die Stadt hinunterzufinden, und damit unabhängig von der Begleitung durch andere – dank ihres guten Orientierungssinns und dank Judith und Dora, die ihr die wichtigsten Wege und Orte in Stuttgart gezeigt hatten. Serafinas Ziel, das Hotel Marquardt, befand sich unweit der Haltestelle. Doch noch zögerte sie, sich dem Gebäude weiter zu nähern.
In der rechten Hand hielt Serafina die Karte, die Lilou ihr am Bahnhof zugesteckt hatte. Ihre Finger spielten nervös mit dem Papier, das von ihrer Nestelei schon völlig zerknittert war. Tat sie das Richtige? Würde Lilou sich überhaupt an sie erinnern?
Ringsherum herrschte reges Treiben, ein durchaus großstädtisches Flair. Die Bauwerke in der Königstraße und auf dem Schloßplatz zeugten von glanzvollen Zeiten – der mächtige Königsbau, das weitläufige Neue Schloss mit der Jubiläumssäule, das Kunstgebäude. Auf der Litfaßsäule vor dem Kronprinzenpalais warben Plakate für die Vergnügungsangebote der Stadt. Eines davon kündigte den Auftritt von Josephine Baker an.
Zahlreiche Ladengeschäfte hatten geöffnet und beschatteten ihren Eingangsbereich mit Markisen. Einige Hundert Meter die Straße hinab erkannte Serafina den markanten Turm des Bahnhofs.
Passanten gingen vorbei, einige in Eile, andere flanierten auf dem Bürgersteig und genossen den warmen Frühlingstag. Fahrradfahrer und Autos, Straßenbahnen und Motorräder teilten sich die Straße. Es knatterte und hupte, dazwischen mischte sich das schrille Bimmeln der Straßenbahn.
Alles in allem ging es in Stuttgart dennoch deutlich ruhiger zu als in Berlin. Vor allem die Menschen waren anders, verschlossener, in sich gekehrter. Victor hatte gemeint, das schiene nur auf den ersten Blick so. Lernte man die Württemberger näher kennen, so zeigten sie sich als hilfsbereite, sehr fleißige und auf ihre eigene Art herzliche Zeitgenossen.
Und so, als wollte die Stadt zeigen, dass ihre Einwohner keineswegs nur zurückhaltende Sonderlinge waren, kreuzten in diesem Moment drei junge Frauen Serafinas Weg. Sie waren etwa in ihrem Alter und hatten sich gegenseitig untergehakt, ihre gut gelaunte Unterhaltung und ihr Lachen waren weithin zu hören. Sie trugen taillenlose, knielange Kleider und enge Hüte auf akkurat geschnittenem Haar. Ihre Gesichter waren perfekt geschminkt.
Serafina beobachtete die drei, wie sie an den Kolonnaden des Königsbaus entlanggingen und dann in Richtung des Alten Schlosses abbogen. Am liebsten hätte sie sich ihnen angeschlossen, denn auch wenn sie sich in Sachen Kleidung und Make-up etwas zurückhielt, seit sie in Stuttgart war, liebte Serafina die selbstbewusste, unkonventionelle Flapper-Mode.
Sie strich ihr hochgeschlossenes Kleid aus cremefarbenem Batist glatt, das über der Wade endete und dessen Saum mit feinen Blumen bestickt war. Eine schmale Schärpe betonte ihre Hüften, und auch sie trug einen Glockenhut, dessen helle Farbe gut mit ihren dunklen Haaren kontrastierte. Serafina hatte bewusst einen schlichten, modernen Stil gewählt, der sich nahezu jeder Umgebung anpasste.
»Kann man Ihnen weiterhelfen, Fräulein?«, fragte ein distinguierter älterer Herr im Anzug. Er trug einen auffälligen weißen Backenbart.
Serafina sah ihn irritiert an. »Ähm, nein danke. Ich komme zurecht.«
»Gut. Ich dachte nur … man hat den Eindruck, dass Sie nicht von hier sind«, meinte der Mann und lächelte entschuldigend. »Und vielleicht nicht wissen, wohin. Aber wenn dem nicht so ist … Einen schönen Tag noch!« Er lüftete seinen Strohhut und setzte seinen Weg fort.
Serafina gab sich einen Ruck.
Offenbar stand sie auffällig unentschlossen auf dem Bürgersteig. Es war höchste Zeit, weiterzugehen.
Bis zum Hotel Marquardt waren es nur wenige Schritte. Serafina wusste durch Judiths Hinweise, dass es sich um eines der besten Häuser Stuttgarts handelte, das nicht nur Menschen aus aller Herren Länder, sondern auch viele prominente Gäste beherbergte.
Sie ließ ihren Blick über das imposante Eckgebäude gleiten, dessen auskragender Erker mehrere Balkone trug, die zwischen schmale, figurenbestandene Halbsäulen eingebettet waren. Die steinernen und schmiedeeisernen Balustraden waren üppig mit Blumen geschmückt. Serafina wandte sich zum Eingang, der linker Hand in der Schloßstraße lag.
Die Hotelhalle, die sie kurz darauf betrat, atmete den Geist vergangener Jahre. Edle Holzverkleidungen, helle Tapeten und Polstermöbel schufen einen Eingangsbereich, der Gediegenheit und Weltläufigkeit vermittelte.
»Sie wünschen?« Ein Angestellter in Livrée sprach sie an.
»Ich möchte gern zu Lilou Roche«, antwortete Serafina und zupfte an der Karte, auf der Lilou ihren Namen in runden, raumgreifenden Buchstaben vermerkt hatte. »Falls sie im Hause ist.«
Der Hotelangestellte warf einen kurzen Blick auf die Karte in ihrer Hand und bat sie dann, einen Augenblick zu warten.
Während er nach Lilou fragen ließ, beobachtete Serafina das Kommen und Gehen im Empfangsbereich des Marquardt.
Ein betagtes Ehepaar, offensichtlich amerikanisch, beschwerte sich erregt über sein angeblich viel zu hellhöriges Zimmer. Zeitgleich rauschte eine Dame an Serafina vorbei, einen Mops auf dem Arm und eine Wolke süßen Parfums zurücklassend. Eine junge Frau, vielleicht ihre Gesellschafterin, beeilte sich, mit ihr Schritt zu halten, wobei sie mit einem Schwall Anweisungen überschüttet wurde.
In einer Ecke standen drei Männer und rauchten Zigarren. Sie hatten weder Hut noch Jackett abgelegt und wirkten beinahe so, als hätten sie etwas Konspiratives zu besprechen. Serafina spitzte die Ohren, doch sie war zu weit weg, um irgendetwas zu verstehen.
Gerade als ein junges Ehepaar hereinkam – möglicherweise auf Hochzeitsreise, denn es wirkte sehr verliebt –, kehrte der Hotelangestellte zurück.
»Fräulein Roche ist auf ihrem Zimmer und bittet Sie zu sich. Wenn Sie mir folgen möchten?«
Serafina nickte und ging hinter dem jungen Mann her, der sie über einen dicken Perserteppich zu einem Aufzug mit Verzierungen aus Messing führte.
Im dritten Stock stiegen sie aus.
»Nummer 301«, sagte der Hotelangestellte und wies in einen Gang. »Soll ich Sie begleiten?«
»Nein danke, das ist nicht nötig«, antwortete Serafina und gab ihm ein kleines Trinkgeld.
»Wenn Sie noch etwas wünschen, Fräulein, so finden Sie mich an der Rezeption.« Er steckte die Münze ein, deutete einen Diener an und trat zurück in den Aufzug.
Während sich dessen Türen klappernd schlossen, ging Serafina den langen Gang entlang. Das Zimmer mit der Nummer 301 befand sich an dessen Ende. Als sie schließlich davorstand, erlaubte sie sich kein Zögern mehr und klopfte sofort an.
Von drinnen waren leise Stimmen zu vernehmen. Ein Hund kläffte.
Dann ging die Tür auf, ein weißer Zwergspitz sauste heraus und sprang an Serafina hoch.
»Coco! Arrête!« Lilou tauchte aus dem dezent abgedunkelten Raum auf und packte den kleinen Hund an seinem mit Strasssteinen besetzten Halsband. Dann erkannte sie Serafina. »Ah, ma chère Serafina! Wie schön! Komm herein.«
Sie trug Anzughose und weiße Bluse, ohne Jackett, ihr kurzes Haar war streng gescheitelt und mit Pomade eng an den Kopf gelegt. Zwischen ihren Fingern glühte eine Zigarette.
Serafina trat in das rauchgeschwängerte Zimmer.
»Ich muss dann ja wohl gehen, chérie.« Eine junge Frau stand auf einmal neben Lilou, umfasste ihre Wange und küsste sie leidenschaftlich auf den Mund. »Wenn du jetzt Besuch hast.« Sie musterte Serafina, und in ihrem Blick lag eine Spur Eifersucht.
»Ist gut, Milly. Wir sehen uns später«, erwiderte Lilou und strich ihrer offenkundigen Freundin über das rote Haar.
»Ich hoffe, es dauert nicht so lang«, sagte Milly und verzog das Gesicht.
»Es dauert, so lange es dauert«, entgegnete Lilou.
Mit einem letzten Blick auf Serafina verließ Milly das Zimmer.
Als sie den Gang hinunter verschwunden war, legte Lilou den Arm um Serafina und schloss leise die Tür. »Ich freue mich, dass du gekommen bist!«
Der Hund wuselte noch immer um die beiden Frauen herum und hörte nicht auf, abwechselnd Serafina und Lilou anzuspringen.
»Coco!«, rief Lilou, diesmal energischer. »Non! Couche!«
Während der Hund sich leise kläffend auf eine Decke am Fuß des Doppelbetts zurückzog, das an der gegenüberliegenden Wand stand, bot Lilou Serafina eine Zigarette an. Serafina schüttelte den Kopf.
»Non?«
»Nein danke.«
»Also gut. Setz dich doch, Serafina.«
Serafina nahm auf einem der beiden dick gepolsterten Sessel Platz, die vor dem Fenster standen.
»Möchtest du etwas trinken?« Auf einem Beistelltisch stand eine Flasche Champagner.
»Auch nicht, danke.«
»Wirklich nicht?« Ohne die Zigarette wegzulegen, schenkte Lilou ein Glas Champagner ein und setzte sich auf den Fauteuil neben Serafina. »Heute Abend ist wieder eine Vorstellung. Möchtest du kommen? Josephines Programm ist sehr beliebt beim Publikum hier in Stuttgart.«
»Ich würde gern, aber ich kann nicht.«
»Du kannst nicht?«
»Ich lebe hier bei der Familie meines Halbbruders. Ich möchte nicht …«
»Ah, du möchtest keinen schlechten Eindruck machen. Ich verstehe.« Lilou beugte sich näher zu Serafina hin. Unwillkürlich wich Serafina aus. Lilou grinste und schuf wieder Abstand.
Liebschaften unter Frauen waren häufig in Berlin. Dennoch fühlte sich diese Nähe für Serafina befremdlich an.
»Mach dir keine Gedanken, ma chère«, sagte Lilou gelassen und nahm einen kräftigen Schluck aus ihrem Champagnerglas. »Lass uns einfach Freundinnen sein.«
Serafina nickte, erleichtert, dass Lilou ihre Reaktion nicht übel nahm.
»Also, du kommst nicht wegen der Aufführung«, fuhr die Französin fort. »Und auch nicht wegen mir. Möchtest du Josephine kennenlernen? Wir könnten mit ihr heute zu Abend essen.«