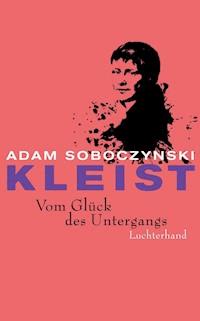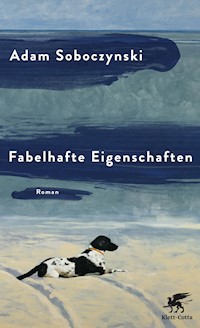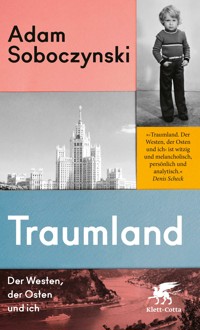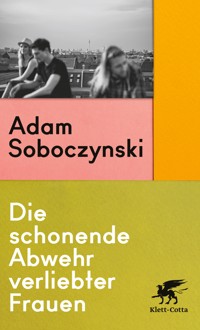
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Nichts ist vor dem Witz dieses Erzählers sicher.« taz Wir wollen Erfolg, wollen gegenüber anderen glänzen oder uns manchmal aus unliebsamen Situationen wie ein Dieb auf und davonmachen. Im Vorteil ist, wer sich dabei gut zu verstellen weiß – dem einen gelingt's während der andere krachend scheitert. Diese peinlichen oder glücklichen Momente schildert Adam Soboczynski schonungslos offen: mit liebevoller Zärtlichkeit und hinreißendem Witz. »Soboczynski führt vor, dass Verstellungskunst, ob wir wollen oder nicht, unser Leben begleitet und dass sie sich oftmals gerade mit dem Ausdruck der Authentizität tarnt.« Ursula März, dlf kultur »An diesem Buch bleibt keines der gewohnten Etiketten haften; es ist ein philosophierender Ratgeber-Erzählungsband, ein kleines, leichtes Kunstwerk.« René Aguigah, Literaturen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Adam Soboczynski
Die schonende Abwehr verliebter Frauen
oder Die Kunst der Verstellung
Klett-Cotta
Impressum
Der vorliegende Titel ist erstmals 2008 im Gustav Kiepenheuer Verlag erschienen.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
© Adam Soboczynski 2023. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © mauritius images / Maskot, shutterstock
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98659-4
E-Book ISBN 978-3-608-12240-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorrede
Dieses Buch, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, enthält dreiunddreißig Geschichten, die darum kreisen, wie sich in einer Welt geschickt zu verhalten sei, in der Fallen lauern und in der Intrigen walten. Die Kunst der Verstellung, die eine jahrhundertealte Tradition hat, erlebt eine Wiederkehr.
Die Geschichten sind so oder zumindest so ähnlich tatsächlich passiert, und lediglich die Namen der Personen, keineswegs ihre Eigenheiten, ihre Berufe oder gar die Orte der Handlung, wurden verändert.
»Und Kunst vollende, was die Natur begann.«
Baltasar Gracián
1 Die schonende Abwehr verliebter Frauen beherrschen
Ein unschönes Ereignis: Jemand ist in einen verliebt, umgekehrt ist man es aber nicht. Höflichkeit gebietet es, in diesem Fall schonend vorzugehen.
Nehmen wir an, Sie sind ein Mann. Sie lernen auf einer Party, der Geburtstag einer alten Bekannten wird gefeiert, gegen ein Uhr nachts eine Frau kennen. Sie sind liiert, das weiß die Frau aber nicht. Sie verraten auch nicht gleich, dass sie mit jemandem liiert sind, der an diesem Abend aufgrund einer kleinen Erkältung verhindert ist. Sie verschweigen diese Information aus zwei Gründen: Zum einen käme das einem Affront gleich. Sie würden mit einer kurzen Erwähnung Ihrer Lebensgefährtin auf grobe Weise zu verstehen geben, dass Sie erkannt haben, dass die Frau des Abends Interesse an Ihnen zeigt. Zum anderen verschweigen Sie Ihre Beziehung, da die Begegnung nicht frei von sich anbahnender nervöser Anspannung ist, was zu genießen, zumindest in den wenigen Stunden einer Feier, Sie reizt.
Sie sprechen über das Berufsleben, über den schwierigen Umgang mit Vorgesetzten, über vergangene und zu planende Urlaubsreisen (Rom, Finnland im Herbst!), darüber ob Kochen eine vergnügliche Tätigkeit ist oder eher nervt, und Sie gelangen mit der Frau des Abends nach dem dritten Glas Wein, der die Zungen vollends löst, in eine übermütig-launige Stimmung. Sie mustern die anderen Gäste und lästern. Es fallen abschätzige Bemerkungen über eine verzweifelt gut gelaunte Frau in reifen Jahren.
Lästern ist ein Gradmesser der Vertrautheit. Wer lästert, teilt unverhohlen seine niederen Gedanken mit und hofft auch noch, dass sie goutiert werden. An diesem Abend werden sie goutiert: Sie lachen gemeinsam. Es ist unversehens spät geworden, irgendwo fällt eine Bierflasche um, vier angeheiterte Frauen tanzen exaltiert zu einem kitschigen Schlager aus den Achtzigern. Sie stehen abseits des Treibens, in einer wenig frequentierten Nische, und fast wäre es zu einer unbedachten Berührung mit Ihrer Gesprächspartnerin gekommen, zur Andeutung eines Kusses. Unbedingt Zeit zu gehen! Sie verlassen nach dem vierten Glas Wein, das die Gefahr einer unkontrollierbaren Zusammenkunft in sich birgt, rasch das Fest, verabschieden sich, einen arbeitsreichen nächsten Morgen vorschützend, mit sachter Umarmung von ihrer neuen Bekanntschaft und vereinbaren noch, sich bald einmal auf einen Kaffee zu treffen.
Irgendetwas störte. Vielleicht das etwas zu laute Lachen? Oder die spitzen Schuhe, die auf aggressive Weise Unterschichtiges suggerierten? Es sind ja immer diese Winzigkeiten, die alles entscheiden in Liebesdingen. Vielleicht war es auch nur die schnöde Scheu vor Komplikationen, die mit Affären einhergehen, das Geständnis, das schließlich zu äußern Sie nicht hätten umgehen können: Sie seien zwar bereits vergeben, aber gegen eine lockere Liaison, herrje, ja, da hätten Sie nichts einzuwenden. Überhaupt: das Reden. Sie reden nicht gern vor einer Beziehung über dieselbige, womöglich lag es gar nicht an den Schuhen.
Zwei Tage später natürlich die SMS von ihr. »Kaffee? Heute? Oder morgen?« Bewusst gut gelaunt abgefasst. Was tun? Am besten nichts. Nicht reagieren. Wobei – sich gleich nach der Feier gar nicht mehr zu melden geht natürlich nicht. Besser: erst einmal Zeit gewinnen. Sie schreiben also: »Gerne, aber im Moment wahnsinnig viel Stress, melde mich nächste Woche. Liebe Grüße!«
Sie melden sich nach einer Woche keineswegs. Eine durchaus nachahmenswürdige Weise, den Kontakt abzubrechen. Die Verschmähte hat nun, Sie betreffend, eine schlechte Meinung. Das ist auch Ihre Absicht gewesen. Denn wer schonend Verliebte abwehren möchte, muss früh den Eindruck erwecken, er sei ein unzuverlässiger, vor allem aber ein durch und durch schwieriger Mensch. Kein bösartiger natürlich – wer weiß, ob die Verliebte Ihnen einmal wiederbegegnet? Oder durch üble Nachrede ihren Ruf zu schädigen sucht?
Niemals darf die schonende Abwehr verliebter Frauen dem Abwehrer schaden. Es gilt vielmehr, die Verliebten kunstvoll im Glauben zu lassen, sie selbst hätten das Interesse an einem verloren. Verliebte Frauen zu schonen bedeutet, in ihnen die Selbstlüge zu entfalten.
Besonders ärgerlich aber ist der Fall, wenn man aufgrund eines wortkargen Rückzugs als schillerndes Mysterium gilt. Wenn sich Frauen aufgrund des vermeintlich komplizierten Charakters angezogen fühlen, ihn gar heilen wollen, und deshalb eine zweite, ja, eine dritte nicht minder gut gelaunte SMS schreiben. Hier hilft nur beharrliches Schweigen.
Nun sind die meisten Menschen natürlich längst nicht so umsichtig wie Sie auf jener Party. Die meisten versuchen nach dem vierten Glas Wein alles daran zu setzen, sich dem alten Spiel der Körper zu ergeben. Im Hintergrund eines Schlafzimmers läuft dann allerspätestens wenige Tage nach der ersten Begegnung leise Musik. Und am Morgen danach sitzt man dann am Küchentisch, blickt aus dem Fenster, rührt in der Tasse, täuscht prächtige Laune vor. Und ahnt, dass man nach einer glühenden Liebesnacht nunmehr auch in Zukunft gefälligst Objekt des Begehrens sein soll. Hilfreich ist in diesem Fall die häufig geäußerte Behauptung, man sei noch nicht soweit, die letzte Beziehung sei so quälend und traumatisch gewesen, man habe sie einfach noch nicht überwunden, sich noch nicht gefangen, die noch unvernarbten Wunden der Seele verhinderten die neue, an sich ganz wunderbare, knospende Liebe! Dann sollte man traurig blicken und mit den Schultern zucken. Auch eine Spur von Verwirrtheit darf angedeutet werden. Das schreckt zumindest einige Verliebte ab. Andere nicht.
Es gibt die zäh Verliebten. Die zäh Verliebten fragen nach den wahren Gründen des Nicht-verliebt-Seins, die zäh Verliebten ahnen, dass man lügt, die Unglücklichen. Doch was, wenn es das Äußere wäre, das nicht ganz dem Geschmack entspräche? Undenkbar, man antwortet, es liege am zu hohen Alter, an zu vielen Pfunden, an der unreinen Haut der Verliebten. Man sollte in solchen Fällen, mit allen Anzeichen der Ratlosigkeit, immer ausweichend antworten, sollte sagen, das so vieles, die Liebe betreffend, sich schlecht in Worte fassen lässt. Was, bei Lichte betrachtet, eigentlich gar nicht stimmt, aber eine Aussage ist, die allgemein anerkannte Plausibilität genießt.
Nur Barbaren, Diktatoren und Scheichen kann die schonende Abwehr verliebter Frauen gleichgültig sein. Alle anderen mögen bitte sorgsam beachten, dass die Liebe, die nicht erwidert wird, nur dann milde abebbt, wenn die Verliebte sich vom ersten Eindruck, den sie sich vom Geliebten gemacht hat, fälschlicherweise getäuscht glaubt.
2 Leidenschaften verbergen
Unkontrollierte Gefühlsausbrüche, ob freudige oder zornige, sind fast immer zu vermeiden. Sie offenbaren den Gegnern unsere Absichten und Leidenschaften. Das überhitzte Gemüt neigt zu Fehlern, der kühle Gedanke macht die Klugheit aus.
Verärgert ist häufig zu Recht, wer eine unverschämte E-Mail erhält. Der Reiz, sogleich noch unverschämter zurückzuschreiben, ist enorm. In diesem Fall sollte man sich erst einmal beruhigen, statt ungehalten in die Tasten zu hauen.
Dreiste Mails sind häufig als berechtigte Forderungen getarnt: »Sehr geehrter Herr Walter, wie versprochen, hier nun die Spesenabrechnung für meine Rom-Reise. Über eine rasche Überweisung würde ich mich sehr freuen. Die Belege werde ich in Kürze nachreichen. Sehr herzlich, Ihr Hans Strass.«
Herr Walter, ein Angestellter bei einer renommierten Immobilienmaklerei, hatte Herrn Strass, einen freien Mitarbeiter, nach Rom beordert, um dort zwei Wohnungen zu verkaufen. Herr Walter war eindringlich von seinem Chef gebeten worden, da sich die Firma in einer leicht angespannten wirtschaftlichen Lage befand, für eine kostengünstige Reise zu sorgen. Deshalb hatte er mit Herrn Strass vereinbart, dieser solle einen dreitägigen Aufenthalt mit Übernachtungen in einem Zwei-Sterne-Hotel anvisieren.
Aber wie erschrak Herr Walter, als er den Mail-Anhang öffnete, der eine Auflistung der Spesen enthielt. Statt drei war Herr Strass sieben Tage in Rom gewesen und hatte im Grand Hotel Parco dei Principi, gegenüber den Villa-Borghese-Gärten, logiert. Herr Walter, eine Rüge seines Chefs fürchtend, sah Herrn Strass vor seinem geistigen Auge: Wie er im Whirlpool saß und hässlich grinsend einen Cocktail schlürfte, wie er sich junge Frauen aufs Zimmer bestellte und eine dicke Zigarre im Foyer rauchte. Und so haute Herr Walter, von neidvollen Gedanken an die Ewige Stadt erfüllt, ungehalten in die Tasten: Er sprach von einer Frechheit, was Herr Strass sich anmaße? Erstens würden Rechnungen für gewöhnlich nicht per Mail, sondern in Briefform samt beiliegenden Belegen entgegengenommen. Dessen ungeachtet aber brauche er zweitens gar nicht erst zu glauben, dass diese horrende Summe irgendjemand in diesem Haus hier begleichen werde.
Herr Walter konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass Herr Strass in Rom mit seiner wunderbaren Verhandlungskunst ausgesprochen vorteilhafte Kaufverträge abgeschlossen hatte! Der Chef ist nun insgeheim derart begeistert, dass er finster entschlossen ist, Herrn Strass nicht nur eine Festanstellung anzubieten, sondern ihn zu einem seiner engsten Berater zu machen.
Unfreundliche Mails werden so gut wie immer weitergeleitet. In der Regel an den Vorgesetzten. So auch in diesem Fall. Bereits wenige Minuten später eilt der Chef, ein untersetzter Herr um die vierzig, mit erhitztem Gesicht auf Herrn Walter zu: Ob er wahnsinnig geworden sei? Wegen der paar Euro den lieben Herrn Strass so zu verärgern! Wieso er glaube, sich hier derart aufspielen zu dürfen? Ob er, der Chef, in diesem Laden aber auch alles selbst machen müsse?
Herr Walter, unruhig auf seinem Bürosessel wippend, erblasst. Was er denn falsch gemacht habe? Der Chef aber, mit einer wegwerfenden Handbewegung, antwortet nicht, schüttelt nur den Kopf und verlässt, mit allen Anzeichen der Verbitterung, sein Büro, nicht ohne noch kräftig die Tür hinter sich zuzuschlagen.
Wie schlecht Herr Walter in den nächsten Tagen schlief! Derart sich die Gunst des Chefs verspielt zu haben, erschien ihm eine große Last. Denn die Maklerei war ihm, seitdem seine Tochter aus dem Haus war und seine Frau nicht mehr lebte, das Lebenselixier in einem ansonsten nur von wenigen Freuden erfüllten Dasein. Wie die Zeiten sich doch geändert haben, dachte Herr Walter oft in jenen Nächten, sich mühsam von einer Seite auf die andere wälzend. Früher, als der Alte noch im Betrieb war, der Vater seines derzeitigen Chefs, war die Welt noch in Ordnung gewesen. Kein einfacher Charakter auch er, gewiss, mit einer Neigung zu heimlichem Alkoholgenuss, daher oft launisch, aber damals galt noch: ein Mann, ein Wort. Niemals hätte der Alte in derart rabulistischer Weise die Tatsachen verdreht (»Die paar Euro!«), niemals hätte er ihn so furchtbar gedemütigt.
Man erkennt leicht, dass Herrn Walter zwei grobe Fehler unterlaufen sind. Nicht nur, dass er es versäumt hat, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, seinem Chef die Misslichkeit einer überhöhten Rechnung zunächst diskret mitzuteilen. Auch hat er, da er seine Affekte nicht zu zügeln vermochte, höchst voreilig zurückgeschrieben. Sicherlich schwang in seiner Mail eine grundsätzliche Abneigung Herrn Strass gegenüber mit, den er vor einigen Monaten bei einem Abendempfang der städtischen Maklervereinigung kennengelernt hatte. Der junge, groß gewachsene Herr Strass war an diesem Abend sehr eloquent gewesen, man hörte ihn gerne raumgreifend Anekdoten erzählen, später, als sich die Gesellschaft bereits in Auflösung befand, unterhielt sich Herr Strass, wie Herr Walter nicht ohne Beunruhigung registrierte, noch mit seinem Chef vertraulich am Tresen.
Die E-Mail von Herrn Strass war eine durchschaubare Falle, die Herr Walter leicht hätte umgehen können. Denn immer gilt der Grundsatz: Ein Satz, der gesagt oder geschrieben wurde, lässt sich nie mehr zurücknehmen, wer indes zunächst schweigt, um seine Gefühlsregungen zu dämpfen, hält sich Optionen offen. Hätte Herr Walter einige Minuten lang überlegt, seine Antwort wäre jedenfalls anders ausgefallen. In etwa so: »Lieber Herr Strass, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Mail. Ich hoffe, dass Sie neben der Arbeit auch einige vergnügliche Stunden in Rom haben verbringen können! Bei der Durchsicht Ihrer Kostenaufstellung ist mir aufgefallen, dass die Spesen höher ausgefallen sind, als zunächst vereinbart. Wenn Sie mich hierüber kurz aufklären könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Mit herzlichen Grüßen und in der Hoffnung, dass wir uns bald einmal wieder treffen, Ihr Heinrich Walter.«
Nun hätte Herr Strass sich erklären müssen, hätte ziemlich wahrscheinlich Herrn Walter geschrieben, dass ein Zwei-Sterne-Hotel sich just an diesen beiden Tagen der Reise nicht hatte auftreiben lassen können. Herr Walter hätte daraufhin Gelegenheit gehabt, durch eine kleine Recherche herauszufinden, dass es an diesen beiden Tagen sehr wohl, und zwar mit Leichtigkeit, möglich gewesen wäre, eine günstige Unterkunft zu finden. Das hätte er Herrn Strass mit großer Höflichkeit geschrieben, nicht ohne zu verschweigen, dass er ein wenig irritiert sei.
Kurzum: Herr Strass wäre im Laufe dieses E-Mail-Verkehrs in immer größere Verlegenheit geraten. Mit nur etwas Glück hätte er sehr bald auch störrisch reagiert, mangels finanzieller Reserven in uneinsichtiger Weise auf dem Gesamtbetrag beharrt und eines schlecht gelaunten Morgens eine Mail an Herrn Walter geschrieben, die diesen dazu aufgefordert hätte, ihn »endlich mit diesem kleinlichen Scheiß« zu verschonen. Darauf aber hätte Herr Walter nur gewartet, hätte den E-Mail-Verkehr ausgedruckt, ihn seinem Chef vorgelegt und bescheiden dargelegt, dass er beim besten Willen zwar nicht die Absicht habe, freie Mitarbeiter schlecht zu machen, aber es sei ein Problem entstanden, um das zu lösen er seinen Rat erbitte.
Ja, wie leicht hätte diese Geschichte eine gute Wendung nehmen können. Wäre Herr Walter nur nicht so zornig geworden!
Wer seine Affekte nicht zu kontrollieren vermag, entblößt sein Inneres und ist leicht verwundbar. Das heißt nun allerdings nicht, dass man sich nicht wütend zeigen dürfte oder traurig. Kunstvoll in Zorn zu geraten, um einen Konkurrenten einzuschüchtern, ist durchaus übliche Praxis. Nur sollte dies niemals in Mails geschehen, die, wie jeder weiß, oftmals in Umlauf gebracht werden. Dagegen: Hin und wieder in das Büro eines sensiblen Kollegen zu treten, diesen übertrieben aufbrausend auf einen Fehler, eine kleine Unaufmerksamkeit hinzuweisen kann nützlich sein, um sich Respekt zu verschaffen.
Große Kunst: Sich gezielt mit Zornesröte öffentlich zu äußern, zum Beispiel während einer Konferenz. Dann sollte man einen Standpunkt aber gleich so vehement vertreten, dass alle Beteiligten glauben, dass dies dem Zornerregten mehr schadet als nützt. Das kann ab und an in Kauf genommen werden, sofern man dadurch als ausgesprochen eigenwilliger Charakter erscheint, als jemand, der eine Haltung hat. Dies wiederum erfordert einen so hohen Reifegrad der Verstellung, dass dies nur den Erfahrenen in jener Kunst empfohlen sei.
3 Sich verstellen
Zwei Geschichten liegen hinter uns, die davon handeln, dass wir uns immerzu inszenieren, inszenieren müssen, um Wünsche, Gedanken, Sehnsüchte auszudrücken, dass wir uns immerzu verstellen! Zur Schonung anderer, damit sie uns in Zukunft nicht schaden und um uns gegenüber Konkurrenten Vorteile zu verschaffen. Wir brauchen dafür den Körper, brauchen die Sprache. Fragile Werkzeuge, die anzeigen, dass ein Riss, seitdem wir auf der Welt sind, in uns ist; dass wir gespalten sind in ein geistiges Innen und ein körperliches Außen; dass wir authentisch sein wollen und bestenfalls so wirken. Nie sind wir bei uns selbst, die Schöpfung, seit wir den Sündenfall erlitten, ist reines Welttheater. Und »wahrhaft zu sein«, wie einst ein Philosoph sagte, heißt nur, »nach einer festen Konvention zu lügen, herdenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen«.
Verstellung ist das Verbergen von Absichten, von Charaktereigenschaften, von Einstellungen. Schon das freundliche Grüßen eines Kollegen, den wir nicht schätzen, der im Büro immer so selbstgefällig grinst, der grundlos glaubt, uns überlegen zu sein, ist streng genommen Verstellung. Es gibt Tage, da würden wir ihn gerne ohrfeigen. Doch wir tun es nicht. Wir grüßen, wen wir verachten, noch herzlich. Ohne Höflichkeit, die unsere Leidenschaften dämpft, die den Alltag mit sanften Lügen umspannt, ohne Triebhemmung, ohne auferlegte Distanz wären wir so unverstellt gefährlich, wie es nur Tiere sind. Man muss schon staunen, wie sehr das zivile Zusammenleben vom beharrlichen Sich-Zusammenreißen der Menschen geprägt ist, ja überhaupt erst ermöglicht wird. Und wie mühelos es den meisten gelingt, sich dabei auch noch moralisch zu wähnen. Verstellt wird in dieser Selbstlüge die Verstellung selbst.
Es wurde vor einiger Zeit die feine Beobachtung gemacht, dass die Verstellungskunst immer dann Konjunktur hat, wenn eine Krisenzeit die Menschen plagt. Verbissen kreisten einst die Höflinge um den Fürsten wie Motten ums Licht, und das, was heute Mobbing genannt wird, war schon damals übliche Praxis: Man stach sich gegenseitig aus, machte den Gegner lächerlich, suchte beharrlich nach seinen diskreditierenden Eigenheiten – um nicht selbst einen sozialen Abstieg zu erleiden. Es ging zu wie heute in Chefetagen, in jedem mittelständischen Unternehmen, jeder freiberuflichen Arbeitsgemeinschaft, in jedem Ladenlokal, jeder Putzkolonne.
Ziemlich beschaulich geht es wohl nur zu, wenn man in einem wohlhabenden Land lebt, das kaum Aufsteiger und kaum Absteiger kennt. Es gibt Menschen, die haben das noch erlebt. Sie hatten ein sattes Wirtschaftswachstum im Rücken, sie studierten, bis die Schläfen grau wurden, diskutierten über Trotzki, bis die Stimme heiser, tauschten Partner, bis die Libido ermattet war. Dann retteten sie sich noch schnell in die sicheren Häfen des Beamtentums und der Ehe, um noch das eine oder andere Kind ihren Lenden abzuringen.
In den WG-Küchen sollte es wahrhaftig zugehen, dort gelangte der ungeheure Ausstoß an Psychologie, den die bürgerlichen Jahrhunderte kultiviert hatten, zu seinem Höhepunkt. An den mit Wachstropfen gesprenkelten Tischen wurde nach erfolgtem Liebesspiel über den weiblichen Orgasmus gesprochen und wie er sich anfühlt angesichts des noch nicht vollständig beseitigten Patriarchats. Was für ein Triumph über die schweigsamen Eltern, dass endlich die feinsten seelischen Verästelungen mit verzärtelter Stimme entblößt werden konnten!
Ähnliches erzählen auch manche Ostdeutsche, wenn sie mit vager Melancholie an die Hilfsbereitschaft erinnern, die einst an jeder Ecke einer bröckeligen Fassade erblühte! Wie selbstverständlich half man sich damals mit raren Ersatzteilen für den stotternden Wagen aus, und in den Kneipen saßen noch die Arbeiter gemeinsam mit den Professoren am Tresen, wohnten im selben Block.
Wer sich heute in eine Lounge begibt, im Hintergrund läuft verhalten Musik, mag noch Reste des alten Wahrhaftigkeitskults erblicken, sieht Männer und Frauen, die in klebriger Vertrautheit im gedämpften Licht sitzen und die Nuancen seelischer Verwerfungen erkunden. Es ist wohl die letzte Generation, die vom Wirtschaftswunder der Großeltern noch eine kleine Weile wird zehren können.
Die Jahre jener Männer und Frauen waren bislang vergangen wie ein langer Sonntagnachmittag, sie waren in den achtziger Jahren aufgewachsen, dem, wie einmal treffend gesagt worden ist, langweiligsten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts: Nicole sang ein bisschen vom Frieden, und Boris Becker spielte ein wenig Tennis. Doch wer heute Gespräche belauscht, als Beobachter, der sich wie zufällig hineinbegibt in die mit weißen Billy-Regalen bestückten Wohnzimmer, hört und sieht erneut das alte Spiel der Verstellung.
Die Verstellung war natürlich nie ganz verschwunden, sie gehört zum Menschsein dazu wie das Fingernägelschneiden oder der aufrechte Gang. Nur lohnte es sich, da die Lebensläufe, die man vor sich hatte, ziemlich vorhersehbar schienen, über lange Zeit nicht recht, zu intrigieren.
Entscheidend ist nach wie vor die Frage, was anzuziehen sei, welches Hemd stilvoller sei, welches Auto einen in günstigerem Licht dastehen lasse, doch die gute, melancholische Laune ist versiegt und gewiss nicht nur in dieser Generation: der Stress; das Handy, das in der Nacht noch klingelt; das fünfte Praktikum in Folge, und noch immer kein rechter Job; zu wenig Zeit, sagen die Erfolgreichen; schon wieder ein Umzug, sagen die Überforderten. Man eilt von einer Stadt in die andere, wechselt den Beruf, steigt auf, steigt wieder ab, arbeitet an wechselnden Projekten, in wechselnden Teams, unter wechselnden Chefs, checkt siebenundsechzig Mal am Tag seine Mails. Die Beweglichkeit ist hoch, die Konkurrenz erbittert, doch die Verstellung ist blendend: So freundlich war die Welt wohl nie, selten war sie in derart süße Worte verpackt. Der Choleriker ist Vergangenheit, dem Charmeur gehört die Zukunft.
In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche tritt der Verstellungskünstler besonders markant ins Licht. Passé sind die in Dreireiher und mit Monokel posierenden Großbürger in zerknitterten Fotoalben oder stolze Arbeiter, die stattlich vor großen Maschinen stehen, mit hochgekrempelten Ärmeln, zum Kampf der Körper gerüstet, passé die Gewissheit einer klassischen Festanstellung.
Aufbegehrt wird nicht. Nicht der Angestellte meutert, nicht der Freiberufler oder der Scheinselbständige. Nur die Unterschicht zieht ab und an in versprengten und desolaten Gruppen durch die Hauptstadt mit schäbigen Plakaten, Trillerpfeifen und Alkoholfahnen. Aufbegehren? Das gehört der Vergangenheit an. Gegen wen denn? Gegen den Vorgesetzten, der mit der Knute die Angestellten antreibt? Soll man sich unterhaken und ihn stürzen? Undenkbar: Es gibt den Chef, auf den sich die Wut vereinen könnte, nicht mehr. Er ist der angenehmste Mensch auf Erden. Es gibt auch kein Wir. Es gibt das Ich, das eingepanzerte, das sich seine Karriere geschickt erkämpft. Der Gegner sitzt nicht mehr oben, da ist nur noch der Himmel. Er sitzt neben einem im Großraumbüro. Das nennt man flache Hierarchie.
Wie sich verhalten, um sich durchzusetzen? Immer mit einem Lächeln. Der flexible Mensch unserer Zeit tut nie das, was er vorgibt, er gleicht einem Chamäleon, das die Farbe des Gesteins annimmt, auf dem es sitzt.
Allzeit reaktionsschnell sei der Mensch heute, ortsunabhängig und anpassungsfähig, heißt es. Treffende Begriffe, gewiss. Es sind Begriffe des höfischen Lebens. Damals, als jeder Höfling des anderen Gegner war, mit Verve seine Karriere vorantrieb oder um eine Liebschaft buhlte. Am Hof war er nicht mehr der alte Ritter, der mit Schwert und Lanze kämpfte, seine Waffen waren nun wohlbedachte Worte und tückische Gesten. So wie auch heute niemand auf dem Schlachtplatz der Straße Parolen skandiert, sondern in seinem Alltag mit Freundlichkeit sich tarnt.
Dem Urvater der Verstellungskunst, dem düsteren spanischen Jesuiten Baltasar Gracián, war die Täuschung, das Schmeicheln, das Hinter-dem-Rücken-Reden unserer Zeit allzu vertraut. Vor über 350 Jahren. Er und andere Moralisten seiner Zeit werden uns ab und an in unseren Geschichten begegnen. Sie wollten den Menschen nicht moralisch erbauen, sondern ihm seine Maskenhaftigkeit aufzeigen, nicht bessern wollten sie ihn, sondern sein moralisches Koordinatennetz nur begreifen; nicht ethisch verfeinern, sondern ihn kluges Handeln lehren.
Das wollen wir auch. Denn schlecht war die Welt, und sie ist es, schauen wir uns nur um, noch heute.
Was ist das Leben? Es ist ein Minenfeld.
Was die Verstellung? Bedingung unseres Aufstiegs.
Was ist die Liebe? Die schönste aller Täuschungen.
4 Interessiert blicken
Wie sehnen wir uns doch nach Aufmerksamkeit! Wer im Gespräch im Mittelpunkt steht, gefällt sich bisweilen ungemein. Kaum etwas befriedigt die Eitelkeit mehr. Vor allem, wer seine Zuhörer dergestalt in den Bann zu ziehen versteht, dass er in seinem Narzissmus gefällt. Erst dann blicken die Zuhörer den Erzähler aufmerksam und interessiert an. Sie vergessen sich selbst, sie hängen, so lautet eine schöne Wendung, an seinen Lippen. Das wiederum gefällt dem Erzähler sehr, der genau weiß, dass sich selbst gefallen nur wenig hilft, wenn man nicht den anderen gefällt. Umgekehrt gilt: Wer dem Erzähler schmeicheln will, hört aufmerksam zu.
Gut zuhören lässt sich einer Frau während eines Spaziergangs am Rhein. Der erste warme Tag im Jahr: Inline-Skater wagen sich nach draußen, ziehen an dem flanierenden Paar vorbei. Die Frau blickt etwas geistesabwesend auf ein Passagierschiff, das gemächlich stromabwärts zieht.