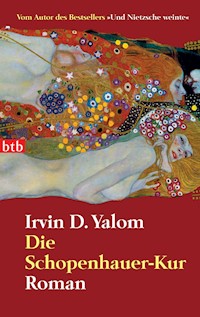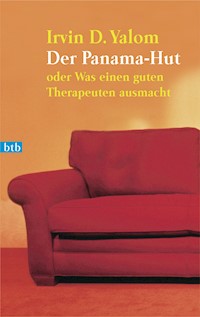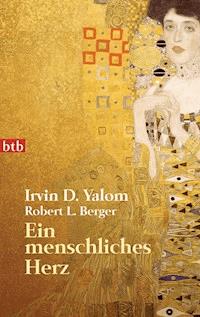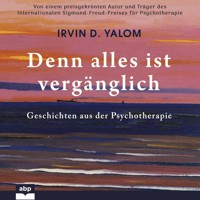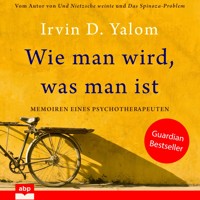17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann eine einzige Stunde Therapie etwas Entscheidendes ändern? Der weltbekannte Psychotherapeut und Autor Irvin D. Yalom über einen vollkommen neuen Ansatz der Verbundenheit.
Das Leben ist kostbar - und unsere gemeinsame Zeit kurz. Der weltbekannte Psychotherapeut und Bestsellerautor Irvin D. Yalom war dreiundneunzig, als er sich nach dem Verlust seiner langjährigen Ehefrau Marilyn Yalom, mitten in der Pandemie, mit einem zunehmenden Gedächtnisverlust konfrontiert sah. Die inneren wie äußeren Beschränkungen zwangen ihn dazu, die Form seiner Sitzungen mit seinen Klienten grundlegend zu überdenken und einen radikalen Ansatz zu wählen: Würden einstündige, einmalige Sitzungen ebenfalls einschneidende Veränderungen herbeiführen können und eine ebenso tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung ermöglichen?
In »Die Stunde des Herzens« erzählt Yalom von einigen dieser intensiven, lebensverändernden Sitzungen, das in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Benjamin Yalom geschriebene Buch ist ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in der Begegnung mit anderen, ein Lobgesang auf die therapeutische Kraft des »Hier und Jetzt«. Dabei geht er immer wieder an die Grenzen der Selbstoffenbarung als therapeutisches Mittel und verschweigt im Dialog mit seinen Klienten auch nicht seine eigenen Dämonen, darunter seine traumatische Kindheit in Washington, DC, die Entwicklung seines Denkens über Philosophie und Psychotherapie und den kürzlichen Tod seiner Frau. Diese eine Stunde der Verbundenheit, die in einer Zeit der Isolation und des Leids für viele Menschen stattfand, bestärkte so nicht nur den Patienten, sondern auch Yaloms Vision von dem, was Psychotherapie leisten kann, und sei sie noch so kurz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BUCH
Das Leben ist kostbar – und unsere gemeinsame Zeit kurz. Der weltbekannte Psychotherapeut und Bestsellerautor Irvin D. Yalom war dreiundneunzig, als er sich nach dem Verlust seiner langjährigen Ehefrau Marilyn Yalom, mitten in der Pandemie, mit einem zunehmenden Gedächtnisverlust konfrontiert sah. Die inneren wie äußeren Beschränkungen zwangen ihn dazu, die Form seiner Sitzungen mit seinen Klienten grundlegend zu überdenken und einen radikalen Ansatz zu wählen: Würden einstündige, einmalige Sitzungen ebenfalls einschneidende Veränderungen herbeiführen können und eine ebenso tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung ermöglichen?
In »Die Stunde des Herzens« erzählt Yalom von einigen dieser intensiven, lebensverändernden Sitzungen, in denen auch er einige seiner Dämonen preisgibt, wie beispielsweise seine traumatische Kindheit in Washington, DC. Das in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Benjamin Yalom entstandene Buch ist ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in der Begegnung mit anderen, ein Lobgesang auf die therapeutische Kraft des »Hier und Jetzt«. Diese eine Stunde der Verbundenheit, die in einer Zeit der Isolation und des Leids für viele Menschen stattfand, erwies sich so nicht nur wohltuend für den Patienten, sondern auch für Yaloms Vision von dem, was Psychotherapie leisten kann – und sei sie noch so kurz.
AUTOREN
Irvin D. Yalom wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und als einer der bedeutendsten lebenden Vertreter der existentiellen Psychotherapie. Er ist vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Sigmund-Freud-Preis für Psychotherapie und dem Oskar Pfister Award. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane sind internationale Bestseller – sie zeigen, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen weiß.
Benjamin Yalom lebt in San Diego als Psychotherapeut und Kreativcoach, seine Ausbildungsschwerpunkte lagen in der Familien- und Paartherapie, mit seinem Vater Irvin D. Yalom verbindet ihn darüber hinaus die Liebe für das Schreiben. Er ist ein Absolvent des Iowa Writers Workshop und vielfach preisgekrönt. 1998 gründete er das legendäre FoolsFURY Theatre in San Francisco, das u. a. mit der Neuinterpretation von Shakespeare-Stücken von sich reden machte.
Irvin D. Yalom
mit Benjamin Yalom
Die Stunde des Herzens
Sich begegnen im Hier und Jetzt
Aus dem Amerikanischen von Sylvia Bieker
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »HOUROFTHEHEART. Connecting in the Here and Now« bei HarperCollins, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Das Zitat »Ich spiele nicht genau, jeder kann präzise spielen, aber ich spiele mit wunderbarem Ausdruck« bezieht sich auf Oscar Wildes Stück »The Importance of Being Earnest«, das 1895 veröffentlicht wurde. Deutsche Ausgabe (herausgegeben von Alexander Varell), Aionas, 2017.
»Schwer ruht das Haupt, das eine Krone trägt« aus: William Shakespeare, Heinrich IV, Dritter Aufzug, Erste Szene, Reclam, 1998.
»… eines aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, was da vorne ist.« Philipper 3:13 aus: Das Ziel. Lutherbibel, 2017.
Copyright © 2024 by Irvin D. Yalom, MD. All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Der Stoclet-Fries, Erwartung, Der Baum des Lebens, Erfüllung, 1908-11 (Bleistift, Gold, Pastell und Gouache auf Papier), Klimt, Gustav (1862-1918), MAK (Museum für angewandte Kunst), Wien / Superstock / Bridgeman Images
Lektorat: Frauke Brodd / write and read
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30684-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für meine Kinder Eve, Reid, Victor und Ben; deren Kinder und die Kinder ihrer Kinder.
IRVIN D. YALOM
Für Anisa, die Tag für Tag mein Herz singen und tanzen lässt.
BENJAMINYALOM
Inhalt
Einleitung
kapitel 1
Ein ganz normaler Tag im Leben eines sehr alten Therapeuten
kapitel 2
Wenn ich doch nur aus dieser Bruchbude raus könnte
kapitel 3
Keine zweiten Dates
kapitel 4
Kolonisierung und Angeberei
kapitel 5
Wie ein Komet, der seine Umlaufbahn vollendet
kapitel 6
Gedächtnis, ach, das Gedächtnis
kapitel 7
Der Kampf mit der Gelassenheit
kapitel 8
Invasione und Aggressione
kapitel 9
Die Fenster des Warum, das Flüstern des Wann
kapitel 10
Allein, allein, allein
kapitel 11
Tauschgeschäft
kapitel 12
Alberts Angst
kapitel 13
Der Kampf mit der Gelassenheit, das Duell mit dem Trauma
kapitel 14
Tough Love
kapitel 15
Einfach mal die Rollen tauschen
kapitel 16
Mein schlimmster Albtraum
kapitel 17
Gedächtnis, Gedächtnis, verweile doch, du bist so schön
kapitel 18
Judy Steinbergs Geburtstag
kapitel 19
Ödnis in London
kapitel 20
Ein schrecklicher Start
kapitel 21
Ein wundervoller Start
kapitel 22
Demenz, ach, die Demenz
Nachwort
Danksagungen
Endnoten
Einleitung
Einst hatte ich die kühne Idee, meine wichtigsten Erkenntnisse zur praktischen Anwendung der Psychotherapie zusammenzutragen, und daraus entstand das nützliche Buch Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht. Im hohen Alter von damals siebzig Jahren schrieb ich in der Einleitung, dass mich zwei Dinge motivierten. Erstens, meine Patienten hatten angefangen, sich Sorgen zu machen, wie lange ich noch für sie da sein könnte. Würde ich in Urlaub fahren und nie mehr zurückkommen? Würden sie demnächst mein Grab besuchen? Zweitens, angesichts meines scheinbar unmittelbar bevorstehenden Ablebens wollte ich unbedingt weitergeben, was ich in damals vier Jahrzehnten als Psychotherapeut gelernt hatte, und zwar so schnell wie möglich.
Doch die Befürchtungen haben sich als ein ganz klein wenig verfrüht erwiesen, denn mehr als zwanzig Jahre später überlege ich immer noch, wie ich Patienten und Therapeuten gleichermaßen am besten helfen kann. Da ich mich altersmäßig mittlerweile an die Dreiundneunzig heranschleiche, ist es wohl tatsächlich dringend geworden, Überlegungen zu meinem Tod und dem Verlangen nach Weitergabe hart erarbeiteter Lektionen anzustellen. Sicher bin ich mir da aber nicht. Besser, Sie schauen in zwanzig Jahren oder so noch mal bei mir vorbei!
Was in meinen nun mittlerweile sechs Jahrzehnten als Psychotherapeut eine Konstante war, ist die Sehnsucht nach menschlicher Verbindung als einer der wesentlichen Beweggründe der bei mir Hilfesuchenden. Die Menschen dürsten nach engeren, besseren Beziehungen. Der Schlüssel zum Aufbau solch erfüllter Beziehungen sind die Fähigkeit und der Wille, sich zu öffnen, um Intimität zu teilen. Das mag einfach klingen, und doch hatte die überwältigende Mehrheit meiner Patientinnen und Patienten genau damit Schwierigkeiten. Intimität fragt nach Verletzlichkeit: Man darf nicht erwarten, dass sich der Freund, Verwandte oder die Partnerin öffnet, wenn man nicht selbst bereit ist, sich der betreffenden Person zu öffnen. Und solch eine Verletzlichkeit fühlt sich schon beinah definitionsgemäß unsicher an. Viele – die meisten von uns – haben Erfahrungen gemacht, in denen emotionale Verletzlichkeit schiefgelaufen ist. Das war schrecklich, also haben wir schnell Schutzmechanismen entwickelt, unter denen die Lektion, uns nicht mehr zu öffnen, an erster Stelle steht. Doch leider, leider, wenn wir nicht zulassen, uns zu öffnen, erlangen wir auch nicht die Verbindung, nach der wir uns so sehnen.
Wer mit meiner Arbeit der Existentiellen Psychotherapie vertraut ist, dem kommt die Betonung der interpersonalen Verbindung möglicherweise widersprüchlich vor. Doch lese ich noch einmal die Einleitung von Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht, fällt mir auf, dass ich die beiden Bereiche schon dort als parallel, aber separat funktionierende Interessen behandelt habe. Die existentielle Psychotherapie konzentriert sich auf die inneren Konflikte des Patienten, die sich aus der Konfrontation mit den Gegebenheiten der menschlichen Existenz ergeben: Tod, Isolation, Sinn des Lebens und Freiheit. Ich stellte damals auch fest, dass die existentielle Sichtweise (denn es handelt sich nicht um einen eigenständigen, vollständigen Therapieansatz) meine Arbeit mit Einzelpersonen prägte. Bei der interpersonalen Therapie hingegen gehe ich davon aus, dass die Patienten Schwierigkeiten haben, enge Beziehungen zu anderen aufzubauen, zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Das ist mir vor allem bei der Arbeit mit Therapiegruppen aufgefallen, bei denen ich mich auf den Austausch, die Impulse und die Emotionen konzentrierte, die sich aus den Reaktionen der Gruppenmitglieder untereinander ergaben.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese beiden Interessen vielleicht doch gar nicht so unterschiedlich sind. Eine der großen Triebfedern von Existenzangst ist unsere grundlegende Ausgangssituation, allein im Universum zu sein, sodass wir Erfahrungen nie vollständig mit anderen teilen können. Diese ultimative Isolation kann furchterregend sein, und sie spielt allemal eine Rolle in der Theologie der meisten Religionen, die Trost spenden, indem sie versichern, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Für viele von uns, ob religiös oder nicht, ist die tiefe Verbindung zu anderen Menschen das beste Heilmittel gegen Isolation und die damit einhergehenden Ängste. Wenn ich also sage, die meisten Menschen, die zur Therapie kommen, suchen nach Hilfe für ihre interpersonalen Probleme, dann hat das ebenfalls ziemlich viel mit existentiellen Sorgen zu tun.
Ebenso gilt, während es bei den Geschichten in diesem Buch um Einzelgespräche mit meinen Patienten geht, dass der von mir verfolgte Ansatz ausdrücklich interpersonal ist, da ich im Hier und Jetzt unserer momentanen emotionalen Verbindung schürfe und die gewonnenen Einsichten direkt anwende, um dem Patienten den Aufbau von Beziehungen zu erleichtern. Das Existenzielle und das Interpersonale sind also gar nicht so sehr voneinander separiert.
Das Bedürfnis nach menschlicher Verbindung, um die existentiellen Sorgen zu lindern, hat sich für mich auf jeden Fall bewahrheitet, nachdem meine Frau Marilyn, mit der ich fünfundsechzig Jahre verheiratet war, im Jahr 2019 verstorben ist. COVID tauchte nur wenige Monate später auf, und ich verbrachte einen Großteil der darauffolgenden drei Jahre – der Zeitrahmen, in dem dieses Buch entstand – in strenger Isolation. Hinzu kam die Tatsache, dass ich mich auf folgenreiches Old Man-Territory begeben hatte. Fast alle meine Freunde und Kollegen waren gestorben oder schienen sich richtig damit zu beeilen. Ein biblisches Alter zu erleben mag besser als andere Varianten sein, es hat aber auch seine Schattenseiten.
Mit dem Älterwerden beschäftigten mich mehr und mehr existentielle Fragen. Ein wesentliches Merkmal meines Alterns ist das Nachlassen des Gedächtnisses. Da die Betrachtung des Gedächtnisverlusts ein Hauptthema dieses Buches ist, werde ich in der Einleitung nicht viel verraten, bis auf zwei kritische Aspekte: Erstens, vor sechs Jahren habe ich festgestellt, dass ich mich nicht mehr an all die wichtigen Details aus dem Leben meiner Patientinnen und Patienten und der gemeinsamen Therapiearbeit erinnern kann. Ich konnte schlicht nicht mehr versprechen, der wirkungsvolle Therapeut zu sein, der ich so lange gewesen war. Doch statt mein Praxisschild sofort abzuschrauben, entschied ich mich, Einzelkonsultationen für Menschen in Not anzubieten. Die prägnantesten dieser Konsultationen und die sich daraus ergebenden Lehren bilden das Herzstück der nun folgenden Kapitel.
Zweitens, auch wenn die Geschichten hier mit meiner, mit Irvin Yaloms Stimme erzählt werden, ist der Text eine Gemeinschaftsarbeit von mir und meinem jüngsten Sohn Benjamin. Unser interessantes Arrangement wurde aus der Not geboren, da ich ganz offensichtlich die vielen Begegnungen, die hier beschrieben werden, und die damit einhergehenden therapeutischen Bezüge nicht mehr simultan im Kopf behalten konnte. Glücklicherweise ist Ben ein hervorragender Schriftsteller, der schon seit vielen Jahren meine Arbeit redigiert. Das Timing hätte nicht besser sein können: Nach fünfundzwanzig Jahren Theaterarbeit und, wie er es ausdrückt, nachdem er es immer vermieden hat, in meinem beruflichen Schatten zu sein, beschloss dieser verlorene Sohn, ins Familienunternehmen einzusteigen. Er war mitten im Promotionsstudium in Paar- und Familientherapie, als meine Ambitionen hinsichtlich dieses Buchs auf die Realität meines bröckelnden Verstands prallten. Das Ergebnis ist eine vielfältige Kombination aus meinen Erfahrungen, Bens Beobachtungen und aufschlussreichen Fragen. Was für ein Glück! Es war ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten, herausgefordert zu werden, einige meiner Thesen zu verdeutlichen und zu überdenken, und Ben dank unserer Arbeit an diesen Seiten als einen meiner letzten Schüler zu bezeichnen.
Terminologie und eine einschränkende Bemerkung
Zu guter Letzt ein paar anleitende Bemerkungen. Zwei im Buch häufig vorkommende Begriffe sind erklärungswürdig. Erstens spreche ich oft von Intimität. Ich verwende diesen Ausdruck nicht in irgendeinem sexuellen oder körperlichen Sinne, auch wenn das in unserer Kultur heutzutage allgemeingebräuchlich so zu sein scheint. Ich meine mit Intimität vielmehr Nähe, Zuneigung, Vertrautheit – jede Form, die auf eine warmherzige, zartfühlende Öffnung von Mensch zu Mensch hinweist. Therapie, wie in diesen Geschichten dargestellt, sollte ein sicherer Ort sein, um diese Intimität zu erfahren und zu praktizieren.
Zweitens bezeichne ich Menschen, die zu mir in die Sprechstunde kommen, als Patienten. Dieser Begriff ist ein wenig problematisch. Der Bereich Psychotherapie wurde von Psychiatern geschaffen, ausgebildeten Ärzten, die sich deshalb ganz selbstverständlich auf den Begriff Patient/-in bezogen. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Psychotherapie jedoch weitgehend zur Domäne von Psychologen, Paar- und Familientherapeuten, Sozialarbeitenden und Coaches verschiedener Fachrichtungen geworden, die meist den Ausdruck Klient/-in verwenden. Ich bin von beiden Begriffen kein sonderlich großer Fan – der eine scheint Krankheit zu implizieren, der andere Kommerz –, aber es gibt eben keinen Begriff, der näher mit Beratung (vielleicht Beratende/-r?) verwandt ist und sich gut anhört, ohne Schmerzen im Ohr zu verursachen. Ich ziehe es vor, mich als gemeinsam Reisender zu betrachten – jemand, der vielleicht mit etwas mehr Weitsicht auf die zurückzulegende Wegstrecke blickt. Nichtsdestotrotz habe ich in den nun folgenden Geschichten den Begriff Patient/Patienten verwendet, obwohl ich weder eine kontinuierliche Betreuung angeboten habe noch die Absicht hatte, in irgendeiner Form ärztlich verantwortlich zu agieren.
Es handelt ich bei diesem Buch um eine Sammlung von Einzelgesprächen mit Menschen, die um Hilfe baten. Aus über dreihundert solcher Begegnungen habe ich zweiundzwanzig Geschichten ausgewählt, um Therapeuten und an Therapie Interessierten anzuleiten, um bestimmte Lektionen weiterzugeben und heikle Dilemmas aufzuzeigen. Und lassen Sie mich ganz klar und deutlich sagen: Ich schlage nicht vor, eine einzelne Therapiestunde als wirksames Therapiemodell zu betrachten! Eigentlich sollte es überflüssig sein, solch eine Einschränkung überhaupt zu erwähnen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass unser Fachgebiet von Versicherungs- und Pharmakonzernen zu immer kürzeren und zunehmend dürftigen Versionen dessen verkommt, was Therapie sein sollte, ist es mir ein Bedürfnis, das klarzustellen. Ich hoffe nicht, dass mein Experiment nachgeahmt wird, sondern dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, die hier vermittelten Erkenntnisse in Ihre Arbeit einfließen lassen können, und zwar so, wie Sie es für hilfreich halten.
Die Stunde des Herzens
Kapitel 1
Ein ganz normaler Tag im Leben eines sehr alten Therapeuten
Der Tag hatte nicht allzu gut begonnen. Um drei Uhr morgens weckten mich Wadenkrämpfe, die einfach nicht aufhören wollten. Leise stand ich auf, ganz vorsichtig, damit ich meine Frau Marilyn nicht störte, die neben mir tief und fest schlief. Um den Schmerz zu vertreiben, duschte ich heiß, bis das Wasser nur noch lauwarm war, dann trocknete ich mich ab und ging zurück ins Bett. Die Hitze hatte meine Muskeln beruhigt und die Krämpfe waren einigermaßen abgeklungen. Ich gab mir alle Mühe, wieder einzuschlafen. Aber im Zusammenhang mit Schlaf ist »sich alle Mühe geben« immer zum Scheitern verurteilt. Schlaflosigkeit war seit Jahrzehnten mein persönliches Kryptonit.
Den Schlaftablettenkonsum hatte ich, widerwillig, heruntergeschraubt, nachdem mein Arzt den Verdacht äußerte, dass die Pillen meinen Gedächtnisverlust beschleunigten. Ich versuchte es mit Atemübungen. Wieder und immer wieder atmete ich ein, flüsterte »beruhigen« und atmete aus, flüsterte »entspannen«, eine Meditation, die ich vor Jahren gelernt hatte. Aber vergeblich – die zarte innere Ruhe, hervorgebracht durch das gewisperte »entspannen« ging rasch über in Angst, eine andere alte Nemesis. Nun richtete ich meine Aufmerksamkeit darauf, die Atemzüge zu zählen. Ein paar Minuten später bemerkte ich, ich hatte das Zählen schon wieder vergessen und mein stets ruheloser Geist war bereits wieder woanders hingewandert.
Ein Jahr zuvor hatte Marilyn die Diagnose Multiples Myelom erhalten, eine schleichende Krebsform des Blutplasmas. Marilyn befand sich gerade mitten in einem Zyklus von Chemotherapien, die noch zu keiner wesentlichen Verbesserung geführt hatten. Ihre Körperwärme und ihre Atemgeräusche waren so vertraut, seit vielen Jahrzehnten meine geliebten Bettgefährten. Aber nun war da etwas Neues bei uns, diese böse Krankheit, die in meiner Frau tobte.
Ich war glücklich, sie in dieser Nacht friedlich schlafen zu sehen, und zeichnete im schummrigen Licht sanft die Linien ihres Gesichts nach. Seit der Middleschool waren wir zusammen, unzertrennlich. Jetzt verbrachte ich den Großteil der Tage damit, mir Sorgen um sie zu machen und in dem Bestreben, die uns verbleibende gemeinsame Zeit zu genießen. In den Nächten sorgte ich mich über ein Leben ohne sie. Was sollte ich mit meiner Zeit anfangen? Mit wem würde ich meine Gedanken teilen? Was für eine Einsamkeit erwartete mich?
Als ich merkte, dass meine Gedanken gehörig abschweiften, gab ich die Vorstellung auf, wieder einzuschlafen. Ich blickte auf die Uhr und stellte überrascht fest, dass es bereits 6 Uhr morgens war. Irgendwie musste ich, ohne es zu merken, doch für ein paar Stunden eingenickt sein.
Nach dem Frühstück checkte ich meinen Kalender. An diesem Tag hatte ich nur zwei Termine. Der erste war ein Abschlussgespräch, die letzte Sitzung mit Jerry, einem Patienten, der seit einem Jahr bei mir in Behandlung war. Jerry war erfolgreicher Anwalt, in den Vierzigern, und er kam in Therapie, weil er nach Antworten suchte, nachdem ihn seine Freundin nach zwei Jahren Partnerschaft verlassen hatte, die dritte Trennung in einer ganzen Abfolge gescheiterter Beziehungen.
»Ich verstehe nicht, warum«, hatte er bei unserer ersten Sitzung gesagt. »Ich habe ein tolles Haus, einen tollen Job, jede Menge Geld. Was gibt’s daran auszusetzen? Ich meine, schauen Sie mich an.« Er deutete auf seinen maßgeschneiderten, eindeutig teuren Anzug.
Jerry war nicht gerade das, was man warmherzig oder zugewandt nennen würde. Er war fordernd und oft mäkelig. Er meckerte über mein Honorar, meinte, ich sollte mir lieber einen Gärtner für die Pflege der Pflanzen entlang des Wegs zu meinem Studio suchen, und im Praxisraum selbst äußerte er sich abfällig über die Kunstwerke an den Wänden.
Er war zu mir gekommen, erklärte er mir während unserer ersten Sitzungen wiederholt, weil es hieß, ich sei der Beste, und weil er den Besten verdiene. Bald darauf schlich sich ein enttäuschter Ausdruck in sein Gesicht, weil ich ihn nicht umgehend von seinen Schwierigkeiten geheilt hatte. Dieser Blick sagte ganz deutlich, dass ich eben doch nicht der Beste war.
Dabei waren wir im Laufe der Zeit doch erfolgreich. Was hatte funktioniert? Zwei wichtige Faktoren halfen uns. Erstens, Jerry war höchst motiviert, sein Leben ändern zu wollen. Ungeachtet seines krawalligen Auftretens war ihm bewusst, dass er in irgendeiner Form zu seinen Beziehungsproblemen beitrug, und er wollte wie besessen daran arbeiten, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich musste ihn bremsen, ließ ihn erst mal durchatmen und verhalf ihm zu der Einsicht, dass ein Teil des Problems die immensen Ansprüche waren, die er an sich selbst und an mich stellte, auf magische Weise »repariert« zu werden.
»Stellen Sie sich ganz kurz vor, Sie wären Ihre Freundin«, schlug ich vor. »Was, wenn Sie nicht ›die Beste‹ wären, wenn Ihr Garten nicht fachmännisch gepflegt wäre, wenn Sie in Jerrys Arm nicht perfekt aussehen würden? Würde Jerry Sie nichtsdestotrotz lieben und unterstützen?«
»Das bezweifele ich«, antwortete er.
»Stattdessen kritisiert er Sie die ganze Zeit, und am Ende fühlen Sie sich mies und halten Ihre Beziehung ebenfalls für mies. Und …?« Ich ließ die Frage in der Luft hängen.
Jerry überlegte kurz.
»Und würde wahrscheinlich nicht bleiben«, sagte er schließlich.
Die Erkenntnis, dass sein forderndes und oft unfreundliches Verhalten seine Beziehungen stark beeinträchtigte, sorgte dafür, dass es bei ihm klick machte. Er erkannte seine Rolle und begann, sich zu ändern. In den darauffolgenden Wochen machte er sich ernsthaft daran, sich zu bessern. Immer öfter ertappte er sich selbst, wenn er mir gegenüber übermäßig kritisch war und wenn er sich darüber beklagte, dass er es nur mit Stümpern zu hatte. Er übernahm mehr Verantwortung dafür, wie Menschen, insbesondere potenzielle Liebespartnerinnen, auf ihn reagierten. Und er versuchte, seine scharfe Zunge zu zügeln. Jerrys unbändiger Wille, sich zu ändern, war ein wesentlicher Faktor für seine echten Fortschritte, großartig kontrollieren konnte ich das allerdings nicht.
Beeinflussen konnte ich hingegen einen anderen Faktor, nämlich die starke Beziehung, die sich zwischen ihm und mir entwickelte. Von Anfang an hatte mich Jerry auf die Probe gestellt: Warum war mein Kunstgeschmack nicht besser? Wo war mein schickes Auto? Warum hatte ich es noch nicht fertiggebracht, ihn zu reparieren? Trotz all der spitzen Bemerkungen war ich an seiner Seite geblieben. Ich war empathisch und gütig, aber auch imstande zurückzuschlagen, wenn ich den Eindruck hatte, dass ihm eine Kampfansage guttäte. Allmählich wurde er weicher und hörte auf, mit mir zu konkurrieren. Je enger unsere Beziehung wurde, desto weniger fühlten sich seine Sticheleien wie Angriffe an, sondern eher wie gewitzte, spielerische Schubser, die ich parieren oder aber hervorheben konnte. Nach und nach bauten wir eine starke Verbindung auf, eine »therapeutische Allianz«, wie es in unserem Fachbereich heißt.
Diese Allianz, sie aufzubauen und zu nutzen, ist der bedeutendste Faktor meines therapeutischen Ansatzes. In mittlerweile unzähligen Vorträgen und zahlreichen Schriften habe ich erklärt: »Es ist die Beziehung, die heilt.« Was die Veränderung antreibt, liegt nicht an einem Arbeitsbogen, den der Patient ausfüllt, an einer genialen Frage, die der Therapeut stellt, an einer Verhaltensänderung, die der Patient tagtäglich notieren muss. In meinem Therapieansatz ist die aufrichtige Verbindung von Therapeut und Patient das Medium, durch das wir entdecken, lernen, etwas ändern und heilen.
In dieser Hinsicht hatten Jerry und ich im Laufe unseres gemeinsamen Jahres ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Er wurde freundlicher, und wenn er mich gelegentlich noch mit einer missbilligenden Bemerkung anschnauzte, wies ich ihn darauf hin. Er lernte, sich zu entschuldigen und sich nach und nach zu kontrollieren, wenn er etwas Bissiges sagen wollte, und er bemühte sich, solche Kommentare nun häufig auf ziemlich liebenswerte Weise durch Komplimente zu ersetzen: »Die Zitronenbäume neben dem Weg sehen diese Woche viel besser aus« oder »Die Buddha-Statue in Ihrem Bücherregal ist viel interessanter, als ich zuerst dachte«.
Ich freute mich auf unsere wöchentlichen Treffen, und es machte mich traurig, mit dem Ende der heutigen Sitzung um 11 Uhr 50 Abschied von ihm zu nehmen. Aber aus Gründen, die noch deutlich werden, hatten wir uns zu Beginn von Jerrys Therapie auf einen Zeitrahmen von einem Jahr geeinigt. Er hatte allemal das Beste daraus gemacht, und wir hofften beide, dass seine zukünftigen Beziehungen, ob romantisch oder nicht, nun gehaltvoller und zufriedenstellender sein würden.
Die zweite Sitzung, die an diesem Tag auf meinem Terminplan stand, verlief völlig anders. Es ging um eine Frau namens Susan, mit der ich nur eine einzige Sitzung vereinbart hatte. Nur ein einziges Mal!? Wie sollte ich in einer einzigen Sitzung eine auch nur annähernd effektive Therapie durchführen? Und warum sollte ich das überhaupt versuchen? Um das zu erklären und den Kontext zu verdeutlichen, muss ich in der Zeit ein wenig zurückspulen.
Etwa fünf Jahre zuvor, als ich Anfang achtzig war, bemerkte ich, dass mein Gedächtnis nachzulassen begann. Ich war schon immer ein wenig vergesslich und verlegte regelmäßig meinen Terminkalender, die Brille oder die Autoschlüssel. Aber das hier war etwas anderes. Ich begegnete Menschen, die ich zwar wiedererkannte, aber deren Namen mir partout nicht einfielen. Gelegentlich blieb ich mitten in einem Satz stecken, weil ich nach einem ganz geläufigen Wort suchte. Und wenn Marilyn und ich uns Filme anschauten, verlor ich immer häufiger den Überblick über die Figuren.
Während diese Verschlechterung voranschritt, kam mir der Gedanke, dass ich nach fast sechzig Jahren womöglich nicht länger imstande war, Langzeittherapien anzubieten. Statt Therapien mit offenem Ende, die manchmal drei oder vier Jahre dauerten, entschied ich, ein zwölfmonatiges Zeitlimit zu setzen, dem alle neuen Patientinnen und Patienten im Voraus zustimmten. Darum auch die Abmachung mit Jerry. Dieser neuen Rahmenbedingung näherte ich mich mit einem Gefühl des Verlusts, weil sie für eine weittragende Veränderung, aus der Not geboren und nicht etwa aus einem Bedürfnis, meiner Arbeitsweise stand. Aber schon bald setzten sich Neugier und mein Wunsch durch, weiterhin helfen zu wollen.
Letztendlich sagte mir diese Lösung sogar zu. Wenn ich die Patienten sorgfältig auswählte, konnte ich während unserer einjährigen gemeinsamen Arbeit fast immer viel erreichen. Bei einigen entstand aufgrund der zeitlichen Begrenzung sogar ein verstärktes Gefühl von Dringlichkeit und damit eine höhere Motivation. Und so hatte das in den vergangenen fünf Jahren gut funktioniert, sowohl für mich als auch für meine Patientinnen und Patienten. Dann, als ich ungefähr siebenundachtzig Jahre alt war, merkte ich, dass ich mehr und mehr auf die Zusammenfassungen angewiesen war, die ich nach jeder Sitzung aufnahm, um mich an Einzelheiten bezüglich der Patienten zu erinnern, und dass mir ihre Gesichter und Probleme selbst mit diesen verfügbaren Notizen gelegentlich fremd vorkamen. Ich kam ins Straucheln und begann, den Wert der von mir zu leistenden Behandlung in Frage zu stellen. Ich hatte zwar das Gefühl, dass ich immer noch viel zu bieten hatte, aber es war klar, dass ich mich nicht mehr guten Gewissens auf eine kontinuierliche Arbeit mit den Patienten einlassen konnte, selbst wenn sie nur auf ein Jahr begrenzt war.
Aber, aber … aber … bei dem Gedanken, gar nicht mehr zu praktizieren, wurde mir schwindelig. Mit meinen Patienten zu sprechen, ihnen durch ihre dunkelsten Gedanken zu helfen und sie auf ihren Entdeckungsreisen zu begleiten – all das war den größten Teil meines Lebens Tag für Tag meine Arbeit gewesen – und meine Berufung. Wer war ich denn, wenn nicht Psychotherapeut? Ganz ehrlich, ich war wütend und hatte große Angst. Ich war nicht bereit, mich derart alt, derart nutzlos zu fühlen. Der Gedanke, die Therapiearbeit hinter mir zu lassen, kam mir vor, als würde ich mich mit dem schnellen Verfall abfinden, auf den unvermeidlich demnächst mein Tod folgen würde.
Dieses Dilemma brachte mich ins Grübeln. Die Bedürfnisse meiner Patienten mussten an erster Stelle stehen, Langzeittherapie ging also nicht. Aber nach so vielen Jahrzehnten Praxis und Forschung wusste ich, ich verfügte über ein seltenes Maß an Erkenntnis und Fachwissen, das immer noch wirkungsvoll war. Außerdem verspürte ich das persönliche Bedürfnis, weiterhin einen Beitrag zu leisten. Welches zufriedenstellende Angebot könnte ich aussprechen – umfassend genug, um Patientinnen und Patienten zu helfen, umfassend genug, um mich selbst engagiert zu beschäftigen – und gleichzeitig niemanden zu gefährden? Da kam ich auf eine unkonventionelle Idee. Vielleicht könnte ich mich mit Menschen zu einmaligen, einstündigen Konsultationen treffen. In dieser Stunde würde ich ihnen alles Erdenkliche bieten – Erkenntnisse, Anleitung, eine warmherzige Präsenz und Akzeptanz – und sie dann, gegebenenfalls, zur weiteren Behandlung an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterleiten, der auf ihre besonderen Herausforderungen gut eingestellt war.
Die Idee einer solchen Kurztherapie war mir zutiefst fremd. Ich habe Psychotherapie immer als ein längerfristiges Unterfangen betrachtet – nicht die endlosen Jahre der Psychoanalyse alter Schule –, aber oft mehrere Jahre, lang genug eben, um Patienten zu helfen, sich selbst besser zu ergründen und das Leben sinnvoll zu ändern. Die Antwort auf die Frage, wie effektiv ich in Einzelsitzungen sein könnte, wäre immerhin ein interessantes Experiment.
Nach diesem Einfall schwankte ich eine Weile zwischen Skepsis – war das bloß ein Weg, mich gegen meinen Verfall zu stemmen, statt Patienten wirklich nützlich zu sein? – und Begeisterung –, ich wusste ja, ich verfügte über Fähigkeiten, die zu einem ungewöhnlich hohen Grad geschliffen waren, und dass ich bereits vielen, vielen Menschen in Schwierigkeiten geholfen hatte, was zweifellos einen gewissen Wert hatte. Ich nahm mir Zeit, meine eigenen Gefühle genau unter die Lupe zu nehmen. Gut möglich, dass sich mein Stolz weigerte, diese Stellung von schwindender Bedeutung zu akzeptieren. Und doch war mir auch klar, dass ich irgendwann meinen Verfall hinnehmen und den Staffelstab komplett an die nächsten Generationen weitergeben musste. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, wie das Experiment ausgehen würde, was an sich schon faszinierend war. Und so begann ich ein neues Abenteuer kurzer therapeutischer Begegnungen und der Erforschung, was in einem weitaus kürzeren Zeitrahmen, als ich es mir je hätte vorstellen können, am hilfreichsten sein könnte, um Veränderungen zu bewirken.
Auf meiner Facebook-Seite kündigte ich den Rückzug vom langfristigen Therapieangebot an und offerierte stattdessen die einstündigen Konsultationen – entweder persönlich in meinem Studio in Palo Alto oder online. Innerhalb weniger Stunden gingen reihenweise Anfragen für Termine ein, weit mehr als ich erwartet hatte. Sie stammten aus der ganzen Welt, natürlich aus englischsprachigen Ländern, aber auch aus vielen anderen – Türkei, Griechenland, Israel, Deutschland –, denn Zoom überwand alle Grenzen. Und sie kamen von Menschen in vielen verschiedenen Lebensphasen und bis zu einem gewissen Grad auch unterschiedlichen sozialen Schichten. Schnell wurde mir klar, dass mir das Format der Einzelsitzung ermöglichen würde, mit vielen Menschen zu arbeiten, die ich auf andere Weise nie erreicht hätte, mit Menschen, für die eine Dauertherapie mit mir unerschwinglich war. Es war klar, dass das eine sehr interessante Abwechslung zu der relativ traditionell geprägten Privatpraxis darstellen würde, die ich in den vergangenen zwanzig Jahren in dem hübschen Spanish-Style Cottage in unserem Garten geführt hatte, und davor jahrzehntelang im Fachbereich Psychiatrie der Universität Stanford. Wäre das wirkungsvoll für die Patienten? Wäre es für mich befriedigend? Nur die Zeit würde es zeigen. Auf jeden Fall war es etwas Neues, und in meinem Alter war Neues nicht zu verachten.
So ging es mir also an jenem Morgen vor meiner ersten Einzelsitzung mit Susan. Ich freute mich, war aber auch besorgt. Ich überlege mir nicht immer alles im Vorhinein, aber nach einer unruhigen Nacht, die ich mit düsteren Gedanken über Marilyns schwächer werdenden Körper und meinen schwächelnden Geist verbracht hatte, hegte ich gewisse Zweifel. Wie viel Gutes würde ich in diesen kurzen Begegnungen tatsächlich bewirken können?
Ich rief mir in Erinnerung, dass gleich mehrere Dinge für mich sprachen. Erstens hat sich mein therapeutischer Ansatz immer stark auf das konzentriert, was ich als das Hier und Jetzt bezeichne. Damit meine ich, dass die Interaktionen zwischen dem Patienten und mir die wesentlichen Werkzeuge von Veränderung sind. Was auch immer für problematische Tendenzen ein Patient hat – Unsicherheiten, Neurosen, Dinge, die er tut und die seinen Beziehungen zu anderen im Wege stehen –, all das kommt in den Therapiesitzungen durch die Interaktionen mit mir höchstwahrscheinlich zum Vorschein. Jerry, der den besten Therapeuten brauchte, ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Obwohl er zu mir kam, um sich helfen zu lassen, und unsere Arbeit vermutlich mit einer positiven Meinung von mir begann, kritisierte er mich ständig und in vielerlei Hinsicht. Immer und immer wieder machte ich ihn auf diese Tendenz aufmerksam. Zunächst führte er diese Kommentare auf meine Unzulänglichkeiten zurück, darauf dass ich übermäßig empfindlich und neidisch auf seinen finanziellen Erfolg sei. Doch nach und nach begann Jerry zu erkennen, dass er sich auch in anderen Bereichen seines Lebens so verhielt und dass dies seine Beziehungen und sein Glücksichsein beeinträchtigte.
Dieser Hier-und-Jetzt-Ansatz ist weitgehend ahistorisch, das heißt, er stützt sich so gut wie gar nicht auf die persönliche Geschichte der Patienten. Statt viel Zeit damit zu verbringen, die Vorgeschichte zu erforschen – Zeit, die ich in den Einzelsitzungen nicht habe –, konzentriere ich mich auf die Gegenwart und achte sehr genau auf jedes Wort und jede Geste des Patienten sowie auf das, was er oder sie übergeht. Ich war zuversichtlich, dieser Ansatz würde es uns ermöglichen, rasch ernsthaft zu arbeiten. Diese Methode hatte auch den großen Vorteil, gut zu den begrenzten Kapazitäten meines schwindenden Verstandes zu passen: Mich an Vergangenes zu erinnern, stellte eine zunehmende Herausforderung dar, und die zahlreichen Details jedes einzelnen Patienten, jeder einzelnen Patientin abrufen zu können, überforderte mich. Doch hier und jetzt präsent zu sein, das konnte ich sehr gut.
Eine zweite Sache, die für mich sprach, war, dass fast alle Menschen, die mich um eine Konsultation baten, bereits einiges über mich wussten. Im Laufe von sechs Jahrzehnten habe ich viele Bücher geschrieben, darunter einflussreiche Lehrbücher für angehende Therapeuten, philosophische Romane und Bücher mit Geschichten wie dieses, die den Therapieprozess entmystifizieren sollen. Dank dieser Bücher hatte ich das Glück, in meinem Fachgebiet als bekannte Persönlichkeit zu gelten, und die meisten der Leute, die mich um eine Konsultation baten, erwähnten, dass sie mindestens eines meiner Bücher gelesen hatten. Aus den meisten E-Mails ging klar hervor, dass sie mir ein bestimmtes Maß an Weisheit und Wirkmacht zuschrieben. Ich nahm das nicht allzu wörtlich, denn ich wusste, dass wir bisweilen alle die Bestätigung von grauhaarigen älteren Menschen brauchen. Aber in Wahrheit war da eine leise Stimme in mir, jugendlich und rebellisch, die am liebsten »So alt bin ich nun auch wieder nicht!« gerufen hätte und das Ganze abblasen wollte. Aber an sich war ich froh, die Rolle des Gurus auf der Bergspitze zu spielen, denn mir wurde klar, dass ich die mir zugeschriebene Weisheit vielleicht dazu nutzen könnte, Leuten zu helfen, sich zu ändern.
In dieser Stimmung ließ ich mich in meinem Bürosessel nieder und öffnete ein Zoom-Fenster, um mit Susan zu sprechen. Sie war fünfzig Jahre alt, Lehrerin in Oregon und hochgradig depressiv. Wir begrüßten uns kurz, und ich erklärte, dass ich, wie in dem Facebook-Post angekündigt, nur ein einziges Mal mit ihr sprechen würde und ihr hoffentlich so gut wie irgend möglich helfen könnte. Es fühlte sich sehr seltsam an, all das zu sagen, und ich glaube, ich präzisierte unsere Ausgangssituation genauso sehr für mich wie für sie. Sie nickte, dann begann sie mit ihrer tragischen Geschichte. Vor zwei Jahren, an einem Donnerstagabend gegen zehn Uhr, hatte sie den Kühlschrank geöffnet und bemerkt, dass der große Kirschkuchen, den sie gebacken hatte, schon fast aufgegessen war. Sie hatte vorgehabt, ihn am nächsten Abend bei einem Essen mit engen Freunden zu servieren, aber jetzt war nur noch ein Stück Rand übrig, aus dem Reste der tiefroten Füllung quollen.
Was war mit dem Kuchen geschehen? Kein Mysterium: zweifellos hatte ihr Ehemann Peter ihn gegessen. Und das nicht zum ersten Mal.
»Dieser gefräßige Dreckskerl!«, rief sie und brach in Tränen aus. Das Schicksal dieses Kirschkuchens war zu viel für sie. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Am nächsten Tag würde sie bis 17 Uhr 30 arbeiten müssen, eine Stunde später sollten die Gäste zum Abendessen eintreffen. Kaum Zeit, sich umzuziehen und den Tisch zu decken, geschweige denn einen neuen Kuchen zu backen. Diese Respektlosigkeit!
Wutschäumend stürmte sie die Treppe hinauf und konfrontierte ihren bereits im Bett liegenden Mann mit den Vorwürfen. Sie stritten zehn Minuten. Die Gereiztheit wuchs, die Stimmen wurden lauter. Er meinte, dass er immer der Hauptverdiener der gesamten Familie gewesen sei (stimmt nicht!, protestierte sie) und dass er verdammt noch mal jeden Kuchen essen würde, wenn ihm danach war. Sie entgegnete, er sei ein fettes Schwein, das sich noch zu Tode fressen würde.
Er sagte ihr, sie solle auf der Couch schlafen, schob sie aus dem Schlafzimmer, schlug die Tür hinter ihr zu und schloss ab.
»Gut«, schrie sie. »Denn das Letzte, was ich will, ist, das Bett mit einem egoistischen Vielfraß zu teilen.«
Am nächsten Morgen klopfte sie heftig an die Schlafzimmertür und rief laut nach ihrem Mann, erntete aber nur Schweigen. Schließlich brachen sie und die beiden Töchter die Zimmertür auf und fanden den Mann leblos im Bett. Sie riefen einen Krankenwagen, und als die Sanitäter eintrafen, wurde festgestellt, dass er bereits seit mehreren Stunden tot war. Die Polizei kam, riegelte das Haus ab und durchsuchte alle Räume. Susan und ihre Töchter wurden verhört – offensichtlich zog die Polizei Tod durch Fremdeinwirkung in Betracht und ging sogar so weit zu vermuten, dass der Kuchen eine Art Mordwerkzeug gewesen sein könnte.
»Wie schrecklich«, sagte ich. »Und haben Sie sich vom Tod Ihres Mannes bereits etwas erholt?«
»Ich würde sagen, null«, antwortete Susan. »Keine Erholung. Überhaupt nicht. Eigentlich geht es mir sogar noch schlechter. Ich vermisse ihn so sehr, und ich werde von Schuldgefühlen geplagt, wegen all dem, was ich am letzten Abend zu ihm gesagt habe. Darüber hinaus bin ich auch wütend auf ihn, weil er mich verlassen hat. Ich weine die ganze Zeit, und jetzt bin ich diejenige, die nicht aufhören kann zu essen, und ich habe dreißig Kilo zugenommen. Kürzlich war ich hier bei einem Psychiater, und der meinte, dass ich mich in gewisser Weise mit meinem Mann identifiziere. Was für eine Hilfe soll das sein? Ich habe schreckliche Probleme mit der Haut bekommen und kann nicht aufhören, mich zu kratzen. Ich kann kaum schlafen, und wenn, dann träume ich von Peter. Wenn meine Töchter in einem Monat ausziehen und aufs College gehen, werde ich allein im Restaurant hocken, und die Leute werden mich ansehen und sicher Mitleid mit dieser plumpen fetten Frau haben, die ganz allein isst.«
Sie holte hörbar Luft, vielleicht hielt sie Tränen zurück.
»Darum geht’s, Dr. Yalom, nun habe ich alles bei Ihnen abgeladen. Das ist alles. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.«
Sie ließ sich im Stuhl zurücksinken.
»Susan, ich habe schon viel mit Frauen gearbeitet, die ihren Mann verloren haben, und die Schilderung dessen, was Sie durchmachen, ist mir nicht unbekannt. Ich möchte Sie etwas fragen. Sie sagen, Ihr Mann sei vor über zwei Jahren gestorben. Können Sie Ihren Zustand jetzt mit dem von vor einem Jahr vergleichen? Ist er anders? Weniger schmerzhaft?«
»Nein. Ganz im Gegenteil. Genau das quält mich ja so. Ich denke immer öfter an ihn, und wenn ich allein im Haus bin, habe ich Angst, für immer traurig und einsam zu sein. Verdammt. Das ist nicht fair.«
»Die Trauer vergeht, aber das braucht Zeit. Normalerweise verläuft Trauer in einem vorhersehbaren Zyklus. Das erste Jahr ist am schlimmsten, wenn man zum ersten Mal den Geburtstag, Weihnachten oder Silvester ohne den Ehepartner erlebt. Aber mit der Zeit lässt der Schmerz nach. Und später, wenn man den Zyklus der besonderen Tage zum zweiten Mal durchläuft, wird es deutlich weniger schmerzhaft. Aber das ist bei Ihnen ja nicht der Fall. Irgendetwas blockiert Sie, und ich habe die Vermutung, dass es mit Ihrer Wut zusammenhängt.«
Susan nickte energisch, und ich fragte: »Können Sie dieses Nicken in Worte fassen?«
»Ich habe dafür keine Worte, aber ich spüre, Sie haben recht. Es ist verwirrend. Ich ertrinke in Trauer, und plötzlich fühle ich nur noch heftige Wut.«
»Konzentrieren wir uns darauf, auf Ihre Wut«, sagte ich. »Lassen Sie Ihre Gedanken dorthin wandern und teilen Sie ein paar Minuten lang Ihre Gedanken mit mir. Mit anderen Worten, denken Sie laut.«
Sie wirkte verdutzt und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.«
»Vielleicht ist es am einfachsten, wenn Sie am Anfang beginnen. Denken Sie laut über Ihre allererste Begegnung mit Wut nach.«
»Wut … Wut. Das erste Mal, dass ich Wut empfand, war bei meinem ersten Atemzug – bei meiner Geburt.«
»Weiter so, Susan.«
»Als ich geboren wurde, war da Wut. Die Wut meiner Mutter. Ich erinnere mich, dass sie immer sagte, sie hätte lieber einen Jungen gewollt, und wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte sie aufgehört. Sie wollte nur ein Kind, aber dieses Kind war ich nicht. Sie ließ mich das immer und immer wieder wissen.«
»Sie haben also einen Teil Ihrer Kindheit über immer wieder gehört, dass Ihre Geburt, Ihre bloße Existenz, Ihrer Mutter Unannehmlichkeiten bereitet hat?«
»Oh Gott, ja, sie ließ mich das ständig spüren. Ich verfluche sie dafür!«
»Und Ihr Vater?«
»Schlimmer. Manchmal sogar noch schlimmer. Sein Lieblingswitz, den er niemals müde wurde, überall zu erzählen, war, dass die Krankenschwester bei meiner Geburt einen Fehler gemacht und der Familie die Nachgeburt statt des Babys gebracht hat.«
»Autsch. Oh, Susan, wie entsetzlich, dieser Scherz Ihres Vaters, dass Sie kein Mensch sind, sondern Plazenta.«
»Er hielt das für lustig. Und meine Mutter hat ihm zugestimmt. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich weiß, es ist unnatürlich, aber ich habe beide gehasst. Alle beide. Meinen Vater besonders. Er wollte nicht für mein College zahlen. Er wollte, dass ich stattdessen als Sekretärin in seinem Geschäft arbeite. Also ging ich früh von zu Hause weg und musste neben der Uni arbeiten.«
Sie hielt kurz inne und ließ diese tiefen Gefühle hochkommen. Nur einen Moment später, als sie noch an diesem offenen, empfindlichen Ort in ihrem Inneren war, drängte ich sie, tiefer zu gehen.
»Und die Wut auf Ihren Mann? Erzählen Sie mir davon.«
»Die war nicht wie die Wut auf meinen Vater. Jedenfalls anfangs nicht. Ich lernte Peter kennen, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, auf dem College. Wir waren sehr verliebt, und er war gut zu mir. Seine Eltern waren wohlhabend, und er hatte immer Geld. Wenn ich knapp bei Kasse war, half er mir, die Miete zu bezahlen oder Lebensmittel zu kaufen. Und diese Art von Unterstützung und Zuwendung kannte ich zuvor nicht.
Peters Vater war Politiker und wollte, dass Peter in seine Fußstapfen tritt. Peter besaß das nötige Charisma – er konnte unglaublich charmant und lustig sein. Aber er war faul, ein schlechter Student, der zockte, wann immer er konnte, und schließlich flog er vom College. Er wurde Wachmann in einer Bank in der Stadt, ein Job, den ihm sein Vater besorgt hatte. Er verdiente nie genug, und wenn doch, dann verspielte er es heimlich. So oder so, es war völlig klar, dass ich immer arbeiten müsste. Ich habe mir nie eine Auszeit genommen, außer drei Monate Mutterschaftsurlaub, als ich unsere Töchter bekam. Ich durfte nie ich selbst sein, nie die Art von Mutter, die ich für meine Mädchen hätte sein wollen.
Stattdessen habe ich gearbeitet, viel gearbeitet. Und wissen Sie was? Nur ein paar Tage, bevor er starb, erklärte er mir, dass er zu schwer geworden sei, um als Wachmann in der Bank zu arbeiten, und dass sie ihn in den Innendienst versetzt hätten und er künftig weniger verdienen würde. Er meinte, das wäre ja keine große Sache, und ich wurde so wütend auf ihn, weil er sich nicht mal um seine Gesundheit scherte. Und weil ich mir wahrscheinlich einen zweiten Job suchen müsste, um die Rechnungen zu bezahlen.«
»Da rumort eine Menge Wut, höre ich raus, Susan«, sagte ich. »Ein Ehemann, der all die Arbeit, die Sie geleistet haben, nie wertgeschätzt, der Ihre Bedürfnisse und Wünsche nie anerkannt hat. Ein grausamer Vater, der Sie entweder als Problem oder Pointe betrachtet hat. Und eine gefühllose Mutter, die Sie nicht gewollt, die Ihnen nie Liebe geschenkt hat. Jetzt sind alle weg – Mutter, Vater, Ehemann – alle weg. Und ein gutes Stück Ihres Lebens ist auch vergangen. Oh, Susan, kein Wunder, dass Sie wütend sind. Wer wäre in Ihrer Situation nicht wütend? Ich jedenfalls wäre wütend.«
Sie nickte, während ich sprach.
»Wie fühlt es sich an, wenn ich das sage, Susan?«
»Hart. Richtig. Aber hart.«
»Ich möchte mir einen Moment die Zeit nehmen, das anzuschauen, was Sie trotz alledem erreicht haben: zwei liebevolle Kinder, eine bedeutende Karriere als Lehrerin und so viel mehr. Sehr gut, Susan.«
Sie schluckte, als sie das hörte.
»Ich konnte noch mit niemandem wirklich darüber reden«, sagte sie. »Alle möchten Peter als einen guten Menschen in Erinnerung behalten, uns als ein tolles Paar. Niemand will über die dunkle Seite sprechen.«
»Danke, dass Sie das mit mir teilen. Ihre Wut ist nur allzu menschlich. Ich vermute jedoch, dass sie ein großes Problem darstellt. Wir glauben, dass wir über Tote nicht schlecht reden sollten, dass es irgendwie falsch ist oder respektlos. Trifft das auf Sie zu?«
Sie nickte, ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Tja, ich bin da anderer Meinung. Jeder in Ihrer Situation, mit Ihren Erfahrungen, würde genau die gleichen Wutgefühle empfinden wie Sie. Sie sind viel zu streng mit sich.«
Jetzt schluchzte Susan, und ich wartete, bis sie sich beruhigt hatte und wieder normal atmete.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll, wie ich die Wut stoppen kann«, sagte sie schließlich. »Ich würde mich sehr gern an viele andere Dinge aus unserer gemeinsamen Zeit erinnern. Ich habe ihn wirklich geliebt. Aber jetzt bin ich einfach so wütend.«
»Ich glaube, wenn Sie Ihre Wut akzeptieren, akzeptieren, dass sie angemessen ist und Sie guten Grund dafür haben, werden die anderen Erinnerungen zurückkehren. Aber das braucht Zeit.«
»Kann sein.« Sie nickte. »Hoffentlich.«
Dann fuhr ich mit meiner feierlichsten Stimme fort: »Susan, ich habe mir alles, was Sie gesagt haben, genau angehört, alles in mich aufgenommen und sorgfältig abgewogen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Sie für unschuldig erkläre. Bitte hören Sie zu: Ich erkläre Sie für unschuldig! Sie verdienen ein gutes Leben. Sie haben hart gearbeitet, waren eine gute Mutter, eine gute Ehefrau, und jetzt verdienen Sie etwas Glück.«
Sie lächelte trotz der Tränen, und ich beendete die Sitzung mit dem schönen Gefühl, ihr geholfen zu haben. Ich gab ihr den Kontakt eines Therapeuten, mit dem sie weiterarbeiten könnte.
Ganz offensichtlich hat dieser alte Mann noch etwas zu bieten, dachte ich, während ich unsere Sitzung Revue passieren ließ!
Ein paar Wochen später erhielt ich eine E-Mail von Susan, in der sie mir das bestätigte. Sie dankte mir für meine Hilfe und schrieb:
Den Moment, als Sie so etwas sagten wie »augenscheinlich waren Ihre Mutter und Ihr Vater keine guten Eltern, aber trotzdem haben Sie das Leben extrem gut gemeistert … Ich bewundere Sie dafür …«, werde ich nie vergessen. Sie haben mir das wohlige Gefühl gegeben, gesehen, respektiert und zugleich unterstützt zu werden … Auch dass Sie mich für unschuldig erklärt haben. Ich werde diesen Satz und das Lächeln auf Ihrem Gesicht, als Sie das sagten, nie vergessen. Ich werde den Klang Ihrer Stimme im Gedächtnis und in meinem Herzen behalten.
Als ich später am Abend noch einmal darüber nachdachte, hatte ich das Gefühl, dass dies eine meiner besten Therapiestunden überhaupt gewesen war. Ich beschloss, diese ungewöhnlichen einstündigen Sitzungen weiter anzubieten, um zu sehen, wem ich helfen könnte, und um aus dieser Methode so viel wie möglich herauszuholen. Ebenso wichtig war mir, das Gelernte weiterzugeben. Ich sprach ja schon von meinem Wunsch, Patienten zu helfen, aber ich habe den anderen wichtigen Aspekt meines Berufslebens ausgelassen, nämlich den des Lehrenden. Meine schriftstellerische Arbeit diente größtenteils der Ausbildung junger Therapeuten und anderer Berufsbereiche, die Therapien durchführen oder damit zu tun haben. Viele meiner Einfälle waren gegen den Strich gebürstet, und ich habe mich den wichtigsten Trends in diesem Fachbereich entgegengestellt. Während die Psychiatrie zunehmend Medikamente als Lösung für psychische Erkrankungen propagiert hat, habe ich mich für die menschliche Verbindung eingesetzt. Während den Psychotherapeuten zunehmend Ansätze vermittelt wurden, die auf Symptomreduzierung abzielen, wie die kognitive Verhaltenstherapie oder die lösungsorientierte Therapie, vertrat ich Neugier und tiefgreifende persönliche Erkundung.
Meine Berufung, Gelerntes weiterzugeben, war immer eine starke, mich antreibende Kraft, und ich spürte diesen Impuls wieder, als ich an Susan dachte und mir vorstellte, dass noch viele solch gehaltvoller kurzer Begegnungen vor mir lagen. Ich wollte dieses Projekt nicht nur in Angriff nehmen, um jenen zu helfen, die Beratung brauchten, und um mich weiterhin persönlich zu engagieren, sondern auch, um weiterzugeben, was ich dabei lernen würde.
Kapitel 2
Wenn ich doch nur aus dieser Bruchbude raus könnte
Es gibt einige wenige Menschen, wie beispielsweise Susan, bei denen eine perfekt platzierte Intervention oder eine einzige tiefgreifende Begegnung schon das meiste von dem abdecken kann, was die Patientin benötigt. Aber ich bin kein genereller Befürworter von Kurzzeittherapien, und ich möchte klarstellen, dass ich dieses Format mit einer einzigen Sitzung keineswegs als vollständige Therapieform empfehle. Denn natürlich bin ich seit Langem Verfechter der wesentlich längerfristigen Therapie. Und warum? Dafür gibt es viele Gründe, der wichtigste lautet, dass ich überaus daran interessiert bin, Menschen zu helfen, wahrhaftig mehr über sich selbst zu erfahren, und so etwas braucht Zeit.
Ich schätze, ich bin ein Therapeut großer Themen: die Suche nach dem Sinn des Lebens, nach der eigenen Identität, nach dem Verstehen der eigenen Impulse und dem eigenen Verhalten. Diese Ziele sind in den meisten Fällen nicht schnell zu erreichen. Und doch drängen die Fachbereiche der mentalen Gesundheit, vor allem in den USA, immer stärker auf immer kürzere Therapiemodelle. Dieser Druck entsteht nicht aus Interesse an besseren Ergebnissen für die Patienten; das Ganze hängt vielmehr mit den Krankenversicherungen zusammen, die nicht mehr als acht oder zwölf Sitzungen bezahlen wollen, und die deshalb die sogenannten evidenzbasierten Modelle wie die kognitive Verhaltenstherapie bevorzugen. Sicherlich gibt es Themen, bei denen Kurzzeittherapien sinnvoll sind, wobei man sich währenddessen häufig auf sehr spezifische Probleme eines Patienten konzentriert: zum Beispiel auf den Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, oder auf die Behandlung von Symptomen wie Prokrastination oder Vermeidungsverhalten. Im Allgemeinen sind diese kurzfristigen Ansätze jedoch nicht geeignet, Menschen dabei zu helfen, die den Symptomen zugrunde liegenden Ursachen tatsächlich zu verstehen und etwas zu verändern. Und für viele Menschen ist eine solch tiefere Erkenntnis und Transformation unerlässlich. Meine nächste Patientin war ein gutes Beispiel dafür. Unsere kurze gemeinsame Zeit sollte sich zwar als ereignisreich erweisen, aber nicht annähernd als lang genug, um ihr bei der Bewältigung ihrer großen Herausforderungen zu helfen.
Ihr Name war Julia, eine junge Doktorandin der Wirtschaftswissenschaften. Sie schlenderte in mein Studio, ohne Blickkontakt aufzunehmen und ließ sich gegenüber von meinem Platz auf den Stuhl plumpsen. Sie trug auf alt getrimmte Bluejeans, ein übergroßes Stanford-Sweatshirt und hatte langes, auffallend ungepflegtes braunes Haar. Es war mitten am Tag, aber sie sah erschöpft aus. Ihr Blick wanderte einmal in Windeseile quer durch den gesamten Raum. Eine Wand bestand hauptsächlich aus Fenstern, eine andere war komplett mit zimmerhohen Regalen gefüllt, in der sich die Bibliothek von Psychologie- und Philosophiebüchern befand, die ich in den letzten sechs Jahrzehnten angesammelt hatte. Julia starrte einen Moment lang auf die Bücherwand.
»Haben Sie die alle gelesen?«, fragte sie.
»Wenn ja, habe ich die meisten längst vergessen.«
Das entlockte ihr ein schwaches Lächeln.
»Also, Julia«, begann ich, »aus Ihrer E-Mail weiß ich nur, dass Sie Doktorandin sind und vor Kurzem für Ihr Studium hierhergezogen sind. Sagen Sie mir, was Sie zu mir führt, und was ich über Sie wissen sollte.«
»Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, warum ich hier bin oder was ich von Ihnen oder überhaupt noch irgendeinem Therapeuten erwarte. Ich bin sechsundzwanzig und habe weit über die Hälfte der Zeit in Therapie verbracht. Und nichts und niemand hat mir geholfen.«
»Und trotzdem sind Sie heute hier und bitten um ein Gespräch mit mir, denn …«
»Vor einer Woche war ich in Stanford im Buchladen und sah mir die Abteilung der Fakultätsautoren an. Ich habe eines Ihrer Bücher wegen des prägnanten Titels ›Momma and the Meaning of Life‹ – Die Reise mit Paula mitgenommen. Ich habe das Buch in einer Nacht durchgelesen, so etwas habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen, vor allem die bizarre letzte Geschichte, »Der ungarische Katzenfluch«.
Das hier könnte interessant werden, dachte ich. Denn diese Geschichte ist die am weitesten hergeholte, die ich je geschrieben habe: Ein Therapeut verliebt sich in eine Frau, deren Familie seit Generationen von einer bösartigen Katze verflucht ist, die die Träume der romantischen Partner heimsucht. Letztendlich lassen sich Therapeut und Katze auf die gemeinsame Erkundung philosophischer Ideen zu Existenz und Sterblichkeit ein, und das alles in einem chinesischen Imbiss. Wohin also würde dieses Gespräch mit Julia wohl führen?
»Was hat Sie an dieser Geschichte gefesselt?«
»Keine Ahnung. Aber sie hat mich berührt. Vielleicht war es die Art und Weise, wie Sie derart hartnäckig bei einem unmöglichen Patienten ausgeharrt haben – einer mürrischen, sprechenden Katze, herrje. Am nächsten Morgen hab ich dann einfach das Telefon genommen und mich bei Ihnen gemeldet.«
»Irgendetwas an den Figuren hat Sie bewegt?«
»Ich weiß nicht so genau. Vielleicht verbindet mich was mit der Katze, die acht ihrer neun Leben verbraucht hatte. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Die Katzen-Situation kann ich echt verstehen.«
»Sie meinen, dass Sie die meisten Ihrer neun Leben aufgebraucht haben?«
»Wenn Sie das so sagen, klingt es komisch, aber ja, so ähnlich. Das andere war, dass Sie anscheinend geradeheraus sagen, was Sie denken. Ich habe schon so viel Bullshit von Beratenden und Suchtspezialisten zu hören bekommen, alle mit ihren jeweiligen Lieblingsmethoden. Ich habe Ihnen vor einer Woche geschrieben, und um ehrlich zu sein, ist der Enthusiasmus inzwischen etwas verblasst. Ich war nahe dran – so nahe …«, sie hielt Daumen und Zeigefinger nur Millimeter voneinander entfernt, »abzusagen. Ich weiß, dass auch Sie nichts mehr für mich tun können. Ich bin nicht mehr zu retten.«
Nicht mehr zu retten. So fingen Julia und ich an.
Sie legte mit einer langen Aufzählung von Ärzten, Medikamenten und Krankenhausaufenthalten los. Überlebenstrainings in der Wildnis für Süchtige. Meditationsprogramme. Akupunktur und Yoga. Reittherapie. Ich hatte selten eine so endlose Reihe von misslungenen Ansätzen und gescheiterten Therapeuten gehört. Und die Art, wie sie sprach, ihr entschlossenes Auftreten und der traurige, gleichgültige Blick, mit dem sie mich ansah und sagte: »Ich bin nicht mehr zu retten«, deuteten darauf hin, dass ich mich bald in diese Prozession einreihen würde.