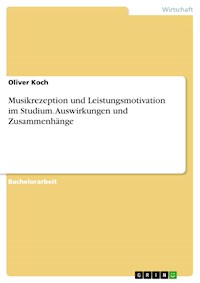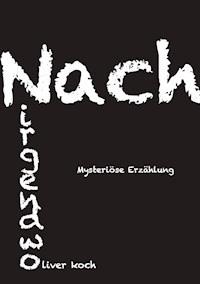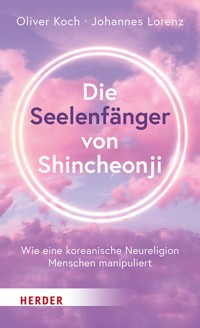
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit dem Versprechen, der "neue Himmel und die neue Erde" zu sein, missioniert die koreanische Neureligion Shincheonji weltweit – auch im deutschsprachigen Raum. Vor allem junge Menschen werden durch Themen wie Frieden, Gemeinschaft oder Spiritualität in Bibelkurse gelockt. Dort finden sie sich in einem System aus Lügen, Tarnung und Täuschung wieder. Die Autoren informieren sachkundig über Entwicklung und Hintergründe der Neureligion mit ihrem weitverzweigten Netz an Umfeldorganisationen. Sie zeigen, wie Menschen durch diese Form extremer Religiosität abhängig und unfrei werden. Ein ausführlicher psychologischer Teil entlarvt den manipulativen Charakter von Shincheonji und gibt praktische Tipps zum Umgang für Betroffene, Angehörige, Institutionen und Beratende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Koch / Johannes Lorenz
Die Seelenfänger von Shincheonji
Wie eine koreanische Neureligion Menschen manipuliert
Für unsere Familien
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Hermann-Herder-Straße 4, D-79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.deproduktsicherheit@herder.deUmschlaggestaltung: Gestaltungssaal, RohrdorfUmschlagmotiv: © akinbostanci / GettyImagesSatz: SatzWeise, Bad WünnenbergISBN Print 978-3-451-02495-5ISBN E-Book (E-Pub) 978-3-451-84494-2
Geleitwort
In den letzten Jahren wurde eine vergleichsweise große Anzahl an kritischen Erlebnisberichten in Form von Blogs und Podcasts im Zusammenhang mit Shincheonji veröffentlicht. Dies mag bereits als Problemanzeiger stehen für die problematischen missionarischen Aktivitäten der Gemeinschaft.
Doch insbesondere das hohe Beratungsaufkommen sowohl bei den kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten der evangelischen und katholischen Kirchen als auch bei den neutralen Beratungsstellen machte es bereits zuvor nötig, die Öffentlichkeit über konfliktträchtige Merkmale dieser Gemeinschaft zu informieren. Ihr Gründer Man-Hee Lee sieht sich als biblisch verheißener Lehrer der Endzeit, mit alleiniger Autorität zum Verständnis der Bibel. Aus den zusammengetragenen Erfahrungen entstanden so die inzwischen mehrfach aktualisierten „Empfehlungen für den Umgang mit Shincheonji“, die federführend vom Zentrum Oekumene und dem Haus am Dom in Frankfurt erarbeitet wurden.
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich als Leiter der (religiös neutralen) Beratungsstelle der Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. in Essen für die gute und kollegiale Zusammenarbeit mit den kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten. Denn die ebenfalls in Essen sitzende größte NRW-Gemeinde von Shincheonji hat auch bei uns für viele Beratungsfälle gesorgt.
Ehemalige Bibelkurs-Besuchende und Shincheonji-Mitglieder schilderten den zunehmend hohen Druck bei den Bibelkursen. Waren die ersten Erfahrungen mit Shincheonji noch freundlicher Art, wurde der Ton bald rauer. Die vermittelte Lehre ist mit der Zeit immer stärker von apokalyptischen Szenarien und Warnungen vor Glaubensabfall geprägt. Viele „Aussteiger“ kämpfen auch nach ihrer Distanzierung von Shincheonji noch lange mit Ängsten. Sie fühlen sich in ihrem Idealismus und Wunsch, sich mit christlichen Werten für eine bessere Welt einzusetzen, geistlich missbraucht.
Nach wie vor herrscht in der Öffentlichkeit das Vorurteil, dass nur einfältige Menschen auf die Heilsversprechen unseriöser Anbieter auf dem Weltanschauungsmarkt hereinfallen. Doch wird dies keineswegs den von Ehemaligen als perfide beschriebenen Missionsmethoden gerecht. Berichtet wird von Einladungen zu Bibelkursen bei bewusster, gar religiös gerechtfertigter Verschleierung der Zugehörigkeit zu Shincheonji. Die Rede ist von inszenierten Begegnungen, von Freundschaften, die lediglich der Anwerbung dienten, manche fühlten sich regelrecht ausgekundschaftet. Gesprächskreise und Friedensorganisationen im Umfeld von Shincheonji weisen für Außenstehende undurchsichtige Strukturen auf, Zusammenhänge werden teils verschwiegen.
Familienangehörige von Bibelkurs-Besuchenden berichteten von deutlichen Veränderungen in Verhalten und Persönlichkeit. Der Name Shincheonji – soweit den Bibelkursteilnehmenden inzwischen selbst bekannt – wurde oft verschwiegen. Für die höheren Ziele der Mission wurden Ausbildungen abgebrochen, Jobs gekündigt und Familien verlassen.
Diese in den Beratungsgesprächen zum Ausdruck kommende destruktive Dynamik erfordert eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Shincheonji. Eine solche liegt nun mit dieser ökumenischen Zusammenarbeit der kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten – vertreten durch Oliver Koch (evangelisch) und Johannes Lorenz (katholisch) – vor. Das Buch beleuchtet die Weltanschauungsgemeinschaft Shincheonji und ihre missionarischen Aktivitäten kritisch – sowohl psychologisch als auch religionswissenschaftlich und theologisch.
Die geschilderten konfliktträchtigen Merkmale, die persönlichen Leiden und familiären Folgen, aber auch die von „Aussteigern“ beschriebene Unterwanderung kirchlicher Gemeinden zur Abwerbung von Gläubigen machen die Notwendigkeit zur Aufklärung besonders deutlich. Dabei steht mit dieser wissenschaftlich fundierten Arbeit keineswegs der apologetische Schutz kirchlicher Gemeinden im Vordergrund, sondern die (therapeutische und) seelsorgliche Erkenntnis, welchen Schaden religiöse Indoktrination anrichten kann.
Dem kann sich in psychosozialer Hinsicht auch eine neutrale Beratungsstelle wie die Sekten-Info Nordrhein- Westfalen nur anschließen. Es handelt sich bei Shincheonji meines Erachtens nicht um eine von vielen religiösen Gemeinschaften, die in gegenseitigem Respekt im pluralistischen religiösen Gesellschaftsgefüge einen religiösen Rahmen zur werteorientierten Lebensbewältigung anbietet. Sondern um eine in sich abgeschlossene endzeitlich orientierte Gemeinschaft, die ihre Gläubigen mit drohenden Botschaften zum Endgericht und Glaubensaussagen zu Dämonen bei der Stange zu halten sucht. Ein solcher Glaube ist eher geeignet die Gläubigen zu ängstigen und krank zu machen als sie zu ermutigen und zu konstruktiver Welt- und Lebensgestaltung zu befähigen.
Diesem Buch sei die nötige Aufmerksamkeit gewünscht, damit die destruktiven Muster religiöser Indoktrination solcher Gemeinschaften frühzeitig erkannt werden können.
Christoph GrotepassTheologe, Berater und Leiter der Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. http://www.sekten-info-nrw.de
Inhalt
Geleitwort
Einleitung: Warum und wie wir über Shincheonji schreiben
1. Hintergründe
Shincheonji in Südkorea: Vorgeschichte – Anfänge – Entwicklungen
Shincheonji in Deutschland
Shincheonji weltweit
2. Man Hee Lee: Der versprochene Gottesbote der Endzeit
Biographische Hintergründe und religiöse Einflüsse
Man-Hee Lees Selbstverständnis
Kult um den religiösen Führer
3. Selbstverständnis und Aufbau von Shincheonji
Die Bedeutung der Bibel
Endzeitvorstellung
Hierarchie
Aufbau
Umfeldorganisationen
Die Rolle der Gemeinschaft
Alltag der Mitglieder
4. Missionierung
Die Bedeutung der Missionierung
Strategien zur Gewinnung von Mitgliedern
Praxis
Früchteinformationen
Die „heilige Lüge“
Religiöser Eifer
5. Kritik
Christlich-theologisch
Lesart der Bibel
Freiheit des Glaubens statt Angst
Kritik am Verständnis von Friedensarbeit und interreligiösem Dialog
Psychologisch
Die psychologische Dynamik von exklusivistischen Weltbildern
Die Fallstricke gruppendynamischer Mechanismen
Manipulation sowie Einstellungs- und Verhaltensänderung
Zwischen Religionsfreiheit und spirituellem Missbrauch
6. Empfehlungen zum Umgang mit Shincheonji
Woran erkennt man Shincheonji-Veranstaltungen oder Bibelkurse?
Für Betroffene
Für Angehörige
Für Verantwortliche in christlichen Gemeinden
Für in der Beratung Tätige
Hinweise für öffentliche und private Träger
7. Die Geschichte von Anna
Missionierung
Persönliche Beziehung
Der erste Bibelkurs
Immer mehr Zeit
Freunde und Familie belügen
Früchteinformationen einholen und selbst missionieren
Die Offenbarung des versprochenen Gottesboten
Friede, Jugend und immer mehr Druck und Zeit
Abbrüche
Psychische Probleme
Nichts geht mehr
Der Weg raus
8. Anmerkungen
9. Literaturhinweise und Glossar
Literatur
Wichtige Quellen
Shincheonji-Vokabular
10. Checklisten
Kennzeichen einer konfliktträchtigen religiösen Gemeinschaft
Wie erkenne ich, dass ich spirituell manipuliert werde?
Empfehlungen für eine selbstbestimmte religiöse oder weltanschauliche Entscheidungsfindung
Anlaufstellen für Beratungsanfragen
Einleitung: Warum und wie wir über Shincheonji schreiben
Shincheonji – wer oder was ist das und wie spricht man das eigentlich aus? Diese Frage taucht im deutschsprachigen Raum immer wieder auf, und das nicht nur, weil es sich um ein koreanisches Wort handelt. Erklärt man jedoch kurz, dass es sich dabei um eine endzeitlich ausgerichtete, stark missionarische Glaubensgemeinschaft handelt, die vor allem junge Menschen anspricht und oft unter falschem Namen auftritt, hört man häufig: ‚Ach ja, klar, die kenne ich – denen bin ich auch schon begegnet.‘
In den deutschsprachigen und internationalen Beratungseinrichtungen für Sekten- und Weltanschauungsfragen spielt Shincheonji seit mehreren Jahren eine große Rolle. Nicht nur aufgrund der Häufigkeit der Anfragen, sondern besonders aufgrund der Dramatik der jeweiligen Beratungsfälle. Legt man die Kriterien für eine konfliktträchtige neureligiöse Gemeinschaft an, so erfüllt Shincheonji nahezu alle Punkte. Aufgrund ihrer ausgeklügelten Missionierungsstrategie, der Manipulationspraktiken, daraus entstehenden Abhängigkeitsmechanismen und einem ausgeprägten Dualismus zwischen der Innenwelt der Gemeinde und der Außenwelt verursacht Shincheonji viele Konflikte im persönlichen und erweiterten sozialen Umfeld von Betroffenen. Diese Konflikte betreffen am häufigsten die Anhänger selbst und ihr soziales Umfeld. Shincheonji ist deshalb aus unserer Sicht eine der neureligiösen Gemeinschaften der Gegenwart, die am meisten Konfliktpotential hat – und das weltweit. Diejenigen, die mit Shincheonji in Berührung kommen, suchen oft Hilfe und Unterstützung: Das reicht von der Bitte um Aufklärung hinsichtlich der Hintergründe der Gemeinschaft, über eine christlich-theologische Einordnung ihrer Lehre und Glaubensansichten bis hin zu ausgiebigen seelsorglichen Begleitungen von Angehörigen oder Betroffenen. Nicht selten münden solche seelsorglichen Begleitungen in psychotherapeutische Behandlungen.
In den letzten Jahren haben wir viel Erfahrung im Zusammenhang mit Shincheonji sammeln können. Wir haben zahlreiche Beratungen durchgeführt, die uns dazu brachten, uns intensiv mit der Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Vor mehr als zehn Jahren erreichten uns die ersten Anfragen. Damals waren wir noch genauso ratlos, wie viele Menschen es heute noch sind, wenn sie zum ersten Mal mit Shincheonji in Kontakt kommen bzw. eine Beratung aufsuchen. Um den Anliegen der uns kontaktierenden Menschen gerecht zu werden, bemühten wir uns immer, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, z. B. jeweils zu wissen, welche neuen Bibelkurse wo stattfanden oder welche neuen Namen dazu benutzt wurden, um die Zugehörigkeit eines Kurses zu Shincheonji zu verschleiern.
Die schwierigste Arbeit blieb und bleibt bis heute jedoch, Angehörige zu begleiten und ehemaligen Mitgliedern zu erklären zu versuchen, in welcher Glaubensgemeinschaft sie gelandet sind und welche Schritte wir empfehlen, um wieder ins „normale“ Leben zurückzufinden. Besonders herausfordernd ist es zu erleben, wie religiös aufgeschlossene und interessierte junge Menschen nach ihrem Ausstieg oft jeglichen Bezug zu Religion hinter sich lassen. Sie haben Religion als ein enges Korsett erlebt und gelernt, die Bibel auf eine Weise zu lesen und zu interpretieren, die die Glaubens- und Erfahrungsschätze dieses vielfältigen Buches zugunsten einer mechanistischen und fundamentalistischen Lesart aufgibt. Es ist deshalb völlig verständlich, dass viele, die Shincheonji verlassen haben, keine lebensförderlichen Assoziationen mehr mit Worten wie Gott, Bibel, Erlösung oder Offenbarung verbinden können.
Die Kritik, die wir mit dem vorliegenden Buch an der Gemeinschaft Shincheonji üben, speist sich vor allem aus den leidvollen Erfahrungen, die Angehörige oder ehemalige Mitglieder mit dieser Gemeinschaft gemacht haben. Wir analysieren vor diesem Hintergrund sowohl die Lehre als auch die sich aus der Lehre ableitende Praxis der Gemeinschaft. Beides hängt miteinander zusammen. Aus Sicht der Gemeinschaft ist die Praxis nämlich die konsequente Umsetzung ihrer Überzeugung. Die Lehre steht an erster Stelle, die Mitglieder der Gemeinschaft lernen sie Wort für Wort auswendig und sind von der Wahrheit dieser Lehre überzeugt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, die Gemeinschaft aus ihrem Selbstverständnis heraus darzustellen. Ihre Überzeugungen und die daraus resultierende Praxis haben jedoch immer auch einen psychologischen Hintergrund. Dass Menschen sich einem derart engen Glaubenssystem zugehörig fühlen bzw. es aktiv verbreiten, lässt sich psychologisch erklären. Es passt in unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation, dass Menschen Halt in streng autoritären Systemen suchen, nicht nur im politischen Bereich.
Trotz aller Kritik an der Gemeinschaft, die wir für berechtigt und sowohl theologisch als auch psychologisch für begründet und notwendig erachten, übersehen wir nicht die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Shincheonji gerne anhängen, ihr folgen und für die Gemeinschaft missionieren. Wie auch immer diese Bindung entstanden ist, ob freiwillig oder durch ein subversives Spiel mit Ängsten – wenn Menschen sich gerne und freiwillig und ohne dass ihr soziales Umfeld darunter sehr zu leiden hat, Shincheonji angehören, ist das aus unserer Sicht zu akzeptieren, auch wenn theologische Bedenken bleiben.
Viele Einblicke erhielten wir aus Berichten von Aussteigerinnen und Aussteigern, insbesondere über innere Abläufe der Gemeinschaft. Hinzu kamen Analysen von Unterrichtsmaterial und Selbstdarstellungen von Shincheonji. Einen wichtigen Anteil zum Verständnis der Gemeinschaft hatte eine Reise von einem von uns nach Südkorea. Er konnte dort nicht nur an Veranstaltungen von Shincheonji teilnehmen und mit diversen Ausstiegsberater:innen, Kritiker:innen und anderen Glaubensgemeinschaften sprechen, die mit Shincheonji im Herkunftsland zu tun haben – die Reise ermöglichte es ihm auch, einen kultursensiblen Blick zu gewinnen, der die Gemeinschaft vor dem Hintergrund der koreanischen Religionskultur besser einzuordnen half.
Wir vermeiden es im Folgenden, die Gemeinschaft als „Sekte“ zu bezeichnen, wiewohl sie beinahe alle klassischen Sektenkriterien erfüllt. Der Ausdruck wurde lange von Seiten der beiden Kirchen als negative Markierung von Andersgläubigen bzw. für vom klassischen Christentum abweichende Gruppen oder Gemeinschaften verwendet. Fast immer mit negativen Konnotationen. Heute wird der Begriff darüber hinaus in einem sozialpsychologischen Sinn verwendet, auch hier mit deutlich negativer Wertung. Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass die klassischen Sektenkriterien zu Recht für Shincheonji gelten, verhindert aus unserer Sicht eine pauschalisierende Verwendung des Ausdrucks „Sekte“ die möglichst vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit Shincheonji.
Eines unserer zentralen Anliegen ist es immer gewesen, in einen direkten Austausch mit der Gemeinschaft zu kommen. Das ist bisher nicht gelungen. Über Jahre haben wir uns darum bemüht, mit Vertreter:innen von Shincheonji in Kontakt zu kommen. Aus internen Quellen ist uns bekannt, dass wir bei Shincheonji als „die Zerstörer“ gehandelt werden.
Grundsätzlich gilt uns der religiöse Pluralismus als eine Errungenschaft von Demokratie. Ihn zu achten und mit Respekt über andere Glaubensgemeinschaften zu sprechen ist zentrales Anliegen unserer Arbeit. Doch die in den Beratungsgesprächen immer wieder zu Tage tretenden Schattenseiten der Gemeinschaft zwingen uns dazu, öffentlich Kritik zu äußern.
Als evangelische und katholische Theologen in Deutschland ist es heute nicht leicht, über andere religiöse Gemeinschaften ein kritisches Buch zu schreiben. Lange Zeit gehörte es zu den Kernaufgaben der Kirchen, sich auch öffentlich kritisch mit dem vielfältigen Markt der Religionen und Weltanschauungen auseinanderzusetzen. Insbesondere die mit hinduistischen und esoterischen Elementen vermengte New Age Bewegung, Scientology, Bhagwan oder die Moon-Bewegung führten in den 1970er Jahren dazu, dass katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen Stellen schufen, die die neuen religiösen und spirituellen Bewegungen beobachteten, aber auch öffentlichkeitswirksam kritisieren sollten, wenn es einen Anlass dafür gab. Es ist dem unermüdlichen Einsatz unserer Vorgänger:innen zu verdanken, dass man in einer breiten Öffentlichkeit um die Problematiken von Organisationen wie Scientology weiß und darüber informiert ist.
Aber die religiöse und gesellschaftliche Lage hat sich seitdem tiefgreifend verändert. In den vergangenen Jahren hat insbesondere die katholische, aber auch die evangelische Kirche einen enormen Mitgliederschwund und damit einen erheblichen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust hinnehmen müssen. Beide Kirchen haben zwar immer noch viele Mitglieder und stellen sich neu auf, aber die Zeit der Volkskirche ist vorbei. Einer der Auslöser für diese kirchliche Entwicklung ist der Verlust von Vertrauen. Die mangelnde Bereitschaft kirchlicherseits, sich den Verbrechen von Missbrauch in den eigenen Reihen zu stellen, ist dafür der Grund. Dabei geht es sowohl um sexuellen als auch um spirituellen bzw. geistlichen Missbrauch. Die Selbstverständlichkeit, mit der noch vor 20 Jahren über andersdenkende oder andersgläubige Weltanschauungen gesprochen werden konnte, ist heute deshalb nicht mehr möglich. Vor dem Hintergrund des kirchlichen Umgangs mit Missbrauchsfällen gehört es sich nicht, mit einer Rhetorik aufzutreten, als habe man als einziger den gültigen Blick auf Religion und Glauben. Im Fokus unserer Arbeit stehen deshalb in erster Linie der Respekt und der wertschätzende Umgang mit allen Angeboten auf dem religiösen Markt. Dafür ist eine Sprache notwendig, die möglichst sachgerecht und fair bleibt. Oft gelingt im weltanschaulichen Kontext ein kritisches Gespräch auch mit Gruppierungen, mit denen uns weder eine theologische, weltanschauliche, ethische noch eine gesellschaftliche Überzeugung verbindet. Diese Kontakte sind wichtig und gut, weil sie gegenseitiges Verstehen und Gespräch ermöglichen und Vorurteile abbauen. Dort wo aus unserer Sicht Religiosität Menschen unfrei und abhängig macht, müssen wir jedoch weiterhin einen Beitrag zur Aufklärung leisten, sowohl mit einem kritischen Blick auf die eigene Kirche als auch in Bezug auf Gemeinschaften außerhalb der Kirchen. Dass wir dabei immer auf einem schmalen Grat unterwegs sind, ist uns sehr bewusst.
Die kirchliche Weltanschauungsarbeit ist seit vielen Jahren deutschlandweit und international gut vernetzt mit anderen Beratungseinrichtungen. Und sie ist ökumenisch aufgestellt, davon zeugt das vorliegende Buch. Ohne unsere eigenen theologischen Positionen zu ignorieren, versuchen wir hier einen möglichst facettenreichen Blick auf die Glaubensgemeinschaft Shincheonji zu werfen. Das Buch richtet sich an Berater:innen, Angehörige und ehemalige Mitglieder von Shincheonji. Es ist aber auch lesenswert für Menschen, die daran Interesse haben, sich mit einer neuen religiösen Bewegung auseinanderzusetzen, die nichts weniger verspricht als einen „neuen Himmel und eine neue Erde“!
1. Hintergründe
Shincheonji in Südkorea: Vorgeschichte – Anfänge – Entwicklungen
Südkorea ist ein Land mit einer großen religiösen Vielfalt. Es gibt wenige Länder auf der Welt, die gegenwärtig über eine vergleichbare Anzahl religiöser Denominationen verfügen wie der südliche Teil der koreanischen Halbinsel. Im Unterschied zu Ländern mit einer ähnlichen Dichte an religiösen Angeboten ist Südkorea ethnisch dabei weitestgehend homogen geblieben. Die Geschichte der südkoreanischen Neureligion Shincheonji ist eng mit der Religionsgeschichte des asiatischen Landes verknüpft, insbesondere mit dem Aufstieg des Christentums. Bereits vor der Gründung von Shincheonji im Jahr 1984 gab es viele neue religiöse Bewegungen, von denen Shincheonji theologische Vorstellungen übernommen hat.
Der Aufstieg des Christentums
Für die Religionsgeschichte der Halbinsel Korea spielt der Aufstieg des Christentums zu einer der bedeutendsten Religionen eine wichtige Rolle. Auch neue religiöse Bewegungen sind von der wachsenden Bedeutung des Christentums beeinflusst worden oder werden es weiterhin.
Die erste große Welle der Christianisierung begann Ende des 19. Jahrhunderts durch evangelikale Missionare aus den Vereinigten Staaten. Zwar gab es bereits zuvor Christen in Korea. Doch erst die Missionen im 19. Jahrhundert hatten einen spürbaren Einfluss. Viele Missionare kamen mit der Überzeugung ins Land, Korea sei das neue biblische Kanaan, das verheißene neue Land, das sie im Sinn der westlichen Zivilisation verändern wollten. Schamanistische, buddhistische oder konfuzianistische Elemente galten ihnen als unreligiös und kraftlos. Solche Vorstellungen werden heute mit Recht auch kritisch in den Blick genommen. Das Christentum galt aber bald als Emanzipationsbeschleuniger.
Unter der Vorherrschaft Japans änderte sich die Stellung des Christentums von einer Untergrund-Religion hin zu einem wichtigen Player im Unabhängigkeitskampf Südkoreas. Denn viele Christen engagierten sich für ein unabhängiges Korea. Dies führte dazu, dass das Christentum nicht länger als Gefahr für Sitte und Tradition der konfuzianisch geprägten gesellschaftlichen Eliten angesehen wurde. Das Christentum konnte so zum Synonym für die Befreiung von der japanischen Vorherrschaft werden. Die Unabhängigkeitsbestrebungen gingen mit einem großen Wunsch nach einer eigenen Nation einher. Auch dafür stand das Christentum, das durch die Freisetzung von Widerstandskräften gegen Japan gleichzeitig eine eigenständige koreanische Nation ermöglichte. Für Südkorea bedeutete das Christentum deshalb nicht primär eine mit dem Westen verknüpfte Form der imperialen Fremdherrschaft, sondern es war ein Emanzipationsbeschleuniger für eine aufstrebende junge Nation. Diese Verknüpfung des koreanischen Unabhängigkeitskampfes mit der späteren Nationbildung brachte dem Christentum in Südkorea einen enormen Wachstumsschub.
Das Wachstum der christlichen Kirchen beschleunigte sich in den 1960er Jahren. Ein wichtiger Faktor dafür lag in der sogenannten evangelikalen Gemeindewachstumsbewegung (Church Growth Movement), die von den Vereinigten Staaten ausging und bis heute besteht. Innerhalb dieser Bewegung stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich, vor dem Anspruch des Missionsbefehls aus dem Matthäusevangelium (Mt 28,18), neue Gemeindemitglieder gewinnen ließen. Man legte ein besonderes Augenmerk auf charismatische Persönlichkeiten und eine Theologie des Erfolgs bzw. des sog. „Wohlstandsevangeliums“. Die neuen Mitglieder sollten davon ausgehen können, dass, wer sich unter den Segen des christlichen Gottes stellt, mit Lebenserfolg belohnt werden würde. Die Überzeugung, dass es einen Zusammenhang zwischen materiellem Erfolg und religiösem Glauben gibt, fand über die christlichen Kirchen hinaus Verbreitung.
Von Anfang an war das südkoreanische Christentum selbstbewusst. Ohne dieses Selbstbewusstsein wäre der Kampf für eine eigene Nation gegen Japan kaum erfolgreich gewesen. Diese Haltung spiegelt sich bis heute in einer ausgeprägten Abgrenzungspolitik christlicher Kirchen gegenüber anderen religiösen Gemeinschaften. Da es im Zuge des rasanten Aufstiegs des Christentums zu vielen Abspaltungen und Zersplitterungen kam, finden Abgrenzungsprozesse auch gegenüber christlichen Gemeinschaften statt. Bis heute gebrauchen christliche Kirchen selbstverständlich den Ausdruck Häresie, wenn sie religiöse Gemeinschaften charakterisieren, die nicht ihrer Vorstellung von christlicher Orthodoxie entsprechen. Auch die Praxis des Proselytismus, d. h. die gegenseitige Abwerbung von Mitgliedern, spielt eine Rolle, wenngleich sie nicht an die militante Missionierungspraxis von Shincheonji heranreicht (siehe unten Kapitel 4: Missionierung).
Ohne den Aufstieg des Christentums, das in einer symbiotischen Beziehung zur Nationsbildung stand, lässt sich das messianische Selbstbewusstsein von Shincheonji nicht verstehen: Südkorea als Nation ist demnach der Ort der neuen Zeitrechnung, von wo aus die gesamte Welt mit der neuen Botschaft des Heils missioniert werden muss. Insgesamt wurden und werden in diesem Land viele neue Gemeinden von charismatischen Einzelpersonen gegründet. Sie haben in den Gemeinden äußerst hervorgehobene, oft jeglicher Kritik enthobene Rollen. In einigen Fällen sind diese Personen theologisch überhöht und als Gottheiten oder als für immer sündlos und unsterblich verehrt worden, wie etwa in der in den 1990er Jahren einflussreichen Moon-Bewegung.
Haupteinflüsse auf Shincheonji
Als sich das Christentum ab den 1960er Jahren stark ausbreitete, beeinflusste dies neue religiöse Bewegungen, die teilweise schon existierten oder die gerade im Entstehen begriffen waren. Für die Entstehung und das Selbstverständnis von Shincheonji spielten sowohl der Einfluss des Christentums als auch bereits bestehende neue religiöse Bewegungen eine große Rolle. Mit dem Wachstum des protestantischen Christentums sind neue religiöse Bewegungen entstanden, die einen christlichen Hintergrund hatten. Bei ihnen hatte die Bibel einen sehr hohen Stellenwert. Hinzu kam ihre Fokussierung auf eine charismatische Gründungsfigur, die sich selbst als religiös erwählt verstand.
Als der Anführer von Shincheonji, Man-Hee Lee, 1984 die Gemeinschaft Shincheonji gründete, gab es bereits eine Vielzahl von neuen religiösen Bewegungen in Südkorea, die sich in vielen Merkmalen glichen. Um sich eine Vorstellung über die Zahl solcher Gemeinschaften zu machen: In den 1960er Jahren soll es über 50 und Anfang der 1980er Jahren fast 70 von ihnen gegeben haben. Eine der wichtigsten und einflussreichsten Bewegungen in den 1960er Jahren war die sogenannte Olivenbaum-Bewegung (Olive-Tree- Movement). Man schätzt die Zahl seiner Anhänger Mitte der 1960er Jahre auf ca. zwei Millionen Menschen. Im Unterschied zur neuen religiösen Bewegung um Sun Myung Moon (Munies oder „Moon-Sekte“), die besonders in den 80er und 90er Jahren auch in Westeuropa aktiv missionierte, hat sich die Olivenbaum-Bewegung nicht im Westen ausgebreitet. Deshalb ist sie außerhalb von Südkorea praktisch unbekannt geblieben. Wichtig ist: Bevor Man-Hee Lee seine Shincheonji-Gemeinschaft gründete, war er Mitglied in dieser Bewegung.
Park Tae Sun, der Gründer der Olivenbaum-Bewegung, berichtet von einer Vision, die er im Jahr 1955 gehabt haben soll. Während dieser Vision habe er bei sich die Gabe der Heilung erfahren. Von diesem Zeitpunkt an verstand sich Park als der „Ernannte aus dem Osten“ und reklamierte Unsterblichkeit für sich. Park sah sich als Erwählter Gottes, der in Korea erscheinen musste, um Koreas Bedeutung als eine von Gott erwählte, siegreiche Nation zu festigen. Seine Kirche bezeichnete Park als den neuen biblischen Zion für Korea. Park grenzte sich von Anfang an entschieden von protestantischen Gemeinden ab und sah seine Bewegung gegenüber allen anderen Kirchen als überlegen an. In den frühen 1970er Jahren begannen die Mitgliederzahlen jedoch einzubrechen; heute spielt die Bewegung in Südkorea keine Rolle mehr.
Doch alle bedeutenden neureligiösen Bewegungen mit christlichem Hintergrund, die danach in Südkorea entstanden sind, sind mit der Olivenbaum-Bewegung verknüpft. Park legte Strukturmerkmale fest, die sich weitertradiert haben und auch für den Gründer von Shincheonji bedeutend werden sollten. Ein wichtiges Strukturelement ist die Auffassung, wonach sich die Autorität der Führungspersönlichkeit göttlicher Berufung verdankt, die sie durch eine Vision erhalten habe und die sie unsterblich mache. Ein weiteres besteht in der Überzeugung, exklusiven Einblick in das richtige Verständnis der Bibel zu besitzen.
Diese Vorstellung entwickelte der Gründer der sogenannten Tabernakelzelt-Bewegung (Tent-Temple-Movement), Jae Yul Yoo, weiter. Yoo war ein langjähriger Anhänger von Parks Olivenbaum-Bewegung gewesen. Angesichts der kurz bevorstehenden Endzeit, so Yoo, müsse die Bibel richtig entschlüsselt werden, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Seiner Auslegungsmethode zufolge besitze jede Bibelstelle einen verborgenen Zwilling, den es zu entdecken gelte. Man-Hee Lee übernahm dieses Bibelverständnis für seine eigene religiöse Bewegung, nachdem er sich auch von der Tabernakelzelt-Bewegung gelöst hatte. Ein weiteres Strukturmerkmal, das eng mit einer wörtlichen Interpretation der Bibel zusammenhängt, ist die Vorstellung, dass sich die biblische Apokalypse in Korea abspielen werde. In diesem Zusammenhang spielt das in der Nähe Seouls gelegene Tal des Berges Cheonggye eine wichtige Rolle. Für Shincheonji sollen sich am Tag der Apokalypse alle Mitglieder dort versammeln, um die erwartete Transformation von einem alten in ein neues Erdzeitalter zu bestehen.
Shincheonji nach 1984
Nach der Gründung von Shincheonji im Jahr 1984 gelang 1990 mit der Etablierung des „Christlichen Missionszentrums Zion“ in Seoul der erste Durchbruch. Das Missionszentrum ist das sogenannte theologische Institut der Gemeinschaft und Dreh- und Angelpunkt der Missionsarbeit – regional wie international. Dort werden die Inhalte der Bibelkurse festgelegt sowie die Absolventen der Kurse graduiert. Nach eigenen Angaben, die sich schwer unabhängig überprüfen lassen, soll es innerhalb von vier Jahren zu über 70 weiteren Gründungen solcher Missionszentren in Südkorea gekommen sein. 1995 ernannte Man-Hee Lee dann 12 Stammesleiter, d. h. Personen, die dafür verantwortlich sein sollten, jeweils 12.000 Neumitglieder weltweit zu rekrutieren. Die 12 Stämme wurden in Analogie zu den 12 biblischen Stämmen Israels gegründet, allerdings mit neutestamentlichen Namen. Die 12 Stämme des biblischen Israels tragen andere Namen. Die Stämme bei Shincheonji heißen: Johannes, Petrus, Jakobus, Andreas, Thaddäus, Philipp, Simon, Bartholomäus, Matthäus, Matthias, Thomas, Jakob. Allen Stämmen sind bestimmte Farben zugeordnet. So gehört z. B. zum Stamm Simon, der u. a. in Frankfurt am Main missioniert, die Farbe Gelb.
1995 unternahm Man-Hee Lee seine erste Pilgerreise nach Israel, 1998 reiste er dann nach Rom, Athen, in die Türkei und auf die Insel Patmos, wo der Autor der Offenbarung des Johannes seine Offenbarung geschrieben haben soll. Ab den 2000er Jahren expandierte die Gemeinschaft, indem sie eine eigene Medienlandschaft ins Leben rief. So z. B. einen eigenen Fernseh- und Radiosender und einen eigenen Verlag. Schon früh baute die Gemeinschaft ihre Präsenz im Internet auf mit eigener Website und Onlinevorträgen. Ab den 2010er Jahren richtete die Gemeinschaft ihre Missionsstrategien vermehrt auf andere Kirchen aus. Es werden Pastoren anderer christlicher Gemeinden zu eigens veranstalteten Olympiaden oder Kulturveranstaltungen eingeladen. In dieser Zeit beginnt die regelmäßige Auseinandersetzung der Gemeinschaft mit Kritikern von außen. Es werden dazu Gegendarstellungen publiziert und Pressekonferenzen abgehalten.
In die internationalen Schlagzeilen kam die Gemeinschaft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 2020. Mitglieder von Shincheonji hatten sich massenhaft mit dem Virus angesteckt und dadurch zur Verbreitung des Virus in Südkorea beigetragen. Es wurde der Vorwurf laut, wonach die Verantwortlichen die zur Bekämpfung der Pandemie notwendige Kooperation mit dem Staat behindert hätten. Im Mittelpunkt stand die Stadt Daegu, die zum Epizentrum der Pandemie in Südkorea wurde. Es gingen Bilder um die Welt, die in Schutzanzüge gekleidete Einsatzkräfte zeigen, die rund um das dortige Hauptquartier von Shincheonji die Umgebung desinfizieren. Es wurde berichtet, dass sich eine 61-jährige Anhängerin von Shincheonji nach ihrer Rückkehr aus China nicht testen ließ und dabei viele andere angesteckt habe. Die anfängliche Weigerung von Shincheonji, interne Mitglieder-Listen herauszugeben, legte den Verdacht nahe, man würde Test- und Quarantäne-Regeln missachten. Von der absichtlichen Behinderung der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ist Man-Hee Lee mittlerweile freigesprochen worden. Dennoch führte die Zeit vor und während des Prozesses dazu, dass die Gemeinschaft zum ersten Mal außerhalb von Südkorea einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde. Höhepunkt war eine Petition, in der über 2 Millionen Menschen den Staat Südkorea aufforderten, gegen Shincheonji vorzugehen. Shincheonji selbst deutete die Zeit als satanische Angriffe der Welt auf die Gemeinschaft und das Virus als „Werk des Teufels“. Anfang März 2020 trat Man-Hee Lee vor die nationale und internationale Presse und entschuldigte sich.