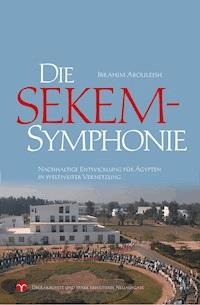
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Info 3
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Vor mehr als zehn Jahren wurde Ibrahim Abouleish für die Pionierarbeit der SEKEM-Initiative mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und legte zeitgleich sein Buch vor. Inzwischen hat SEKEM als ein geschätztes Modell für die nachhaltige Integration von Wirtschaft, Bildung und Kultur auf internationaler Ebene Ansehen gewonnen. Die Stimme SEKEMS wird auf dem weltbekannten Wirtschaftsforum in Davos und im „Weltzukunftsrat“ gehört und gilt nicht zuletzt angesichts der unsicheren Lage Ägyptens nach dem „Arabischen Frühling“ als Hoffnungsträger. In einer aktualisierten und stark erweiterten Neuauflage hat Ibrahim Abouleish die Entwicklung SEKEMS im beginnenden 21. Jahrhunderts zusammengetragen. Anschaulich und von eindrücklichen Bildern begleitet tritt die symphonische Vielfalt dieser Initiative von Wirtschafts- und Ausbildungsbetrieben, landwirtschaftlicher Produktion, medizinischen Einrichtungen, Schulen, Therapieangeboten und Forschungsstätten hervor. Ein Klang der Zukunft, der aus der Wüste Ägyptens in die Welt hinaus tönt. „Insgesamt sehe ich meinen Beitrag in einer Reihe anderer Bemühungen im islamischen Kulturkreis, die mir heute den Eindruck vermitteln, dass der Islam vor einer grundlegenden Reform steht. Der islamischen Welt und damit auch Ägypten fehlt eigentlich etwas Vergleichbares, was einst Martin Luther für den christlichen Kulturkreis geleistet hat. Das ganze Schicksal der gegenwärtigen Welt scheint mir auf diese Aufgabe hinzudeuten.“ - Ibrahim Abouleish
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Ähnliche
Ibrahim Abouleish
Die SEKEM-Symphonie
Für die vielen Freunde von SEKEM,
Dr. Ibrahim Abouleish
Vorwort
Wenn ich gefragt werde, was SEKEM ist, und erzähle von den Schulen, der Universität und der Erwachsenenbildung, dann stellt sich der Fragende einige soziale Einrichtungen vor, die irgendwie finanziert werden und weitestgehend auf Spenden angewiesen sind. Wenn ich ausführe, dass SEKEM aus erfolgreichen Unternehmen besteht, dann trifft das ebenso zu, aber nicht ausschließlich. Ich könnte auch sagen: SEKEM ist eine politische Initiative, eine Forschungsinitiative, eine ökologische Initiative. Alles ist richtig, und doch ist es nicht das, was SEKEM ist. Was also ist SEKEM eigentlich? – Wir kennen alle ein Orchester, in dem Streicher, Bläser und Trommler zusammenspielen. Jeder Spieler hat seine eigenen Noten, kennt sein Instrument und seine Fähigkeiten, es so gut wie möglich zu beherrschen. Lediglich der Dirigent hat die gesamte Partitur vor sich und alle gemeinsam, Spieler und Dirigent, ordnen sich der Idee des Komponisten unter. Jeder Einzelne bringt sich nach Vermögen ein, nimmt sich aber auch zum Besten des Ganzen zurück, wie es die übersinnliche Idee der Komposition, der alle dienen, braucht. Nicht nur jeder für sich ist gut, sondern alle hören aufeinander. Dadurch entsteht Musik.
SEKEM ist also der Zusammenklang aller einzelnen Bereiche, die, für sich gesehen, autonom sind. Und doch macht erst das Zusammenspiel, das Miteinander der einzelnen Bereiche, das Ganze aus, wie bei einer Symphonie.
In den letzten Jahrzehnten hat die landwirtschaftliche Nutzfläche, die fünf Prozent der Landesfläche ausmachen, in Ägypten kontinuierlich abgenommen und 95 Prozent sind Wüstengebiete. In großem Umfang wurde kostbares Ackerland überbaut und damit der Nahrungserzeugung entzogen, während gleichzeitig die zu ernährende Bevölkerung exponentiell wuchs. Mitte des vergangenen Jahrhunderts lebten 18 Millionen Menschen in Ägypten und die Bevölkerung ist gewachsen auf heute 90 Millionen. Ägypten erhält jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Wasser vom Nil. Durch den Bevölkerungszuwachs entsteht eine Wasserknappheit, die in den kommenden Jahren eskalieren wird. Die Probleme Bevölkerungswachstum und Wohnungsnot wurden zum Teil kommerziell angegangen auf Kosten künftiger Generationen, weil kein Bewusstsein für größere Zusammenhänge und Auswirkungen vorhanden war. Die Überbevölkerung schränkt den Lebensraum ein, was zu problematischen Verhaltensweisen im sozialen Umgang der Menschen miteinander führt.
Das sind brennende Probleme in der ägyptischen Gesellschaft, die mich intensiv beschäftigten. Ich wollte ein Modell einer Gemeinschaft aufbauen, die neuen fruchtbaren Boden in der Wüste schafft, auf dem gesunde Pflanzen und Tiere gedeihen können, und ich wollte auch Menschen ausbilden, die sich daran entwickeln in neuen sozialen Räumen.
Die komplexen Zusammenhänge genauer aufzuzeigen und die Hintergründe zu beleuchten, die Geschichte der Initiative mit der Geschichte der vielen mutigen Menschen, die daran mitgewirkt haben, in Zusammenhang zu bringen, das »Wunder der Wüste« zu erzählen, das soll Ziel dieses Buches sein. Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens begleiteten und formten SEKEM, und daher möchte ich anhand meines Lebenslaufes, hineingewachsen in die Geschichte SEKEMS, von dem Weg dieser Initiative erzählen. Dabei ist es mir ein inneres Anliegen, all jenen zu danken, die an der Entstehung dieses Buches beteiligt waren.
Als erstes möchte ich meiner Frau Gudrun für ihre unendliche Geduld, Fürsorge und Liebe danken. Sie ist mit mir nach Ägypten gekommen und hat SEKEM von Anbeginn an tatkräftig unterstützt. Sie hat es verstanden, mir die Alltagssorgen abzunehmen, und hat mir so Raum zur Verwirklichung der SEKEM-Ideen geschaffen. Ihre Arbeit am Manuskript hat wesentlich zu der hier vorliegenden Form beigetragen.
Auch bei meinem Sohn Helmy möchte ich mich bedanken. Er hat die Wirtschaft SEKEMS durch die vielen Höhen und Tiefen ständig mit enormer Sicherheit und strategischem Weitblick geführt. Durch seinen Humor und seine Positivität hat er viele Menschen für die Idee begeistern können, was schließlich den Inhalt dieses Buches entscheidend beeinflusste.
Mein ganz besonderer Dank gilt Barbara Scheffler, die es mir durch ihre geduldige Ausdauer ermöglichte, meine Erinnerungen wachzurufen. Ihr gelang es, die gesamten Informationen zu überarbeiten und somit die Grundlage für diesen Lebensbericht zu schaffen.
Jens Heisterkamp danke ich für seine spontane Bereitschaft, die Lektoratstätigkeit zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit ihm half mir, Ordnung in meine Ideen und Gedanken zu bringen.
Dank gilt auch Konstanze Abouleish und Hans Werner, die mir wertvolle Anregungen und Einblicke lieferten und die Entstehung dieses Buches liebevoll begleitet haben.
Mein Leben lang hatte ich das Glück, Menschen an meiner Seite zu haben, die mich förderten, unterstützten und liebten. Sie erfüllten mein Leben mit Freude und halfen mir, mich zu entwickeln. Leider ist es nicht möglich, alle Menschen zu erwähnen, denen ich Dank schulde – und trotzdem ist meine Dankbarkeit gegenüber all denen, die mich begleitet haben und die die Grundlage für diesen Lebensbericht schufen, unendlich groß.
Die Vision
Tief in meinem Innern lebt ein Bild: Mitten in Wüste und Sand sehe ich mich aus einem Brunnen Wasser schöpfen. Achtsam pflanze ich Bäume, Kräuter und Blumen und tränke ihre Wurzeln mit dem kostbaren Nass. Das kühle Brunnenwasser lockt Tiere und Menschen an, die sich erquicken und laben. Bäume spenden Schatten, das Land wird grün, Blumen verströmen ihren Duft, Insekten, Vögel und Schmetterlinge zeigen ihre Hingebung an Gott, den Schöpfer, als sprächen sie die erste Sure des Koran. Die Menschen, das geheime Gotteslob vernehmend, pflegen und achten alles Geschaffene als Abglanz des Paradiesgartens auf Erden.
Dieses Bild einer Oase inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung ist für mich wie ein Auferstehungsmotiv in der Frühe nach einer langen Wanderung durch die nächtliche Wüste. Es stand modellhaft vor mir, noch bevor die konkrete Arbeit in Ägypten begann. Und doch wollte ich eigentlich mehr: Ich wollte, dass sich die ganze Welt entwickelt.
Lange hatte ich darüber nachgedacht, wie die Initiative, die ich aufgrund meiner Vision verwirklichen wollte, heißen sollte. Aus meiner Beschäftigung mit der alten ägyptischen Hochkultur wusste ich, dass SEKEM Lebenskraft bedeutet. Diesen Namen sollte die Initiative tragen, die ich am Rand der Wüste zu gründen begann. Dieses Buch erzählt davon, wie sich alles entwickelt hat.
ERSTER TEIL
Hermann Hesse
Der 12-jährige Ibrahim Abouleish
1. Die ersten Lebensstationen
Kindheit
Jeder Besuch meines Großvaters war ein Fest. Auf seinem Gang in die nahe Moschee zum Gebet durfte ich ihn begleiten. Wir traten aus dem Haus. Ein leichter Dunst lag über den Gärten und Feldern, durch den eine weiße Sonne strahlte, so weiß wie das Gewand meines Großvaters. Er nahm meine Hand, ich spürte, wie seine Wärme und Geborgenheit mich aufnahmen, und ging schweigend neben ihm durch die Stille des Morgens. Er hatte Zeit für mich. Wenn wir so gingen, war keine Eile. Wir blieben an reich fruchtenden Orangenbäumen stehen, sogen den Duft von Rosen ein und freuten uns daran, wie ein Schmetterling selbstvergessen auf einer Margerite Nektar sog. Mein Großvater fand auf all meine kindlichen Fragen ausführliche Antworten, die mich tief befriedigten. Er hockte sich vor die weiß leuchtende Blüte mit dem tanzenden Schmetterling und nahm mich auf seine Knie. Ich schmiegte mich, seine Milde genießend, an ihn. Der Schmetterling entfaltete seine bunten Flügel, hob sich von der weißen Blüte in den blauen Himmel und wir beide, mein Großvater und ich, sahen ihm lange nach.
Nach dem Besuch der Moschee begleitete ich meinen Großvater zum Bäcker und wir holten Fladen für die ganze Familie. Ich tauchte tief in den Duft und die Wärme dieses Ortes ein, nahm von einem freundlich blickenden Mann die großen runden »Fetier« in meine Arme und trug sie wie Heiligtümer nach Hause. Meine Mutter kam uns durch den Garten entgegen und ich reichte ihr die zuckerglänzenden Brote. Dann sprang ich davon, kletterte auf den riesigen Sykomorenbaum und wiegte mich in seinen Zweigen.
Mit dem Großvater war auch die Großmutter gekommen und half meiner Mutter beim Nähen. Gegen Abend legte sie ihre Nähsachen aus der Hand, faltete die Hände und entspannte sich. Darauf hatte ich nur gewartet, kroch auf ihren Schoß und bat um eine Geschichte, von denen ich nie genug bekommen konnte. Ich wusste, sie kannte die schönsten der Welt und konnte sie spannend erzählen. Es mussten gar nicht immer neue sein, ich hätte hundert Mal dieselbe hören können. Gerne erzählte sie mir vom Großvater, der aus Marokko stammte und in Kairo Textilhändler war. Meine Großmutter hatte früher in Menja gelebt, der Stadt Echnatons. Die Religiosität des Großvaters und die stille Freundlichkeit der Großmutter prägten die Kindheit und das Leben meiner Mutter. Meine Großmutter erzählte mir, dass meiner Mutter nach meiner Geburt die Milch gefehlt habe und dass ihr, als älterer Frau, Milch gekommen sei und sie mich damit genährt hatte. Da schmiegte ich mich an sie und genoss die warme Lebenskraft, die von ihr ausströmte. – Der Großvater meines Vaters, der aus Galiläa stammte, war ein reicher Baumwollhändler in Ägypten gewesen. Die Mutter meines Vaters kam ursprünglich aus Syrien. Für meine Großeltern war ich das erste Enkelkind, das sie mit all ihrer Liebe verwöhnten. Obwohl zwei Jahre später meine Schwester Kausar zur Welt kam und danach alle zwei Jahre vier weitere Geschwister, Mohammed, Hoda, Nahed und Mona geboren wurden, lebte in mir die Empfindung, dass meine Großeltern und besonders meine Großmutter allein nur für mich da waren.
Ich habe zwei Geburtstage: den Tag, an dem ich in Mashtul das Licht der Welt erblickte, und den, der noch immer in meinem Pass verzeichnet ist – der 27. April – und den ich bis in meine Jugendzeit hinein als meinen Geburtstag kannte. Mein Vater hielt täglich sorgfältig alle Geschehnisse in seinem Notizbuch wie in einem Tagebuch fest. Als ich ihn einmal bei seinen Eintragungen erlebte, fragte ich ihn spontan: »Hast du auch meinen Geburtstag aufgeschrieben?« Er holte das Notizbuch des Jahres 1937 und las mir eine Eintragung zu meiner Geburt vor, die er am 23. März verzeichnet hatte, der islamischen Zeitrechnung nach der 10. Moharram 1356. Auf meine Frage, warum mir bisher ein anderes, rund einen Monat später liegendes Datum bekannt sei, erklärte er mir, dass es üblich sei, erst Wochen oder manchmal sogar Monate später die Ankunft eines Kindes bei den Behörden zu melden. Dieser Tag wurde dann im Pass als Geburtsdatum vermerkt.
Meine Tante Aziza hatte einen herrlichen Garten mit Guaven-, Mango-, Orangen- und Granatapfelbäumen, mit Bougainvillea, Rosen und Hibiskus. Immer, wenn ich sie einige Tage besuchen durfte, beschenkte sie mich mit Früchten und gab mir frische Honigwaben zum Aussaugen. Lächelnd blickte sie auf mich nieder und freute sich, wie es mir schmeckte. In der Frühe standen wir beide auf und gingen in die Milchkammer, wohin die Milch von den Kühen gebracht wurde. Von der Decke hing an zwei Seilen eine Ziegenhaut. Dort hinein leerte sie den Rahm und begann die Haut zu schütteln, wobei ich ihr kräftig half. Wir beobachteten, wie die Milch allmählich flockiger wurde und zu Butter zusammenklumpte. Dann sprang ich wieder in ihren Garten. Immer war jemand um mich, der auf mich acht gab und mich behütete.
In diesem Garten stand ein Brunnen. Wenn ich mich ihm näherte, bekamen meine Wärterinnen ängstliche Gesichter. Einmal in der Hitze des Tages war niemand da. Ich befand mich in der Nähe des Brunnens, beugte mich herab und blickte in die feuchte, schwarze Tiefe. Da verlor ich den Halt und fiel hinein, fiel nach meinem Erleben tausend Meter tief, so lang währte das Fallen, dabei waren es höchstens drei bis vier Meter. Auf dem Grund gab es kein Wasser, aber ganz trocken war er zum Glück auch nicht. Dumpf traf ich unten auf und blieb liegen. Sogleich eilte eine Frau herzu und ließ mich aus dem finsteren Brunnenschacht herausholen. Aber für mich hatte sich etwas verändert. Ich sah die Welt mit anderen Augen und erkannte, dass sie auch Gefahren barg.
Kairo
Die Familie Sabet, deutsche Juden, die aus der Nähe von Stuttgart übergesiedelt waren, führten in Ägypten den Kunstdünger ein. Mein Großvater wurde damals einer der größten Kunstdüngerhändler Ägyptens. Mein Vater, der zunächst mit meinem Großvater geschäftlich zusammengearbeitet hatte, machte sich mit eigenen Firmengründungen selbstständig, von denen ich noch ausführlicher erzählen möchte. So zogen wir, als ich vier Jahre alt war, in die Stadt. Meine Eltern führten mich durch ein geräumiges helles Haus mit vielen Zimmern und unendlich zahlreichen riesigen Kartons mit kostbarem Geschirr. Fremde Leute brachten schöne Möbel, die glänzend lackiert waren und fein rochen, denn meine Eltern richteten sich ganz neu nach europäischem Stil ein. In einem prächtigen Salon empfing meine Mutter Gäste zum Tee. Besonders Berta Sabet, die Frau eines Geschäftspartners meines Vaters, besuchte uns oft. Sie trug vornehme Hüte und rauchte mit einer langen Zigarettenspitze. Meine Mutter liebte diese Eleganz.
Wir zogen in dieser Zeit mehrmals um und bewohnten, als ich sechs Jahre alt war, eine Wohnung im dritten Stock eines hellen, wunderschön verzierten alten Hauses mit riesigen, unendlich vielen und, wie mir schien, hohen Zimmern. Um uns herum wohnten viele Juden. Rachel, unsere Nachbarin, sah es nicht gern, wenn meine Schwester und ich morgens die Treppen herunter sprangen und in den christlichen Kindergarten Sankt Anna eilten: »Pfui«, meinte sie dann, »dass ihr in so eine schreckliche Schule geht, verstehe ich nicht!« – Samstags kamen die Nachbarn öfter zu uns Kindern und baten, für sie das Licht anzuzünden, weil sie selbst am Sabbat keine Arbeit verrichten durften. Wir bekamen zum Dank für unsere kleinen Gefälligkeiten Kekse.
Ramadan – ein herrlicher Monat, die schönste Zeit des Jahres begann und wir Kinder bekamen kleine Laternen, Fanouz genannt. Wir öffneten an diesen wunderschön geformten, farbigen Glasgefäßen ein kleines Türchen und zündeten das Licht an: wie verzaubert erschien der Raum von dem herrlichen Farbenspiel! Meine Schwester Kausar und ich trugen die Lichter durch die Straßen und sangen vor fremden Türen Lieder. Ich sang laut und inbrünstig, denn ich erhielt dafür Kuchen und andere schöne Sachen.
Ramadan – das waren auch die abendlichen Geschichten, die meine Mutter vom Propheten erzählte. Andächtig lauschten wir und bewunderten, was der Prophet alles ertragen und ausgehalten hatte, wie klug er die Fragen, die an ihn gerichtet wurden, beantwortete, wie viel Freiheit er den Mitmenschen zutraute. Es entstand das Bild eines bewundernswerten Mannes in meiner Seele: sehr zart und sehr weise, sehr stark und sehr bestimmt. Meine Mutter oder meine Großmutter erzählten uns Geschichten von den Jüngern des Propheten. Bis tief in die Nacht hinein saßen sie bei uns. Auch schon bekannte Erzählungen erlebten wir immer wieder neu und mit Spannung.
Am Ende des Monats Ramadan liegt ein großes Fest, Bairam genannt. Dazu wurden wir neu eingekleidet, bekamen neue Schuhe und ein neues Gewand. Es roch alles so gut. Meine Mutter legte die herrlichen Sachen in einen Schrank und wir durften sie erst zum Festtag anziehen, der dann voller weiterer Überraschungen war. Die Frauen buken riesige Mengen puderzuckerbestreuter Kekse. Wir Kinder hockten um den großen Küchentisch und halfen eifrig mit, kleine Törtchen auszustechen, die mit Dattelmus gefüllt wurden. Wir legten sie auf große Bleche, die übereinander gestapelt und nummeriert von einem Dienstmädchen auf dem Kopf zum Bäcker getragen wurden. Das fertig gebackene, duftende Gebäck sortierte meine Mutter in kleine Schachteln, die ich zu den Armen trug. Das gefiel mir. »Meine Mutter grüßt euch!«, sagte ich bei der Übergabe an der Haustür. Die Menschen freuten sich und ließen ihr Dank ausrichten.
Mein Vater brachte mich in eine französische Schule, wo ich drei Jahre lang die französische Sprache erlernte. Nachdem meine Schwester Kausar auch dort eingeschult worden war, merkten wir beide bald in einem stillen Übereinkommen, dass wir eine Art Geheimsprache kannten, die niemand im Hause verstand. Meine Mutter litt darunter und kämpfte mit Erfolg darum, dass ich in eine ägyptische Schule kam, während Kausar bis zu ihrem Abitur bleiben durfte. In unserem großen Haus hatte jeder von uns Kindern sein eigenes Zimmer. Kausars Raum war immer ordentlich und schön eingerichtet und auch mir war es ein Anliegen, dass alles um mich gepflegt aussah. Deshalb schlossen wir unsere Räume vor unserem kleinen Bruder Mohammed ab.
Mein Vater gründete damals ein selbstständiges Handelsunternehmen und begann sich, als ich ungefähr neun Jahre alt war, für die Industrie zu interessieren. Er gründete eine Seifenfabrik und eine Süßwarenfabrikation, in der das berühmte, aus Honig und Mandeln bestehende Halwa hergestellt wurde. Die Art, wie mein Vater den Standort für dieses Unternehmen wählte, ist bezeichnend für ihn. Kurze Zeit vor der Firmengründung ereignete sich in dem von vielen Juden bewohnten Viertel ein furchtbarer Anschlag. In einer Straße war ein Wagen mit »Gelati«, mit Eis, abgestellt worden. Gerade als der Eiswagen von Kindern umringt war, ging eine von Extremisten gezündete Bombe hoch. Und genau an der Stelle, wo die Wucht der Explosion einen Ort der Zerstörung hinterlassen hatte, baute mein Vater seine Fabrik als ein Zeichen, dass Terror nie geduldet werden dürfte.
Wenn ich aus der Schule kam, zog ich mich um und lief in die Seifenfabrik. In der großen Halle umfing mich der Geruch von in Riesenkesseln kochender Seifenlauge. Die Arbeiter winkten mich freundlich heran, drückten mir eine der überlangen Stangen in die Hand und ließen mich in der dicken Seifensuppe rühren. Spannend erlebte ich den Moment, wenn die heiße Lauge in die mit Pergamentpapier ausgekleideten Rahmen gegossen wurde, um dort über Nacht zu trocknen. Dabei wurden nach einem Geheimrezept die Öle zugesetzt: echtes Rosenöl, Öl von Zitronen- und Orangenschalen – herrlich! Am nächsten Tag wurden diese zweimal zwei Meter großen Kuchen mit Messern und einer Schnur in kleinere Stücke von 60 mal 60 Zentimetern geschnitten. Ich stand an einem Tisch und schob die Seifenstücke durch die Edelstahldrähte, die im rechten Winkel befestigt waren. So wurden sie erst zu Stangen und beim zweiten Durchschieben zu Seifenstücken gesägt. Wehe, wenn ich nicht acht gab! Mancher Finger erhielt eine Wunde, in der die Seifenlauge brannte. Die fertigen Seifenstücke wurden noch einmal getrocknet und dabei mit einem Stempel versehen. Der Name der Seife lautete übersetzt »Al Doktor« und war in einem Halbmond geprägt. Ich ließ sie gern durch die Finger gleiten und genoss das seidige Gefühl.
Neben der Fabrik befand sich eine Schreinerei, in der die Holzkistchen für die Seifenstücke angefertigt wurden. Dort arbeitete ich gern und lernte viel im Umgang mit Holz. Ein wirklich genussvoller Augenblick war dann das Verpacken. Farbiges Seidenpapier, Schleifen und vor allem die schöne Beschriftung mit dem Handelsnamen »Al Doktor« machten das Produkt vollkommen. Am liebsten hätte ich alle diese edlen Päckchen selbst behalten, um sie zu verschenken. Genauso ging es mir mit den Produkten der anderen Fabrik meines Vaters, wo die Süßigkeiten entstanden. Ganz praktisch lernte ich am Verpacken, wie die farbig glänzenden Papiere auf den Geschmack und den Duft der einzelnen Bonbons abgestimmt werden mussten.
Dann gab es, an die Fabrik angeschlossen, ein Fuhrunternehmen. Das waren Hand- oder Eselskarren, die die Ware auf den Markt, ins Lager oder in die Läden brachten. Die Gegend um die Fabrik war ein Judenviertel und neben unserer Fabrik stand die Synagoge. Wir waren die einzigen Nicht-Juden in dieser Gegend. Durch diese Umstände wuchs ich mit selbstverständlicher Toleranz auf. Jude bedeutete für mich: Freund. Wenn ich abends aus der Fabrik auf die Straße trat, rief es laut aus einer Ecke: »Ibrahim! Komm und fahr mich bitte!« Dudu war ein behinderter jüdischer Junge, der eigentlich David hieß. Er wartete geduldig, bis ich erschien. Dann setzte ich ihn auf einen dieser Handkarren und fuhr ihn durch die Gassen, und der kleine Dudu jubelte. Wie leicht ließ sich dieser Mensch durch einen Scherz, eine kleine Neckerei erfreuen! Er wollte mich gar nicht mehr loslassen. Andere Leute beobachteten unser kleines Spiel, erzählten es weiter und die Eltern brachten mir immer wieder ihre behinderten Kinder, damit ich sie auf dem Karren spazieren fuhr und mit ihnen spaßte. Als sie mit der Zeit zu schwer wurden, spannte ich einen Esel vor, der sie durch die Gassen zog.
Unser Hausschneider, der die perfektesten Moden zuschnitt und mit der Hand nähte, war ebenfalls ein Jude. Wie stolz war ich, wenn ich wieder einmal mit einem neuen Anzug von ihm auf die Straße trat. Damit konnte ich mich sehen lassen! Natürlich wollte ich den Anzug auch meinem Vater zeigen. Auf dem Weg dorthin rief mich ein Junge an: »Ibrahim!« Ich sah mich um. Da kam der Junge auf mich zu, aber ich kannte ihn nicht. Woher wusste er meinen Namen? Mit treuherzigem Blick erzählte er mir, er sei von meinem Vater beauftragt, mir auszurichten, dass er mich in der Bank erwarte. Nun schlug ich eine andere Richtung ein und er begleitete mich, lobte meinen neuen Anzug und sagte plötzlich ganz traurig: »Weißt du, dass dein schöner Anzug einen Fleck an der Schulter hat? Ich will ihn abputzen!« Er fing an zu reiben und zu wischen. »Ich schaff es nicht. Zieh ihn aus, ich lauf geschwind ins Haus und versuche es mit etwas Wasser. Ich bin gleich zurück!« Ich gab ihm meine Jacke – er aber kam nicht wieder und ich stand lange auf der Straße, bis ich merkte, was geschehen war.
In der ägyptischen Schule hatte ich einen hervorragenden Arabischlehrer, den ich sehr verehrte. Er war ein richtiger Lehrertyp, sauber und pedantisch bis ins Letzte. Seine ordentliche Kleidung, sein Tafelanschrieb, seine gehobene Sprache begeisterten mich und prägten sich tief als Bild eines edlen Menschen in meine Seele ein. Abdu Affifi war mein Idol, und wenn ich zu ihm kommen sollte, wagte ich fast nicht, in sein Zimmer zu treten. In der Oberstufe hatten wir einen Französischlehrer, mit dem ich mich richtig anfreundete. Er war Marokkaner, sprach perfekt französisch und nur gebrochen ägyptisch. Ich frischte meine Sprachkenntnisse aus den ersten beiden Schuljahren auf und redete mit ihm in seiner Sprache. Das freute ihn sehr. – Mein Lehrer im Kunstturnen war Landesmeister, der uns über Jahre an den Geräten und im Bodenturnen hervorragend trainierte. Ich übte begeistert für die Teilnahme an Wettbewerben. Zu Hause lief ich im Handstand durch die Wohnung und erstieg auch die Treppen auf diese Weise unter dem Gelächter meiner Familie.
Mein vollständiger Name lautet Ibrahim Ahmed Abouleish. Da im Arabischen zwischen I und A nicht unterschieden wird, bedeutet dies »AAA«. Wir wurden in der Schule nach dem Alphabet gesetzt und aufgerufen. Deshalb kam ich immer als Erster dran und wurde als Erster gefragt. Viel lieber hätte ich in der Mitte gesessen, um bei schwierigen Fragen erst einmal hören zu können, was die anderen vor mir dazu zu sagen gehabt hätten. So aber waren diese drei »A« für mich nicht immer ein leichtes Schicksal.
Leider hatte ich in den oberen Klassen keinen guten Arabischlehrer mehr und die Stunden und Arbeiten verliefen manchmal qualvoll. Die arabische Grammatik ist sehr schwer. Oft hieß es in meinen Aufsätzen: »Inhalt gut; die Schrift könnte besser sein«. Auch konnte und wollte ich nicht frei vortragen. Das machten die Kinder vom Land viel besser als ich, weil sie sich unbefangener gaben. Deshalb verlegte ich mein Interesse schon recht früh auf die Naturwissenschaften. Bei den Laborversuchen in Physik und Chemie konnte ich vor lauter Faszination über das, was ich sah und erlebte, nie nah genug an dem Geschehen sein und saß den experimentierenden Lehrern fast auf dem Tisch. Ich wollte nicht nur auswendig lernen, sondern verstehen, was ich sah und erlebte. Mathematik fiel mir zu, weil der Lehrer die Inhalte gut vermitteln konnte.
Zum Lernen zog ich mich in mein Zimmer zurück, denn neben einem Schlafzimmer hatte ich noch ein schönes, ordentliches Arbeitszimmer. Wenn ich am Abend mit dem Lernen fertig war und aus meinem Zimmer trat, saß meine Mutter im Wohnzimmer mit einer Näharbeit. Sie ließ die Arbeit sinken und sah mich mit einem feinen Lächeln an: »Magst du mir ein wenig erzählen von dem, was du gelernt hast?« Sie kannte weder die englische noch die französische Sprache, noch wusste sie etwas von physikalischen und chemischen Versuchen oder höherer Mathematik. So setzte ich mich zu ihr und begann ihr alles, was ich vorher gelernt hatte, zu erzählen und auf diese Weise zu vertiefen. Sie hörte gespannt zu, fragte nach und ging ganz auf mich ein. Obwohl sie ja viele Kinder hatte, sparte sie diese besondere Zeit für mich auf. In dieser Sphäre inniger Zuneigung, die uns beide verband, entwickelte sich früh meine Fähigkeit, anderen etwas beizubringen.
Sommer auf dem Land
Die Sommerferien verbrachte ich stets auf dem Land in meinem Heimatdorf Mashtul im Nildelta, rund fünfzig Kilometer nördlich von Kairo. Dort wohnten zwei meiner Tanten in weit auseinanderliegenden Häusern. Um von der einen zur anderen zu gelangen, brauchte ich Stunden, weil ich auf dem Weg vielen Freunden begegnete. Die Jugend des Dorfes versammelte sich um mich, wir lachten und scherzten, ich gab die neuesten Geschichten zum Besten oder trug meine selbst geschriebenen Gedichte vor. Einmal berichteten sie mir, sie müssten mit einer Archimedischen Spirale Wasser auf die Felder hochdrehen. Da sah ich dieses Gerät und seine Bedienung zum ersten Mal, war ich doch früher, als ich klein war, von der Bauernarbeit fern gehalten worden. Wir hatten ja Angestellte, die alle einfachen Arbeiten für uns verrichteten. Nun empfand ich es wie ein Wunder, wie das Wasser von ganz tief unten allmählich heraufgeschafft wurde, sich in die Gräben ergoss, langsam weiterrieselte und durch einen Erdwall umgelenkt auf das Feld floss. Stundenlang hätte ich drehen können, immer von neuem staunend, dass es so etwas gab. – Sie nahmen mich auch mit zum Korndreschen mit dem Norak, einem Brett mit Eisenscheiben, das über das Korn gelegt wurde. Ein Büffel zog es nun langsam über das Stroh und zerhackte es, sodass die Körner herausfielen. Ich sah zu, redete mit den Arbeitern, erfuhr ihre Lebensweise. Mit der Zeit erzählten sie mir auch ihre Nöte und Wünsche, die ich in ein kleines Heftchen schrieb, mit den Namen dahinter. Menschen interessierten mich, und sicher spürten auch sie meine Zuneigung. Ich kam sehr schnell in Kontakt mit ihnen, besonders auch mit den Armen und Kranken. In Kairo lag das Heft offen auf meinem Schreibtisch und ich überlegte, was ich beim nächsten Besuch mitbringen könnte, um ihnen eine Freude zu machen: Seife, aber auch Stoffe, Kleidung, Schuhe und Süßigkeiten. Alles wurde schön verpackt und in meinem Koffer gut vor den Augen der Eltern und Geschwister verborgen gehalten, denn es war mein Geheimnis. Ich hatte aber eine Scheu, diese Geschenke den Menschen direkt zu geben. Spätabends schlenderte ich durch das Dorf von Haus zu Haus und warf die Päckchen durch die geöffneten Fenster hinein. Dann versteckte ich mich und beobachtete, was geschah. Das war meine stille Freude.
Bis auf meine Mutter wusste niemand davon und sie unterstützte mich bei der Beschaffung der Geschenke. Nur als ich sie einmal um ein schönes Kleid von ihr für jemanden fragte, sagte sie sanft: »Ibrahim, ist das nicht etwas zu viel?« Meine Großmutter erfuhr von meinen Aktivitäten, als sie mich einmal bei meinem geöffneten Koffer überraschte und ganz schlicht fragte: »Hast du auch etwas für mich?« Da beichtete ich ihr alles. Wie war ich beiden dankbar, dass sie mein Geheimnis nicht weitererzählten, denn sie kannten mich gut. Ich war ein außerordentlich fröhliches und humorvolles Kind, daneben aber auch sehr stolz, gefährlich stolz, wie meine Mutter meinte. Gewisse Dinge durfte man mir nicht sagen, weil sie diesen Stolz verletzten. Wenn ich verletzt war, zog ich mich zurück und sprach nicht mehr. Das ist bis heute so.
Ein Bewohner des Dorfes musste nach Kairo zum Arzt, weil er im Dorf nicht behandelt werden konnte. Nun erkundigte ich mich, wie viel das kostete, um Geld für seinen Arztbesuch und den Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Ich selbst hatte bis dahin kaum eine Beziehung zum Geld. Manchmal griff ich auf selbst Gespartes zurück. Es hatte sich aber auch herumgesprochen, was ich mit meinem Geld tat. Eine der fünf Grundsäulen des Islam ist das Almosengeben, Zakat genannt. So kamen meine Verwandten und brachten mir ihre Almosengelder, damit ich sie an die Bedürftigen weitergab. Mit diesem Geld ging ich sehr verantwortungsvoll um und führte Buch darüber, was ich von wem erhalten und an wen weitergegeben hatte. Von Kindheit an erhielt ich deshalb zu meinem Vornamen Beinamen wie Ibrahim Effendi oder Ibrahim Bey, die Respekt ausdrückten, den die Menschen mir gegenüber empfanden.
Jugendjahre in Ägypten
Die Jahre 1952 bis 1956 waren für die politische Zukunft Ägyptens von großer Bedeutung und von Unruhen in der Bevölkerung sowie zahlreichen Demonstrationen in den Straßen von Kairo begleitet. 1952 stürzten oppositionelle Offiziere den ägyptischen König Faruk. Ein Jahr später wurde die Republik ausgerufen und 1954 wurde Oberst Abdel Nasser Staatspräsident. Die junge Republik blieb aber unter starkem Einfluss der Briten, die ihre Truppen beiderseits des Suezkanals konzentriert hatten. Im gleichen Jahr erreichte Nasser die vertragliche Zusicherung Großbritanniens, sich vom Suezkanal und damit aus ganz Ägypten zurückzuziehen, was aber erst 1956 wirklich geschah. Bis dahin wehrten sich die Ägypter gegen die zunehmende Korruption und die Ungerechtigkeiten seitens der britischen Herrscher. Diese politisch unruhige Zeit erlebte ich in Kairo hautnah mit, hörte vom Zusammenprall der ägyptischen Polizei mit dem englischen Militär, als hundert Polizisten am Suezkanal erschossen wurden und die Menschen anschließend empört auf die Straße gingen. 1952 brannte Kairo, weil aus Protest viele ausländische und insbesondere britische Geschäfte angezündet wurden. Die Schüler der Oberstufen bekamen schulfrei, um an den Demonstrationen teilnehmen zu können.





























