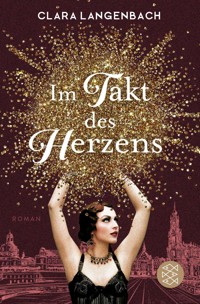9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Senfblütensaga
- Sprache: Deutsch
Das große Finale der Senfblütensaga! Düsseldorf 1920: Nach der überstürzten Flucht aus Metz müssen Emma und die Familie Seidel ihre Existenz neu aufbauen. Doch als Flüchtlinge sind sie nirgends gern gesehen. Das Wertvollste, was Emma besitzt, sind Carls Pläne für Senfmaschinen. Aber wie soll sie ohne ihn den Betrieb wieder aufbauen? Emma bleibt nichts anderes übrig, als auf die Gnade ihrer Eltern zu hoffen. Ihre Mutter sieht in der Notlage der Seidels eine wunderbare Chance, sich an der Familie zu rächen. Wird es Emma gelingen, sich in der Gesellschaft zu behaupten, die sich gegen sie verschworen hat? Ihre Lage scheint aussichtslos zu sein. Bis jemand aus ihrer Vergangenheit wieder auftaucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Clara Langenbach
Hoffnung im Herzen
Die Senfblütensaga 3
Roman
Über dieses Buch
Düsseldorf 1920: Nach der überstürzten Flucht aus Metz müssen Emma und die Familie Seidel ihre Existenz neu aufbauen. Doch als Flüchtlinge sind sie nirgends gern gesehen. Das Wertvollste, was Emma besitzt, sind Carls Pläne für Senfmaschinen. Aber wie soll sie ohne ihn den Betrieb wieder aufbauen? Emma bleibt nichts anderes übrig, als auf die Gnade ihrer Eltern zu hoffen. Ihre Mutter sieht in der Notlage der Seidels eine wunderbare Chance, sich an der Familie zu rächen. Wird es Emma gelingen, sich in der Gesellschaft zu behaupten, die sich gegen sie verschworen hat? Ihre Lage scheint aussichtslos zu sein. Bis jemand aus ihrer Vergangenheit wieder auftaucht …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Clara Langenbach liebt Geschichten, die im Alltäglichen stecken. »Die Senfblütensaga« ist inspiriert vom wahren Leben einer Firmengründerin Anfang des 20. Jahrhunderts. In dieser hinreißenden Trilogie verknüpft die Autorin ihre Leidenschaft für historische Stoffe und Liebesromane mit kulinarischem Genuss und erfüllte sich so einen eigenen Traum.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Ulla Mothes
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Arcangel/Magdalena Russocka und www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491308-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Triggerwarnung:
In diesem Roman wird an einzelnen Stellen sexualisierte Gewalt geschildert. Physische und psychische Gewalt, Tod, Trauerbewältigung und posttraumatische Belastungsstörungen kommen u. a. im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg vor. Im historischen Kontext werden zudem Diskriminierung und diskriminierender Sprachgebrauch sichtbar. Dies betrifft die Themen Ableismus, Antisemitismus und Rassismus.
Für meinen Vater, der mir die Liebe zum Lesen und Schreiben geschenkt hat. Ruhe in Frieden.
Teil Eins
Speyer, 1918
EMMA
Die Arme um die Schultern geschlungen, machte Emma ein paar Schritte auf die ausladende Treppe zu, die zum großen Eingangsportal führte. Sogleich verzog sich ihr Gesicht vor Kälte. Trotz bequemen Schuhwerks hatte sie sich die Zehen und Fersen wund gerieben. Wind und Regen peitschten unaufhörlich auf sie ein, und schon nach wenigen Sekunden war sie vollkommen durchnässt. Dennoch kreiste nur ein Gedanke in ihrem Kopf: Sie hatten es geschafft! Ihre Flucht aus Metz hatte ein Ende gefunden. Ihr Blick strich über die weiße Fassade des Herrenhauses. Das warme Licht hinter den großen Bogenfenstern lockte mit seiner Gemütlichkeit. Nur wenige Stufen trennten sie von trockenen Räumlichkeiten, einem heißen Bad und sauberer Kleidung. Und doch kam es ihr nach den langen Strapazen unwirklich vor.
»Ist alles in Ordnung?« Neben ihr tauchte Louise auf. Regenbäche liefen über ihr Gesicht. Das nasse Haar klebte ihr am Kopf und an den Wangen, die ihre Rundlichkeit verloren hatten. Ihr Kinn bebte, obwohl sie alles daranzusetzen schien, nicht zu sehr mit den Zähnen zu klappern.
»Ja, natürlich«, erklärte Emma rasch. »Es ist nur …« Sie verstummte. Plötzlich fühlte sich ihre Kehle ganz wund an, und jeder Ton schien sie noch mehr aufzureiben. Sie starrte auf die große, mit Ornamenten verzierte Eichentür, und es kam ihr vor, als hätte eine Pranke ihre Brust gepackt und würde die Luft aus ihrer Lunge herauspressen. Was sollte sie sagen? Wie konnte sie nur erklären, dass sie es einfach nicht schaffte, die Stufen emporzusteigen und die Hausglocke zu betätigen?
»Emma?« Louise stupste sie sanft an.
Sie sollte stark sein. Diese Familie brauchte sie!
Stattdessen reichte Louises leichte Berührung aus, um sie zu Fall zu bringen. Ihre Knie gruben sich in den Kies der Einfahrt, sie krümmte sich, während sie mit den Händen ihre Schultern noch fester umarmte. Sie schlotterte, während sie unter dem geißelnden Regen weinte, so sehr weinte, dass sie darin zu ertrinken glaubte.
Schnelle Schritte. Antoine kniete sich neben sie. Sie sah ihn nicht, aber sie fühlte seine Präsenz. Noch immer lauerte etwas Dunkles, Bedrohliches darin, obwohl Emma mit ganzer Kraft versuchte, dieses Gefühl abzustreifen.
»Was ist passiert?« Seine Stimme klang fern und hohl, aber genauso besorgt wie die von Louise. Ehrlich besorgt. Er spielte ihr nichts vor. Und dieser Umstand war am schwersten zu ertragen, denn gegen seine tiefe Aufrichtigkeit war sie nicht gewappnet. Es machte sie nur verletzlicher.
»N-nicht … nicht anfassen …«, wimmerte sie, obwohl sie am liebsten losgebrüllt hätte. Wie sollte sie nur weitermachen? So tun, als wäre nichts passiert? Nach vorn blicken und alles hinter sich lassen?
»Emma«, flehte Louise, zitternd und völlig durcheinander. »Was ist nur los mit dir?«
Immer noch weinend, hob Emma den Kopf und schaute abermals zur Tür. Da wartete eine neue Welt auf sie. Ein neues Leben. Ein Leben ohne Carl.
»W-wie … wie soll er uns finden?« Sie verstand ihre eigenen Worte kaum, so sehr versanken sie im Wind und plätschernden Regen. »Wenn wir hier sind und nicht in Metz? Was ist, wenn er … wenn er … doch noch zurückkommt?« Alles in ihr zog sich zusammen. Ihr eigener Körper wie ein Gefängnis, das sie im Hier und Jetzt hielt, während Carl … während Carl fort war.
Denn er würde nicht zurückkommen. Er würde niemals zurückkommen.
Carl und Emma. Emma und Carl.
Hier, an dieser Schwelle, war sie nur noch Emma.
»Bleib bei ihr«, murmelte Louise, trat auf die Tür zu und klingelte. Emma zuckte zusammen, richtete sich auf den Knien auf und starrte fassungslos den Eingang an. Schluchzend wischte sie sich über das Gesicht, auch wenn der Regen ihre Tränen längst weggespült hatte. Trotzdem schaffte sie es nicht hochzukommen. Was würde ihr Onkel nur über sie denken? Antoine stellte sich vor sie und schirmte sie ab, als die Tür sich öffnete.
»Sie wünschen?«, tönte eine nasale Frauenstimme, hoch und unangenehm abweisend.
»Emma Seidel«, behauptete Louise unbeeindruckt. »Geborene Bergmann. Mir ist klar, dass es nicht die passende Zeit für einen Besuch ist, aber wir müssen dringend den Hausherrn sprechen.«
Stille dehnte sich aus bis ins Unendliche. Nur der Regen rauschte und verschluckte jedes andere Geräusch.
»Einen Augenblick«, kam es zurück. Tippelnde Schritte entfernten sich.
Emma schnappte nach Luft, um die Ketten zu sprengen, die ihre Brust zusammengezurrt hatten. Sie musste hoch. Irgendwie auf die Beine kommen.
Als hätte Antoine es gespürt, drehte er sich zu ihr um und reichte ihr die Hand. Sie beachtete ihn nicht. Noch immer schien es ihr vollkommen abstrus zu sein, dass er da war. Aus Fleisch und Blut vor ihr stand. So lebendig! Während die Zeilen seines Briefes vor ihren Augen herumhüpften: Wenn du das liest, bin ich vermutlich tot. Aber du bist nicht tot, hätte sie am liebsten losgeschrien. Carl ist es, der tot ist! Carl! Warum … warum … ausgerechnet Carl?
Seufzend ließ Antoine seinen Arm sinken. Enttäuschung flog über seine Züge. Aber auch Verständnis – nichts anderes hatte er erwartet. Es war Louise, die Emma packte und auf die Beine zog. »Hier draußen holen wir uns nur den Tod. Wir müssen die Sache schnell klären und die anderen ins Warme bringen.« Sie deutete zum Laster, der neben einer überdimensionierten Marmorschale mit aus Stein gemeißelten Bonbons parkte. Bergmanns bunte Mischung verhieß die eingravierte Inschrift.
Das Dienstmädchen hatte die Tür offen gelassen. Also schleppte Louise Emma einfach über die Schwelle. Ihre ausgelatschten Schuhe hinterließen matschige Abdrücke auf dem polierten Boden, die nassen Kleider tropften regelrechte Pfützen voll.
Emma wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber es reichte, um sich wieder zu fassen. In der Luft lag der fruchtig-minzige Duft, der Onkel Johann überallhin begleitete. Der Geruch nach Bonbons und Frische-Pastillen hatte sich tief in diesen Wänden eingenistet. Woran ihr Onkel wohl gerade tüftelte? Unwillkürlich sah sich Emma nach Kristallschalen um, die früher überall gestanden hatten und mit den neuesten Kreationen zum Naschen verführten. Konnte aber keine entdecken.
Auf der Treppe raschelte es. Emmas Blick schnellte hoch. »Tante Mathilde!« Insgeheim hatte sie gehofft, ihren Onkel zu sehen. Mit ihm zu sprechen, fiel ihr tausendmal leichter, als sich vor Mathilde Bergmann zu rechtfertigen, warum sie ohne jegliche Vorwarnung auf ihrer Schwelle aufgetaucht war. Diese Frau hatte nie einen Hehl daraus gemacht, wie wenig sie von der Verwandtschaft ihres Mannes hielt. »Bitte entschuldige den überraschenden Besuch.« Ihre Stimme zitterte immer noch von dem plötzlichen Weinausbruch. Aber mit etwas Glück führte ihre Tante das vielleicht bloß auf das Unwetter da draußen zurück. »Mir ist klar, dass es nicht gerade die passende Zeit …«
»Ersparen wir uns die Höflichkeitsfloskeln. Was willst du?«
Nur schwer fand Emma die Sprache wieder. Diese Frau hatte schon immer eine furchteinflößende Wirkung auf sie gehabt. Wie so oft fühlte sie sich klein und unerwünscht unter diesem strengen Blick.
»Ist Onkel Johann zu Hause?« Sie merkte selbst, wie fiepend sie klang.
»Dein Onkel ist tot.«
Emma taumelte. Als würde der Boden unter ihren Füßen einbrechen. »Tot? Was …« Sie schluckte krampfhaft. »Was ist passiert?«
»Die Seuche ist passiert!«, schnitten Mathildes Worte in sie ein. »Vor zwei Wochen ist er gestorben. Kurz nach Kitty und Henny.«
Kitty. Henny. Sie sah ihre Cousinen. Lachend und wild herumtobend zwischen den Bäumen des heimischen Gartens. Früher – da waren sie unzertrennlich gewesen. Und jetzt …
… jetzt gab es sie nicht mehr.
»Und Betty?« Sie knetete ihre Finger. O mein Gott, Betty, war sie denn wenigstens wohlauf? Egal, wie sehr sie sich im Verlauf der Zeit voneinander entfernt hatten – so einen Schicksalsschlag hatte keine Familie verdient!
»Ihr Mann ist ein Politiker in Berlin. Einer dieser Sozialisten.« Mathilde Bergmann kniff den Mund zusammen. Ihre dünne Hand krallte sich in das Geländer wie eine Vogelklaue. »Wir haben keinen Kontakt.«
Emma spürte, wie ihre Beine ganz schwach wurden, wie sehr sie zitterte und wie eine neue Welle der Verzweiflung anrollte, der sie nichts entgegenzubringen vermochte. Ein Glück, dass Louise da war und sie sich an ihrer Schwägerin abstützen konnte. Wie unter Wasser hörte Emma Louises Erklärungen, sachlich und knapp berichtete die junge Frau über ihre Odyssee: Metz, Franzosen, die Flucht im klapprigen Laster, den nur ein Wunder so lange zusammengehalten hätte. Die Bilder rauschten wie eine Lawine durch Emmas Verstand. Unaufhaltsam. Erschütternd. Als würde sie alles von neuem erleben: den Einmarsch der französischen Truppen, die von den alteingesessenen Lothringern mit Jubelrufen und Marseillaise-Gesängen empfangen wurden. Die Angst der Altdeutschen um das eigene Wohl und die Sicherheit ihrer Liebsten. Wie ihr Schwiegervater Ehrhard in der Senffabrik zusammengeschlagen worden war. Das waghalsige Unternehmen, den Laster zu klauen, in dem sie innerhalb von vierundzwanzig Stunden aus der Stadt fliehen mussten.
Jetzt waren sie da.
In der Hoffnung, einen Unterschlupf zu finden.
Als Louise verstummte, wurde es still. So still, dass es Emma erneut die Kehle zuschnürte. Warum sagte ihre Tante nichts?
Entschieden löste sich Emma aus Louises Griff und trat vor. »Wir wissen einfach nicht, wohin. Onkel Johann …«
»Wie du gerade gehört hast, ist Onkel Johann tot«, unterbrach Tante Mathilde sie. Ihre drahtige Gestalt wirkte wie aus Stein gemeißelt. Und diese Augen … Es kam Emma vor, als hätte der Verlust jegliches Gefühl darin ausgehöhlt und nichts Lebendiges mehr hinterlassen. »Dieses Haus hat schwere Zeiten hinter sich. Du hast sicherlich Verständnis dafür, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen können.«
»Bitte!« Das Flehen pulsierte in Emmas Hals. »Wenigstens für einen Tag! Für ein paar Stunden!«
Tante Mathilde schnaubte. »Meinst du wirklich, du kannst hier auftauchen und von mir fordern, dich und …«, sie deutete auf Louise und Antoine, »… und deine Bagage da zu umsorgen?«
Die Worte fühlten sich wie eine Ohrfeige an. Emma taumelte zurück. Es hatte keinen Sinn, an Mathildes gutes Herz zu appellieren, denn dieses Herz war gebrochen. Tief in ihrem Innern konnte sie ihre Tante sogar verstehen. Denn auch in ihrer eigenen Brust war nichts außer Scherben, die sich in ihre Seele bohrten und höllisch weh taten. Sie beide hatten so viel verloren. Die Welt schien nur noch aus Trümmern zu bestehen. Und wenn sie unter der Last zusammenbrachen, die auf ihnen lag, würden sie nie mehr hochkommen. »Ich weiß, wie es ist, vor Trauer wie betäubt zu sein. Keine Kraft mehr aufbringen zu können, um nach vorn zu blicken und weiterzumachen. Ich kenne den Schmerz, den du fühlst!«
»Du kennst meinen Schmerz? Wie kannst du es wagen!«, schnaubte Tante Mathilde bitter. Zorn loderte in ihren Augen auf. Also war sie doch noch zu Gefühlen fähig. Auch wenn diese Gefühle sie zu Asche zu verbrennen schienen.
»Auch ich habe meinen Mann verloren!«, rief Emma aus, und etwas riss in ihrer Seele. Eine Wunde, die nie ausheilen würde. Und der Schmerz, von dem sie gesprochen hatte, fuhr in jede Faser ihres Körpers. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, was sie da gerade gesagt hatte. Laut und aus ihrem tiefsten Innern heraus. Und plötzlich wurde aus Worten Wirklichkeit, die mit der ganzen Unbarmherzigkeit auf sie einstürzte.
Hilfesuchend sah sie zu ihrer Tante. Wie schaffte man es nur, daran nicht zu zerbrechen? Bitte! Sag mir, dass man die Hoffnung nicht verlieren darf. Dass irgendwann ein Tag anbricht, an dem es sich ein wenig leichter anfühlt, es zu ertragen.
Steif und mit kerzengeradem Rücken stieg Mathilde Bergmann ein paar Stufen hinunter.
»So, du hast deinen Mann verloren? Deine zwei Töchter auch? Ich glaube nicht.« Kühl und ohne jegliche Bedeutung hallten die Worte von den hohen Wänden wider. »Also erzähl mir nichts davon, was du da verstehst. Denn du verstehst rein gar nichts! Und jetzt raus hier.« Ruckartig wandte sie sich ab, im Begriff wegzugehen.
»Nein, warte!« Emma rang um Worte, Gefühle, um die letzten Funken ihres Verstandes, die noch nicht vollends in der Verzweiflung versunken waren. »Wilhelmine hat Fieber, sie muss ins Trockene. Und Louises Sohn ist völlig erschöpft. Er ist doch noch ein Kind!«
»Geht!«, warf Tante Mathilde ihr knapp zu, als fürchtete sie, allein mit dem Wort »Fieber« würde sich die Seuche wieder Zutritt zu diesem Haus verschaffen. »Hier gibt es keinen Platz für euch.«
»Aber wo sollen wir hin?« Verzweiflung schlug in ihr hoch und drohte, sie vollkommen zu übermannen. Verzweiflung bis zur Besinnungslosigkeit. Stumm drückte Louise ihre Hand, doch was half das schon, wenn sie gleich zurück in den Regen mussten. Um ohne jegliches Ziel den klapprigen Laster durch die Straßen zu jagen.
Tante Mathilde zuckte die Schultern. »Du hast deine Eltern. Sie sind dazu da, sich um dich zu kümmern.«
Ihre Eltern … Alles, nur nicht das! Hatte sie es laut ausgesprochen?
»Ich lasse dir die Adresse geben«, kam es trocken zurück. Dann stieg Mathilde Bergmann die Stufen hoch.
Eine Weile glaubte Emma, im Nichts zu schweben.
Bis die Stimme des Dienstmädchens sie aus der Trance herausholte. »Die Adresse.« In der Mitte des Tabletts, das sie in der Hand balancierte, lag ein Kärtchen. »Und jetzt verlassen Sie bitte unverzüglich das Haus.«
Emma schaffte es kaum, sich zu rühren. Die Schwermut legte sich über sie wie ein dunkler Mantel, der sie niederdrückte. Nur verschwommen sah sie, wie Antoine seine Hand ausstreckte und das Kärtchen vom Tablett pflückte. Was machen wir jetzt?, pochte es in ihren Schläfen. Doch ihr Kopf gab absolut nichts her. Sie stand vollkommen neben sich und beobachtete schon fast unbeteiligt die Situation, zu der sie nicht gehören wollte. Unmöglich konnten sie zu ihren Eltern fahren und die beiden um Gnade anflehen. Nicht nach dem, was passiert war. Niemals würde ihre Mutter die Schmach in der Kirche vergessen, und Emma schaffte es nicht einmal, sich vorzustellen, auf welche Weise Käthe Bergmann es ihnen allen heimzahlen würde, sollte sie die Gelegenheit dazu bekommen.
»Komm jetzt.« Louises Arm legte sich um Emmas Schultern. Aus dem ersten Impuls heraus wollte sie ihn abschütteln, doch Louise ließ es nicht zu. »Hier können wir nicht bleiben.«
Sanft, aber bestimmt wurde Emma über die Schwelle geschoben. Wie ein eisiger Schwall ergoss sich der Regen über sie. »Was sollen wir nur tun?«, stammelte sie vor sich hin, während ihre Lippen zitterten. Ihr Kopf war leer.
»Wir sind die Seidels. Zusammen stehen wir alles durch, Emma.« Der Griff um ihre Schultern wurde eine Spur fester. »Absolut alles, hörst du? Etwas anderes darfst du nicht denken!«
Sie ließ sich weiterführen, verfluchte sich dafür, dass sie es sich erlaubte, so schwach zu sein, und konnte nichts dagegen tun. Alles um sie herum schien zu bröckeln. Rieselte ihr durch die Finger wie Sand. Zerrüttete ihre Seele.
Schon standen sie beim Laster. Antoine drehte das Kärtchen vor ihrer Nase. »Weißt du, wo das ist?«, fragte er sanft, doch die Zeilen zerflossen vor ihren Augen. Vielleicht hatte der Regen das Papier schon zu sehr aufgeweicht. »Du kennst dich hier besser aus als wir. Meinst du, du schaffst es, uns hinzuleiten?«
Louise scheuchte ihn in Richtung Fahrertür, ohne auf die Antwort zu warten. »Sonst fragen wir einfach nach dem Weg. Los jetzt! Ich sehe nach meiner Mutter. Emma? Fahr du vorne.« Sie schob Emma noch ein Stück weiter zum Laster, dann drehte sie sich schwungvoll um und ging nach hinten.
Emma sah ihrer Schwägerin hinterher. Insgeheim fragte sie sich, woher diese Frau die Kraft nahm, weiterzumachen. Trotz allem, was ihr Leben so gewaltig durcheinandergewirbelt hatte. Sogar als der totgeglaubte Antoine vor ihr gestanden hatte, war sie damit umgegangen, als wäre es nur ein Punkt auf ihrer Liste, der eingeordnet und abgehakt werden musste. Unbeirrt tat Louise, was getan werden musste. Traf Entscheidungen für sich und Frederick und beachtete Antoine recht wenig, der die meiste Zeit schweigsam blieb. Ein wenig konfus sogar. Als wüsste er nicht wirklich, wo er seinen Platz suchen sollte und ob es die richtige Entscheidung gewesen war, zurückzukommen.
Emma hatte nichts gefragt – seit er wieder aufgetaucht war, hatten sie kaum eine Handvoll Worte miteinander gewechselt. Sein letzter Brief stand zwischen ihnen, die Zeilen, die sie noch immer aufwühlten, sobald sie daran dachte. Und noch viel mehr. Es fiel ihr so unglaublich schwer, seine Anwesenheit zu ertragen. Aber er war nun einmal da, und sie musste es akzeptieren.
Über die Umstände seiner Rückkehr hatte sie nur nebenbei etwas von Louise mitbekommen. Ihre Schwägerin hatte berichtet, dass Antoine wohl eine schlimme Lungenentzündung durchgemacht hatte. Dass es zeitweise schlecht um ihn stand, wirklich schlecht, dass er geglaubt hatte, die Krankheit nicht zu überstehen. Doch er hatte es geschafft, war als dienstunfähig entlassen worden und genau im richtigen Moment im Seidel’schen Park erschienen, um sie alle auf ihrer überstürzten Flucht zu begleiten.
Unwillkürlich schauderte es Emma bei dem Gedanken, dass er es immer irgendwie schaffte, in ihrem Leben aufzutauchen. Dass ihre Wege sich unweigerlich kreuzten, auch wenn die Welt um sie herum auseinanderbrach. Während Carl und sie sich ständig zueinander hingekämpft hatten, nur damit er doch noch von ihr losgerissen wurde. Wie viel Schicksal verträgt ein Leben?, fragte sie sich im Stillen. Vor allem: ihr Leben. Lohnte es sich überhaupt noch, stark zu sein, weiterzumachen, auf etwas zu hoffen, das ihr sowieso niemals zurückgegeben werden konnte?
Schwerfällig kletterte Emma in die Kabine. Der Sitz machte ein schmatzendes Geräusch, als sie sich in ihrer durchnässten Kleidung darauffallen ließ. Die Feuchtigkeit verstärkte den Geruch der rissigen Polster, den Gestank nach Motoröl und Kraftstoff. Wie sie selbst roch, vermochte sie sich nicht einmal vorzustellen.
Antoine kletterte hinter das Lenkrad und steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel, die er nicht anzündete. Diese neue Gewohnheit hatte Emma schon mehrfach bei ihm beobachtet. Dabei war er früher doch immer bereit gewesen, seine Mitmenschen in Tabakdunst einzuhüllen. Gehörte das zu seinem neuen Ich, das er so offensichtlich zur Schau stellte? Trotzig kramte Emma herum und reichte ihm ein Messingfeuerzeug. Es hatte die Form eines Geschosses. Sie fasste es sehr ungern an, aber jetzt wollte sie einfach nur, dass Antoine mit seinen Spielchen aufhörte. Was auch immer er mit dieser Schau bezweckte.
»Bitte sehr«, murmelte sie und ließ die kleine Flamme auflodern.
Erschrocken starrte er auf ihre Hand. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich rauche nicht.«
»Seit wann?«, gab sie trocken zurück. Nein, er brauchte ihr nichts vorzumachen! Sein Verzicht auf Alkohol, seine permanente Fürsorge … Als könnte sie je vergessen, was für ein Mensch er wirklich war. Es ärgerte sie, dass er anscheinend glaubte, die Vergangenheit wie ein gelesenes Buch zuklappen zu können, um eine neue Geschichte zu beginnen.
»Seit meiner Krankheit, die mir quasi nur noch eine halbe Lunge gelassen hat.« Verlegen rieb er die Lippen aufeinander. »Na ja, vielleicht ist es ein wenig übertrieben. Anscheinend habe ich immer noch einen Hang zum Drama. Aber meine Lunge ist zu sehr angegriffen, als dass ich sie mit dem Rauchen noch weiter kaputtmachen kann.«
Sie ließ die Flamme erlöschen und senkte die Hand. »Wozu dann die Zigarette?« Mit einem knappen Kopfnicken deutete Emma auf den Stängel, der zwischen seinen Lippen tanzte.
»Ist etwas Vertrautes. Beruhigt ungemein.«
»Ja, einen Hang zum Drama hast du gewiss.« Langsam wandte sie den Blick ab. Der Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe und lief in Bächen hinunter. Dazu mischten sich einige Schneeflocken, die augenblicklich am Glas schmolzen. »Wir sollten fahren. Bald wird es ganz dunkel.«
Sie wusste nicht, warum sie das sagte. Zu welcher Uhrzeit sie bei ihren Eltern ankommen würden, konnte kaum etwas am rauen Empfang ändern, mit dem sie insgeheim rechnete. Es grauste ihr, ihnen unter die Augen treten zu müssen, sich zu erklären und um ihre Gunst zu betteln. Ein Schritt, der ihr um einiges schwerer fallen würde als bei Tante Mathilde.
Antoine startete den Motor. Trotzdem spürte Emma, dass er sie noch immer aus den Augenwinkeln betrachtete. Und obwohl sie es gern bestritten hätte, fühlte es sich anders an als sonst. Nicht mehr so eindringlich wie früher, als sie das Gefühl hatte, er würde sie mit Haut und Haaren verschlingen wollen. Oder sie am liebsten Stück für Stück ausziehen.
Der Wagen setzte sich in Bewegung. Emma versuchte, sich auf die Straße zu konzentrieren, um sich in der hereinbrechenden Dunkelheit zurechtzufinden. Erklärte den Weg, um von der seltsamen Stimmung in der Kabine abzulenken. Diese Atmosphäre gefiel ihr nicht. Sie zeigte ihr, dass alle um sie herum irgendwie weitergezogen zu sein schienen. Während sie zurückblieb.
»Es tut mir leid.« Antoines Stimme ließ sie zusammenzucken.
Ihre Finger verkrampften sich um das Feuerzeug, das sie noch immer in der Hand hielt. »Was genau?« Ihre eigenen Worte kamen ihr rau und unbeholfen vor. Dabei war er der letzte Mensch, der ihre Verletzlichkeit bemerken sollte.
»Meine Besessenheit von dir. Die Übergriffigkeit. Dieser Brief … Emma, ich kann mir nicht ausmalen, was dieser Brief angerichtet hat … Zugegeben, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Natürlich könnte ich mich damit herausreden, dass ich zu krank war, um mir über irgendetwas Gedanken zu machen. Aber vielleicht zeigen gerade diese Deliriumsmomente, wer wir wirklich sind. Und als mein Kopf wieder richtig zu funktionieren begann, ist mir klargeworden, dass ich so nicht sein will. Ich kann nicht meiner Vorstellung vom Leben nachlaufen. Ich muss anfangen zu leben. Für mich selbst.«
»Schluss jetzt!« Sie presste sich eine Hand an den Mund. War es zu spät, doch noch mit Louise zu tauschen? Oder einfach so nach hinten auf die Ladefläche des Lasters zu flüchten? Denn seine Worte trafen sie wie ein Schlag in die Magengrube. Auch sie tat nichts anderes, als einer Vorstellung vom Leben nachzulaufen, seit Carl gegangen war.
Sie wollte, dass er aufhörte, all das zu sagen, was so wahr war.
»Menschen ändern sich, Emma. Ich habe mich geändert.«
»Und deshalb ist alles vergessen und verziehen?«
»Nein.« Ein Wort wie ein Hauch. So leise hatte sie ihn noch nie sprechen gehört. So bedrückt und … irgendwie von sich selbst beschämt. »Ich kann nicht erwarten, dass alles vergessen und verziehen ist. Ich kann nur um Entschuldigung bitten. Und hoffen, dass die Menschen, denen ich Unrecht angetan habe, diese Entschuldigung irgendwann zumindest akzeptieren. Was geschehen ist, kann man nicht mehr ungeschehen machen, das ist mir bewusst.«
Änderten sich Menschen wirklich? Verbittert presste sie die Lippen zusammen. Vielleicht war es nur ein neuer Trick, endlich das zu bekommen, was er wollte. Jetzt, da Carl ihm nicht mehr im Weg stand.
Zusammen mit den Tränen stieg Übelkeit in ihr hoch. Sie glaubte, ihr Spiegelbild sehen zu können. So verkniffen, wie sie da kauerte und vor sich hin starrte mit einem leeren Blick – wann war sie zu Tante Mathilde geworden, die die Welt von sich abprallen ließ, damit nichts mehr an sie heranreichte, was sie irgendwie berühren und an ihren Verlust erinnern konnte?
»Es ist ein langer Weg«, hörte sie ihn sagen und fragte sich, ob er den Weg zu ihren Eltern meinte. Oder sich selbst und seine Hoffnung darauf, dass sie ihm verzieh. Konnte sie es? Ihm irgendwann verzeihen? Oder war ihr Herz zu gebrochen, und es gab längst keine Hoffnung mehr darin?
Emma schloss die Augen und lehnte den Kopf an die Scheibe. Das Prasseln des Regens beruhigte nach und nach ihr Gemüt. Was dieser Weg ihnen allen auch brachte – sie mussten ihm wohl weiter folgen. Ob sie es wollten oder nicht. Ihre Gedanken wurden träge. Sie spürte die Kälte, die sich immer tiefer in sie fraß. Die Dunkelheit, die sie umschloss. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sich mühsam durch eine zähe Masse zu kämpfen, obwohl ihre Bewegungen langsamer und langsamer wurden. Bis sie kaum noch vorankam. Du kannst nicht verzeihen … Die Stimme kroch in sie hinein wie unzählige Spinnen, die mit ihren haarigen Beinchen nach ihrer Seele tasteten. Aber hast du dich je gefragt, ob ich dir verzeihen werde? Ein Gesicht schälte sich aus der Dunkelheit. Aschfahl und mit tot dreinblickenden Augen. Sommersprossen wie Leichenflecken. Schmale, blutleere Lippen, wie beim letzten Atemzug leicht geöffnet.
Sie schrie …
»Emma! Emma, hörst du mich? Wir sind da.«
Emma riss die Augen auf. Verwirrt blinzelte sie umher, am ganzen Leib zitternd. Carl suchte sie heim. Niemals würde er ihr verzeihen, seine Fabrik verloren zu haben. Wie auch? Wenn alles, was er erschaffen hatte, was in dieser Welt an ihn erinnern konnte, buchstäblich ausradiert worden war?
»Emma, geht es dir nicht gut?«, hörte sie Antoines erschrockene Stimme.
Sie riss die Tür auf und stürzte nach draußen. Louise kam bereits um den Laster herum, fing sie auf. Verzweifelt schlang Emma die Arme um ihre Schwägerin, drückte sie so fest, wie sie nur konnte, an sich.
»Ach du meine Güte, was ist nur passiert?«
»Ich … Es ist nur …« Sie war bloß weggedämmert. Was sie gesehen hatte, war nicht echt! Und doch weigerte sich ihr Verstand, es zu begreifen.
Antoines Schritte tönten.
»Hast du nicht gesagt, du willst nur mit ihr reden?«, zischte Louise wütend. »Was hast du schon wieder angestellt, dass sie so völlig aufgelöst aus dem Wagen stürzt?«
»Er hat nichts gemacht«, murmelte Emma.
»Scht.« Vorsichtig strich Louise ihr über den Rücken. »Ich bin da. Wir alle sind für dich da.«
Emma schmiegte sich noch etwas mehr an die junge Frau. »Lass mich nicht allein«, murmelte sie in ihren Hals.
»Niemals. Was auch immer kommt – wir stehen es zusammen durch, hörst du mich?«
Emma nickte. Sie hatten es so weit geschafft! Irgendwie würden sie den Rest auch schaffen. Sie musste sich endlich zusammenreißen! Diese Menschen zählten auf sie.
Vorsichtig wandte sie sich aus der Umarmung. Jetzt hing alles von ihr ab. Sie musste es schaffen, ihre Mutter davon zu überzeugen, sie alle aufzunehmen. Denn noch länger würde es niemand von ihnen in diesem Laster aushalten. Wilhelmine am allerwenigsten.
Sie schaffte ein paar steife Schritte, um zu sehen, wie Antoine seinen Sohn von der Ladefläche hob und ihn am Bürgersteig hinstellte. Wie immer presste der Junge Gusti an seine Brust und versuchte, sie mit seiner Jacke vom Regen abzuschirmen. Ein bisschen so, wie Émile Perrin es getan hatte, wenn er die Katze in seinen Schal einkuschelte und sich mit ihr auf die Bank vor seinem Buchladen setzte.
Scharf saugte Emma die Luft ein. Zu qualvoll waren die Gedanken an den Mann, der ihr wie ein Vater gewesen war. Nie wieder würde sie seine Stimme mit dem französischen Akzent hören. Oder den Duft nach frischbedruckten Seiten und Kamillentee einatmen, der ihn stets umgeben hatte. Émile, Ehrhard … Carl. Zu viele, die nicht mehr da waren. Ohne dass sie etwas dagegen hätte machen können. Oder doch? Hätte sie ihre Liebsten besser beschützen sollen? Ehrhard nicht erlauben, sie in die Fabrik zu begleiten … Carl und Émile von diesem wahnsinnigen Unternehmen abhalten … War es ihre Schuld? Und wenn nicht – warum fühlte es sich dann so an?
Antoine nahm Wilhelmine in die Arme und drückte behutsam ihren geschwächten Körper an sich. Ihr Kopf mit den wirren grauen Haaren sank vertrauensvoll an seine Schulter. Er neigte sein Gesicht zu ihr und schien ihr etwas zuzuflüstern, während er sie fest in seinen Armen hielt. Es ging ihr deutlich schlechter als noch heute früh. Bange fragte sich Emma, ob ihre Schwiegermutter überhaupt bei Besinnung war, und atmete erleichtert auf, als sie merkte, wie Wilhelmine auf irgendeine Frage Antoines hin nickte.
Sie mussten sofort ins Trockene!
Als hätte diese schwache Geste ihr Antrieb gegeben, marschierte Emma ins Treppenhaus. In der Dunkelheit, die sie empfing, fiel es ihr schwer, das beklemmende Gefühl loszuwerden, das sie befiel. Es roch streng nach Urin und gekochtem Kohl. Dazu mischte sich ein modriger Geruch alter Wände, die bestimmt voller Schimmel waren. Normalerweise würde ihre Mutter nicht einmal in die Nähe solcher Häuser kommen. Aber die schwierigen Zeiten hatten offensichtlich auch sie gezwungen, die Ansprüche den Umständen anzupassen.
Emma stieg die Stufen hoch. Ihre Schritte hallten durch das ganze Haus. Zum Glück war es nicht weit, ihre Eltern bewohnten das erste Stockwerk. Appartement Nr. 5, stand auf dem Kärtchen, auch wenn es Emma absurd vorkam, dass man die Bleiben in diesem Haus als Appartement bezeichnete.
Dumpf trommelte ihr Herz gegen ihre Rippen, als sie an die Tür klopfte.
Auf der anderen Seite ertönte ein Grummeln. Die rostigen Scharniere quietschten, und Emma schaute durch den Türspalt in das Gesicht ihrer Mutter. Dünn, faltig, völlig abgenutzt. Die hervorstechenden Knochen schienen die Haut aufzuspannen. Die dunklen Augen waren wie in Höhlen versunken.
»Ich weiß, ich bin die Letzte, die du sehen möchtest«, begann Emma, und ihre Stimme kippte, doch sie fing sich wieder. »Wir sind in Not. Können wir … können wir drinnen reden?«
In Käthe Bergmanns Gesicht zuckte etwas. Ein Lächeln? Ihre Mutter zu deuten, war Emma noch nie leichtgefallen. Langsam kniff die Frau die Augen zusammen. Der plötzlich so wache Blick durchbohrte Emma förmlich. Mit einem Mal wirkte ihr spitzes, abgemagertes Gesicht füchsisch, als hätte sie unter einer hohen Schneedecke den Herzschlag einer Maus gewittert.
»Natürlich.« Mit dem Kinn wies Käthe Bergmann gebieterisch auf Wilhelmine. »Aber sie soll mich darum bitten.«
»Ich bin diejenige, die dich enttäuscht hat. Auf die du wütend bist. Und ich bin diejenige, die dich um Verzeihung bitten muss.« Gerade der letzte Satz hörte sich an wie der von Antoine. Nur dass seiner aufrichtiger geklungen hatte.
Ein Schnauben ertönte durch den Türspalt. »Auf wen ich wütend bin, entscheide immer noch ich. Entweder sie bittet mich darum, oder ihr verschwindet allesamt. Ich will aus ihrem Mund hören, wie sehr es ihr leidtut, mich und meinen Gatten von der Hochzeit unserer Tochter vertrieben zu haben. Und wie sehr sie hofft, dass wir anständige Menschen sind im Gegensatz zu ihrer gesamten Sippe.«
Emma ballte die Hände. Wäre sie allein dem Hohn ausgesetzt gewesen, hätte sie es ertragen können. Aber dass Wilhelmine ins Kreuzfeuer geriet, war einfach zu viel. »Wilhelmine geht es nicht gut …«
»Bitte.« Wilhelmines Lider flatterten. Kaum wahrnehmbar hauchte sie jeden einzelnen Laut – eine Anstrengung, die sie ihre letzte Kraft zu kosten schien. »Verzeih mir, Käthe. Ich hoffe von Herzen … dass du uns … hilfst.«
Die Härte in Käthes Mundwinkeln wurde noch eine Spur fester. »Damit ihr diese fremdländische Seuche in dieses Haus schleppt? Bis jetzt sind wir davon verschont geblieben.«
»Es ist nicht die Seuche!«, widersprach Emma hitzig. Auch wenn sie sich nicht sicher sein konnte. Fieber und Husten waren durchaus die Symptome, die immer mehr Menschen niederstreckten, so viel hatte sie mitbekommen. Aber die Vorstellung verbannte sie schleunigst aus ihrem Kopf. Wilhelmine würde wieder gesund werden. Wie sollte sie es ertragen, noch jemanden zu verlieren, den sie liebte?
»Was tut man nicht alles für die Familie, nicht wahr?«, säuselte Käthe hämisch. »Ich persönlich glaube eh, dass es gar keine Seuche gibt. Es sind immer noch der Krieg und das Elend, die die Menschen töten.« Sie trat beiseite.
Antoine zögerte nicht länger und trug Wilhelmine herein, bevor Käthe es sich anders überlegen konnte. Emma schlüpfte hinter ihm durch die Tür.
Die Wohnung war klein und spärlich eingerichtet. Eine Petroleumlampe auf einem einfach gezimmerten Tisch beleuchtete schwach die Wände, die mit schiefen Regalen bestückt worden waren. Eine Küchennische, eine Tür zu einem weiteren Raum, ein Schrank, der nicht ganz zuging. Als Louise und Frederick ebenfalls eintraten, war es, als könnte man sich zwischen diesen Wänden kaum noch bewegen. Die Katze krallte sich verängstigt in den kleinen Jungen, und am liebsten hätte sich Emma ebenfalls in irgendetwas festgekrallt. Aber jetzt ging es um alles! Und sie durfte weder Schwäche noch Angst zeigen.
Vorsichtig bettete Antoine Wilhelmine auf ein schmales Sofa, das unter dem Fenster stand. Emma eilte zu ihr, sank vor dem Sofa auf die Knie und prüfte Wilhelmines Fieber. Es war gestiegen. Neben einem erholsamen Schlaf brauchte ihre Schwiegermutter dringend einen Arzt. An eine Weiterfahrt war nicht zu denken.
»Nun, meine Teuerste.« Aus dem Augenwinkel sah Emma, wie ihre Mutter die Arme vor der Brust verschränkte und auf Wilhelmine herabsah. Der füchsische Ausdruck wirkte wie eine Karnevalsmaske. »Jetzt bist du drin. Dann lass uns darüber reden, wie weit deine Dankbarkeit geht, sofern du bleiben willst.«
»Mama!«
Ihr lauter Ausruf scheuchte Gusti auf. Das Tier sprang auf den Boden, huschte panisch umher.
»Ich hoffe, du verstehst, dass ich nicht einfach so Flüchtlinge aufnehmen kann«, fuhr Käthe Bergmann fort und trat nach der Katze, die an ihren Füßen vorbeiflitzte. So stark, dass Gusti unter das Sofa geschleudert wurde, wo sie erst einmal blieb, vermutlich völlig verstört in eine Ecke gedrückt. »Sieh dich um. Wir haben selbst kaum etwas. Also: Was ist?«
Wilhelmine hob eine Hand und streifte mit einer langsamen Bewegung einen Ring von ihrem Finger. Den wertvollen Ring mit einem Smaragd, den Ehrhard ihr geschenkt hatte, sobald er sich Gold und Edelsteine für seine Frau leisten konnte. Weil er dachte, der einfache Reif aus Messing würde ihr nicht gerecht werden.
Emma senkte den Blick auf ihre vernarbte Hand. Nun schmiegte sich der Messingring an ihren Finger. Und etwas Wertvolleres als dieses Kleinod, das Carl ihr in Perrins kleiner Buchhandlung auf den Finger gesteckt hatte, konnte sie sich nicht vorstellen.
Wie durch einen Nebel sah sie, wie Wilhelmine Käthe den wertvollen Ring entgegenhielt.
»Ist es weit genug, wie meine Dankbarkeit geht?« Ihre dünne Stimme brach. Länger würde sie kaum noch durchhalten. Emma betete, dass diese Farce bald enden möge, die ihre Mutter da veranstaltete.
Zufrieden betrachtete Käthe Bergmann den Ring von allen Seiten. »In Ordnung. Du kannst bleiben. Meine missratene Tochter auch, irgendjemand muss dich ja pflegen.« Sie trat an Antoine vorbei und griff nach einem Besen in der Ecke. »Aber den Franzosen dulde ich nicht unter meinem Dach.« Mit dem Stiel tippte sie Antoine gegen die Brust. »Genauso wie seinen Balg.« Sie schleuderte den Besen Louise entgegen. Die junge Frau fing ihn völlig verwirrt auf. »Und holt den Flohzirkus unter meinem Sofa hervor. Das Vieh muss weg.«
Emma keuchte. Die Stille, die sich plötzlich ausbreitete, erstickte in ihr jegliches Gefühl. Außer der grenzenlosen Ohnmacht.
»Überlegt es euch gut«, knirschte die Stimme der Mutter in ihren Ohren. »Denn mehr werde ich euch gewiss nicht anbieten.«
Frankreich, 1919
CARL
Er vermisste das Gefühl der Senfkörner zwischen seinen Fingern. So sehr, dass es seine Brust fest zusammenschnürte. Wenn er die Augen schloss, glaubte er, auf der Terrasse seiner Eltern zu stehen und in den dunklen Park zu blicken. Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass Emma da war, direkt neben ihm. Dass sie gleich nach seiner Hand greifen würde, um die winzigen Körnchen auf seine Handfläche rieseln zu lassen. Warum tust du das? Warum tust du das nur? Die Worte blieben in seiner Kehle stecken, obwohl alles in ihm sie herausschrie. Doch kein Laut durfte seine Lippen verlassen. Denn wenn er die Augen öffnete und sich umdrehte, sah er die Barackenwände des Gefangenenlagers. Und plötzlich tat jeder Atemzug, jeder Herzschlag so verdammt weh, dass er nicht wusste, wie er das noch weitere Wochen, Monate … Jahre vielleicht? … aushalten sollte.
Die Vorstellung schnürte ihm den Atem ab.
»Ey. Du!«
Carl zuckte zusammen und richtete sich auf der Pritsche auf. Sofort wusste er, dass er mit der Ansprache gemeint war. Nicht gut. Er biss die Zähne zusammen und überlegte fieberhaft, womit er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Ob er doch etwas gemurmelt hatte? Emmas Namen hervorgeflüstert hatte? Manchmal vermischten sich seine Träume, die Erinnerungen, die Realität, so dass er nicht einmal mehr seinem Verstand traute. Ruhe bewahren!
Mit einer konzentrierten Bewegung wischte er sich die Haarsträhnen zur Seite, die ihm auf der Stirn klebten, und sah in Lutz’ verkniffenes Gesicht. Na großartig. Als Feldwebel hatte der Kerl den höchsten militärischen Rang inne, wodurch er schnell zum Sprachrohr der anderen Gefangenen avanciert war. Er gab sich gern wie ein Kumpel, doch die Nettigkeiten verloren sich schnell, wenn man ihm nichts nützte. Er scharte Stiefellecker um sich, zu denen Carl definitiv nicht gehörte.
Jetzt lehnte sich Lutz an einen Pfosten des Doppelstockbetts und sah auf ihn herab.
»Was ist?« Langsam richtete sich Carl auf und überprüfte unauffällig seinen Stand, um sich auf keinen Fall in eine Ecke drängen zu lassen. Auch wenn ihm klar war, dass er in einer offenen Konfrontation körperlich nicht die besten Chancen gegen Männer wie Lutz hatte, der ihn um einen Kopf überragte und keine Verletzung zu beklagen hatte.
»Mir sind da ein paar Gerüchte zu Ohren gekommen.« Lutz sprach leise, als würde er jedes Wort auskosten. »Man munkelt, du bist ein elender Lügner.«
Das stimmte. Verdammt, das stimmte – und trotzdem musste er jetzt die Fassade aufrechterhalten.
»Erwischt.« Ruhig hielt er dem Blick des Mannes stand. Es lag etwas Lauerndes in diesen schmalen Augen, die im ersten Moment harmlos und ein wenig kurzsichtig wirkten. »Ich bin in Wirklichkeit achtundzwanzig. Nein. Neununddreißig? Ach was. Runden wir auf vierzig auf. Schon gut, schon gut, such dir eine Zahl aus, wenn du magst. Aber lass mich einfach in Frieden, ja? Das hat doch bis jetzt auch wunderbar geklappt.«
Lutz verzog die Mundwinkel zu einem spöttischen Feixen und machte einen Schritt auf ihn zu. »Dass du ein richtiger Scherzbold bist, wusste ich noch nicht.« Noch ein wenig, und sie würden sich Brust an Brust berühren, doch Carl wich nicht zurück.
»So nah, wie wir uns gerade gekommen sind, ist es doch mehr als angebracht, einander etwas besser kennenzulernen, oder?«
Lutz schnaubte, und ein warmer, leicht faulig riechender Atem schlug Carl ins Gesicht. »Dann fangen wir doch von vorn an. Was sagst du noch einmal, wie du heißt? Kai?«
»Richtig. Mit C, wenn du mir ein Briefchen schreiben möchtest. Ansonsten kannst du mich weiterhin Ey-Du nennen.« Unwillkürlich tastete seine Hand in der löchrigen Tasche seiner Gefangenenkluft. Allein der Gedanke an die Senfkörner spendete ihm Kraft, auch wenn die Finger vergeblich versuchten, nach den Körnchen zu greifen. Es ging ums Überleben. Er musste die Lügenfassade aufrechterhalten. Denn was passieren würde, sollte jemand herausfinden, unter welchen Umständen er von den Franzosen wirklich gefasst worden war, konnte er sich leicht ausmalen. Spionage – so würde die Anklage lauten. Und dann blieben nur noch wenige Schritte bis vor ein Erschießungskommando.
Also hieß er Cai – ein Name, auf den zu reagieren er, Frederick sei Dank, gewöhnt war. »Onkel Caj, Onkel Caj« – der fröhliche Ruf des Jungen hallte jedes Mal in seinen Ohren, wenn er an sein anderes Leben dachte. An das Leben, in das er unbedingt zurückkehren musste.
»Nun gut. Caaai«, sagte Lutz gedehnt und rieb sich nachdenklich über das kantige Kinn. Kurz sah er zu den Männern, die hinter ihm standen – er tauchte nie allein auf, sondern stets mit seinem Gefolge. »Ich weiß nicht, wer du bist und was für ein Spielchen du treibst. Mag sein, dass du es geschafft hast, die Franzmänner zu täuschen, aber uns täuschst du nicht. Von wegen, du wurdest von deinem Regiment getrennt, gefasst, dann hast du angeblich einen Fluchtversuch unternommen, nicht wahr? Und dann bist du irgendwie in eine Brikettfabrik gelangt, wo du wieder geschnappt wurdest.« Er schnalzte mit der Zunge. »Eine sehr abenteuerliche Geschichte, scheint mir.«
So ruhig wie möglich zuckte Carl mit den Schultern. »Bin halt ein Pechvogel.«
Es wurde so still, dass er glaubte, jeder in der Baracke hätte die Luft angehalten, um die Konfrontation mitzuverfolgen. Wie ein Rudel Wölfe lauerten sie im Halbdunkel und warteten auf das Zeichen seiner Schwäche oder der kleinsten Unsicherheit. Er ließ seinen Blick schweifen. Mürrisch dreinblickende Gesichter, von Hunger, schwerer Arbeit und Misshandlungen der Aufseher vollkommen ausgezehrt. Und er – ihnen allen allein gegenüber. Wortkarg. Ein Außenseiter. Weil seine verdammte Geschichte Lücken hatte, die zu stopfen er nicht einmal versuchte, um sich nicht in Widersprüchen zu verstricken.
»Denkst du, ich will mit dir spaßen? Sag doch gleich, dass du für die Franzen als Spitzel arbeitest.«
»Deine Phantasie geht mit dir durch.«
»Ach ja? Los, sag schon! Wo kommst du her? Wer bist du?« Lutz stieß ihn hart in die linke Schulter.
Der scharfe Schmerz zog durch seinen ganzen Arm und ließ ihn hörbar nach Luft schnappen.
»Cai Seitner«, stieß er durch die zusammengebissenen Zähne. »Das 27. Reserve-Infanterie-Regiment. Die 3. MG-Kompanie.«
»Was du nicht sagst!«
Wieder stieß Lutz ihn in die Schulter. Mit dem erneuten Schmerz fluteten die Bilder durch seinen Kopf. Die unzähligen Verhöre. Immer wieder die gleichen Fragen. Und die Antworten, die er unter Schlägen gab und von denen er niemals abwich: Cai Seitner, das 27. Reserve-Infanterie-Regiment. Die 3. MG-Kompanie. Cai Seitner, das 27. Reserve-Infanterie-Regiment. Die 3. MG-Kompanie. Cai Seitner, verdammt nochmal, er war Cai Seitner, und daran würden weder Folter noch die tagelange Isolation in einer engen Zelle und schon gar nicht Lutz etwas ändern.
»Cai Seitner«, rezitierte er wie im Wahn, ohne zu wissen, wie oft er das gerade wiederholt hatte und wie verdächtig das auf andere wirken mochte. Wie durch einen Nebel merkte er, wie sich andere nach und nach zu Lutz gesellten, angelockt vom Gefühl der Ohnmacht, das in ihm aufstieg. Die Ohnmacht war das Einzige, was half, um Verhören zu entkommen. Um zumindest kurzzeitig nichts zu fühlen. Er ballte die Hände, obwohl es ihm kaum gelang, so sehr zitterten seine Finger. Er fixierte einen unerreichbaren Punkt irgendwo in der Ferne. Und alles andere existierte nicht.
Die Ohnmacht.
War das Einzige, was half.
Wenn es zu schlimm wurde.
»Cai Seitner, natürlich!« Lutz spuckte ihm vor die Füße und deutete nach hinten zu einem seiner Kumpane. »Na dann: Ich habe dir einen Freund mitgebracht. Oswald kommt aus der Kompanie, in der du angeblich gedient hast. Aber weißt du, was merkwürdig ist? Er erinnert sich nicht an dich. Also frage ich dich noch einmal: Wer bist du? Was führst du im Schilde?«
Nur mit Mühe gelang es Carl, sich von dem Punkt in der Ferne loszureißen und sich auf besagten Oswald zu fokussieren. Studierte seine Züge, blickte ihm in die Augen. Nichts war in seiner grobschlächtigen Miene zu lesen. Bluffte Lutz? Konnte es einen so großen Zufall geben, in diesem gottverdammten Lager auf einen Mann zu treffen, der sein Kamerad sein sollte?
»Ich war ganz neu«, antwortete Carl – jedes Wort präzise dosiert. »Komisch. Deinen Oswald kenne ich auch nicht.«
Das 27. Reserve-Infanterie-Regiment. Die 3. MG-Kompanie, ratterte es unaufhörlich in seinen Gedanken. Das Stammeln eines Soldaten in Fieberträumen war das Erste, was er wahrgenommen hatte, als er im Lazarett aufgewacht war. Carl wusste, dass gleich die Franzosen kommen würden, um ihn zu befragen. Dass er nicht viel Zeit hatte, um zu erklären, was er in der Brikettfabrik gemacht hatte, als er angeschossen worden war. Ein paar Stunden später war der Soldat neben ihm verstorben, ohne je zur Besinnung gekommen zu sein. Und Cai Seitner war geboren.
»Komisch? Ich sag’s doch: Ein richtiger Scherzbold bist du.«
Lutz holte aus und boxte ihm in die Schulter, dass es knackte. Unwillkürlich presste Carl eine Hand gegen die Stelle, die sich schon jetzt anfühlte, als hätte man ihm ein glühendes Messer hineingerammt.
»Tut es weh?«, höhnte Lutz. »Soll ich nachlegen?«
»Nur zu«, zischte Carl und verengte die Augen. Inzwischen waren es nicht nur Oswald und ein paar andere Kerle, die für Lutz’ Unterstützung sorgten. Die halbe Belegschaft stand Carl gegenüber und wartete nur darauf, ihn zusammenzuschlagen. Mühsam krümmte er seine Finger zu einer Faust.
Überleben, schoss es ihm wie ein Befehl durch die Gedanken. Überleben!
Um zu Emma zurückzukehren. So wie er es ihr versprochen hatte.
Scheppernd flog die Tür der Baracke auf. Die Aufseher stürmten herein, brüllten, zerrten die versammelten Menschen auseinander und stießen sie mit Hieben und Tritten Richtung Ausgang. »Allez, allez«, ertönte immerzu. Noch bevor Carl realisieren konnte, was um ihn herum geschah, tauchte ein französischer Soldat neben ihm auf und hob die Peitsche. Carl versuchte, sich wegzudrehen, doch der Hieb erwischte ihn an der Wange. Sogleich spürte er einen Tritt gegen die Wade, der ihn zum Ausgang befördern sollte. Er taumelte den anderen hinterher, stolperte blindlings über die Schwelle nach draußen. Die frische Luft kühlte seine verletzte Wange. Vorsichtig tastete er über die Haut.
»Keine Sorge, ist ganz hübsch geworden«, spottete es neben ihm. Lutz! Das Blitzen in den Augen des Mannes zeigte ihm deutlich, dass die Auseinandersetzung von eben alles andere als vergessen war.
»Neidisch? Beim nächsten Mal lasse ich dir gerne den Vortritt. Anscheinend brauchst du Schönheitskorrekturen mehr als ich.«
»Ach, man muss die Unterhaltungen mit dir einfach lieben! Seltsam, dass du außer mir keine Freunde hier hast. Woran könnte das nur liegen?«
»Sicherlich nicht daran, dass ich ein Spitzel der Franzosen sein soll, die mir dann kaum so etwas zum Dank verpassen würden.«
Lutz zog eine Grimasse. Natürlich. Ein Peitschenhieb bewies rein gar nichts. Und der Ausflug in den Hof, wo die Aufseher die Gefangenen in Reih und Glied aufstellten, bevor es einen Marschbefehl gab, bedeutete bloß eine kurze Schonfrist. Keine Begnadigung.
Als auch der letzte Mann nach draußen getorkelt kam, gaben die Wachleute den Befehl zum Marsch. Die Menge setzte sich in Bewegung, passierte das Tor. Während der ersten Male hatte sich in Carl das Gefühl von Freiheit eingestellt: endlich weg aus der Baracke und vom mit Stacheldraht bewehrten Hof zu sein. Hier draußen schien der Blick weit wegfliegen zu können, hier glaubte man, den Horizont zu spüren. Doch das Gefühl währte nicht lange. Die Monotonie erstickte alles im Keim. Und schon bald wollte der Blick nirgendwo mehr hin, außer auf den Boden.
Carl war froh, sich in der Menge zu verlieren. So zog er nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Viele der Männer um ihn herum hielten sich kaum auf den Beinen. Das karge Essen, bestehend aus Wasserreis und einem trockenen Stück Brot, die Misshandlungen und die harte Arbeit zehrten an den Kräften. So einige waren bereits vor Erschöpfung und wegen der ständigen Unterernährung zusammengebrochen. Und manchmal wunderte sich Carl, dass ausgerechnet er durchhielt. Wie lange noch? Wenn nicht einmal das Ende des Krieges die Rückkehr in die Heimat näher gebracht hatte? Eine Nachricht, die sich beiläufig anfühlte und ihre Bedeutung im kargen Alltag vollkommen verlor. Denn solange Deutschland die Reparationsansprüche der Entente-Mächte nicht getilgt hatte, gab es für keinen von ihnen einen Weg nach Hause.
Seit einer Stunde marschierten sie die unebene Schotterstraße entlang. Die kleinen Steinchen drangen immer wieder durch das löchrige Schuhwerk an die Fußsohlen, scheuerten und verursachten Blasen – aber auf solche Unannehmlichkeiten achtete schon lange niemand mehr. Carl fragte sich, wohin es ging. In den letzten Wochen hatten sie die Telefonmasten versetzt. Davor die Gleise ausgebessert, die von einem Bombenangriff beschädigt worden waren. Doch diesen Weg kannte er nicht. Unwillkürlich versuchte er, sich die Gegend einzuprägen, auch wenn der Gedanke an eine Flucht sich nicht so recht in seiner Vorstellung einnisten konnte. Zu oft waren Flüchtige beim Versuch, zu entkommen, erschossen worden. Was unter Umständen noch ein besseres Schicksal war im Vergleich zu den armen Seelen, die geschnappt und zurückgeschleppt worden waren.
Die Landschaft veränderte sich. Offensichtlich kamen sie in die Gebiete der früheren Kämpfe, von denen auch nach Monaten der Waffenruhe aufgewühlte Erde, riesige Krater und entwurzelte Bäume zeugten. Wie tiefe Wunden gruben sich die verlassenen Schützengräben in den Boden, Stollen und Unterstände wirkten wie Geisterstädte. Hier und da entdeckte man noch Hab und Gut der Soldaten. Von der Witterung ausgefranste Planen wehten im Wind, Militärkarossen rosteten unter freiem Himmel, wie Skelette versanken zurückgelassene Karren im Schlamm. Carl fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis Gras und Büsche diesen Ort überwuchern und ihm Frieden schenken würden. Bis die Grausamkeit der Menschen vom Angesicht der Erde verschwinden würde.
Es war Oswald, der plötzlich stehen blieb. Mit einem leeren Blick starrte er auf ein Feld, das von unzähligen Kreuzen gesäumt war. Die anderen Gefangenen torkelten in einem steten Strom an ihm vorbei. Carl wollte ihn warnen weiterzugehen, bevor die Wache ungeduldig wurde.
»Die Männer aus meiner Kompanie liegen hier«, murmelte Oswald. »Eine schlimme Schlacht war das.« Dann drehte er sich zu Carl, blinzelte, als wäre ihm bewusst geworden, wer neben ihm stand, und seine kantigen Züge verzogen sich vor Abscheu. »Aber dich scheint es nicht weiter zu berühren, dass unsere Kameraden hier liegen, was?« Seine riesige Pranke krallte sich in Carls Gefängniskluft.
Fest blickte er Oswald ins Gesicht. »Finger weg.«
Er packte die behaarte Hand und riss sie von seiner Kleidung weg. Egal, was passierte, er durfte nicht weichen!
»Allez! Allez!«, brüllte es unmittelbar neben ihm.
Zum zweiten Mal an diesem Tag waren es die Franzosen, die ihm die Haut retteten.
Einer stieß seinen Gewehrkolben in Oswalds Seite und brachte ihn ins Taumeln. Ein weiterer Schlag erwischte ihn am Rücken, trieb ihn voran. Carl bekam einen Hieb in die Rippen, keuchte, nutzte aber die Gelegenheit, um Abstand zwischen sich und Oswald zu bringen. Auf dem weiteren Weg beobachtete er den Mann, der Lutz eingeholt hatte und die ganze Zeit auf ihn einredete. Die Blicke, welche die beiden ihm zuwarfen, verhießen nichts Gutes. Was auch immer die zwei ausheckten – irgendwann würden die Franzosen nicht zur Stelle sein, um seine Lage zum Besseren zu wenden. Er musste auf der Hut sein.
Der Befehl zum Halt zerriss die Monotonie der Bewegung.
Die Aufseher ließen sie sich in Reih und Glied aufstellen, erklärten in kurzen Sätzen, was zu tun war. Lutz, der am besten Französisch verstand, übersetzte. Mit finsterer Miene erklärte er, sie würden ab jetzt einer Sprengkolonne angehören, um auf den ehemaligen Schlachtfeldern nach Blindgängern zu suchen. Die Sprengkörper waren zu Sammelstellen zu tragen, wo sie zu einer kontrollierten Detonation gebracht werden sollten. Die knappen Anweisungen der Wachleute deuteten nicht gerade darauf hin, dass sie viel von der Aufgabe verstanden, die sie da gerade zuwiesen. Oder sich große Gedanken über die Sicherheitsvorkehrungen gemacht hätten.
Carls Blick huschte über die aufgewühlte Erde, über die Gräben, unzählige Krater und die entwurzelten Bäume. Hier und da sprossen frisches Frühlingsgras und das eine oder andere Gänseblümchen, die jedem Elend zum Trotz ihre Blüten öffneten. Noch vor wenigen Minuten hatte er geglaubt, Lutz und Oswald wären sein größter Grund zur Sorge. Jetzt fragte er sich, ob schon der nächste Schritt ihm zum Verhängnis werden konnte. Etwas Schweres legte sich um seine Brust, zog sein Herz zusammen, hinderte es daran, frei zu schlagen.
Überleben, pochte es in seinen Schläfen. Überleben, um zu Emma zurückzukehren.
Vor seinem geistigen Auge wimmelten die Kreuze, die er vorhin vom Weg aus gesehen hatte. Überleben? Wie sollte er es schaffen, wenn er schon im nächsten Augenblick in Stücke gerissen werden konnte?
»Umbringen wollen sie uns«, dröhnte Lutz’ Stimme über die Köpfe der anderen Gefangenen hinweg. Jeder Laut schlug wie ein Sargnagel in Carls Kopf. Denn der Mann hatte recht. Eine Todesfalle war das hier.
»Allesamt umbringen!«, rief Lutz nachdrücklicher. »Da wir anscheinend nicht willens sind, an Hunger und Not zu verrecken. Das sollten wir uns nicht gefallen lassen!«
Die Aufseher schimpften, schubsten ihn zurück zu den anderen, verpassten ihm Tritte und Hiebe, ohne ihn zum Verstummen bringen zu können. Immer weiter, immer lauter schrie er: »Die Arbeit sollten wir verweigern, jawohl! Männer! Schließt euch mir an!« Er schrie bis zur Heiserkeit. Und seine raue, kräftige Stimme verursachte Carl Gänsehaut.
Ein Gemurmel erhob sich. Die Wachleute brüllten, fuchtelten mit Gewehren.
Was wirst du tun? Carl bis sich auf die Lippe. Hier stehen bleiben? Auch auf die Gefahr hin, von einem Soldaten erschossen zu werden, der die Geduld verlor? Oder sich fügen. Ins Feld gehen. Um von einem Blindgänger in die Luft gejagt zu werden?
Der Gedanke schnürte ihm die Kehle zu. Beides bedeutete, dass er sein Versprechen gegenüber Emma brechen würde. Dass er es nicht schaffte, zu ihr zurückzukommen. Dass er sie im Stich lassen würde.
Noch nie hatte er sich so sehnlich die Senfkörner in der Tasche gewünscht. Denn wenn er die kleinen Kügelchen zwischen den Fingern hielt, flogen ihm die richtigen Entscheidungen zu.
»Uns alle können sie nicht erschießen!«, rief Lutz erneut, presste die Lippen zusammen und drehte sich den Gewehrmündungen entgegen, die auf ihn zielten.
»Aber mit irgendjemandem werden sie anfangen«, murmelte einer neben Carl. Ein drahtiger Mann mit hängenden Schultern, der sich als Erster abwandte und zum Feld trottete. »Das geht schon«, brummte ein anderer. »Müssen wir halt vorsichtig sein.« Nach und nach taten es ihm die anderen gleich. Der Widerstand schmolz wie Spätschnee unter der Frühjahrssonne und floss in Bächen dahin.
Bis nur noch Oswald, Lutz, zwei andere Männer und Carl zurückblieben.
Carl merkte nicht einmal, wie einer der Wachleute neben ihm aufgetaucht war. Ein harter Schlag gegen den Kopf warf ihn zu Boden. Mit einer Wange spürte er, wie er im Matsch landete. Vor seinen Augen tanzten weiße Punkte. »Emma …« Ihr Name gab ihm Kraft. Unwillkürlich schlossen sich seine Finger um ein Gänseblümchen, bevor weitere Tritte in den Bauch und gegen die Brust ihm den Atem raubten und sein Herz schier zum Explodieren brachten.
Speyer, 1919
EMMA
Sie lief.Auf keinen Fall durfte sie stehen bleiben. Auch wenn jeder Schritt sich wie ein Kampf anfühlte, sie immer langsamer wurde und die Füße drohten im matschigen Boden stecken zu bleiben. Weiter. Immer weiter durch die Dunkelheit, die auf sie zu lauern schien. Wie ein Ungeheuer, das nach ihr lechzte.
Weg. Bloß weg von hier. Auch wenn es kein Entkommen gab.
Sie stolperte durch die Schwärze. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Beim nächsten rutschte sie aus und fiel in den Matsch. Ihre Arme versanken bis zu den Ellbogen im Morast. Sie zog und zerrte, um ihre Hände frei zu bekommen, kam aber nicht hoch.
Plötzlich verharrte sie. Jemand war da. Direkt über ihr.
Nein, nein, nein, wollte sie rufen. Aber die Worte blieben in ihrer Kehle stecken, als eisige Hände sie klauenartig an den Schultern packten und hochzerrten.
Nein, schrie sie stumm und blickte mit aufgerissenen Augen in das Gesicht ihres Verfolgers.
In Carls totes Gesicht.
Emma. Seine bläulichen Lippen bewegten sich stumm. Der leblose, kalte Blick fuhr wie eine Klinge in ihre Seele. Emma!
Sie schreckte hoch. Einen Augenblick lang wusste sie nicht, wo sie sich befand, während das drückende Gefühl, die Gewissheit, Carl enttäuscht, nein, ihn verraten zu haben, ihre Brust wie ein Schraubstock zusammenpresste.
Kein Wunder, dass er sie heimsuchte.
Sie hatte es nicht geschafft, sein Vermächtnis zu bewahren. Sie hatte alles verloren, was ihm lieb und teuer gewesen war. Noch mehr: Wofür er sein Leben gegeben hatte.
Sie schauderte.
»Emma …«
Wie aus dem Nebel erschien Wilhelmines blasses Gesicht vor ihren Augen. In der Dämmerung der Morgenstunde wirkte es surreal mit seinen hervorstehenden Wangenknochen, angeschwollenen Lidern und trockenen, aufgeplatzten Lippen.
»E-es tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken«, stammelte Emma verlegen. Noch immer raste ihr Herz, und sie hatte das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Als würde der tote Carl in den dunklen Ecken auf sie lauern und nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um seine Klauen erneut in ihre Schultern zu bohren.
»Hast du nicht. Ich konnte nicht schlafen.« Wilhelmine richtete sich auf. Der muffige Strohsack, auf dem sie kauerte, raschelte bei jeder ihrer Bewegungen. Ganz hochzukommen und sich aufzurichten, schaffte sie nicht. Obwohl die Krankheit längst überwunden war, hatte Wilhelmine noch immer nicht zu alter Kraft zurückgefunden. Der trockene Husten hatten sich tief in ihrer Brust eingenistet und quälte anfallartig ihren geschwächten Körper. Es tat Emma in der Seele weh, diese einst so energische, resolute Frau vollkommen erloschen zu sehen, ohne jeglichen Lebensfunken.
Manchmal fragte sich Emma, ob Wilhelmine aufgegeben hatte. Ob ihre Schwiegermutter nach dem Tod ihres Ehemannes und dem Verlust ihres Sohnes gar nicht mehr ins Leben zurückkehren wollte, sondern nur noch da war, um auf das Ende ihrer Tage zu warten. Wie gern hätte Emma ihr geholfen, wieder Mut zu fassen. Doch an manchen Tagen fühlte sie sich selbst ohne jegliche Hoffnung und ließ sich durch den tristen Alltag treiben, ohne etwas wahrzunehmen. Manchmal war es ein Segen, nichts zu spüren. Abgesehen vom dumpfen Gefühl der Trauer, das sie mehr und mehr aushöhlte.
Meistens legte sich Wilhelmine wieder zurück auf ihr Lager, um vor sich hin zu dämmern. Dieses Mal blieb sie halb aufgerichtet. Ihr Arm zitterte leicht vor Anstrengung, und doch ließ sie sich nicht fallen, sondern schaute Emma mit einem matten, aber eindringlichen Blick an. »Hast du … hast du wieder von ihm geträumt?«
Allein beim Gedanken an den Albtraum spürte Emma, wie sich die feinen Härchen auf ihrem Körper aufrichteten und ein kalter Schauer ihren Rücken entlangjagte.
Sie nickte kaum merklich.
Zu mehr war sie nicht imstande. Die Heimsuchungen der Nacht hatten sie vollkommen ausgelaugt. Noch immer spürte sie Carls Gegenwart, als würde er irgendwo da sein und stumm ihren Namen rufen.
»Wen auch immer du in deinem Traum gesehen hast, es war nicht Carl.« Wilhelmines Stimme klang ganz brüchig. Eher ein Keuchen, mehr nicht. »Es war nicht unser Carl, Emma. Carl würde dir niemals etwas Böses wollen.«
»Ich weiß«, flüsterte sie. Mit einem Mal konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. Einem Impuls folgend, schloss sie ihre Arme um Wilhelmines dürren Leib und vergrub ihr Gesicht an der Schulter ihrer Schwiegermutter. »Unser Carl würde niemals etwas Böses wollen. Aber unser Carl ist tot.«
Die Worte machten sie schwach mit ihrer Endgültigkeit. Sie rissen ein Loch in ihr Innerstes. Zogen den Boden unter ihr weg, so dass sie glaubte, jeden Moment in den Abgrund zu stürzen und nie wieder hochzukommen. Dabei brauchte sie Kraft! Durfte nicht aufgeben. Sie musste sich um Wilhelmine kümmern und alles dafür tun, die Seidels wieder miteinander zu vereinen.
Doch sie hatte keine Ahnung, woher sie die Zuversicht noch nehmen sollte. Wenn alles, was sie stützte, nicht mehr da war.
Behutsam strich Wilhelmine über ihren gekrümmten Rücken, und ein wenig Wärme schlich sich in ihre Seele. Was ihr guttun sollte, brachte sie endgültig aus der Fassung. In ihrer Nase kribbelte es. »Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn so entsetzlich!«, wisperte sie. Ihre Stimme klang hoch und dünn und unglaublich hilflos in ihren Ohren.
»Nichts kann das Loch füllen, das er in unseren Herzen hinterlassen hat.«
»Es wird jeden Tag größer, dieses Loch«, flüsterte Emma. Ihre Augen brannten. »Irgendwann wird es mich verschlingen. Mit Haut und Haaren. Ich habe eine schreckliche Angst, dass es passiert, bevor ich es schaffe, dich von hier wegzubringen. Zu Louise und deinem Enkel und …«
Antoine.
Sie schluckte seinen Namen hinunter. So schnell, wie sich ihre Wege gekreuzt hatten, so rasch hatten sie sich wieder getrennt. Jetzt stand all das Unausgesprochene zwischen ihnen, was sie im Automobil nicht hatte hören wollen. Sie fühlte sich allein mit dieser Last, mit all ihren Gedanken … Sie fühlte sich verloren in ihrer eigenen Verbitterung.
Es tut mir leid.
Vier Worte, die ihr damals ohne Bedeutung vorkamen. Wie so vieles, was Antoine sagte oder tat. Und die doch mehr in ihr hinterlassen hatten, als sie wahrhaben wollte.