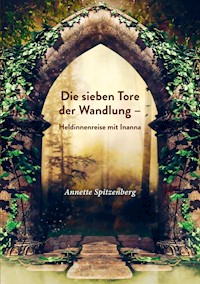
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In ihrem Buch untersucht Annette Spitzenberg den ältesten uns zugänglichen sumerischen Mythos der Inanna und Ereschkigal und entfaltet anhand von ihm eine Held:innenreise für unsere Zeit. Es ist ein Weg voller Weisheit und Mitgefühl, uneingeschränkter Hingabe und mutiger Entschlossenheit, sich der Tiefe zu stellen. Der Mythos von Inanna und Ereschkigal gibt zu diesem Weg eine Art Landkarte. Die Autorin ist ihn selbst auch gegangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich allen *Frauen, die Held:innen sind, weil sie um ihr Überleben und um grundlegendste Rechte kämpfen müssen, sowie allen Held:innen des Alltags. Ihnen allen gilt meine Bewunderung und mein Respekt.
Inhalt
Vorwort von Marianne Verny
Vorwort der Autorin
Danksagung
Heldinnenreise
Der Held in tausend Gestalten
Struktur der Heldenreise nach Campbell
Und die Heldin?
Struktur der Heldinnenreise gemäss Inanna
Inanna und Ereschkigal historisch eingebettet
Vorbemerkungen
Einführung in den Mythenkreis von Inanna
Inannas Aufstieg – ihr Weg zur Göttin
Die Errichtung des Weltenbaums
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Wurzel 1
Wurzel 2
Mitte 1
Mitte 2
Oben 1
Oben 2
Verbindung der drei Bereiche 1
Verbindung der drei Bereiche 2
Inanna holt sich die ME-Kräfte
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Meinen Rang erkennen
Inanna und Dumuzi – heilige Hochzeit
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Begegnung mit einem verletzten Teil in dir
Feiere deine Sinnlichkeit – Spiel mit Händen
Hand-in-Hand, Herz-zu-Herz
Inannas Abstieg
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Innere und äussere Ninshubur
Übe dich ein ins Sterben
Sieben Tore – Exkurs zur Zahl sieben
Das erste Tor: Die Krone fällt – königlich-priesterliche Macht
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Deine Krone
Meditation zum Kronenchakra
Ritual: Das Ablegen deiner Krone
Das zweite Tor: Das Nackenband wird genommen – Konfrontation mit den eigenen Ängsten
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Schutzmantelmeditation
Angst als Verbündete
Durchspielen der Angst oder zu Ende träumen
Primäre Reaktionsweise erforschen und erweitern
Traumadistanzierungsübung
Ritual: Das Ablegen der Lapislazulisteine
Das dritte Tor: Die doppelreihige Perlenkette wird genommen – verlorene Ausdrucksfähigkeit
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Atemübung Teil 1
Atemübung Teil 2
Die eigene Stimme Teil 1
Die eigene Stimme Teil 2
Ritual: Das Ablegen der doppelreihigen Perlenkette
Das vierte Tor: Die Brustplatte wird genommen – das ungeschützte Herz
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Eigene Strahlkraft
Herzmeditation
Herzwunde 1
Herzwunde 2: Tonglen
Heilende Grünkraft der Natur
Ritual: Das Ablegen der Brustplatte
Das fünfte Tor: Der goldene Armreif wird genommen – die Handlungsfähigkeit wird zurückgelassen
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Ohne Hände
Meditation zu deinen Händen
Wandlung der Handlungsunfähigkeit
Handlungs(un)fähigkeit zum Tanzen bringen
Ritual: Das Ablegen des goldenen Armreifs
Das sechste Tor: Der Lapislazustab wird genommen – Messen und Gemessen Werden
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Aufeinander zugehen
Aura ausweiten
Begegnung mit dem inneren Kritiker
Balance im Zumessen
Eintreten in einen nondualen Bereich: Zen Übung
Ritual: Das Ablegen des Lapislazuli Stabes
Das siebte Tor: Das königliche Gewand wird genommen – Nacktheit: Scham und Verletzlichkeit
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Übung zu zweit: Modellieren der Scham
Übung allein: Scham und Befreiung
Kleidung
Meditative Erinnerung einer Schamgeschichte
Feiere deine Nacktheit
Transformation der Beschämung
Ritual: Das Ablegen des königlichen Gewandes
Der Tod
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Übe dich ein ins Sterben
Inkarnation
Etwas sterben lassen
Übung zu zweit: nonverbale Kommunikation
Ereschkigals Schmerz
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Tonglen
Täterenergie
Verbindung mit Ereschkigal
Ho’oponopono
Mitgefühl mit dir selbst
Verbindung mit der Urmutter, Schöpferin des Lebens
Meditation der inneren Anteile der Erzählung
Inannas Aufstieg, Integration der Kräfte des Todes
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Äussere Schwesternschaft
Innere Schwesternschaft
Zorn ausdrücken
Ritual: Aufstieg aus dem Grossen Unten (allein)
Ritual: Aufstieg aus dem Grossen Unten (Gruppe)
Der Energieausgleich
Deutung
Erfahrungen
Übungen
Übung zu zweit: Dumuzi und Geschtinanna
Übung Anima und Animus
Die vier Göttinnen in sich spüren
Inanna, Gender und Queer
Erfahrungen
Inanna, Dumuzi und Jesus – ein Vergleich
Historische Vergleiche und Analogien
Analogien in den synoptischen Evangelien
Analogien im Johannesevangelium
Hinweise aus apokalyptischen biblischen Texten
Gesangbuchdichtung
Die Unterschiede
Wirkungen und Folgen
Synthese
Religion der Zukunft
Erfahrungen
Schlussbetrachtungen
Glossar
Personen und Konzepte aus dem sumerischen Mythenkreis
Oft verwendete Fachbegriffe
Verwendete Bilder
Bibliographie
Filmographie
Vorwort von Marianne Verny
Eigentlich ist die Autorin Annette Spitzenberg eine Visionärin, selber Mystikerin, mit einem tiefem politischem Engagement für unsere Welt:
So erkennt sie, dass dieser urälteste Mythos eine Blaupause darstellt dafür, wie wir Frauen und Männer Co-Schöpfer:innen werden können einer Welt, in welcher tiefe seelische Verbundenheit mit beherztem Handeln im Aussen in Verbindung steht.
Liegt es daran, dass für *Frauen die Rolle als Heldin nicht vorgesehen war in patriarchalen Strukturen? Oder liegt es daran, dass *Frauen auf andere Art und Weise zur Heldin werden?
So beginnt die Recherche der Autorin Annette Spitzenberg und sie findet spannende und überzeugende Antworten…
Dabei forscht sie insbesondere auf der Ebene von Selbstwerdung und Individuation und diese braucht weibliche Heldinnen, um sich weiblich entfalten zu können.
Anstatt das sogenannt Böse / Fremde ausschliesslich im Aussen zu bekämpfen, wird die Protagonistin Inanna zur Heldin, die durch ihren selbst gewählten Gang in die Unterwelt / ‘das grosse Unten’ sich ihren Ängsten vor Machtlosigkeit und Einsamkeit stellt und sich damit dem Fremden in sich selbst stellt und (ver-)wandelt. Die Autorin nennt dies den vertikalen Heldinnen-Weg.
Nach der Rückkehr auf unsere sogenannt ‘consensus-reale’ Welt hat sie dann das Werkzeug, um entschieden und kraftvoll ihre Führungsaufgaben zu übernehmen und in diesem Sinn auf horizontaler Ebene den Herausforderungen zu begegnen.
Annette Spitzenberg erkennt die vertikale Ausrichtung der archetypischen Heldinnenreise, welche sich zwischen einem Oben und Unten aufspannt – die Heldin muss in die Tiefe, um das Wesentliche / Sich zu finden im Gegensatz zum männlichen Helden, der auf der uns vertrauten ‘consensus realen’ Welt, der Ebene der mittleren Erde, sich seinen Herausforderungen und Gegnern im Kampf stellen und gewinnen muss – ein Heldenmythos auf horizontaler Ebene
In diesem Sinn ist es ein durchaus kämpferisches Buch, mit welchem Annette Spitzenberg eine neue Begegnung fordert zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip in uns Menschen und insbesondere darauf verweist, wie wesentlich Bewusstseinsentwicklung ist in einer Zeit, in welcher der horizontale geführte Krieg zwischen sich polarisierenden Kräften Meinungen uns gerade als Menschheit lähmt und vernichtet.
Ein aufklärendes, bewusstseinsbildenden Buch: es wird dazu eingeladen anhand des Mythos die eigene Beziehung zu Macht / Ohnmacht und selbstbewusstem Handeln zu reflektieren und das eigene Entwicklungs-Potential zu erkennen, sozusagen aufzuwachen aus einer Jahrtausende dauernden patriarchalen Indoktrinierung, als Frau ‘zum schwachen Geschlecht’ zu gehören und stattdessen durch den Entwicklungs-Prozess der fast 6000 Jahre alten Inanna einen selbstermächtigenden Weg durch sich selbst und das unnennbare Grosse Ganze neu zu entdecken.
Dieses Buch verbindet so viele verschiedene Ebenen von Realität:
Da ist der wörtlich wiedergegebene Hymnus, der auf poetische Weise Inanna’s Leben besingt und deutlich macht, wie Inanna als selbstbewusst ermächtigte Frau sich ihren Mann erwählt und ihn offen ausgesprochen begehrt, sodass die beiden einander ebenbürtig in einer Unio Mystica begegnen und verschmelzend miteinander Ganz werden können.
Da ist die geistreiche, sowohl historische wie mythologische Zusammenhänge auslotende Analyse des damaligen sumerischen Uruk, welches sich gesellschaftlich in einer Wandlungsphase befand eines eher matrilinearen zu einem patriarchalen Werteverständnis.
Und da ist die heutige psychologische prozessorientierte Sicht, die u.a. ein modernes Rang- und Privilegienbewusstsein spiegelt und der Leserin / dem Leser die Anleitung dazu bietet, kognitiv über Fragen einen Bezug zum eigenen Erleben herzustellen und praktisch und mit Hilfe des Körperempfindens und Gestik sich schrittweise einem noch unbekannten Erforschen innerer Figuren, innerer Spannungen und Ängste aus zu setzen und sich tiefer kennen zu lernen und zu wandeln.
Dem Mythos wird somit hoch aktuelles Lebendig-Sein eingehaucht und er wird zur Brücke zum spürenden Träumen der/des Leser:in – er ist nicht mehr nur Seelen-Landkarte, sondern eine Herausforderung zum Leben jetzt.
Eine Heldinnenreise wie die von Inanna lädt uns dazu ein, solche Prozesse nicht nur dann zu durchlaufen, wenn wir tatsächlich sterben, sondern schon mitten im Leben. Sie lädt uns dazu ein, sie als zyklisches Geschehen zu verstehen, als Individuationsweg der Seele, der immer tiefer gehen kann, mit jedem Zyklus.
Annette Spitzenberg ist eine Forscherin und gleichwohl persönlich Suchende, die in radikaler Weise an eigene Erfahrungs-Grenzen geht und stösst, um sich im eigenen grossen Unten zu erkennen aber auch um sich dem Unbekannten persönlich zu stellen mit all dem Mut, den es zu diesem Sich-Stellen braucht.
Damit ist sie die Inanna-Schwester, die wir als Leserinnen und Leser brauchen, um Vertrauen zu fassen, dass ein solcher Heldinnen-Weg nicht nur möglich ist, sondern Lösendes, Heilendes ermöglicht und dies zu einer geistig-seelischen Öffnung führt, die rückwirkt auf das Ganze, unsere Menschen-Welt jetzt.
An dieser Stelle danke ich Annette Spitzenberg ausserordentlich für ihre Pionierarbeit und den Wagemut, einen unserer urältesten Mythen so hoch aktuell in Erscheinung zu bringen und uns Leser:innen wohlwollend herauszufordern, in unser eigenes grossen Unten zu steigen und dort zu schöpfen.
Marianne Verny
Winterthur, 26.11.2022
Vorwort der Autorin
Als ich im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung in Prozessarbeit begann, mich vertieft mit dem Topos der Heldenreise auseinanderzusetzen, fiel mir auf, dass Helden überwiegend männlich besetzt sind. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es kaum Heldinnen, und die wenigen, die es gibt, haben oft tragisch geendet, wie Jeanne d’Arc zum Beispiel.
Liegt es daran, dass für *Frauen die Rolle als Heldin nicht vorgesehen war in patriarchalen Strukturen? Oder liegt es daran, dass *Frauen auf andere Art und Weise zur Heldin werden? In beidem mag Wahres liegen, denn es gibt durchaus starke Heldinnenfiguren in Märchen und Erzählungen, wenn sie auch in der Minderzahl sind. Und es gibt die feministische Theorie, die besagt, dass in vorpatriarchaler Zeit *Frauen die Männer hinausschickten, um für sie Heldentaten zu vollbringen1.
Bei der Heldinnenreise geht es nicht nur um Märchen und Mythen, sondern auf der psychologischen Ebene auch um Selbstwerdung und Individuation. Daher ist es nicht ohne Bedeutung, ob das Konzept der Heldenreise, wie es Joseph Campbell in seinem wegweisenden Buch «Der Heros in tausenderlei Gestalt» geschildert hat, überwiegend männlich konnotiert ist oder auch für *Frauen eine Identifikationsmöglichkeit anbietet.
Campbell greift auch auf die Forschungen C.G. Jungs zurück. Dieser hat herausgefunden, dass Kindheitsträume, oder auch früheste Erinnerungen, Lieblings(angst)märchen für den eigenen Lebensmythos, d.h. für die persönliche Reifung, Selbstwerdung und somit für die eigene Held:innenreise von richtungweisender Bedeutung sind. Daher ist auch die Frage nach den archetypischen Heldenmythen von Bedeutung für die Held:innenreise von *Frauen.
Ich bin vor etlichen Jahren auf einen sumerischen Göttinnen Mythos gestossen2, welcher vermutlich der älteste schriftlich überlieferten Mythos überhaupt ist und aus einer Zeit stammt, in welcher die patriarchalen Strukturen noch jung waren. Es handelt sich um die sumerische Göttin Inanna und ihre Reise zu ihrer dunklen Schwester Ereschkigal. Lange blieb Inanna mir eine verborgene Wegbegleiterin, bis ich selbst durch das Leben genötigt wurde, in die Tiefen hinabzusteigen.
Da begann ich mich auf einer existenziellen Ebene neu mit dem Mythos von Inanna und Ereschkigal zu beschäftigen. Er sprach zu mir durch Räume und Zeiten3, er half mir zu deuten, was mir widerfuhr und sein archetypischer Gehalt liess mich fragen, ob hier ein weiblicher Heldinnenmythos wäre, den die heutige Zeit braucht. Und ich verstehe hier weiblich über das biologische Geschlecht hinausgehend, im Sinne des weiblichen Archetyps.
Ich entdeckte, dass die Struktur der weiblich konnotierten Heldinnenreise in die Vertikale geht, da geht es um Erde, Himmel und Unterwelt resp. das Reich des Todes. Geburt und Tod, Vergehen und Rückkehr ins Leben, Dürre und Fruchtbarkeit, diese urweiblichen Themen sind Gegenstand einer weiblichen Heldinnenreise. Sie ist eigentlich nie wirklich verloren gegangen, Mystikerinnen und Mystiker, Schamaninnen und Schamanen sind immer schon mit der vertikalen Reise im Kontakt geblieben4. Der Mythos von Inanna ist ein Mysterien Mythos wie auch der spätere von Persephone und Demeter, der in den eleusinischen Mysterienspielen gefeiert wurde. Wie alle Mysterien Mythen gibt es dabei Aspekte und Erlebnisse, die sich dem Verstand entziehen5. Männlich geprägte Heldenreisen hingegen gehen ihren Weg in der Horizontalen. Der Held zieht aus, begeht seine Heldentaten und kehrt zurück und bringt ein, was er dort gewonnen hat. Auch auf horizontalen Reisen kann er natürlich dem Tod begegnen.
Ich bin der Überzeugung, dass es beide Arten von Heldenreisen braucht. Ebenso glaube ich, dass es Männer und *Frauen braucht, die beide Arten von Heldenreisen zu gehen vermögen. Gerade der Mythos von Inanna und Ereschkigal macht deutlich, dass beide Geschlechter angehalten werden, die Reise in die Tiefe auf sich zu nehmen. Wenn das Männliche sich weiterhin weigert, diesen Weg auch zu gehen, bedeutet dies eine Fortsetzung von Krieg, Gewalt, Zerstörung und Ausbeutung, der Krieg in der Ukraine zeigt dies nochmals in aller Schärfe. Ich glaube, für das Überleben unserer Spezies könnte es von entscheidender Bedeutung sein, dass Menschen den Weg in die Tiefe zu gehen bereit sind. Yuval Noah Harari bemerkt zu Recht, dass wir ebenso viel Energie (inkl. Geld) darauf verlegen sollten, uns der Entwicklung und Erforschung menschlichen Bewusstseins zu widmen wie wir dies bereits tun in der Erforschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz6. Es wird Zeit, dass wir zurückfinden zu einer Gesellschaft und Kultur, die auf friedliche Kooperation und auf Teilhabe beruht, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit sowieso7.
Ich gebe es zu, ich bin eine Träumerin. Ich träume von einer Welt, in welcher die Menschheit zurückfindet zum Wissen, dass sie Teil der Natur ist und nur mit ihr überlebt, nicht gegen sie. Ich träume, dass sie zurückfindet zu Kooperation, zum Teilen, zum Schenken. Dass sie Gesellschaftsformen entwickelt, die nicht auf Herrschaft über andere, Macht, Hierarchie, Dominieren und Gewalt ausgerichtet sind. Nicht aufgrund einer romantischen Verklärung und Idealisierung der Vergangenheit, sondern als notwendiger Wandel für die Zukunft. Und ja, da spricht auch die Theologin aus mir, die sowohl Texte des verlorenen Paradieses kennt als auch solche, die eine Utopie entwerfen, in der sogar Wildtiere friedlich werden und Gras fressen8.
Als Theologin bin ich es gewohnt, sehr alte Texte zu übersetzen und zu deuten in eine heutige Zeit hinein, um ihre Relevanz für das Hier und Jetzt aufzuzeigen. Doch wie ist es mit einem Text, der noch weitaus älter ist? Kann es gelingen, diesen Mythos9 für heutige Menschen gewinnbringend auszulegen? Ihn als kollektive Identifikationsmöglichkeit anzubieten? Ihn in Austausch zu bringen mit eigenen, persönlichen, individuellen Mythen? Um dies zu erforschen, entwickelte ich einen Pilotkurs, dessen Erfahrungen auch in dieses Buch einfliessen. Die Meisten in anonymisierter Form und nur das, was die Teilnehmerinnen ausdrücklich erlaubt haben. Auch persönliche Erfahrungen flechte ich ein. Nicht in voyeuristischer Absicht, sondern um exemplarisch je nachdem zu verdeutlichen, wie der Mythos korrespondieren kann mit eigener Erfahrung.
Ich werde in diesem Buch mit Ausnahme des ersten Kapitels, in welchem ich die Unterschiede zwischen männlicher Heldenreise und weiblicher Heldinnenreise herausschäle, konsequent von Held:innenreise sprechen. Ich möchte dadurch ganz bewusst alle Menschen und alle Geschlechter ansprechen, insbesondere alle FLINTA*s10. Menschen, die nicht zur heteronormativen Mehrheit gehören, insbesondere solche, bei denen Geschlecht und Körper nicht übereinstimmen oder die sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlen, werden vom Leben bereits gefordert, eine Held:innenreise zu gehen. Gerade ihnen ist dieses Buch ausdrücklich gewidmet.
Wenn ich im Buch von männlich und weiblich spreche, meine ich in der Regel männliche und weibliche Prinzipien, Erfahrungen und Konstrukte, manchmal auch entsprechende Archetypen.
Das Buch erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Insbesondere erhebt das Buch auch nicht den Anspruch, die sumerische Kultur, aus welcher Inanna stammt, in ihrer Tiefe verstehen zu können. Ich bin Theologin, nicht Assyriologin, ich kann weder Keilschrifttafeln lesen noch bin ich der sumerischen Sprache mächtig. Alles Wissen, auf das ich mich stütze, ist hergeleitet durch das Wissen anderer. Doch selbst wenn ich des Sumerischen mächtig wäre, mag es gewissermassen ähnlich sein wie bei biblischen Texten, wir können sie nicht objektiv lesen, sondern wir bringen auch bei der sorgfältigsten Exegese11 und der grösstmöglichen Bemühung um wissenschaftlichen Forschergeist die Prämissen einerseits der wissenschaftlichen Methodik und ihrer Zeit selbst als auch persönliche Haltungen und Gesichtspunkte hinein. Somit erhebt dieses Buch auch keinen Anspruch auf Objektivität12. Fehler sind allein bei der Autorin zu suchen.
Auf der anderen Seite möchte ich mich unterscheiden von Herangehensweisen, die einer esoterischen Beliebigkeit verfallen und oft mehr über die Phantasie des entsprechenden Autors aussagen als über den Gegenstand selbst. Ich möchte mich auch der historischen Inanna annähern, so gut ich es vermag, sie aber existenziell in die heutige Zeit hineindeuten13. In dieser Deutung gehe ich weit über die historische Zeit und deren Deutung hinaus. Wenn es bereits für normale Bücher gilt, dass ein Text mehr weiss als seine Autorin, so gilt dies für mythische Texte erst recht. Mein Zugang ist erfahrungsbezogen, und im Unterschied zur Monografie von Balz-Cochois verweigere ich mich einer (queer)feministischen und (tiefen)psychologischen Herangehensweise nicht, im Gegenteil ist dies wesentlicher Teil meines eigenen Standpunktes. Natürlich fliesst auch meine theologische und exegetische Ausbildung mit hinein. Auch wenn ich mich bemühe, möglichst viele Lebensrealitäten einzubeziehen, so schreibe ich doch aus der Perspektive einer weissen Schweizerin des oberen Mittelstandes und aus der Perspektive einer *Frau, die es sich leisten kann, Teilzeit zu arbeiten, um genügend Zeit für das Schreiben zu finden. Dies heisst selbstverständlich auch, dass ich keinerlei Anspruch darauf erhebe, diesen Mythos umfassend erschlossen zu haben. Ganz im Gegenteil erhoffe ich mir, dass sich ihm noch viel mehr Menschen deutend, erlebend, romanhaft oder künstlerisch nähern und ihn dadurch in die heutige Zeit hineinwirken lassen.
Das Buch eignet sich gut zur selektiven Lektüre. Wer sich nicht so sehr für die theoretischen, historischen und spirituellen Zusammenhänge interessiert, kann die sachbezogenen Kapitel «Heldinnenreise», «Inanna und Ereschkigal historisch eingebettet», «Inanna, Gender und Queer» sowie «Inanna, Dumuzi und Jesus» weglassen. Wer vor allen Dingen erfahrungsbezogen an den Mythos herangeht, wird sich vielleicht vorwiegend den empfohlenen Übungen widmen und die Erfahrungsberichte lesen. Wer psychologisch, existenziell, feministisch und spirituell interessiert ist, wird die Deutungen lesen und mit ihnen in einen (kritischen) Dialog treten. Ich habe mich bemüht, weiterführende sachbezogene Ausführungen in die Fussnoten zu verlegen. So kann die Lesende selbst entscheiden, wie gründlich und wie vertieft sie lesen will. Und vielleicht trifft das Buch auch auf Lesende, die wie ich strukturiert sind, welche am Ende eines sie interessierenden Buches sogar die Bibliographie sorgfältig durchlesen, um sich von ihr zu weiterführender Lektüre inspirieren zu lassen.
Dieser Schatz dieses wohl ältesten uns bekannten Mythos soll für Menschen von heute in seiner archetypischen, initiatorischen und spirituellen Bedeutung erfasst und fruchtbar gemacht werden. Dazu möge mein Buch einen Beitrag leisten.
Ich wünsche mir, dass mein Buch dazu anregt, Inanna durch die Zeiten und durch die Welten sprechen zu lassen, sodass Lesende sich in ihrer Geschichte wiederfinden, sich inspirieren lassen und Mut schöpfen, ihre eigene Held:innenreise gehen oder sich einen Kreis zu suchen, um es gemeinsam zu tun.
1 Vgl. Marie Göttner-Abendroth, die die ursprünglichen Heldentaten des Hera-kles als der Göttin Hera gewidmet deutet und eine gänzlich andere Perspektive einnimmt als die spätere Mythenschreibung, welche Hera als verbitterte, eifersüchtige Rächerin sieht sowie Herakles als Helden, welcher den Mord an seinen Kinder sühnen muss und Taten begeht, die eindeutig im Zeichen des gewalttätigen Patriarchats stehen.
2 Oder war es umgekehrt: sie hat mich gefunden?
3 Es ist ein Geschenk an die heutige Zeit, dass wir nun Zugang haben zu den sumerischen und akkadischen Texten, die von den Forschenden entziffert wurden und bis in die Zeit um 2000 v.Chr. zurückreichen und somit zu den ältesten schriftlichen Texten der Menschheitsgeschichte gehören.
4 Und als Theologin möchte ich ergänzen, dass auch der Weg Christi derjenige einer vertikalen Heldenreise ist. Siehe Kapitel Inanna, Jesus und Dumuzi
5 Vgl. Tokarczuk 2006, S. 199
6 Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, 1. Auflage 2019, S. 127f: „Um solche Ergebnisse zu vermeiden, wäre es klug, für jeden Dollar und jede Minute, die wir in die Verbesserung künstlicher Intelligenz investiere, einen Dollar und eine Minute in die Förderung menschlichen Bewusstseins zu stecken. Leider unternehmen wir gegenwärtig nicht viel, um menschliches Bewusstsein zu untersuchen und zu entwickeln…. Wir schaffen jetzt zahme Menschen, die ungeheure Mengen an Daten produzieren und als ausgesprochen effiziente Chips in einem riesigen Datenverarbeitungsmechanismus fungieren, aber diese Datenkühe schöpfen das menschliche Potenzial nicht wirklich aus. Wir haben vielmehr gar keine Vorstellung, wie das volle menschliche Potenzial aussieht, denn wir wissen so wenig über den menschlichen Geist. Und doch investieren wir kaum in die Erkundung des menschlichen Geistes und konzentrieren uns stattdessen darauf, die Geschwindigkeit unserer Internetverbindungen und die Effizienz unserer Big-Data-Algorithmen zu verbessern, wenn wir nicht aufpassen, haben wir am Ende verkümmerte Menschen, die mit Unterstützung verbesserter Computer der Welt ungeheuren Schaden zufügen.
7 Riane Eisler postuliert in ihrem wegweisenden Buch «Kelch und Schwert.», dass diese Gesellschaftsform vor der Ausbildung des Patriarchats vorherrschend war. Sie betont, dass es nicht ein Matriarchat gab im Sinne einer Unterdrückung der Männer, sondern dass die Gesellschaft zwar matrilinear organisiert war und die weiblichen Werte des Nährens, des Schenkens, des Teilens und der Beziehung im Vordergrund standen, aber ohne Unterjochung, Versklavung und Ausbeutung des anderen Geschlechts. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob es eine Art Urgesellschaft gab, in der dies flächendeckend der Fall war oder ob es verschiedene Formen nebeneinander gab, so wie es auch in indigenen Gemeinschaften sowohl patriarchal als auch matrilinear strukturierte Kulturen gibt. Hierzu wird sicherlich noch mehr geforscht werden, hoffentlich auch weiterhin aus feministischer Perspektive.
8 Jes 11, 6; Jes 65, 25
9 Zum Thema Mythos möchte ich die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zitieren: «Ein Mythos ist in dem Masse wirklich, in dem alles, was wahrgenommen wird, ebenso wirklich ist. Solange wir die Götter auf ihren Reisen, Abenteuern, in ihren Metamorphosen, ihren Schöpfungen und Apokalypsen begleiten, existieren sie auch. Und so existiert auch Inanna», Tokarczuk 2006, S. 187
10 S. Glossar
12 Hier unterscheide ich mich auch ganz klar vom Buch der Alttestamentlerin Helgard Balz-Cochois, «Inanna – Wesensbild und Kult einer unmütterlichen Göttin», die alle Versuche, Inanna auch tiefenpsychologisch zu deuten, radikal ablehnt (S. 17f). Ich verstehe zwar das Argument, sich gegen vorschnelle Vereinnahmungen zu wehren, sowie Dinge zu postulieren, die schlicht historisch falsch sind, dennoch gibt es bekanntlich auch in der Theologie tiefenpsychologische Exegese, sowie es auch feministische, materialistische, befreiungstheologische und fundamentalistische Exegese gibt, um nur einige zu nennen.
13 Daher kann ich bspw. Inanna nicht einfach als Mondgöttin deuten wie Göttner-Abendroth und Hämmerling, denn dafür gibt es m.W. keinerlei historischen Belege.
Danksagung
Es gibt sehr viele Menschen, denen ich zu Dank verpflichtet bin, weil sie direkt oder indirekt zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben. Meine mittlere Schwester Martina hat einen Teil meines Buches gegengelesen und damit als Lektorin fungiert mit vielen wertvollen Hinweisen, meine jüngste Schwester Eveline hat den Umschlag des Buches fachkundig gestaltet.
Eine grosse Quelle der Inspiration war und ist mir Marianne Verny, Präsidentin des Instituts für Prozessarbeit, die mich in den Geburtswehen dieses Buches kompetent begleitet hat und schon lange selbst mit dem Mythos der Inanna unterwegs ist. Sie ist für mich lebendiges und inspirierendes Vorbild einer Frau, die eine Institution leitet mit einem patriarchal geprägten Gründungsmythos. Ich freue mich sehr, dass sie bereit war, das Vorwort zu schreiben! Mich hartnäckig immer wieder ins Spüren geführt hat Beatrix von Crayen, meine ehemalige Lehrtherapeutin des Instituts für Prozessarbeit. Sie hat zu einigen Erfahrungen beigetragen, die in das Buch eingeflossen sind. Elke Schlehuber hat mich mit ihren Hinweisen davon überzeugt, den Beginn des Buches klarer und ausführlicher zu fassen. Sie ist selbst Autorin und eine Meisterin darin, aus der Tiefe heraus mutig Prozesse anzustossen und zu gestalten und darin eine wahre Heldin. Sie hat mich nach dem Seminar zum Thema Heldenreise im Übrigen darauf hingewiesen, dass es noch kaum Forschung gibt zur weiblichen Heldinnenreise, als ich sie dazu befragte.
Margrit Wenk, meiner Kontemplationslehrerin und seit vielen Jahren meine spirituelle Begleiterin verdanke ich unendlich viel, unter anderem war sie meine erste Lehrerin in Bezug auf das tiefe Wissen, dass wir mit allem verbunden sind und letztlich EINS. Sie ist eine wahre Hebamme der Liebe, einige Erfahrungen des Buches verdanke ich ihr. Sie hat darüber hinaus einen eigenen Text für dieses Buch zur Verfügung gestellt.
Allen, die mit eigenen Erfahrungen zu diesem Buch beigetragen haben, danke ich sehr herzlich: den drei Frauen, welche die Pioniergruppe bildeten meiner ersten von mir angeleiteten Heldinnenreise. Das war ein richtiges Hin- und Herfliessen zwischen ihnen, mir und dem wachsenden Text. Sie haben nicht nur mit ihren eigenen Erfahrungen beigetragen, sondern auch mit ihren Ergänzungen, Erweiterungen und eigenen Hinweisen. Der Hebamme Sonia Koller danke ich für ihren Beitrag. Und ich danke allen, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hier nicht namentlich erwähnt werden, mir aber alle die Erlaubnis gaben, ihre Erfahrungen zu verwenden.
Dann gibt es eine Reihe von Menschen, die indirekt dazu beigetragen haben, dass dieses Buch reifen konnte. Meine Ahn:innen, meine Grosseltern und meine Eltern. In diese Familienseele bin ich hineingeboren worden und dank ihnen bin ich, die ich heute bin. Ihrethalben weiss ich mittlerweile viel über transgenerative Traumata und welche Auswirkungen auf Individuen kollektive Ereignisse wie Krieg haben können.
Zu diesem Wissen beigetragen hat auch meine damalige systemische Therapeutin Joyce M. Schmid, die sich mir weise für meine Mutterübertragungen zur Verfügung stellte. Sie hat mich als Erste mit der erstaunlichen Kraft der morphogenetischen Felder bekannt gemacht. Mein schamanischer Lehrer Carlo Zumstein liess mich darauf vertrauen, dass alles möglich sein kann. In seiner Ausbildung bin ich erstmals Inanna begegnet. Ich danke auch allen Lehrenden am Institut für Prozessarbeit, namentlich dem noch nicht erwähnten Stephan Müller, ein weiser Enki, dem ich viel verdanke an Traumaarbeit und Traumaforschung, zusammen mit seiner Frau Marianne Sinner. Ebenso erwähnen möchte ich Kate Jobe, die mir immer wieder tiefe spirituelle Erfahrungen ermöglichte in veränderten Bewusstseinszuständen und Ivan Verny, ein Pionier der Kombination von Prozessarbeit mit systemischer Arbeit.
In Bezug auf Matriarchatsforschung verdanke ich Christina Schlatter vom MatriArchiv sehr wertvolle Hinweise auf Bücher.
Sehr vieles verdanke ich im Übrigen zahlreichen Büchern, die für mich zu indirekten Inspirationen wurden. Mit einigen Autor:innen fühle ich mich seelenverwandt. Namentlich erwähnen möchte ich Starhawk, Gertrude R. Croissier, Olga Tokarcuk mit ihrem Nachwort und zum Schluss gesellte sich noch Kim de l’Horizon dazu. In Bezug auf Sachwissen über die sumerische Zeit und Inanna verdanke ich am Meisten Henriette Broekema, und natürlich der genialen Übersetzung von Diane Wolkenstein ins Englische. Für die Entdeckung der weiblichen Heldinnenreise war Joseph Campbell verantwortlich, sein Buch war es, das mich ins Nachdenken und Forschen brachte und mich die weibliche Struktur der Held:innenreise entdecken liess im Mythos der Inanna und Ereschkigal. Arny und Amy Mindell haben mit den Strukturen ihrer genialen Bücher dazu beigetragen, mir die Idee zu vermitteln, in mein Buch Übungen einfliessen zu lassen, damit Lesende sich selbst auf den Weg begeben können. Die Übungen dieses Buches – und nicht nur sie - sind zutiefst inspiriert von der Prozessarbeit, deren Gründer sie sind.
Ich danke allen Mitstudentinnen und -studenten des Instituts für Prozessarbeit. Wie Hebammen haben sie mich oft in meinem eigenen Prozess unterstützt. Namentlich erwähne ich Natalie, Kasja, Ulrich, Markus und René. Vieles, was sie mir an Erfahrungen ermöglichten, fand in diesem Buch seinen Niederschlag.
Ebenso danken möchte ich meinen Trommelkreisfrauen. Gemeinsam erkunden wir Welten und halten in all unserer Verschiedenheit einen tiefen Raum des weiblichen Vertrauens. Die Erfahrung, in einem Frauenkreis gehalten zu werden, ist für mich von unschätzbarem Wert.
Schliesslich möchte ich meinen beiden Töchtern Sophia und Eliane danken. Beide haben mich so unendlich vieles gelehrt, was ich gar nicht benennen kann. Ich liebe euch!
Mein tiefster Dank geht an das Unnennbare. Ich hatte den Eindruck, immer im richtigen Moment auf die passenden Erfahrungen, richtigen Menschen oder inspirierenden Bücher zu stossen. Das kann frau nicht machen, das geschieht einfach.
Heldinnenreise
Damit die Lesenden erfahren, warum ich auf eine vertikale Held:innenreise gestossen bin, möchte ich im ersten Kapitel zuerst kurz die horizontalen Heldenreise gemäss Campbell vorstellen, um dann den Unterschied der vertikalen Held:innenreise gemäss Inanna herauszuschälen.
Der Held in tausend Gestalten
In dem bereits erwähnten Buch „Der Heros in tausend Gestalten“ des Professors für Mythologie Joseph Campbell, veröffentlicht vor über 60 Jahren, untersucht er die Struktur der überwiegend männlichen Heldenreise, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen14. Dies liegt nicht einfach nur daran, dass ein weisser Mann dieses Buch schrieb15, sondern durchaus auch am Material selbst, das er bearbeitet hat.
Sowohl in Mythen, Märchen und Erzählungen sind Heldenreisen überwiegend männlich konnotiert. Ich nenne: Gilgamesch, die griechischen Helden und Götter Herakles, Achilles, Odysseus, Prometheus, der orientalische Sindbad der Seefahrer, die deutschen und schweizerischen mythischen Parzival, Siegfried, Wilhelm Tell, Winkelried, aus dem englischen Sprachkreis König Arthus, Richard Löwenherz, Robin Hood, die biblischen Gestalten Abraham, Simson, Joseph, David und Goliath, der Prophet Jonas, oder an göttlichen Gestalten und Religionsstiftern Shiva, Buddha, Jesus, Mohamed, an neueren Helden wären u.a. zu nennen Zorro (Mexiko), Buffalo Bill, und Harry Potter.
Bezeichnenderweise wurde Jeanne d’Arc, diejenige Heldin, welche wie die männlichen Helden in den Krieg zog, geköpft und verbrannt. Sie teilte ihr Schicksal mit unzähligen „Hexen“, die in der frühen Neuzeit gefoltert und verbrannt wurden (mehrheitlich zwischen 1450-1750).
In den Grimm’schen Märchen spielen *Frauen oft passive Rolle als Prinzessinnen, welche gerettet werden (Dornröschen, Schneewittchen) oder figurieren als böse Hexe. Das Weibliche ist also entweder passiver Gegenstand für männliche Rettungsbemühungen oder aber Widersacherin des männlichen Helden oder des unschuldig Guten Weiblichen. Ausnahmen gibt es wie z.B. Frau Holle.
Struktur der Heldenreise nach Campbell
Campbell hat eine Struktur herausgearbeitet, unter der eine Heldenreise stattfindet. Die Reise beinhaltet drei Teile, welche in weitere Etappen unterteilt sind, die nicht alle vorkommen müssen:
1. Der Aufbruch (oder Auszug)
2. Die Initiation
3. Die Rückkehr
Der Aufbruch ist unterteilt in folgende Etappen:
1. a) Die Berufung: Der Held erhält seinen Ruf, sei es durch eine Botschaft oder durch eine Aufgabe, die ihm zufällt (im Grimm-Märchen «Das Wasser des Lebens» ist es die Krankheit des Königs, die seine Söhne ausziehen lässt, nur dem Jüngsten gelingt die Reise)
b) Die Weigerung: Der Held will seinem Ruf nicht folgen (klassisch in der biblischen Erzählung von Jona, der fliehen will)
c) Übernatürliche Hilfe: Wenn der Held auszieht, erfährt er übernatürliche Hilfe, etwa durch eine weibliche, männliche oder mythische Gestalt, einen magischen Gegenstand oder ein Tier (im Grimm-Märchen «Der arme Müllersbursche und das Kätzchen» ist es letztgenanntes, das dem jüngsten Müllerssohn hilft, zum verlangten Pferd zu finden und die Aufgabe zu erfüllen). Wichtig ist, dass der Held jeweils auf die Gestalt hört. In Geschichten, in welcher mehrere Söhne ausziehen, um die Reise zu vollbringen, ist dies oft entscheidend: wer hören kann, wer die Zeichen beachten kann, dem gelingt die Reise.
d) Das Überschreiten der ersten Schwelle: Hier begegnet der Held der ersten Herausforderung, oft in dämonischer Gestalt. Wenn er sie bezwingt und auch ihre dämonische Natur erkennt, dann geht die Reise weiter.
e) Der Bauch des Walfisches: Nicht nur in der oben erwähnten Erzählung von Jona kommt es vor, dass der Bauch des Walfisches sinnbildlich steht für Tod und Wiedergeburt. Hier muss der reisende Held im übertragenen Sinn sterben, um neu und anders wiedergeboren zu werden. Bei Jona führt sein Aufenthalt im Walfischbauch z.B. dazu, dass er dem Ruf folgt.
Die Initiation ist unterteilt in folgende Etappen:
2. a) Der Weg der Prüfungen: In der Traumwelt, in die der Held nun eingetreten ist, besteht er Prüfungen und wird dabei oft geleitet und unterstützt von der übernatürlichen Hilfe, die er bereits bei seinem Aufbruch erfahren hat. (Ich erinnere an das Märchen vom «tapferen Schneiderlein», in welchem dieses die Prüfungen des Königs erfüllt, die Riesen besiegt, das Einhorn und das wilde Schwein)
b) Die Begegnung mit der Göttin: hier begegnet der Held der Göttin. Diese kann vielerlei Gestalt haben. Sie kann nährende Mutter sein, Erdgöttin, Schicksalsgöttin oder auch böse Hexe. Auf jeden Fall gehört diese Begegnung dazu, um weibliche Aspekte zu integrieren.
c) Das Weibliche als Verführung: Hier begegnet der Held dem Weiblichen als einer Kraft, die ihn von seiner Heldenreise abbringen will. Sprichwörtlich ist die Fahrt des Odysseus, der sich fesseln lässt, um dem Gesang der Sirenen nicht zu erliegen, ihn aber dennoch hören zu können.
d) Die Versöhnung mit dem Vater: In manchen Märchen wird der Held vom Vater verstossen. Erst die Wandlung und die Initiation des Helden bewirkt die Versöhnung. Ich erinnere mich auch an den Prozess von Luther, der rang und kämpfte, bis er zu einem gnädigen Gott fand.
e) Die Apotheose16: Dies ist eine Stufe, die der Held erfährt, der die Prüfungen bestanden hat. So wird er nun verklärt mit göttlichem Licht und ebensolchem Glanz. Moses, der auf dem Berg die Gesetzestafeln empfängt und Gott schaut, ist nach seinem Abstieg verklärt und umgeben von einem Leuchten. Die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor mit seinen Freunden ist auch eine solche Erzählung. Auch die Erleuchtung des Boddhisattvas17 Avalokiteshvara hat diesen Charakter. Laut Campbell liegt es auch an der Vereinigung von männlichen und weiblichen Aspekten18, welche zu dieser Verklärung führen.
f) Die endgültige Segnung: Oft geschieht diese durch eine göttliche oder mythische Gestalt. Gilgamesch (auf der Suche nach Unsterblichkeit) erfährt sie bei Utnapischtim, der babylonischen Variante des Noah19.
Die Rückkehr schliesslich gliedert sich in folgende Etappen:
3. a) Die Verweigerung der Rückkehr: Mancher Held würde gerne dort bleiben, wo er die Heldentaten vollbracht hat. Schliesslich lebt es sich so gut in dieser (göttlichen) Anderswelt, in der es Aufgaben zu bewältigen gilt. Wäre es nicht besser, gleich hier zu bleiben? Überhaupt, wer wartet schon auf die Rückkehr des Helden. Wer wird auf ihn hören? Wer wird die Veränderung wertschätzen? Wer wird seine Gaben brauchen? Hat das alles einen Sinn?
b) Magische Flucht: Sie ist die Umkehr des Obigen. Der Held möchte zurück, aber da er die Aufgabe vielleicht gegen Widerstand eines Wächters gelöst hat, braucht es eine magische Flucht. Hierbei unterstützen ihn die Kräfte, die ihn ursprünglich auf die Reise geschickt haben und ermöglichen ihm die magische Flucht für die Rückkehr.
c) Rettung von aussen: Möglicherweise ist auch eine magische Flucht nicht möglich, dann braucht es eine Rettung von aussen.
d) Rückkehr über die Schwelle: So wie der Held über die Schwelle geschritten ist bei Beginn seiner Heldenreise muss er dies bei seiner Rückkehr wieder tun. Er muss eintreten aus der Welt der Visionen und Träume in die Welt des Alltäglichen, zum Teil Banalen, Irdischen. Er muss bereit sein, seine Gaben genau hier einzubringen. In Märchen geschieht dies oft, indem der Held in das Schloss gelangt (in welchem er später dann in der Regel herrschen wird).
e) Herr der zwei Welten: Dies sind die neuen Fähigkeiten des Helden, er vermag es nun, beide Welten zu verbinden und zu vereinigen. Sowohl die Welt, in der er seine Aufgaben gelöst hat und den Individuationsweg durchschritten hat, als auch die Welt der Alltagswirklichkeit. Die Verbindung dieser zwei Welten gehört zu den Gaben, die ein Held mitbringt und integriert. In schamanischen Kulturen war die Durchdringung der beiden Wirklichkeiten eine Selbstverständlichkeit, insbesondere für die initiierten Schaman:innen selbst. Die Welt der Geister und die Welt der Menschen durchdrangen sich gegenseitig.
f) Freiheit zum Leben: Der Held ist initiiert, erleuchtet, hat seine Aufgaben gelöst und hat nun die Freiheit, zu leben. Denn er ist durch die Reise und durch die Fähigkeit, in beiden Welten zuhause zu sein, befreit und innerlich gelöst von der Furcht zu sterben.
In dieser Struktur wird deutlich, dass es tatsächlich sehr viele Aspekte gibt, die zugeschnitten sind auf eine männliche Heldenreise, ich erinnere an die Begegnung mit dem archetypisch Weiblichen, an die Versöhnung mit dem Vater. Und gleichzeitig ist es eine Reise, die nicht nur von Männern begangen wird, sondern auch von Frauen, heutzutage öfters als früher, da die Geschlechterrollen fluider werden.
Ersichtlich wird auch, dass die Reise in Bereiche der Seele führt, die dem Alltagsbewusstsein ferner sind, Bereiche, die in das Traumland, das Unterbewusstsein und bis hinein in archetypisch-mythische Schichten reichen20.
14 Auch Inanna kommt übrigens vor
15 Hat er sich doch z.B. intensiv mit den Thesen Marija Gimbutas auseinandergesetzt, die als Archäologin das Neolithikum (Jungsteinzeit) in Europa erforschte und sich verdient machte in der Entdeckung der matrilinearen friedlichen Gesellschaften von damals.
17 Ein Boddhisattva entschliesst sich, so lange wiedergeboren zu werden, bis alle Wesen zur Befreiung und Erleuchtung gefunden haben, d.h. diese Seele verzichtet bewusst und aus Liebe, aus dem Rad der ewigen Wiedergeburten auszubrechen und ins Nirwana einzugehen.
18 Campbell 2019, S. 175
19 Campbell 2019. S. 201ff. Dabei gilt es zu bemerken, dass Gilgamesch ein Beispiel ist für eine Heldenreise, die nicht gelingt. Mehr dazu später. Vgl. auch die feministische Nacherzählung in Göttner-Abendroth 2004, S. 47ff
20 In der Prozessarbeit nach Mindell gibt es ein Wahrnehmungsmodell, das diesen Bereich als Traumland bezeichnet, der schliesslich dort kulminiert, an dem alles Eins ist, die sogenannte Essenzebene. Es ist die Ebene, die in allen Religionen, Kulturen und Philosophien unterschiedliche Namen trägt und über die man eigentlich nichts aussagen kann, da die Erfahrung jenseits des Sagbaren liegt. All-Eins, Gott, Nirwana, Nichts, All-Eine, etc.
Und die Heldin?
Als ich das Buch von Campbell gelesen hatte, fragte ich mich, was das nun für mich als Frau heisst. Söhne ich mich statt mit dem Vater mit der Mutter aus? Begegne ich Gott anstelle der Göttin? Werde ich vom Männlichen versucht und verführt, das mich abhalten will von meiner Heldinnenreise?
Diese Fragen allein machen deutlich, dass eine Heldinnenreise anders strukturiert sein muss. Dazu kommt, dass eine Heldin auch Identifikationsfiguren braucht, Vorbilder, Archetypen, seien es nun historische Persönlichkeiten oder archetypische Figuren oder Märchengestalten. Es ist nicht so sonderlich attraktiv, sich in der Rolle der zu rettenden Prinzessin wieder zu finden.
Ausserdem ist es leider keineswegs so, dass sich die Zeiten seit Jeanne d’Arc grundlegend geändert hätten. Ein Schwarzer konnte sehr wohl US-Präsident werden, nicht aber eine Frau21! Wenn demnach Frauen Heldinnenreisen gehen, starke Stellungen einnehmen in Politik und Wirtschaft, kann dies immer noch gefährlich sein für sie, weltweit betrachtet sowieso, ungeachtet dessen, dass es durchaus starke Frauen gab und gibt in patriarchalen Gesellschaften wie Benazir Bhutto, Indira Gandhi, Golda Meir, Aung San Suu Kyi u.a.m.
Auch ich suchte in meinem Studium unbewusst nach Heldinnen, nach Vorbildern in der männerdominierten Kirche. Ich fand sie damals in der spanischen Nonne Teresa von Avila aus dem 16. Jh., die väterlicherseits aus einer Conversofamilie22 stammte. Sie reformierte den Orden der Karmelitinnen und Karmeliter, gründete mehrere Klöster, darunter zwei Männerklöster, schrieb theologische Werke und stand mit den bedeutendsten Theologen ihrer Zeit im Austausch. Darüber hinaus ebnete sie den Weg dafür, dass Frauen einen eigenständigen spirituellen und kontemplativen Zugang hatten zu Gott. Zuvor hielt man sie nur für fähig, an einem Chorgebet teilzunehmen. Dies alles zu einer Zeit, in welcher nur 10% der *Frauen überhaupt lesen konnten.
Vielleicht oder hoffentlich haben auch Sie, liebe Leser:innen, Heldinnen gefunden, mit welchen Sie sich identifizieren konnten.
Als ich begann, mich tiefer mit dem Mythenkreis um Inanna zu beschäftigen, fielen mir die Unterschiede auf zu der männlich geprägten Heldenreise, ich entdeckte die vertikale Struktur der Heldinnenreise. Daher möchte ich anhand des Inannamythos eine Struktur der Heldinnenreise entwerfen. Damit erhebe ich nicht denselben Anspruch wie Campbell, eine allgemeingültige Struktur für eine weibliche Heldinnenreise festzulegen, dies lässt sich anhand von einem einzigen Mythos nicht tun.
Struktur der Heldinnenreise gemäss Inanna
Der Mythenkreis um Inanna beginnt bereits vor ihrem Abstieg in die Tiefe, in welchem sie sich auf den Weg begeht zu ihrer dunklen Schwester. Diese Vorgeschichten sind wegleitend und Voraussetzung für die spätere Heldinnenreise. Anders als in anderen Mythen und Märchen wird hier vorausgesetzt, dass vor dem durchaus furchterregenden Abstieg in die Tiefe ein vorgängiger Reife- und Ermächtigungsprozess vonnöten ist, sozusagen ein Aufstieg in den Himmel und eine Ermächtigung auf Erden.
Man kann die erste Erzählung um den Huluppubaum deuten als Initiation einer jungen Frau, die bereits über die Fähigkeit verfügt, die Weltachse zu richten, d.h. Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Hier wird sie auch zur Königin des Himmels. Die «übernatürliche» Hilfe erfährt sie durch Gilgamesch.
Die zweite Erzählung über den Raub der ME-Kräfte lässt sie dann ihre Herrschaft auf Erden antreten und stattet sie aus mit (magischen) Kräften. Diese holt sie sich allerdings mit List, Selbstbewusstsein und zielbewusstem Willen selbst. Diese Reise ähnelt am Meisten einer horizontalen Heldenreise gemäss Campbell, es tauchen Dämonen auf, da wird gekämpft und schliesslich gesiegt und am Schluss geschieht eine friedliche Versöhnung.
In der dritten Erzählung der Liebesverbindung und heiligen Hochzeit mit Dumuzi wird sie nicht nur zur initiierten Frau, sondern verleiht Dumuzi mit der Heiligen Hochzeit auch Teilhabe an ihrer Göttlichkeit. Viele Heldenreisen enden an diesem Punkt: da ist es der Held, der zurückkehrt und die Königstochter heiraten darf. Ausgestattet mit den magischen Me-Kräften und mit Dumuzi an ihrer Seite könnte die Reise jetzt enden.
Doch nun beginnt die eigentliche Heldinnenreise in das Grosse Unten.
1. Der Aufbruch:
a) Der Ruf: Im Unterschied zur Heldenreise erfolgt hier der Ruf von innen. Die Heldin hört auf das Grosse Unten.
b) Aufbruch bis zur Schwelle: die Heldin sorgt dafür, dass eine Wächterin, eine Hüterin, oben bleibt und Hilfe holen kann (im Mythos Ninshubur, welche bis zum Tor mitkommt)
2. Der Weg:
a) Die Heldin durchschreitet sieben Tore der Wandlung. Im Unterschied zu den Heldenreisen, in denen der Held magische Kräfte oder Objekte erhält, muss sie diese Stück um Stück allesamt abgeben, bis sie nach dem letzten Tor völlig nackt ist.
3. Die Initiation:
a) Die Heldin stirbt
b) Ihre Wächterin holt Hilfe
c) Die Hilfe erfolgt durch einen männlich-weisen Archetyp, dem Wasser und den Gefühlen verbunden (im Mythos Enki)
d) Der Schmerz des Todes (oder der Todesgöttin) wird in seiner ganzen Tiefe wahrgenommen, bezeugt und gesehen
e) Die Heldin erhält die Nahrung und das Wasser des Lebens
4. Die Rückkehr:
a) Die Heldin kehrt zurück und muss ein Opfer bringen
b) Sie bestimmt das männliche Prinzip als Animus und Geliebten (Dumuzi) dazu, die Heldinnenreise auch zu gehen
c) Der Animus hat Todesangst und flieht
d) Die Anima (im Mythos Geschtinanna) fühlt den Schmerz und die Angst, trauert und wird dieses Schicksal teilen
e) Es beginnt der zyklische Auf- und Abstieg jeweils der Anima und des Animus in das Reich des Todes und wieder zurück23
f) Das Reich des Todes ist integriert und wird gepriesen.
Bei Reisen in die Tiefe wie Inanna sie geht, gelten weitgehend andere Gesetze als auf horizontalen Heldenreisen. Sie erinnern vielmehr an Reisen von initiierten Schamaninnen und Schamanen sowie an Erfahrungen von Mystikerinnen und Mystikern, die auf ihren Wegen jeweils auch mit sterbeähnlichen Erfahrungen konfrontiert werden. Und auch sie machen die Erfahrung, dass sie alle ihre bisherigen Ressourcen im Stich lassen. Es ist die dunkle Nacht der Sinne, die ein Johannes vom Kreuz beschreibt24 oder Erfahrungen, wie sie moderne Schamanen wie Carlo Zumstein25 offenlegen. Wenn es in der horizontalen Heldenreise auch darum geht, die Furcht vor dem Sterben zu integrieren, so könnte man in der Heldinnenreise die Integration des Todes geradezu als konstitutiv ansehen. Geburt und Tod werden als zyklisch zusammengehörend angesehen, die Verbindung zum weiblichen Körper drängt sich geradezu auf.
Der achtstrahlige Stern, das Symbol Inannas als Göttin des Morgen- und Abendsterns (Venus).
21 Anhänger Trumps riefen im Wahlkampf in Sprechchören «Lock her up» (sperrt sie ein), sodass Hillary Clinton später aussagte, sie sei sich gar nicht mehr wie ein Mensch vorgekommen. Das ist eine moderne Art, geköpft zu werden.
22 Zwangsgetaufte Juden. Mit dem Erlass von 1492 von Isabella und Fernando von Aragon hatten Juden nur die Möglichkeit, entweder alles zurück zu lassen inkl. Hab und Gut oder aber sich taufen zu lassen. Die zwangsweise Getauften standen aber immer unter der scharfen Beobachtung der Inquisition, da die Echtheit ihrer Bekehrung angezweifelt wurde . . Teresas Grossvater musste denn auch im Büsserhemd durch Toledo gehen. Nicht altkatholisch zu sein galt gesellschaftlich als Makel.
23 An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Begriffe Anima und Animus als weibliche und männliche Urkräfte verstehe, nicht im Sinne einer Festschreibung polarer Binaritäten, sondern als absolut gleichwertige Kräfte, die wir in uns tragen. Kocku von Stuckrad vermeidet die beiden Begriffe gänzlich, weil er sie durch die Abwertung des Weiblichen durch C.G. Jung kontaminiert sieht. Das Weibliche war nach C.G. Jung alles, was der Mann nicht war (d.h. die Frau das Abgeleitete), sie wurde am Idealbild Mann definiert. Ausserdem im Unterschied zum Mann, der seine (durch die Abwertung vergiftete) Anima als Individuationsweg integrieren sollte, war dies der Frau ausdrücklich verwehrt, da sie den Animus pervertieren würde und zu einer Karikatur der Männlichkeit machen. Vgl. von Stuckrad 2009, S. 14ff. Ich persönlich halte mehr davon, die Begriffe in heutigem Sinn zu gebrauchen und ggf. neu zu füllen und zu reinterpretieren, zumal ich davon ausgehe, dass auch die Tiefenpsychologie nach C.G. Jung wandlungsfähig ist.
24 Ein Weggefährte Teresa von Avilas, spanischer Mystiker und Karmelitermönch aus dem 16. Jh.
25 Im Buch «Reise hinter die Finsternis», Zumstein 2011
Inanna und Ereschkigal historisch eingebettet
Vorbemerkungen
Aufgeschrieben wurde der sumerische Mythos ca. 1750 v. Chr., stammend aus einer Zeit zwischen 3500-1900 v.Chr. Fast 4000 Jahre ruhte dieser Schatz eingraviert auf Tontafeln unentdeckt in den Ruinen von Nippur. Um 1900 wurden sie ausgegraben. Doch das war nur der erste Schritt. Lange haben die Forscher gebraucht, um die sumerischen Tafeln in eine logische Reihenfolge zu bringen, zumal die Tafeln in zwei unterschiedlichen Museen lagerten, um sie dann übersetzen und interpretieren zu können. Dazu kam, dass sich in dem grossen Material erst mit der Zeit die passenden Tontafeln fanden. Bis heute hat die Geschichte eine kurze Lücke26. Mit der poetischen Übersetzung von Diane Wolkenstein auf Englisch geschah 1983 ein erster Schritt, diesen Mythos einem Publikum bekannt zu machen, welches über die sumerisch-akkadischen, assyriologischen Wissenschaftskreise und archäologischen Forscher hinausging. Weitere wichtige und inspirierende Bücher folgten auch im deutschen Sprachraum.
Dieser Mythos stammt aus einer Zeit, in der das Patriarchat vergleichsweise jung war. Mit Inanna erscheint daher eine archetypische *Frauenfigur, deren Instinktnatur nicht beschnitten worden ist, die noch ganz Wolfsfrau27 ist resp. die in ihrem eigenen Initiationsweg alle Aspekte der menschlichen, weiblichen Natur integriert hat, den Mann dazu brachte, seinen Initiationsweg ebenfalls zu gehen und so für Fruchtbarkeit und Wohlergehen für Mensch und Natur sorgte.
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass der Text nur in englischer Übersetzung vollständig zur Verfügung steht in der bereits erwähnten sorgfältigen Übertragung von Diane Wolkenstein28. Wenn ich ihren Text in Auszügen übersetze, ist dies die Übersetzung einer Übersetzung. Es ist ungefähr so, als würde ich die Vulgata, die lateinische Übersetzung der biblischen Urtexte, ins Deutsche übertragen. Und jede Übersetzung birgt auch eine gewisse Deutung in sich, ist also ihrerseits bereits Interpretation.
Ich habe mich dazu entschlossen, nicht den ganzen Text wiederzugeben. Einerseits wegen seiner Länge, und andererseits, um bereits eine erste Deutungsarbeit zu leisten für die heutige Zeit, indem ich zusammenfassend nacherzähle. Dennoch möchte ich die Leserin einladen, sich auf die übersetzten Verse einzulassen, um etwas vom hymnischen29 und poetischen Charakter des Urtextes auf sich wirken zu lassen in seiner ganzen Schönheit.
Einführung in den Mythenkreis von Inanna
Inanna ist eingebettet in den sumerischen Götterolymp. Sie ist Tochter der Mondgöttin Ningal und des Mondgottes Nanna. Interessanterweise wird von ihr gesagt, dass die Tochter grösser werden kann als die Mutter. Eine bemerkenswerte Aussage, welche deutlich macht, dass Rang und Macht nicht von vorneherein eine Frage der Generationenfolge ist, sondern auch erworben werden kann. Bereits damit beginnt eine wichtige Ermächtigung für *Frauen. Das Kind darf grösser werden, die Tochter darf die eigene Mutter überragen, sie muss sich nicht in deren Schatten bewegen.
Ihr Bruder ist der Sonnengott Utu, sie selbst ist Göttin des Morgen- und Abendsterns. Gemeint ist der Planet Venus, welcher am Morgen im Osten erscheint als Morgenstern und am Abend im Westen als Abendstern. Aufgrund des Venuszyklus, welcher schneller verläuft als die Erde, gibt es Zeiten, in welchen sie sowohl am Morgen als auch am Abend sichtbar ist sowie Zeiten, in welchen sie nur als Morgenstern oder nur als Abendstern oder gar nicht sichtbar ist30. Die griechische Aphrodite und die römische Venus haben Inanna als Vorbild, im akkadischen und babylonischen Reich wurde sie später zu Ischtar, ihre phönizische Schwester ist Astarte. Sie wacht über die Kräfte, die Tag und Nacht voneinander unterscheiden. Sie ist die Göttin der Liebe. Gemeint ist ausdrücklich auch die romantische, die sexuelle Liebe. Später wurde sie dann auch zur Göttin des Krieges, als sich das Patriarchat stärker verfestigte. Vermutlich fliessen in der sumerischen Inanna Züge mehrerer Göttinnen zusammen, doch diese Ursprünge liegen im Dunkel der Geschichte31.
Ihre Schwester Ereschkigal hingegen ist genealogisch nicht direkt verbunden, weder mit ihr noch mit sonst jemandem aus der Götterwelt.
Offensichtlich sind die Genealogien Entwicklungen im dritten Jahrtausend vor Christus, in der die unterschiedlichen Stadtgötter Sumers zueinander in Beziehung gesetzt wurden als patriarchale Familie mit dem männlichen Gott An, dem Gott des Himmels, ein ferner Gott, als oberste, wenn auch nicht wichtigste Gottheit32.
Genealogie von Inanna
Inannas Schriftzeichen ist ein Schilfringbündel. Sie wurden verwendet bei Torbogen als Eingang zu einem heiligen Ort. Noch bis vor kurzer Zeit wurden im Süden des Irak solche Schilfringbündel verwendet für zeremonielle Hütten. Gemäss dem babylonischen Schöpfungsmythos «Enuma Elisch» befindet sich hier eine der Urzonen der Schöpfung, die Trennung von Salz- und Süsswasser fand statt in je eigene Gottheiten33. Das Schriftzeichen steht auch für die Zahl 1534 (bei Nanna, dem Mondgott, entspricht sein Zeichen der Zahl 30, einem Monat).
Inanna war die Stadtgöttin von Uruk, einer für damalige Verhältnisse sehr grossen Stadt (20000 Einwohner, die grösste Stadt Sumers), stark befestigt und in regem Handel begriffen. Sie lag auf dem Gebiet des heutigen Irak, dessen Name die ursprüngliche Stadt Uruk immer noch in sich trägt. Ihr Tempelkomplex Eanna (Haus des Himmels) inmitten der Stadt war gross, zwei der Tempel hatten zusammen fast die Grösse der Notre Dame. Neben Inanna wurde in Uruk auch An verehrt, der Himmelsgott. Uruk ist die Stadt, in welcher die ersten Schriftzeugnisse der Menschheit gefunden wurden.
Als die Menschen anfingen, Götter figürlich und von Menschen unterscheidbar darzustellen, waren deren Attribute Kronen und/oder Hörner, Datteln (als Symbol für die Fruchtbarkeit), Flügel, Löwen.
Die Welt in Sumer war durchtränkt von Religiosität. Dabei gab es keinerlei Trennung zwischen Alltag und Religiosität, sondern beides floss ineinander über. Die *Frauen befruchteten weibliche Dattelpalmen und dachten dabei an Inanna (es gibt Rollsiegel, die Inanna bei dieser Tätigkeit zeigen), die Menschen brachten Opfer im Tempel dar und dankten für die gute Ernte, usw. Auch die Götter ähnelten vielleicht eher bestimmten Energien, die fliessend waren und auch wechseln konnten.
Inanna wurde über Jahrhunderte, ja eigentlich über Jahrtausende verehrt in der Sumerischen, Akkadischen und wiederum sumerischen Kultur. In der akkadischen Kultur nannte man sie Ischtar, in der späteren babylonischen wurde sie dann endgültig zu Ischtar. Der Zeitraum erstreckt sich von 2900 (frühe Dynastie) bis zum altbabylonischen Reich ab 1894. Dass die Verehrung der Himmelskönigin Ischtar unter verwandten Göttinnen weiterging resp. zu ihnen überging als Lokalgottheiten, sehen wir bei der phönizischen35 Variante von Ischtar, der Göttin Astarte36. Ihre Verehrung finden wir in der Bibel bezeugt (der weise König Salomo verehrte sie offiziell37) und sie hat zweifellos sehr enge Verwandtschaft zu Inanna resp. Ischtar. Interessanterweise wird ein Streitgespräch zitiert im Buch des Propheten Jeremia38, in welchem sich die Frauen mitsamt ihren Männern vehement dagegen aussprechen, ihren Kult zu verbieten, denn als sie ihr Himmelsbrote gebacken hatten und Räucheropfer dargebracht, sei es ihnen gut gegangen, besser als jetzt. Eine sehr spannende matriarchale Erinnerungsspur39.
Die Attribute einer Kriegsgöttin sind ihr erst in späteren Zeiten zugeordnet worden (assyrische Zeit) und spielen in unserem Mythenkreis keine Rolle. Auch gibt es jüngere Texte, die sie als unersättliche Nymphomanin erscheinen lassen. Gerade letzteres ist Ausdruck von abwertendem Blickwinkel der politischen und religiösen Eliten auf die Frau und auf die einst mächtige Göttin, die es dadurch zu erniedrigen galt. In der Epoche, in der unsere Mythen spielen, hätte sich dies niemand erlauben dürfen. So zeigt sich auch hier, wie die Göttin immer mehr marginalisiert wurde im Verlauf der Jahrhunderte und gleichsam verkümmerte.
Es gibt jedoch auch unterschiedlichen Facetten und Bilder von Inanna im Verlauf der Geschichte, die sich vergleichen lassen mit wechselnden Jesusbildern. Die Vielstimmigkeit beginnt bereits im Neuen Testament und zieht sich dann weiter über Zeiten, Kulturen und Konfessionen hinweg. Nicht nur theologisch ändern sich Zuschreibungen, auch in der figürlichen oder bildlichen Darstellung sind Unterschiede auszumachen. Ich umreisse grob und nur auf die westliche mitteleuropäische Kunst bezogen: da sind die alten Darstellungen, die Jesus als König und Weltenherrscher zeigen (frühes Mittelalter), da sind die Darstellungen, die ihn als leidenden Gottesknecht zeigen (am ergreifendsten für mich der Isenheimer Altar), da sind später die Bilder, die Jesus als Aufklärer zeigen, dann die romantischen Darstellungen Jesu mit blonden Locken, blauen Augen und einem Schaf im Arm als guten Hirten, da ist schliesslich das moderne Bild aus dem Lycée de Peronne, das Jesu Antlitz aus vielen Menschenköpfen aus aller Welt gebildet zeigt. Alles sind unterschiedliche Perspektiven, Darstellungen und Betonungen bestimmter Aspekte.
Solches lässt sich auch bei Inanna beobachten, die im Spiegel und in Wechselbeziehung mit der damaligen Kultur gestanden hat, nur dass es sehr viel früher geschah und schwieriger erforschbar ist.
Da Mythen auch seelische Wahrheiten ansprechen über ihren historischen, kulturellen und zeitlich bedingten und damit auch begrenzten Kern hinaus, haben sie immer auch einen zeitlosen Aspekt. Ihre Adaption für heute fokussiert auf diesen zeitlosen, seelischen Aspekt.
26 Wo sich Dumuzi nach der Ergreifung durch die Gallas aufhält, die vermutete Klage von Geschtinanna über ihren ergriffenen Bruder, das erste Auftauchen der Fliege. Vgl. «Inanna – Queen of Heaven and Earth» Diane Wolkenstein, Samuel Noah Kramer, S. 135
27 Vgl. Clarissa Pinkola Estes: Die Wolfsfrau, S. ff, die sehr anschaulich beschreibt, was die Unterdrückung der Instinktnatur der Frau für Folgen hat und wie mit dieser Unterdrückung auch das Überleben der Erde gefährdet erscheint.
28 Und hierzu möchte ich anfügen, dass es wie in Mythen üblich ist, auch unterschiedliche Varianten und Überlieferungen gibt, wie es auch in biblischen Texten der Fall ist. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass die Version, auf die sich Diane Wolkenstein stützt, die einzig historisch korrekte Version ist, vertraue jedoch darauf, dass es sich in weiten Teilen um die ältesten uns überlieferten Schichten handelt.
29 Hymnisch heisst gesanglich. Die Texte sind rhythmisiert, enthalten Wiederholungen, Verse, die wiederkehren, sind wohl rezitiert und/oder gesungen und vorgetragen worden. Sie wurden benutzt bei Kulten, Feiern, Festen, Tempelanlässen.
30 Das Verhältnis der Umlaufzeiten um die Sonne zwischen Erde und Venus beträgt 8:13, d.h. wenn die Erde achtmal um die Sonne gelaufen ist, so ist es die Venus dreizehnmal. https://de.wikipedia.org/wiki/Venuspositionen#:~:text=Positionen%20relativ%20zum%20Sternenhimmel,-Venus%20am%2026&text=Relativ%20zur%20Sonne%20wandert%20die,daher%20relativ%20zu%20ihr%20station%C3%A4r.
31 Es gibt die Spekulation, dass der achtstrahlige Stern, mit dem Inanna symbolisch dargestellt wird, möglicherweise seine Ursprünge bereits in vorschriftlicher Zeit hatte. Die Schamanin im Grab von Bad Dürrenberg, 7000 v Chr ist in einem oktogonförmigen Grab bestattet worden. Die beiden Autoren des Buches «Rätsel der Schamanin», Harald Meller und Kai Michel, weisen auf die Parallele zu Inanna hin, sind sich aber der rein spekulativen Verbindung bewusst. Vgl Meller/Michel 2022, S. 213
32 Broekema 2014., S. 165
33 Groneberg 2004, S. 151, es handelt sich um die Göttinnen Nammu und Ti’amat. Mehr zu Enuma Elisch weiter unten im Kapitel Inanna, Dumuzi und Jesus, Wirkungen und Folgen
34 Groneberg 2004, S. 23. Eine Erklärung dafür findet sich wohl im Beginn des Mythos beim Huluppubaum. Siehe Kapitel «Die Errichtung des Weltenbaumes».
35 Die Phönizier lebten im Raum Palästina-Israel-Libanon im 1. Jt. V. Chr.
36 Ihre Attribute sind die Schlange, oft wird sie mit der weiblich universellen Mondsichel dargestellt und daneben der Venusstern!
37 1 Kön 11, 5
38 Jer 44, 15-19 nach der Bibel in gerechter Sprache: 15 Da antworteten alle Männer dem Jeremia, die wussten, dass ihre Frauen anderen Gottheiten Räucherwerk darbrachten, und alle Frauen, die in großer Anzahl dabeistanden, und das ganze Volk, das sich im Land Ägypten in Patros aufhielt: 16 Was das Wort betrifft, das du zu uns im Namen Gottes gesprochen hast – wir werden nicht auf dich hören. 17 Sondern wir erfüllen gewissenhaft jedes Wort, das aus unsrem Munde kam, der Himmelskönigin Räucherwerk und Trankopfer darzubringen, wie wir, unsere Eltern, unsere Könige und Königinnen und unsere politische Führung es in den Städten Judas und in den Gassen Jerusalems getan haben. Da hatten wir genügend Brot zu essen, es ging uns gut und wir sahen kein Übel. 18 Aber seit wir aufgehört haben der Himmelskönigin Rauch- und Trankopfer darzubringen, fehlt es uns an allem und wir kommen durch Schwert und Hunger um. 19 Wenn wir Frauen der Himmelskönigin Räucherwerk und Trankopfer darbringen, beziehen wir unsere Männer da etwa nicht mit ein, wenn wir Opferkuchen mit ihrem Abbild bereiten und ihr Trankopfer darbringen?
Die Niederschrift dieses Prophetenbuches erfolgte zur Zeit des babylonischen Exils im 6. Jh. v Chr. Jeremia hatte den Untergang Jerusalems und die Deportation nach Babylon vorausgesehen.
39 «Die Frauen wollten der »Himmelskönigin», der matriarchalen Göttin, dienen, . . .Mit anderen Worten: Die Grosse Göttin schenkte Wohlstand und Frieden, Jahwe hingegen brachte Mangel und Krieg! Erstaunlich, dass ein für Jahwe so miserables, für die Göttin so gutes Zeugnis überhaupt – wenn auch unter negativem Vorzeichen – in der Bibel auftaucht.» Marti 2020, S. 49
Inannas Aufstieg – ihr Weg zur Göttin
Inanna
häute dich
greif nach den Sternen
steh in deiner Mitte
verwurzle dich tief
verbinde die Welten
und besteige deinen Thron
Die Errichtung des Weltenbaums
Ich beginne zunächst mit einer direkten Übertragung, um gerade zu Beginn vertraut zu machen mit dem Klang der Dichtung40.
In den ersten Tagen, in den wahrhaftig ersten Tagen
In den ersten Nächten, in den wahrhaftig ersten Nächten
In den ersten Jahren, in den wahrhaftig ersten Jahren
In den ersten Tagen, als alles, was notwendig ist, ins Gewordene kommt,
In den ersten Tagen, als alles, was notwendig ist, in passender Weise genährt wurde,
Als das Brot in den Kultstätten des Landes gebacken wurde,
Und das Brot in den Häusern des Landes gekostet wurde,
Als der Himmel sich von der Erde wegbewegt hatte,
Und die Erde sich vom Himmel getrennt hatte,
Und der Name des Menschen bestimmt wurde;
Als der Gott des Himmels, An, die Himmel davongetragen hatte,
Und als der Gott des Windes, Enlil, die Erde davongetragen hatte,
Als der Königin des Grossen Unten, Ereschkigal, die Unterwelt gegeben wurde als ihr Herrschaftsbereich.41
In dieser Zeit wird der Huluppubaum42 an den Ufern des Euphrat gepflanzt, genährt von seinen Wassern. Doch der Südwind zerrt an seinen Ästen, reisst an seinen Wurzeln, bis der Euphrat ihn fortträgt. Eine Frau, in Angst vor den Worten des Himmelsgottes An, in Angst vor den Worten des Windgottes Enlil, nimmt den Baum und sagt: ich will ihn nach Uruk bringen und in meinen Garten pflanzen. Es ist Inanna, die für ihn sorgt und sich dabei fragt, wie lange es wohl dauern würde, bis sie einen strahlenden Thron hat, bis sie ein leuchtendes Bett (für die Heilige Hochzeit) hat. Die Jahre vergehen, der Baum wird dick. Da kommt die Schlange, die nicht beschwört werden kann, und errichtet ihr Nest in seinen Wurzeln. Der Anzu-Vogel43 baut sein Nest in dessen Zweigen und zieht seine Jungen auf. Und die dunkle junge Frau Lilith44 baut ihr Haus im Stamm. Inanna, die sonst das Lachen liebt, weint bitterlich und sucht nach Hilfe.
Zuerst ruft sie Utu, ihren Bruder. Doch er kann und will ihr nicht helfen. Dann ruft sie Gilgamesch45, ihren Bruder46.
Er tötet die Schlange, der Vogel und sein Junges fliegen weg, Lilith flieht in die Wüste. Gilgamesch lockert die Wurzeln, seine Helfer schlagen die Äste ab, aus dem Stamm fertigt er einen Thron für Inanna sowie ein (Hochzeits)Bett für sie. Sie wiederum fertigt aus den Wurzeln ein Pukku und den Zweigen ein Mikku47 für Gilgamesch.
Deutung
Inanna wird geschildert als junge Frau, eine junge Frau in Angst. Sie fürchtet sich vor dem mächtigen Gott des Windes und dem mächtigen Himmelsgott. Diese ist eine Macht, die grösser, mächtiger ist als sie selbst, es ist eine Macht, die ihr etwas anhaben kann, eine männliche Macht, eine Macht von oben (Himmel), die Sturm senden kann und unberechenbar ist. Deren Worte sind wirkmächtig, Inanna fürchtet sie. Sie fürchtet die Worte der Vernichtung und Zerstörung. Und es sind die Winde und Stürme, die Kräfte des Enlil, die den Huluppubaum entwurzeln lassen, bis er im Euphrat heruntertreibt.





























