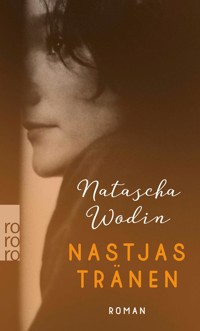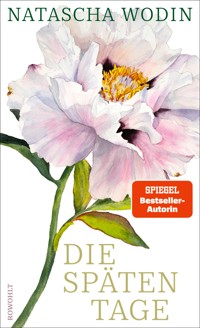
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Wie gut und ermutigend, dass es Natascha Wodin und ihre Bücher gibt!» Marko Martin, Welt am Sonntag Was bedeutet es, wenn man sich in hohem Alter noch einmal verliebt? Wenn nicht mehr viel Zeit füreinander bleibt und man sich eigentlich schon im Alleinsein eingerichtet hat? In Natascha Wodins neuem Buch wagt die Erzählerin den Versuch, die Liebe über die Einsamkeit siegen zu lassen, ein letztmögliches Lebensexperiment, in dem sich die Fragen nach Liebe und Tod mit existenzieller Dringlichkeit stellen und die Mühen des Alters zum Alltag gehören. Die Geschichte des Paares ist der rote Faden im Text, einem Gewebe aus Erinnerungen, Reflexionen, Beobachtungen – aufgezeichnet an einem mecklenburgischen See mit Blick auf das Wasser und den gegenüberliegenden Horizont. Natascha Wodin erzählt berührend, ehrlich und poetisch über widersprüchliche Gefühle, über Nähe und Fremdsein in einer Beziehung, ihre Gedanken an den näher rückenden Tod und den Schmerz des unaufhaltsamen Abschieds. «Die Sprache Wodins nimmt dem, was sie erzählt, nicht den Schrecken. Im Gegenteil: Sie macht ihn spürbar, nachvollziehbar. Und gleichzeitig spendet ihre Kunst den so nötigen Trost.» Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Natascha Wodin
Die späten Tage
Über dieses Buch
Was bedeutet es, wenn man sich in hohem Alter noch einmal verliebt? Wenn nicht mehr viel Zeit füreinander bleibt und man sich eigentlich schon im Alleinsein eingerichtet hat? Die Erzählerin in diesem Buch unternimmt den Versuch, die Liebe über die Einsamkeit siegen zu lassen, es ist ein letztmögliches Lebensexperiment, in dem sich die Fragen nach Liebe und Tod mit existenzieller Dringlichkeit stellen. Die Geschichte des Paares, in der die Mühen des Alters zum Alltag gehören, ist der rote Faden in diesem Text, einem Gewebe aus Erinnerungen, Reflexionen, Beobachtungen – aufgezeichnet an einem mecklenburgischen See mit Blick auf das Wasser, das gegenüberliegende Ufer und den Horizont dahinter.
Natascha Wodin erzählt in ihrem neuen Buch von widersprüchlichen Gefühlen, von Nähe und Fremdsein in einer Beziehung, ihren Gedanken an den näher rückenden Tod und den Schmerz des unaufhaltsamen Abschieds.
«Die Sprache Wodins nimmt dem, was sie erzählt, nicht den Schrecken. Im Gegenteil: Sie macht ihn spürbar, nachvollziehbar. Und gleichzeitig spendet ihre Kunst den so nötigen Trost.» Der Spiegel
«Wie gut und ermutigend, dass es Natascha Wodin und ihre Bücher gibt!» Marko Martin, Welt am Sonntag
Vita
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt, das 1983 erschien, folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister und Irgendwo in diesem Dunkel. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für Sie kam aus Mariupol wurden ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil verliehen. 2022 wurde sie mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Zuletzt erschien ihr Erzählungsband Der Fluss und das Meer (2023), die in diesem Band enthaltene Erzählung «Nachbarinnen» wurde 2024 mit dem Boccaccio.cc-Preis für die beste Erzählung des Jahres ausgezeichnet. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Zhanna Pulcho
ISBN 978-3-644-01554-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ein jeder steht allein auf dem Herzen der Erde,
getroffen von einem Sonnenstrahl,
und schon ist es Abend.
Salvatore Quasimodo
Mehrmals in der Nacht kommt Friedrich zu mir ins Zimmer und setzt sich in den Sessel neben meinem Schreibtisch. Als ich ihn kennenlernte, war er auch schon ein alter Mann, aber er beherrschte noch den Kopfstand und ging im Winter täglich zum Eisbaden in den See. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Neben seinen vielen anderen Alterserscheinungen besitzt er nur noch einen Bruchteil seiner Herzleistung und kann jeden Augenblick sterben. Auch die Hightechmedizin, die so viele Wunder vollbringt, kann ihm nicht mehr helfen, sein Herz ist irreparabel beschädigt. Er ist sehr schwach und immer müde, kann aber nie viel länger als eine Stunde am Stück schlafen. Ihn wecken Schmerzen, Harndrang, seine unruhigen Beine, die sich nachts selbstständig machen, unentwegt wandern und ausschlagen. Jedes Mal, wenn er wach wird und zur Toilette gehen oder eine weitere Tablette einnehmen muss, klopft er bei mir an, öffnet die Tür und sagt: «Ah, im Kreml brennt noch Licht …» Ich habe eine signifikante Gemeinsamkeit mit Josef Wissarionowitsch Stalin, ich arbeite immer nachts. Wenn man in Russland «Im Kreml brennt noch Licht» sagte, dann meinten die einen damit Väterchen Stalin, der, getrieben von der Sorge um sein Volk, auch nachts nicht ruhen konnte, sondern am Schreibtisch saß und arbeitete, für die anderen war es ein Zeichen dafür, dass der blutrünstige Tyrann hinter den erleuchteten Fenstern wieder Todesurteile unterschrieb.
Wenn Friedrich «Im Kreml brennt noch Licht» sagt, dann meint er etwas unbestimmt Liebevolles, er spielt auf meine Herkunft an und darauf, dass ich für ihn etwas Gefährliches an mir habe, dass er mich tief in seinem Herzen fürchtet, wie jede Frau. Es gab Zeiten, da nannte er mich seine Königin, seine Heilige, seine Jeanne d’Arc. Jetzt liegt er nachts mit seinem Tod im Bett. Er spürt ihn als Kälte im Bauch, in seiner Mitte, die nicht mehr warm wird, er spürt ihn in seiner unendlichen, schlaflosen Müdigkeit. Mit dem zerzausten Rest seiner silbernen Haare sitzt er im Sessel neben mir und lächelt verloren oder starrt ins Leere. Ein immer noch schöner alter Mann, sehr schmal und zart, mit etwas vogelhaften, wie mit einem feinen Bleistift gezeichneten Zügen.
Als ich ihn vor sechs Jahren kennenlernte, hatte ich die Idee, eine geheime Beziehung mit ihm zu führen, jenseits unserer zwei antipodischen Welten. Ich stellte mir vor, dass niemand von unserer Verbindung wissen würde, dass wir uns immer nur allein treffen würden, dass wir eine einsame Insel hätten, auf der der Rest der Welt keine Rolle spielte. Aber natürlich hatte diese romantische Idee keinen Bestand. Wir wussten, dass uns die gemeinsame Basis fehlte, aber wir konnten der Versuchung nicht widerstehen, uns noch einmal zu zweit in der Welt einzurichten, uns gegen Einsamkeit und Tod zu verbünden und schließlich so etwas wie Philemon und Baucis zu werden. So nahm das Verhängnis seinen Lauf.
Im Grunde hat sich an diesem Verhängnis bis heute nichts geändert. Wir sind nur sechs Jahre älter und beide sehr viel schwächer geworden in dieser Zeit. Wir haben keine Kraft mehr für unsere leidenschaftlichen Zerwürfnisse, für unsere ständigen Gefühlswechselbäder, wir haben aufgegeben.
Ich schaue ihn an, wie er neben mir im Sessel sitzt, der Kopf ist ihm auf die Brust gesunken, er schläft. Wer ist er? Ich weiß es bis heute nicht. Es gibt Momente, in denen er mir immer noch so fremd ist, dass mir vor ihm graut, dass ich ihn fürchte, obwohl er inzwischen ein Greis ist, ein Fliegengewicht, so durchsichtig und fragil, dass der nächste Lufthauch ihn wegwehen könnte wie eine Feder.
Heute Morgen entdeckte ich in einer Ecke meines Kopfkissens ein kleines, geheimnisvolles Gemälde. Es glich einer geöffneten Rosenblüte, zart und poetisch auf den alten weißen Damastbezug aufgetragen. Ich fragte mich, ob es sich um eine filigrane Stickerei handelte, die ich bisher nicht bemerkt hatte, aber ich konnte keine Erhebungen tasten. War die kleine Rose kunstfertig in den Stoff hineingewebt? Es dauerte eine Weile, bis ich begriff. Gestern war ich beim Zahnarzt und hatte nach der Parodontosebehandlung meiner letzten fünf eigenen Zähne nachts aus dem Mund geblutet.
Ich sitze auf der Bettkante, ich sitze und sitze. Es ist immer dasselbe: Ob ich auf meinem ergonomischen Schreibtischstuhl sitze, auf einem Esstischstuhl, auf dem Sofa – ich sitze und sitze. Von außen könnte man meinen, ich sei in Gedanken versunken, und das bin ich auch, aber es sind nicht die Gedanken, die mich in meiner sitzenden Position festhalten, es ist die Angst vor dem Aufstehen. Ich drücke mich vor der Kraftanstrengung, vor dem Schmerz. Früher, denke ich, vor zehn Jahren, als ich neunundsechzig war, habe ich mich oft auch schon sehr alt gefühlt, obwohl ich noch völlig problemlos von einem Stuhl aufstehen und kilometerweit zu Fuß gehen konnte. Damals war es mir unvorstellbar, was es heißt, so alt zu sein, wie ich es heute bin. Und es ist zu befürchten, dass ich in weiteren zehn Jahren, sofern ich dann noch leben sollte, genauso über mein jetziges Alter denken werde. Ich werde denken, wie gut es mir doch damals gegangen ist, ich konnte zwar nur noch schwer aufstehen und nur noch wenig gehen, aber ich konnte es noch, ich konnte noch vieles, auch wenn es aus meiner jetzigen Perspektive lächerlich wenig ist.
Jedes Mal, wenn ich es endlich doch geschafft habe, mich aufzurichten, bin ich sicher, dass es das letzte Mal war, dass es mir das nächste Mal nicht mehr gelingen wird. Irgendwann werde ich mich hinsetzen und nicht wissen, dass es das letzte Mal gewesen ist. Das ist meine Perspektive. Die Bewegung durch die Zeit führt unaufhaltsam zum Ende meiner Bewegung durch den Raum.
Endlich schaffe ich es, nach dem Heizkörperventil mir gegenüber zu greifen und mich daran hochzuziehen. Meine Beine antworten mit einem scharfen, grellen Schmerz, sie werden so schwer, als wäre nach Erreichen der Vertikale meine gesamte Körperflüssigkeit schlagartig nach unten gesackt. Ich muss mich an der Fensterbank festhalten und eine Weile warten, bis der Schwindel vorbei ist, bis ich die Verbindung zu meinen Füßen gefunden habe. Und während ich die ersten kleinen Schritte mache, beginnt schon das Herzklopfen, wie immer, wenn ich nach meiner Tagnacht mein Schlafzimmer verlasse und zu Friedrich hinübergehe. Immer die panische Angst, dass er nicht mehr lebt, dass er gestorben ist, während ich geschlafen habe. Von Mal zu Mal vergesse ich, dass Friedrich am Tag ein anderer Mensch ist als in den Nächten, in denen sein Körper so weiß und so flach wie ein Blatt Papier auf dem Bett liegt, so substanzlos, als sollte mir zu meiner Vorbereitung schon jetzt das Bild seines Leichnams gezeigt werden. Immer schlafe ich mit diesem Bild von ihm ein, aber am nächsten Tag erlebe ich stets dieselbe Überraschung. Er begrüßt mich freudig, wenn ich ins Zimmer komme, er ist schon vor Stunden aufgestanden, war bereits mit dem Fahrrad unterwegs und hat eingekauft, Vollkornbrot, Äpfel, Tomaten, seinen geliebten russischen Quark, der aus Polen in den Supermarkt der mecklenburgischen Kleinstadt geliefert wird, in der wir unsere erste und wahrscheinlich letzte gemeinsame Wohnung haben. Oft bringt er frische Blumen mit und stellt sie mir auf den Schreibtisch.
Jeden Tag nach dem Aufwachen, wenn das Bewusstsein langsam einsetzt, der Schock: Du bist alt, du wirst bald sterben.
Eine seltsame, der menschlichen Hybris entsprungene Idee, dass ausgerechnet unser Planet der einzige bewohnte im All sein sollte. Was wissen wir schon über den extraterrestrischen Raum, wie tief haben wir denn geschaut mit unseren Spiegelteleskopen und Astrografen, wie weit sind wir gekommen mit unseren Raumfahrzeugen, da allein unsere winzige Milchstraße einen geschätzten Durchmesser von einhundert Millionen Lichtjahren hat und aus ungefähr dreihundert Milliarden Sternen und Planeten besteht, auf denen es wahrscheinlich von intelligentem Leben nur so wimmelt, nicht zu reden vom Rest des Universums, hinter dem ein neues beginnt. Wir haben nicht weiter geschaut als bis zum Bauch einer Fliege, die auf einem Globus sitzt und sich die Flügel putzt.
Ich glaube, dass niemand weiß, wie man alt wird. Niemand hat uns das gesagt, niemand hat uns darauf vorbereitet. Alle werden vom Alter überrumpelt und sind ratlos, auf einem fremden, unergründlichen Gelände, von dem man nicht weiß, ob es Wirklichkeit ist oder ein Traum. Man weiß nur, dass man aus diesem Albtraum nie mehr erwachen wird.
Friedrich und ich werden nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn wir uns in jungen Jahren begegnet wären. Ich glaube nicht, dass wir ein Paar geworden wären, es war das Alter, das uns aneinandergebunden hat. Und trotzdem gab es das Verliebtsein, das Brennen, das Wunder, noch einmal das Unsterblichsein. Ich kannte bisher kein Paar, dem das in so hohem Alter widerfahren war. Wir wussten beide nicht, wie uns geschah. Wir waren die Einzigen auf der Welt, die das erlebten, wir fühlten uns wie Auserwählte, wir waren einmalig, erstmalig, und gleichzeitig waren wir etwas Unanständiges, ein Skandal, ein Greis und eine Greisin, die miteinander schliefen.
Am Anfang, als Friedrich mich oft in Berlin besuchte, wo ich damals noch wohnte, saßen wir einmal in der Grünanlage neben meiner Wohnung auf einer Parkbank und sahen dem Treiben der Kinder auf dem Spielplatz zu, den Kunststücken der Jugendlichen mit ihren Skateboards und Fußbällen, wir ließen die Erwachsenen Revue passieren, die ihre Hunde hier ausführten oder auf einem ihrer Alltagswege die Abkürzung durch die Grünanlage nahmen. Friedrich, der seit Jahrzehnten in einem Villenviertel der Thomas-Mann’schen Hansestadt Lübeck wohnte und in dieser Zeit den Rest der Welt offenbar kaum wahrgenommen hatte, staunte über die Vielfalt der Menschen in meinem kunterbunten, familiären Berliner Kiez. Er staunte über Frisuren, über Kleider, über Verhaltensweisen, die in meinen Augen völlig alltäglich waren, er staunte eigentlich über jeden Menschen, dem er begegnete, jeder, so schien es, war für ihn der erste, den er sah.
Auf einer Bank etwa drei Meter von uns entfernt saßen zwei junge Männer, wahrscheinlich arabischer Herkunft. Sie warfen uns immer wieder Blicke zu, lächelten, schließlich sprach einer der beiden uns in fließendem Deutsch an: Entschuldigen Sie, wir wollen Sie nicht stören, aber Sie sind so ein schönes Pärchen, das müssen wir Ihnen sagen.
Es passierte uns nicht zum ersten Mal, dass wildfremde Leute uns auf der Straße ansprachen und genau dieses Kompliment machten. Ich vermute, dass es an Friedrichs Ausstrahlung lag. Die Kehrseite seiner Unnahbarkeit und Gefühlsangst ist eine Extravertiertheit, die an Exhibitionismus grenzt. Er ging mit einem so unverstellten kindlichen Strahlen neben mir, dass es, zumindest innerhalb der Grenzen meines jungen, kommunikationsfreudigen Kiezes, fast unvermeidbar war, angesprochen zu werden. Die Leute lächelten uns zu, unser Anblick schien sie zu entzücken, ihre Augen schienen uns zu bestätigen, dass wir tatsächlich einmalig und erstmalig waren, vielleicht waren wir so etwas wie die leibhaftige Widerlegung der Alterstristesse und des Todes. Immer wieder ließ man uns wissen, was für ein schönes Paar wir seien, in einer Kneipe bat uns ein aufdringlicher Fremder sogar einmal darum, uns für irgendeine Zeitschrift fotografieren zu dürfen, wahrscheinlich unter der Überschrift, wie schön das Alter sei.
Die zwei jungen Männer auf der Bank, die irgendein Abspielgerät bei sich hatten, boten uns an, eine gewünschte Musik für uns zu spielen. «‹Only you› von The Platters», platzte es aus mir heraus, weil wir den amerikanischen Millionenseller aus den fünfziger Jahren zu Hause ständig auf YouTube hörten und uns eng umschlungen zur Musik wiegten. Prompt erklang der Song in ohrenbetäubender Lautstärke über den ganzen Platz. Am liebsten wäre ich davongelaufen, es war wie in jenen Träumen, in denen man auf der Straße geht und plötzlich feststellt, dass man nackt ist, ohne sich irgendwo verstecken zu können. Alle schienen zu wissen, dass mit dem Song wir gemeint waren, die einzigen zwei Oldies inmitten dieser jungen, multikulturellen Kiezwelt, alle begannen, zu lächeln und zu lachen, Vorübergehende verfielen in einen tänzelnden Schritt, andere begannen, sich rhythmisch in den Hüften zu wiegen, es fehlte nicht viel, und alle hätten mit allen zu tanzen begonnen und uns mit hineingezogen ins Getümmel. Gleich nach dem Ende des Songs ließen die jungen Männer ihn noch einmal ablaufen, sie wollten uns Süßigkeiten und etwas zu trinken aus dem Kiosk holen, ihre Begeisterung für uns als Paar schien sich mit orientalischer Gastfreundschaft und mit muslimischem Respekt vor dem Alter zu paaren. Als wir uns, etwas bedrängt von so viel Aufmerksamkeit, zum Gehen anschickten, riefen sie uns nach: Der heutige Tag soll der schlechteste in Ihrem Leben gewesen sein … Sie werden noch lange glücklich leben … und an einem Tag zusammen sterben …
Bis heute wundere ich mich über unsere damalige Wirkung auf fremde Menschen, eigentlich schäme ich mich. Was ging andere unsere Beziehung an, was veranlasste wildfremde Menschen zu dieser Distanzlosigkeit, die normalerweise nur Kindern oder Hunden widerfährt, wenn man sie unwiderstehlich süß findet? Was war an uns, das anderen erlaubte, sie offenbar geradezu aufforderte, uns anzusprechen und ihr Entzücken zu bekunden? Offenbar sah man uns nichts davon an, dass wir in Wirklichkeit zwei Verlorene waren, die sich aneinandergeklammert hatten und sich selbst etwas vorspielten, die unsterbliche Liebe inszenierten, um ihrer Sterblichkeit zu entkommen.
Letzte Nacht, ich saß am Schreibtisch, hörte ich plötzlich Friedrich in seinem Schlafzimmer schreien. Es waren genau die Schreie, die ich immer fürchte, die ich in meiner Vorstellung mit seinem Tod verbinde, mit einem letzten, vernichtenden Schmerz in seinem erschöpften Körper. Panisch stürzte ich zu ihm hinüber, aber er hatte nur geträumt. Eine große, sehr starke Frau, gegen die er sich nicht wehren konnte, hatte ihn angegriffen und zu vergewaltigen versucht.
Bisher sind alle Menschen, die geboren wurden, gestorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sollen über acht Milliarden Menschen auf der Erde leben. Sie werden ebenfalls alle sterben. Ich auch? Manchmal denke ich immer noch, nein, das wird mir nicht passieren, irgendwie werde ich davonkommen, das ist mir doch bis jetzt immer gelungen. Warum können wir alle nicht glauben, dass wir sterben müssen? Weil der Gedanke unerträglich ist oder weil uns ein natürlicher Instinkt sagt, dass es den Tod nicht gibt?
Ich gehe davon aus, dass Friedrich mich überleben wird, trotzdem übe ich mich darin, immer auf alles gefasst zu sein. Ich übe mich in größtmöglicher Härte gegen mich selbst, um dann, wenn Friedrich vor mir sterben sollte, nicht verrückt zu werden. Ich verbiete mir das Weinen, weil ich weiß, dass ich, wenn ich einmal damit anfinge, nie wieder aufhören könnte, dass ich mich in ein Tränenfass ohne Boden verwandeln würde.
Vor einiger Zeit hat Friedrich die alte Hohner-Mundharmonika meiner Kindheit entdeckt. Wenn er im Bett liegt und wegen der Schmerzen nicht schlafen kann, spielt er jetzt darauf, ganz leise. Und ich muss weggehen, die Tür schließen, weil es mir das Herz zerreißt vor Traurigkeit.
Der Schwindel, der immer gegen Abend einsetzt, fühlt sich an wie ein Nachlassen der Gravitation, wie ein langsames Entlassenwerden aus dem Gesetz der Schwerkraft. Ich bin nirgends mehr befestigt, auf dem letzten Weg des Tages, dem Weg in mein Bett, komme ich mir vor wie ein Astronaut, der über den Mond torkelt und nur dank seines Raumanzugs nicht zwischen zwei Schritten ins Nichts entschwebt. Es ist Tag für Tag so etwas wie ein Sterbetraining für mich, eine Vorstufe zur endgültigen Ablösung meines Körpers von der Erde.
Wir sind wieder einmal in Friedrichs Haus in Lübeck – mit dem Dornröschenzimmer im Souterrain, das mein Reich ist. Das Fenster ist zugewachsen von Rosen, die immer noch blühen, der ganze Garten inzwischen stark verwildert, zugeschüttet mit Laub, die Auffahrt vermoost. Das Dach hat undichte Stellen, wenn es regnet, müssen wir Eimer unterstellen, was uns beide an unsere Kindheit in der Nachkriegszeit erinnert. Die Luft im Haus ist dumpf, es wundert mich, dass man hier überhaupt noch atmen kann. Seit es dieses Haus gibt, wurde noch nie ein Fenster geöffnet, weil es hier keine Fenster gibt, sondern nur Sichtscheiben aus schusssicherem Panzerglas mit schmalen Lüftungsklappen. Die kleinen Hebel, mit denen man diese Klappen bedient, scheinen defekt zu sein, denn noch nie hat mich in diesem Haus ein Hauch frischer Luft erreicht. Alle Türen, die nach draußen führen, sind alarmgesichert, an der schweren Haupttür setzt das aggressive Bellen eines elektrischen Hundes ein, wenn sich jemand von draußen dieser Tür nähert. Ein Haus wie ein Tresor. Immer wenn ich mich durch die luxuriösen Räume mit den vielen Teppichen, Lüstern und Louis-quinze-Möbeln bewege, fürchte ich mich vor den zahlreichen unsichtbaren elektronischen Schranken, deren Berührung sofort Alarm auslöst, einen infernalischen Sirenenton, der wahrscheinlich kilometerweit zu hören ist und sofort einen bewaffneten Polizeieinsatz herbeiführt.
Nachts, während Friedrich schläft, in dem Schlafzimmer, in dem er über dreißig Jahre mit seiner Frau, der Herrin dieses Palastes, geschlafen hat, sitze ich vor einer der Überwachungskameras und beobachte ein Eichhörnchen oder eine Maus, die draußen herumtippelt und ständig den Bewegungsmelder ein- und ausschaltet. Fast körperlich spüre ich den Geist der Toten, die hier einst residiert hat, eine reiche Erbin, die ihre Kinder aus erster Ehe mit einem namhaften Playboy gehasst und in ihrem Leben, wie ich aus Friedrichs Erzählungen schließe, nie etwas anderes getan hat, als Geld zu haben und auszugeben. Eine Frau, deren Haus niemand betreten durfte, der Jeans trug, weil diese vulgäre Allerweltsmode ihr Auge beleidigte. Ein Haus, das vollgestopft ist mit antiken Möbeln und Dekorationsgegenständen, die Dekoration ist hier das Wichtigste. Zahllose Figuren aus Meißner Porzellan, antike Gläser, Vasen, Schalen, alte Bilder in prächtigen Goldrahmen, Supraporten, Schrankkronen, Gobelins, barocke Putten, Seidenblumen, venezianische Masken, Damastportieren, mindestens ein Dutzend antiker Heiligenfiguren, die einmal ihren Platz in einer Kirche gehabt haben müssen und jetzt hier als Deko zwischen Möbelstücken herumstehen, manche lebensgroß. Eine absurde Ansammlung verstauber feudaler Kostbarkeiten, die sich gegenseitig erdrücken, unsichtbar werden in ihrer Fülle, das verfallende Gespensterhaus reicher Messies, das von einer rätselhaften Geschmacksverirrung und schamlosen Verschwendungssucht zeugt.
Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass Friedrich sich einst in dieses Haus verlaufen hat. Und ich weiß auch nicht, wie es möglich ist, dass ich mich hierher verlaufen habe. Weil ich nicht wusste, wohin ich sonst gehen sollte? Weil Friedrich meine einzige Möglichkeit war? Im Grunde ist es nichts Neues für mich, was ich jetzt erlebe. Es war immer schon so bei mir. Ich war immer in der Fremde, ich konnte nie bleiben und nie gehen, sosehr ich es auch wollte. Immer wieder habe ich mich von Friedrich getrennt, habe ihn weggeschickt oder bin vor ihm geflohen, aber spätestens nach zwei Tagen ergriff mich eine so bodenlose Traurigkeit, ein so zerreißender Schmerz, dass ich es nicht mehr aushielt und zu ihm zurückkehrte.
An der Garderobe hängen noch Marthas schicke Mäntel, im Ankleidezimmer zahllose Blusen und Hosen, in den Regalen stehen mindestens hundert Paar Schuhe, von denen ich nicht weiß, wo man sie kaufen kann, in den Geschäften, die ich kenne, gibt es solche Schuhe nicht. Auf ihrem Damensekretär, an dem sie Briefe auf Büttenpapier geschrieben hat, steht immer noch ein gerahmtes Foto von ihr. Das kälteste Gesicht, das ich jemals gesehen habe, Augen, in die man nicht hineinsehen kann. Was hat Friedrich an dieser Frau angezogen? Ihr Reichtum, ihre Herrschsucht, ihre Bosheit? Hatte er nicht widerstehen können, weil eine so unnahbare, hochmütige Frau ihn erwählt hatte?
Alles in diesem Haus riecht nach Angst, die Angst sitzt in jeder Ritze. Es riecht nach Marthas Schmerzhölle, die hier fünfzehn Jahre lang gestorben ist. Fünfzehn Jahre kämpfte Friedrich gegen ihren Tod, gegen den Krebs, der in ihrem Körper grassierte, er tat alles für sie, legte schließlich sogar seine Mathematikprofessur nieder, um ganz für sie da zu sein. Er lebte nur noch für sie, verweigerte ihr nur eins: den gemeinsamen Suizid, den sie von ihm forderte. Für diese Weigerung hat sie sich an ihm gerächt. Wenn er schon nicht mit ihr starb, dann sollte er auch mit keiner anderen Frau leben, jedenfalls nicht in ihrem Haus. Er konnte hier mit ihr, der Toten, weiterleben, für eine Lebende musste er sein Zuhause opfern. Dass Friedrich vorläufig nicht dazu gezwungen ist, verdankt er nur dem Umstand, dass die Erben, Marthas Kinder, aussichtslos zerstritten sind und Friedrich die Erhaltung des Hauses überlassen, solange sie um ihre Anteile kämpfen. Es ist ihnen egal, ob er sich allein darin aufhält oder mit jener verbotenen Lebenden, die ich bin.
Ich weiß nicht, warum es ihn wieder und wieder an diesen Ort zieht. Ist dieses gesunkene Luxusschiff immer noch sein Zuhause? Ist es ein Prestigeobjekt, an dem er festhält? Besucht er hier immer wieder Martha, weil er, wie mir scheint, nie etwas zu lieben aufhört, das er einmal zu lieben begonnen hat? Oder bewacht er das Haus als seinen letzten Zufluchtsort, seine letzte Bastion für den Fall, dass ich ihn doch noch verlassen sollte? Weiß er nicht, dass diese Gefahr nicht mehr besteht, dass ich nirgends mehr hingehen kann? Ich kann kein neues Leben mehr anfangen, dazu ist es zu spät, ich kann nur noch bleiben, wo ich bin, und mich in der Beständigkeit der Liebe üben. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es mir ging, als ich noch die Kraft hatte, mich im Streit von Friedrich zu trennen. Jedes Mal war ich todsicher, dass es für immer war, jedes Mal kam ich mir vor wie meiner Verbannung in die Fremde entronnen, aber schon sehr bald begann es mich gegen meinen Willen und inneren Widerstand wieder zu ihm zurückzuziehen, mit dem mir so vertrauten Heimwehgefühl, mit dieser Heimatsehnsucht, die schon seit Langem in mir eingeschlafen war und die er wieder geweckt hatte, der fürsorglichste Mensch, den ich kenne, ein Genie des Nestbaus, der Verbreitung häuslicher Wärme.
Mein Souterrain-Zimmer, das einstige Bügelzimmer, das Friedrich mir so liebevoll nach meinem schlichten Geschmack eingerichtet hat und an dessen Panzerglasscheibe sich draußen die Rosen anlehnen, ist bewohnt von rätselhaften raupen- oder wurmartigen Tieren. Sie kommen zweifellos von draußen, aus dem feuchten Erdreich unter dem Haus, aber wie durchdringen sie das versiegelte Parkett? Sie liegen als leblose, schwarze Kringel herum, die, wenn ich sie mit der Fußspitze anstoße, über den glatten Boden gleiten, als wären sie aus Plastik. Ihre Vorform müssen die kleinen, filzigen Flocken sein, die ebenfalls überall herumliegen und lautlos zu atmen scheinen. Hin und wieder sehe ich, wie ein etwa drei Zentimeter langes Kriechtier sich in Bewegung befindet, offenbar einer der Kringel, der sich ausgerollt hat und einem unbekannten Ziel zustrebt. Sooft ich den Boden auch sauge, in kurzer Zeit ist er wieder mit den unheimlichen Lebewesen aus dem Nirgendwo besiedelt.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es sich um Tausendfüßler handelt. Irgendwo habe ich einmal eine Parabel gelesen: Eine Krähe fragt einen Tausendfüßler, wie er es eigentlich macht mit seinen tausend Füßen, woher er weiß, in welcher Reihenfolge er sie beim Gehen benutzen muss. Der Tausendfüßler hält inne, denkt nach und kann von diesem Moment an keinen einzigen Schritt mehr gehen. Auch mir stellte sich einst, in noch sehr jungen Jahren und doch erstaunlich spät, die Krähenfrage, und seitdem ist auch meine Automatik irreparabel beschädigt. Heinrich von Kleist nennt das in seinem Marionettentheater den Verlust der natürlichen Grazie und beschreibt einen Fall, in dem dieser Verlust tödlich endet. Im Grunde bin auch ich gestorben im Moment meines bösen Erwachens, ich bin in diesem Moment steckengeblieben. Es gab kein Zurück mehr in den Zustand der Unschuld, aber ich fand auch den nächsten Schritt nach vorn nicht mehr, bis heute habe ich keine Antwort auf die Krähenfrage. Jetzt sitze ich Nacht für Nacht in meinem Bügel-Rosen-Panzerglas-Souterrain bei Friedrich und beobachte meine ersten leibhaftigen Artgenossen.
Die österreichische Schriftstellerin Ilse Helbich, die erst mit achtzig Jahren zu schreiben begann, lässt mich zum ersten Mal in das Innere eines sehr alten Menschen hineinsehen. In ein mir noch unbekanntes Land, in die Anderswelt einer Hochbetagten, in der Bilder der Vergangenheit, Träume und Gedanken ineinander verfließen, sich nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. Es sei gefährlich, sich zu lange in dieser Anderswelt aufzuhalten, schreibt Ilse Helbich, es bestehe die Gefahr, dass man nicht mehr zurückfindet. Erstaunlich ist die kraftvolle Sprache, die auch ein Mensch in so hohem Alter noch besitzen und zu jenem unverwechselbaren Destillat verdichten kann, das man Poesie nennt. Mit hundert Jahren gibt sie, inzwischen erblindet, ihr letztes Interview, in dem sie immer noch hellwach und vollkommen präzise formuliert. Unter anderem sagt sie: Mein Tod geht mich eigentlich nichts an. Kurz darauf stirbt sie.
Mehr und mehr überfordert mich der Alltag, das Lebensmanagement, all die scheinbar nebensächlichen Dinge, die aber getan werden müssen, wenn man am Leben bleiben will. Sobald ich mehr zu bewältigen habe als das Übliche, sobald etwas über die tägliche Routine hinausgeht, gerate ich in Stress, ich werde hilflos und konfus.
Früher war Friedrich ein energischer, unermüdlicher Helfer, eigentlich hat er fast alles gemacht, mir immer ganz selbstverständlich alles abgenommen, was er konnte, er hat gekocht, die Wäsche gewaschen, die Wohnung geputzt, Dinge wiedergefunden, die ich aussichtslos verlegt hatte, so dass ich in einem beinah paradiesischen Zustand der Sorglosigkeit lebte und ihn meine Mutter nannte. Die Fürsorge, mit der er so lange seine schwerkranke Frau gepflegt hatte, war nun, mehrere Jahre nach ihrem Tod, auf mich übergegangen, ich war die Nutznießerin der Leerstelle, die in seinem Leben entstanden war. Ich durfte niemals ein noch so leichtes Gepäckstück tragen, einen Regenschirm oder das Sitzkissen, das ich als Sitzinvalidin überallhin mitnehmen muss, alles trug er, und immer hielt er mir die Autotür auf, ich nannte ihn scherzhaft meinen Butler.
Jetzt habe ich schon lange keinen Butler mehr. Von Anfang an hat mich der Gedanke verfolgt, dass ich mit einem so alten Mann wie Friedrich keine Lebensperspektive habe, dass ich mir mit ihm den Tod ins Haus hole. Aber nach und nach stellte ich fest, dass Friedrich ein ungewöhnlich jugendlicher, kraftvoller und agiler alter Mann war, jünger und fitter als ich, obwohl er sieben Jahre älter war. Er musste eine deutlich bessere Konstitution besitzen als viele andere seines Alters, ihm fehlte mit zweiundachtzig Jahren noch kein einziger Zahn, er stieg noch auf das Dach seines Hauses, um eine undichte Stelle zu reparieren, er beschnitt Hecken und fuhr mit einer Rasanz Auto, die mir abenteuerlich erschien. Vielleicht, so hatte ich gedacht, bestand das Geheimnis seiner scheinbar unverwüstlichen Gesundheit im Eisbaden, das er schon sein ganzes Leben betrieb. Schon in Weimar, wo er geboren und aufgewachsen war, tauchte er auch im Winter regelmäßig in die Ilm, solange sie nicht zugefroren war. In unseren ersten gemeinsamen Jahren, als er noch Dauergast in meiner kleinen Zweitwohnung am See war, verging kein einziger Tag, an dem er nicht hinunter zum Steg ging, um zu schwimmen, Sommer wie Winter. Das erinnerte mich an Ernst Jünger, dem man nachsagt, er sei auch deshalb einhundertdrei Jahre alt geworden, weil er jeden Morgen in seiner Regentonne im Garten gebadet hat. Nach und nach beruhigte ich mich und begann, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Friedrich noch lange leben würde, wahrscheinlich viel länger als ich selbst, die von Anfang an biologisch Ältere und Schwächere von uns beiden.
Eines Tages fuhren wir zurück von einer Lesung, zu der Friedrich mich begleitet hatte. Es war eine weite Reise mit dem Zug, auf halber Strecke mussten wir umsteigen. Da unser Zug sich verspätet hatte, blieben uns nur wenige Minuten Zeit, um den Anschlusszug zu erreichen. Friedrich lief auf der Treppe voraus, die zum anderen Bahnsteig führte, ich blieb keuchend zurück, und als er schon fast oben war, sah ich, wie ihm plötzlich der Koffer aus der Hand fiel. Er versuchte nicht, ihn wieder aufzuheben, er nahm die letzte Stufe und verschwand aus meinem Blickfeld. Sein Koffer kam mir auf den Stufen entgegengehüpft, und ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert war.
Wir kamen noch bis nach Hause, aber am nächsten Tag musste ich den Notarzt rufen, weil Friedrich plötzlich wieder Atemnot bekam, wie schon am Vortag auf dem Bahnhof, als ich ihn kreidebleich und um Luft ringend auf dem Bahnsteig erblickt hatte. Nur dass er jetzt nicht mit einem Koffer in der Hand eine Treppe hinaufgerannt war, sondern ruhig im Sessel saß.
Es stellte sich heraus, dass er nur noch eine Herzleistung von dreißig Prozent besaß. Das Internet, das ich nach der Lebenserwartung bei dieser Diagnose fragte, gab mir ausweichende Antworten, die auf ein Wunder hinzudeuten schienen, dass Friedrich überhaupt noch am Leben war. Die Ärzte hatten versucht, seinen völlig entgleisten Herzrhythmus durch einen Elektroschock zu stabilisieren, was offenbar einigermaßen gelungen war. Aber seine einstige Kraft hatte ihn verlassen, er nahm rapide ab und wurde immer schwächer. Aus meiner Mutter war er mein Kind geworden, ein Kind, dessen Herz jeden Augenblick zu schlagen aufhören kann.
Es stimmt nicht, dass das Leben im Alter ruhiger, gemächlicher, beschaulicher wird. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben wird immer schwerer, anstrengender, unüberschaubarer und komplizierter. Früher war es eine Kleinigkeit für mich, ein Apfelbrot zu backen, das habe ich nebenbei gemacht, heute ist es fast eine Heldentat für mich, wenn ich es schaffe, die Äpfel zu reiben, die richtige Menge Zucker, Mehl, Nüsse, Rosinen, Backpulver, Rum abzumessen, mich nach allen Backzutaten zu bücken, den Backofen vorzuheizen, den zähen Teig zu verrühren und in die Backform zu kippen. Die Finger schmerzen, es zieht im Rücken, in den Beinen, die Augen tränen. Ängstlich balanciere ich die schwere Backform mit meinen steifen, ungeschickten Händen ins Backrohr, noch ängstlicher hole ich das heiße, dampfende Gebäck wieder heraus, ich könnte es fallen lassen, auf meine Füße, was in meinem Alter wahrscheinlich der Anfang vom Ende wäre. Früher habe ich meine Dreizimmerwohnung in Berlin in ein paar Stunden geputzt, nach und nach brauchte ich immer länger, schließlich musste ich die Putzarbeit auf drei Tage aufteilen, und nachdem auch das immer mühsamer geworden war, musste ich mir eine Putzfrau suchen. Immer ist etwas zu schwer, zu hoch, zu tief, zu weit entfernt. Die gegenständliche Welt ist nicht für alte Menschen gemacht, der Alltag in dieser Welt wird zu einer ständigen Überforderung, zum Dauerstress, zu einer Leistung, die man nicht mehr erbringen kann. Und damit verbunden ist die Scham darüber, dass man es nicht mehr kann, dass man es immer weniger kann, weil man immer schwächer, hilfloser und konfuser wird. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich alte Menschen in meinen jungen Jahren wahrgenommen habe. Ich fühlte etwas zwischen Grauen, Mitleid, Verständnislosigkeit und Aversion bei ihrem Anblick, und ich hielt es für ausgeschlossen, dass ich irgendwann genauso werden würde wie sie. Jetzt fühlen und denken junge Menschen genau dasselbe von mir, wenn sie mich sehen.
Elisabeth, eine ehemalige Apothekerin, gehört zu den Menschen, die, wie Friedrich, mit dem Alter immer schöner werden. Sie ist zweiundneunzig Jahre alt und sieht aus wie ein Mädchen, zart und anmutig, immer tadellos gekleidet und frisiert, eine zweifache Witwe, die bei ihrem ebenfalls verwitweten Sohn lebt, einem pensionierten Arzt, der viel älter aussieht als seine Mutter. Bis vor kurzem hat sie noch Zeitung gelesen und täglich im Garten gearbeitet, vor ein paar Jahren reiste sie mit ihrem fast gleichaltrigen Freund sogar nach Marokko. Inzwischen ist sie dement. Alles, was man sagt, nimmt sie als Stichwort zur Überleitung auf die Kriegs- und Fluchtgeschichte ihrer Kindheit und Jugend. Wenn sie die Geschichte zu Ende erzählt hat, vergisst sie sofort, dass sie das eben getan hat, und beginnt wieder von vorn, jedes Mal so, als wäre es das erste Mal. Die restlichen achtzig Jahre ihres Lebens scheint sie vergessen zu haben, alles, was nach Krieg und Flucht kam, hat für sie offenbar keine Bedeutung mehr. Vielleicht sieht sie so jung aus, weil sie nie aufgehört hat, sich in der Zeit aufzuhalten, als sie ein Mädchen war, vielleicht war sie für immer gefangen in dieser Zeit, in einem unheilbaren Trauma, das sich nun mit der Demenz verschwistert und ihr gesamtes Leben überwuchert hat.
Es gab eine Zeit, in der ich es akzeptiert hatte, die letzte Strecke meines Lebens allein zu gehen, wahrscheinlich, so dachte ich damals, war die Einsamkeit schon immer die mir angemessene Lebensform gewesen, sie lag in der Logik meiner Biografie, weshalb auch alle meine Beziehungen zu Männern gescheitert waren, die ich im Lauf meines Lebens eingegangen bin. Ich hatte begonnen, mich auf das Alleinsein mit mir zu freuen, die Einsamkeit nicht nur zu bejahen, sondern zu wünschen, anstatt ständig auf ihr Ende zu warten.
Ausgerechnet in dieser Zeit lernte ich einen Mann kennen, den ersten seit langem, der sich für mich zu interessieren schien, ein Fremder, der während einer meiner Lesungen im Publikum saß und sich in dem anschließenden Gespräch als Kenner meines Stoffes erwies. Er war wahrscheinlich etwas älter als ich, aber noch sehr vital und präsent, ein weißhaariger, elegant gekleideter Mann, der sich rege an der Diskussion beteiligte und mir einmal dezent auf die Sprünge half, als ich bei einer Antwort auf eine Publikumsfrage ins Stottern geriet. Schließlich stellte sich heraus, dass er der ehemalige Botschafter eines mir nahestehenden Landes war, wodurch sich sein auffallendes Wissen um meine Materie erklärte, wahrscheinlich wusste er davon mehr als ich selbst. Am Ende der Lesung, als er sich mein Buch signieren ließ, gab er mir seine Visitenkarte, ich schrieb ihm meine Mailadresse ins Buch und fand zu meiner Überraschung schon am nächsten Tag eine Nachricht von ihm in meiner Mailbox. Ganz unkonventionell lud er mich zum Tee bei sich zu Hause ein, er könne mich mit seinem Wagen abholen, schrieb er, sollte es mir passen, innerhalb der nächsten Stunde. Ich antwortete ihm nicht. Zwar verband mich eine gemeinsame Landeskunde mit ihm, fast etwas Familiäres, ich hätte mit ihm sogar meine Muttersprache sprechen können, aber es überwog meine Angst vor einem erneuten Desaster mit einem Mann. Ich war eine Beziehung mit mir selbst eingegangen und wollte mir nicht bei erstbester Gelegenheit untreu werden, aber es gelang mir auch nicht, ihn zu vergessen. Er schien genau der Mann zu sein, auf den ich immer gewartet hatte und der nun, da mein Leben sich schon dem Ende näherte, auf ganz unspektakuläre Weise, im letzten Moment sozusagen, doch noch gekommen war. Ich brauchte ihn nur anzurufen. Schließlich, etwa ein halbes Jahr nach unserer Begegnung, als er mir immer noch nicht aus dem Sinn gegangen war, kapitulierte ich. Bevor ich die mir bekannte Telefonnummer wählte, tippte ich seinen Namen bei Google ein, um mich ein wenig über ihn zu informieren, aber nichts hatte ich dabei weniger erwartet als das, was ich erfuhr: Er lebte gar nicht mehr. Nicht einmal zwei Monate nach seinem Besuch meiner Lesung, auf der er noch so vital und gesund wirkte, war er gestorben. Nach kurzer Krankheit, wie es hieß. Ich starrte auf sein Foto auf dem Bildschirm, und in mir brandete das Gefühl eines irreversiblen Versäumnisses auf. Obwohl ich doch gar nichts versäumt hatte. Hätte ich ihn geheiratet, wäre ich jetzt schon wieder Witwe gewesen. Ich hatte nur seinen Tod versäumt. So war das mit der Liebe im Alter.
Ich bemerke, dass Friedrich tief in der Nacht auf seiner Bettkante sitzt, ein schwarzer Schemen in der Dunkelheit. Ich frage ihn, warum er da sitzt. Er überlegt einen Moment, dann sagt er: Vielleicht um der Erkenntnis willen.
Immer wieder befällt mich die Angst, dass wir einem Wahn erlegen sind, einem Rausch, dass wir einander etwas aufgeladen haben, das wir gar nicht tragen können, dass es plötzlich wieder vorbei sein könnte mit der Liebe, dass sie uns abhandenkommen könnte, aus den Händen fallen, weil sie zu schwer ist für uns, für zwei so altersschwache, hinfällige Kreaturen wie wir. Wir müssten sehr weit fortgeschrittene Liebende sein, wenn die Liebe keine Arbeit mehr für uns wäre, wenn sie so selbstverständlich sein könnte wie das Atmen. Aber das wird in der kurzen Lebenszeit, die uns geblieben ist, nicht mehr erreichbar sein, sofern es überhaupt erreichbar ist für Sterbliche.
Ich liebe den See, aber zu Hause war ich in meinem Leben nur in den ersten Jahren nach dem Mauerfall in Berlin, auf dem Prenzlauer Berg. Osten und Westen waren ineinandergeflossen, das Unvereinbare in mir hatte sich plötzlich in der Außenwelt vereint. Zum ersten Mal war ich damals ganz geworden, ein kompletter Mensch. Und zum ersten Mal gab es für mich ein Wir, eine Gemeinschaft von Verschworenen, die das Geheimnis eines Ortes miteinander teilten, der niemandem gehörte, das Geheimnis einer Zeit jenseits der Zeit. Wir befanden uns in einer Lücke der Geschichte. Die alte Macht war gegangen, die neue noch nicht gekommen. Die Baumaschinen rückten schon von allen Seiten an, aber noch war der Ort nicht vermessen, nicht abgesteckt, die Eigentumsverhältnisse waren noch ungeklärt. Es gab noch keine Schlösser, keine Zäune, es gab noch keine Fremden, jeder sprach mit jedem. In zufälligen Rudeln zogen wir nachts durch die von Kerzen erleuchteten Wälder der Hinterhöfe, in denen ein nicht endendes Fest gefeiert, eine neue Wirklichkeit erfunden wurde, eine Zukunft, die, wir wussten es, nie stattfinden würde. Immer spürte ich in der Gegenwart schon die Wehmut des bevorstehenden Verlustes, mein künftiges Heimweh nach diesem Ort, wenn es ihn nicht mehr geben würde. Heute erinnert auf dem Prenzlauer Berg so gut wie nichts mehr an die damalige Zeit. Bis vor einigen Jahren gab es noch ein einziges unsaniertes Haus, das zum Grausen der Touristen in meiner Parallelstraße stand. Inzwischen ist auch dieses letzte Relikt der damaligen Zeit verschwunden.
Immer wieder diese innere Raserei. Falsch, falsch, falsch. Ich weiß nicht, was falsch ist und warum es falsch ist, ich weiß nur, dass es falsch ist. Und dass ich in diesem Falschen gefangen bin, aussichtslos gefangen, weil ich seinen Namen nicht kenne und einfach nicht herausfinden kann, was mich so quält. Alles, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, berühre – alles ist unerträglich falsch. Alles stößt mich ab, alles ekelt mich an. Es ist wie Folter, wie eine Besessenheit, ein unablässiger Schrei, der mich zerreißt: falsch, falsch, falsch. Was ist das? Verliere ich den Verstand? Überfällt mich eine Art Alterswahnsinn?
Der vierundneunzigjährige Vater eines Freundes sah vor seinem Tod das Meer und marschierende Soldaten, endlose Regimente, die zum Himmel zogen. Irgendwann begann er, um Hilfe zu schreien. Zwei Wochen lang, bis zu seinem Tod, schrie er ununterbrochen um Hilfe.
Lange bevor es das sogenannte Sterbefasten gab, bevor das Wort überhaupt existierte, hat mein fast neunzigjähriger Vater aufgehört zu essen und die Einnahme seiner Medikamente eingestellt. Gelegentlich ließ er sich noch ein paar Tropfen Tee aus einer Schnabeltasse einflößen. Das haben Menschen seit jeher getan, wenn sie alt und krank waren und nicht mehr leiden wollten, wenn der Körper sie nur noch peinigte. Vermutlich hatten sie auch einfach keinen Hunger mehr und litten an