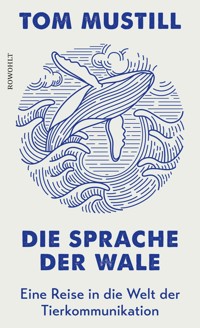
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Big Data trifft Big Beasts: Wie neueste Technologien unser Wissen über das verborgene Leben der Wale radikal verändern. Nachdem er den Zusammenstoß mit einem Buckelwal nur knapp überlebt hat − das Video, wie dieser direkt vor ihm in die Höhe schießt und auf seinem Kajak landet, ging viral −, lässt Filmemacher Tom Mustill die Faszination nicht mehr los. Er besucht Wissenschaftler:innen und Expert:innen auf der ganzen Welt, sammelt unzählige Geschichten über Begegnungen zwischen Mensch und Wal und erkennt: Wir beginnen gerade erst, diese hochintelligenten Meeressäuger zu erforschen und zu verstehen. Der Kommunikationssinn der Wale ist extrem ausgeprägt: Ihr vielfältiger Gesang entwickelt sich wie Sprache ständig weiter. Dank neuester Technologie gibt es inzwischen Möglichkeiten, Walgeräusche auch in entlegensten Gewässern aufzuzeichnen, mit künstlicher Intelligenz auszuwerten und Muster zu entdecken, die kein menschliches Ohr wahrnehmen würde. Doch das ist erst der Anfang. Tom Mustill zeigt, dass sich tatsächlich eine Revolution in der Tierkommunikation anbahnt − und was das für unsere Welt bedeuten könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tom Mustill
Die Sprache der Wale
Eine Reise in die Welt der Tierkommunikation
Über dieses Buch
Big Data trifft Big Beasts: Wie neueste Technologien unser Wissen über das verborgene Leben der Wale radikal verändern.
Nachdem er den Zusammenstoß mit einem Buckelwal nur knapp überlebt hat – das Video, wie dieser direkt vor ihm in die Höhe schießt und auf seinem Kajak landet, ging viral –, lässt Filmemacher Tom Mustill die Faszination nicht mehr los. Er besucht Wissenschaftler:innen und Expert:innen auf der ganzen Welt, sammelt unzählige Geschichten über Begegnungen zwischen Mensch und Wal und erkennt: Wir beginnen gerade erst, diese hochintelligenten Meeressäuger zu erforschen und zu verstehen.
Der Kommunikationssinn der Wale ist extrem ausgeprägt: Ihr vielfältiger Gesang entwickelt sich wie Sprache ständig weiter. Dank neuster Technologie gibt es inzwischen Möglichkeiten, Walgeräusche auch in entlegensten Gewässern aufzuzeichnen, mit künstlicher Intelligenz auszuwerten und Muster zu entdecken, die kein menschliches Ohr wahrnehmen würde. Doch das ist erst der Anfang. Tom Mustill zeigt, dass sich tatsächlich eine Revolution in der Tierkommunikation anbahnt – und was das für unsere Welt bedeuten könnte.
Vita
Tom Mustill, geboren 1983, ist Biologe, Filmemacher und Autor. Seine Filme – viele in Zusammenarbeit mit Greta Thunberg und David Attenborough – wurden international vielfach ausgezeichnet, u.a. mit zwei British Academy Film Awards und einer Emmy-Nominierung. Er lebt mit Frau und Tochter in London.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «How to Speak Whale» bei William Collins, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«How to Speak Whale» Copyright © Tom Mustill, 2022 International Rights Management: Susanna Lea Associates
Die Übersetzerin dankt Holger Mihm für die Unterstützung bei allen Sach- und Fachfragen.
Mitarbeit Friederike Moldenhauer
Register Hubert Mania
Zitatquelle Motto: Lem, Stanisław, Solaris, Berlin: Ullstein, 2021
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung iStock
ISBN 978-3-644-01498-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung Van Leeuwenhoek beschliesst Hinzuschauen
1 Eröffnung. Verfolgt von einem Wal
2 Ein Gesang im Ozean
3 Das Gesetz der Zunge
4 Die Joy der Wale
5 «Irgendwelche blöden grossen Fische»
6 Die suche nach einer Sprache der Tiere
7 In den Tiefen des Gehirns: Kulturverein der Wale
8 Das Meer hat Ohren
9 Tierische Algorithmen
10 Maschinen der liebenden Gnade
11 Anthropoleugnung
12 Mit Walen tanzen
Dank
Bildnachweis
Register
Für Dad. Ich wünschte, du hättest es sehen können.
~~~~~~~~~
Und für den Buckelwal CRC-12564, der mich auf diese Reise geschickt hat.
Wie können Sie erwarten, mit dem Ozean zu kommunizieren, wenn Sie nicht einmal einander verstehen? Stanisław Lem, Solaris
EinleitungVan Leeuwenhoek beschliesst Hinzuschauen
«Was, wenn ich dies noch nie gesehen hätte?»[1]
Rachel Carson, Magie des Staunens
Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts lebte in Delft in den Niederlanden ein ungewöhnlicher Mann namens Antoni van Leeuwenhoek. Das ist er:
02 Antoni van Leeuwenhoek 1686 mit einer seiner Vergrößerungserfindungen, von Jan Verkolje.
Van Leeuwenhoek war ein Geschäftsmann, ein Tuchhändler. Er war außerdem ein Erfinder von Hochtechnologie. In Europa waren innerhalb der vorausgehenden fünfzig Jahre in rascher Folge Vergrößerungsinstrumente erfunden worden – Teleskope und Mikroskope. Die meisten funktionierten nach einem ähnlichen Prinzip, mit zwei gläsernen Linsen in einer Röhre. Der Blick durch diese Linsen schenkte dem Benutzer übermenschliche Macht, da ferne Planeten und winzige Objekte besser erkennbar wurden. Diese Instrumente waren außerdem sehr selten: Nur wenige Menschen hatten gelernt, die Gläser zu schleifen, zu polieren und einzupassen, und viele hielten ihr Wissen geheim. Für den Tuchhändlerlehrling van Leeuwenhoek waren «Mikroskope» (vom Griechischen für «klein» und «ansehen») auch Werkzeuge für seinen Beruf; sie halfen ihm, die Qualität der Tuchwaren, mit denen er handelte, zu beurteilen. Die ersten Mikroskope konnten bis aufs Neunfache vergrößern, spätere Instrumente holten die Dinge noch näher heran. Doch die Konstruktion aus mehreren hintereinander gesetzten Linsen wies einen Makel auf – je stärker die Linsen vergrößerten, umso mehr verzerrten sie das Bild, und bei einer über zwanzigfachen Vergrößerung konnte man kaum noch etwas erkennen.[2]
In Delft hatte van Leeuwenhoek heimlich mit einer anderen Technik experimentiert. Anstatt mit einer Reihe von Linsen zu arbeiten, kam er auf die Idee, einzelne winzige bikonvexe Glaskörper herzustellen, manche mit kaum mehr als einem Millimeter Durchmesser, die er zwischen zwei metallene Klammern spannte. Und wenn er nun ein Objekt auf die anmontierte Halterung legte, den Apparat auf eine Lichtquelle richtete, die Glaslinse ganz dicht an sein Auge hielt und hindurchblickte, stellte er fest, dass er seinen Gegenstand ohne große Verzerrungen um das bis zu 275-Fache vergrößern konnte.[3] Es heißt, er habe im Laufe seines Lebens mehr als fünfhundert Mikroskope gebaut.[4] Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die Schärfeneinstellung und die Klarheit, die seine Geräte erreichten, mit denen moderner Lichtmikroskope vergleichbar sind.[5]
Van Leeuwenhoek benutzte seine revolutionäre Vergrößerungstechnologie nicht nur, um die Webstruktur der Tuche, die er verkaufte, zu überprüfen. Er erforschte auch die Welt jenseits seines Gewerbes. Während andere Mikroskopiker das Sichtbare vergrößert und erforscht hatten – etwa Insekten oder Kork –, entdeckte van Leeuwenhoek einen ganzen Kosmos des Unsichtbaren. In einer Fingerhutmenge Wasser aus einem nahen See seiner Heimat, das für das bloße Auge leer wirkte, erspähte er zu seiner Überraschung Scharen von «animalcules»[6], wie er sie nannte – winzige Tierchen, Bakterien und Einzeller. Wo immer er hinschaute, fand er wimmelnde Schwärme bis dahin unbekannter Geschöpfe: in der Welt um uns herum – in Regen- und Quellwasser und in unseren Körpern – und in Proben, die er aus seinem Mund kratzte oder seinen Eingeweiden entnahm. Van Leeuwenhoek war hingerissen und schrieb, dass «kein erfreulicherer Anblick meinem Auge begegnet ist als jener von so vielen Tausenden lebender Geschöpfe in einem kleinen Wassertropfen, und alle drängen sich aneinander und wuseln umher».[7]
Damals waren die Menschen nicht in der Lage, die Eier von Flöhen, Aalen oder Muscheln mit dem bloßen Auge zu erkennen, deshalb gingen sie davon aus, dass sie nicht existierten. Sie glaubten, diese Tiere entstünden nicht aus Eiern, so wie größere Tiere, sondern in einem Prozess, der «Urzeugung» genannt wurde, bei dem zum Beispiel Fliegen aus Staub entspringen, Muscheln aus Sand und Aale aus Tau. Van Leeuwenhoeks Instrumente offenbarten die bis dahin nicht wahrnehmbaren Eier dieser Tiere und erledigten die Theorie. Er selbst war besessen von dieser neuen Welt, die er entdeckt hatte; rote Blutkörperchen, Bakterien, die Struktur von Salz, die Muskelzellen von Walfleisch. Er erforschte die immer noch geheimnisvolle Welt der menschlichen Reproduktion und entdeckte im Sperma winzige bewegliche Körper mit Schwänzen – Spermien. Wenn ich an diesen Moment denke, male ich mir aus, wie erstaunlich es gewesen sein muss und wo er das Sperma wohl herhatte.
Jenseits des Ärmelkanals, in England, hatte der Naturphilosoph Robert Hooke seinerseits mit Mikroskopen experimentiert, sie um weitere Linsen ergänzt, diese verändert und die Struktur von Schneeflocken und Flohhaaren erkundet. Die Zeichnungen, die er von diesen verborgenen Welten veröffentlichte, waren eine Sensation. Der Tagebuchschreiber Samuel Pepys las Hookes Buch im Bett bis zwei Uhr früh. Vertieft in die ausklappbaren Illustrationen, schrieb er, es sei «das genialste Buch, das ich jemals in meinem Leben gelesen habe».[8] Van Leeuwenhoek wiederum schrieb an Hooke und die anderen gelehrten Experimentatoren der Royal Society (die damals noch Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge hieß) und berichtete von seinen Entdeckungen. Anfangs zweifelten viele, trotz glaubwürdiger Zeugen, an dem «außerordentlich neugierigen und emsigen»[9] Kaufmann. Wie konnte es komplette Lebensbereiche geben, die für normale Menschen unsichtbar waren? Van Leeuwenhoek beklagte sich, er höre «häufig sagen, dass ich nichts als Märchen über die kleinen Tierchen erzähle».[10] Es half ihm auch nicht gerade, dass er seine Mikroskope und die Methoden ihrer Herstellung eifersüchtig hütete.
03 Eine Kopie der Zeichnungen, die van Leeuwenhoek von den vom ihm entdeckten «animalcules» anfertigte. Fig. IV gilt als die erste gedruckte Wiedergabe eines Bakteriums.
In London arbeitete Hooke unterdessen daran, van Leeuwenhoeks Resultate zu reproduzieren. Es bedurfte mehrerer Versuche, bis ihm die Herstellung der exquisiten winzigen Glaslinsen gelang; doch als er am 15. November 1677 endlich erfolgreich in Regenwasser blicken und, «überrascht von solch einem wunderbaren Spektakel»[11], darin winzige bewegliche Geschöpfe erblickte, war auch er «wahrhaftig überzeugt», dass es Tiere waren. Sehen hieß glauben. Van Leeuwenhoek wurde in aller Form zum Mitglied der Society ernannt und gilt heute weltweit als Vater der Mikrobiologie. Seine Erfindungen haben es uns ermöglicht, das mikroskopische Leben, das uns seit jeher umgibt, zu erkennen, aber was ebenso bedeutsam ist, er selbst besaß einen so neugierigen Verstand, dass er dorthin schaute, wo andere nichts zu finden vermuteten.
Ein paar Jahrhunderte später, und unsere Kultur hat sich verändert. Wenn jemand auf der Straße niest, malen wir uns aus, wie Keime durch die Gegend fliegen. Wenn wir besorgt unser Muttermal betrachten, weil es ein bisschen komisch aussieht, stellen wir uns sofort vor, dass sich da winzige Krebszellen wie verrückt teilen. Das Wissen um die mikroskopische Welt hat unser Leben verändert: Wir waschen unsere Hände und unsere Wunden, wir produzieren Embryos und frieren sie ein. Wir wissen, dass in jedem von uns ebenso viele Bakterien wie menschliche Zellen verborgen sind. Ein unsichtbares Ökosystem. Van Leeuwenhoeks Entschluss hinzuschauen hat unser Verhalten, unsere Kultur und die Art, wie wir uns selbst sehen, verändert.
Das ist das Vermächtnis von van Leeuwenhoeks Erfindung. Wir können nicht mehr ungesehen machen, was er erspäht hat.
Welche weiteren unsichtbaren Welten könnten wir heute noch entdecken? Sie, die das lesen, sind schon Teil einer neuen Grenzlinie. Seit dem siebzehnten Jahrhundert haben sich unsere Sehinstrumente vervielfältigt, und viele sind inzwischen auf uns selbst gerichtet: Sicherheitskameras überwachen unseren Gang durch die Straßen, das Thermometer und das Gyroskop in unserem Smartphone spüren, wenn wir uns im Schlaf drehen, sobald es im Zimmer kühler wird. So vieles wird heutzutage nachverfolgt. Wann wir schlafen und wann wir träumen. Wo wir leben und wohin wir gehen. Unser Fingerabdruck, Stimmporträt, Irismuster, Gang, Gewicht, Eisprung, unsere Körpertemperatur, mögliche Infektionen, unsere Mammografie, unsere Schrittzählung, die Form unseres Gesichts und seine Mimik. Was wir mögen und was nicht. Wen wir mögen und wen nicht. Die Lieder und Farben und Dinge, die uns gefallen. Was uns anmacht. Was wir lustig finden. Unser Name und unsere Avatare und unsere Spitznamen. Die Wörter, die wir benutzen, unser Akzent. Und das ist erst der Anfang. Heute erinnern sich nicht nur Freunde und Familie an uns, sondern auch Computer, denen wir selbst nie begegnet sind – was die von uns wahrnehmen, ist in Daten kristallisiert und wird via Internet an riesige Server gesendet, wo es zusammen mit den Daten von Milliarden anderen Menschen gespeichert ist. Die Menge unserer Daten nimmt schneller an Umfang zu als jedes Erinnerungsbuch, das wir schreiben könnten, und wenn wir sterben, überdauern sie uns. Und andere Maschinen lernen, in dieser Datensammlung unsichtbare Muster zu entdecken.
Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte wurden viele unserer klügsten Ingenieure, Mathematiker, Psychologen, Computerwissenschaftler und Anthropologen von den Universitäten abgeworben und arbeiten jetzt für Alphabet, Meta, Baidu, Tencent und andere Informations-Giganten ebenso wie für die Regierungen der Vereinigten Staaten und Chinas. In den 1940er Jahren hätten diese klugen Köpfe vielleicht im Manhattan Project an der Spaltung des Atoms gearbeitet; in den 1960ern wären sie vielleicht im Jet Propulsion Laboratory an der Entwicklung von Raumschiffen beteiligt gewesen. Heute werden clevere junge Leute üppig dafür belohnt, dass sie neue Wege zum Sammeln, Speichern und Analysieren menschlicher Daten finden. Indem sie unsichtbare sprachliche Muster anwenden, können ihre Maschinen Gespräche zwischen Menschen übersetzen, ohne dass sie selbst auch nur eine der Sprachen erlernt hätten; und indem sie verborgene Muster von Gesichtern nutzen, können sie besser als ein Mensch sagen, ob ein Lächeln echt ist oder nicht.[12] Widerwillig akzeptieren wir das Sammeln unserer Daten ebenso wie die Tatsache, dass wir von jenen, die deren Muster zu deuten wissen, manipuliert werden können.
Bei alledem vergessen wir leicht, dass wir Tiere sind, menschliche Tiere. All diese Muster – unsere Körper, unser Verhalten und unsere Kommunikation – sind Biologie. Die Werkzeuge, die wir zum Auffinden unsichtbarer Muster in den Menschen entwickelt haben, können auch bei anderen Arten funktionieren. Ähnlich wie van Leeuwenhoeks Mikroskope – nützlich für die Begutachtung von Tuchen, aber auch geeignet, die Entstehung von Flöhen zu erkunden – sind viele unserer Aufspürgeräte, Sensoren und Mustererkennungsmaschinen ursprünglich entwickelt worden, damit sich Waren erfolgreicher verkaufen ließen, werden jedoch heute auf andere Arten und den Rest der Natur angewendet. Und im Verlauf dieses Prozesses revolutionieren sie die Biologie.
Dieses Buch handelt von einigen der Pioniere dieses neuen Zeitalters der Entdeckungen; es handelt von der Entschlüsselung der Welt der Natur. Es ist eine Reise zu den Grenzen, dorthin, wo Big Data auf Big Beasts trifft, auf große Tiere; dorthin, wo siliziumbasierte Intelligenz sich anschickt, Muster in kohlenstoffbasiertem Leben zu entdecken. Es konzentriert sich auf einige der geheimnisvollsten und faszinierendsten Tiere – Wale und Delfine – und darauf, wie die neueste Technologie unser Wissen über ihr verborgenes Leben und ihre Fähigkeiten radikal verändert hat. Es erkundet die Art und Weise, wie Unterwasserroboter, gewaltige Datensätze, künstliche Intelligenz (KI) und die Veränderung unserer Lebensweise sich verbinden und die Methode verändern, mit der Biologen die Kommunikation der Waltiere entschlüsseln.
Dieses Buch handelt davon, wie man lernt, mit Walen zu sprechen. Und davon, ob so etwas, angesichts all der Veränderungen in Wissenschaft, Technologie und Kultur, überhaupt jemals möglich sein wird. Ich frage mich, ob wir, wenn wir unsere Mustererkennungsmaschinen nicht mehr auf uns selbst, sondern auf die Äußerungen anderer Arten richten, durch das, was wir herausfinden, auch selbst verändert werden, so wie die mikroskopischen Welten, die van Leeuwenhoek durch seine Glaslinsen sah, uns verändert haben. Werden unsere Entdeckungen uns dazu bringen, diese Tiere zu schützen?
Ich weiß, all das klingt ziemlich weit hergeholt. Ich dachte das auch. Aber ich habe mir diese Geschichte nicht aus den Fingern gesogen: Sie hat mich gefunden, und ich bin ihr hinterhergestolpert. Sie begann 2015, als ein dreißig Tonnen schwerer Buckelwal aus dem Meer schnellte und auf mir landete.
1Eröffnung. Verfolgt von einem Wal
Man sagt, das Meer sei kalt,
aber im Meer gibt es das heißeste Blut überhaupt.[1]
Captain James T. Kirk, Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart
Am 12. September 2015 machte ich mit meiner Freundin Charlotte Kinloch vor Kaliforniens Küste in der Monterey Bay einen Kajak-Ausflug. Wir waren zusammen mit einem Führer und einem halben Dutzend weiterer Kajakfahrer gegen 6 Uhr früh von Moss Landing aufgebrochen, einem Tiefwasserhafen in der lang gestreckten Bucht zwischen den Küstenstädten Monterey und Santa Cruz. Wir waren in Paare aufgeteilt und bekamen jeweils ein Zweierkajak zugewiesen. Es war kalt, neblig und so still, dass ich das Wasser von unseren Paddeln auf die Meeresoberfläche tropfen hören konnte. Im ruhigen, von Mauern eingefassten Hafenbecken trieben Seeotter müßig auf dem Rücken und beäugten uns, zu flauschigen Flößen verbunden, von ferne. Als wir, vorbei an den aufgetürmten Felsklötzen der Wellenbrecher, den offenen Ozean erreichten, rollten sich Seelöwen wie die oberen Hälften rotierender Räder einer riesigen Unterwassermaschine überall auf der Wasseroberfläche, schnurrbärtig und schnaubend. Das Morgenlicht brach sich im Nebel, der uns umgab, und es war, als paddele man in einem Leuchtkasten, häufig sah man gar nichts, aber überall um uns herum herrschte Leben. In der Luft kreuzten Pelikane zum rauen Gekreisch der Möwen.
Ich blickte auf das graue, fast metallische Meer. Unterhalb von uns gab es eine Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon.[2] Obwohl wir uns noch in Hörweite des Festlands befanden, hatte das Wasser schon eine Tiefe von mehreren hundert Faden – eine gewaltige Spalte, die etwa 50 Kilometer weit von der Küste bis ins offene Meer reichte. Eine geologische Verrücktheit – das drittgrößte Unterwassertal der Welt –, die nahrungsreiches Tiefseewasser an die Oberfläche transportiert, wo die maritime Alchemie aus Sonnenlicht und Nährstoffen dann eine erstaunliche Nahrungskette erschafft, die als ein Wunder der Natur gilt. Das National Marine Sanctuary, bestehend aus dem 450 Kilometer langen Küstenstreifen und den fünfzehneinhalbtausend Quadratkilometern Ozean, enthält einen solchen Reichtum und eine solche Vielfalt an Leben, dass es auch die Blaue Serengeti genannt wird.[3] An Land gibt es nur wenige Orte, wie etwa die Namensgeberin, die Serengeti in Tansania, wo man noch Großfauna finden kann. Auf den meisten Kontinenten ist das größte Tier, das man wahrscheinlich zu Gesicht bekommt, eine Kuh. Doch in den Meeren haben viele Riesentiere überlebt. Meist halten sie sich, weit entfernt von Menschenaugen, in Polargewässern auf, oder sie scharen sich um entlegene Inselketten. Aber wegen dieses Canyons haben sich hier die größten Meeresgeschöpfe des Planeten zusammengefunden: große Weiße Haie, Lederschildkröten, riesige Mondfische, See-Elefanten, Buckelwale, Schwertwale und die Größten aller Megafauna-Arten, Blauwale. Unmittelbar vor der Küste, am Rande eines der größten menschlichen Ballungsräume, einfach nur ein Stück die Straße von San Francisco und dem Silicon Valley hinunter.
Sean, unser Führer, war ein junger, bärtiger, braunhaariger Typ, der aussah, als habe er mehr Zeit mit einer Kajak-Spritzdecke um die Taille verbracht als in Landkleidung. Sean hatte uns erklärt, dass wir uns, wenn wir irgendwelche Wale sehen sollten, hundert Meter von ihnen entfernt halten müssten. Es handele sich um wilde Tiere, und es sei an uns, ihnen aus dem Weg zu gehen, und nicht andersherum. Es gebe viele Arten von Walen in diesen Gewässern. Grauwalmütter führten ihre jungen Kälber von ihrem Geburtsgewässer in Mexiko an der Küste entlang; Schwertwale lauerten ihnen auf; Finnwale und Zwergwale streiften auf der Suche nach Planktonschwärmen umher; und Rundkopfdelfine hätten es auf Tintenfische abgesehen.
Sobald wir aus dem Hafen hinausgepaddelt waren, dauerte es nur noch wenige Minuten, bis wir die Wale sahen. Sie waren überall. Der Morgennebel hob sich, und in allen Richtungen schossen ihre Fontänen aus dem Wasser; Walatem in der Luft markierte den Weg an der sandigen Küste entlang nach Monterey und hinaus aufs offene Meer. Als Naturschutzbiologe und Tierfilmer hatte ich schon mehrfach das Vergnügen, jeder Menge Wale verschiedenster Arten begegnet zu sein. Aber so etwas wie dies hier hatte ich noch nie erlebt. Es waren so viele. Anfangs hielten alle, die wir entdecken konnten, etwa achthundert Meter Abstand zu uns. Doch dann tauchte plötzlich, nur einen Steinwurf entfernt, eine Dreiergruppe auf, einer nach dem anderen, in hoher Geschwindigkeit. Rasch erschienen noch mehr und verschwanden hinter uns. Sean befahl uns, dicht zusammenzubleiben, und wir paddelten rückwärts, um weiterhin auf Abstand zu bleiben. Ohne Wind und Wellengang wirkte das plötzliche, knallartige Ausatmen, wenn ein Wal auftauchte, beängstigend laut und nah, wie irgendetwas zwischen einem wiehernden Pferd und einem Gaskanister, der Druck ablässt. Ihr Atem trieb zu uns herüber und roch nach abgestandenem, fischigem Brokkoli.
Eine Walsichtung kann häufig enttäuschend sein: Meistens sieht man sie nur, wenn sie zum Atmen nach oben kommen, weshalb es an Deck eines Schiffs eher so ist, als erspähe man von hoch oben flüchtig einen großen atmenden Holzklotz. Oft ist es deshalb schwierig, einen Eindruck von ihrer Größe zu bekommen. Aber von einem Kajak aus war es auffallend anders. Als wir sie aus einer Perspektive in Höhe des Meeresspiegels beobachteten, spürten wir ihre Ausmaße und ihre Macht.
Die Wale, die wir an jenem Morgen zu sehen gehofft hatten, waren Buckelwale (Megaptera novaeangliae), eine der größten Arten der Zetazeen – das ist der lateinische Fachbegriff für die Gruppe von Säugetieren, die Wale, Delfine und Tümmler umfasst. Ein Buckelwal wiegt schon bei der Geburt so viel wie ein ausgewachsenes Breitmaulnashorn. Die meisten der erwachsenen Tiere, die uns umkreisten, hatten die Größe von einem Flughafen-Shuttlebus. Das indifferente, diffuse Licht ließ alle Feinheiten ihrer Haut sichtbar werden – die filigrane Struktur aus Rissen und Narben, ähnlich der Hautstruktur einer Gurke, die erhabenen Muskelstränge um die beiden zusammengekniffenen Blaslöcher oben auf dem Kopf. Auf der Oberseite waren die Tiere blaugrau, auf der Unterseite etwas blasser, und sie hatten lange, armartige Brustfinnen.
Man hatte uns gesagt, die Wale würden sich von einem etwa anderthalb Kilometer langen Fischschwarm ernähren, und ganz offensichtlich fand da unter uns tatsächlich gerade ein prächtiges Walfestessen statt. Buckelwale sind anfallsartige, exzessive Fresser, sie jagen und verschlingen Hunderte Fische auf einmal. Und sie wandern: Im Sommer ziehen sie in kühlere Gewässer, in die Antarktis, nach Alaska oder in die Monterey Bay; dort verbringen sie dann den größten Teil des Tages mit Fressen. Sie legen endlose Pfunde zu, schlemmen monatelang. Dann, im Winter, fasten sie, fressen über Monate nichts. Sie schwimmen in wärmere tropische Meere, wo sie einander den Hof machen, ihre Parasiten loswerden und ihre Jungen gebären (Kälber genannt). Buckelwale sind ungewöhnlich «oberflächenaktive» Wale; sie heben häufig Teile ihres Körpers aus dem Wasser oder wälzen und rollen sich an der Wasseroberfläche. Wenn sie sich auf ihre Beute stürzen, können sie plötzlich den größten Teil ihres Kopfs mit weit aufgerissenem Maul aus dem Wasser schießen lassen. Und wenn sie tauchen, falten sie sich anmutig zusammen, und ihre Schwanzflossen können ganz schön weit aus dem Wasser ragen. In den Tropen ruhen sie sich hauptsächlich aus und bewegen sich wenig, sparen ihre Kräfte für die lange Rückreise auf. Gelegentlich stören die männlichen Tiere (Bullen genannt) im Streit um die weiblichen Tiere (Kühe) den Frieden, wenn sie in sogenannten «Heat runs» einander in blutigem, gefährlichem Wettkampf bedrängen und angreifen. Ihre jährlichen Wanderungen sind die längsten sämtlicher Säugetiere und umspannen ganze Ozeane. Wenn sie schließlich in ihre Fressgründe zurückgekehrt sind, ist ihr Walfischspeck dermaßen aufgezehrt, dass die Umrisse ihrer Wirbelsäule deutlich zu erkennen sind. In Monterey treiben die Buckelwale also keinen Unsinn. Wenn Fresszeit ist, schlemmen und schlingen sie.
Überall um uns herum bewegten sich Buckelwale, und sie waren schnell. Sie schienen sich jeweils zu kleinen Gruppen von dreien oder vieren zusammenzutun, die häufig wechselten. Inzwischen weiß ich, dass diese Wale in Teams arbeiten können: Sie setzen ihren Körper und die Wand ausgeatmeter Luftblasen ein, um Fischschwärme einzukesseln und nach oben zu drücken, ehe sie sich gemeinsam auf sie stürzen. Bei diesen Manövern scheinen bestimmte Wale bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Ungewöhnlich für kooperierende Säugetiere ist, dass die Walteams häufig nicht miteinander verwandt sind, und doch bilden sie über Jahre und Tausende von Kilometern hinweg feste Konvois. So beobachtete ich jetzt, wie eine Gruppe von vier Walen hochkam, alle dicht nebeneinander, mit überlappenden Brustfinnen. Sie atmeten unisono aus und ein und verschwanden sofort wieder. Sie wirkten wie Volleyballspieler, die nach Punktgewinnen mit den Fäusten anstoßen.
Man hat diese Art von Beziehungen Freundschaften genannt (allerdings sprechen Wissenschaftler generell von «stabilen langjährigen Zusammenschlüssen»[4]). Mit tauben Zehen und offenem Mund wippten wir in unseren Kajaks auf und nieder und sahen den Tieren beim Fressen zu. Später erfuhr ich, dass an jenem Tag mindestens 120 Wale in der Bucht gezählt worden waren. Manchmal schlugen sie mit echt krassem Lärm («Brustklatschen») ihre Finnen aufs Wasser oder reckten sogar den Kopf so hoch, dass sie sich in der Luft umsehen konnten, ein Verhalten, das sich «spy-hopping» nennt (Sprungspionieren). Am Horizont sahen wir mehrere Beinah-Luftsprünge – Wale, die aus dem Wasser schnellten und sich in einer weißen Explosion mit einem Wumms, der wie ferner Donner klang, wieder zurückfallen ließen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das, was wir da gerade erlebten, selbst für die Monterey Bay eine beispiellose Fressorgie war. Wir waren, bei ruhigstem Wetter und so nah an der Küste, zufällig in die größte Ansammlung von Walen seit Menschengedenken geraten.
Ich blickte hinüber zu Sean, unserem Führer, und bemerkte, dass er nicht entspannt wirkte. Seine Augen zuckten hektisch zwischen den vier Booten unserer kleinen Flottille hin und her; regelmäßig rief er uns zu, wir sollten zusammenbleiben, wenn wir zu stark auseinanderdrifteten, und zurückpaddeln, als immer neue Wale auftauchten. Natürlich können sich Wale sehr viel schneller bewegen als Kajaks. Im Laufe des Morgens gesellten sich noch drei oder vier Walbeobachtungsschiffe und mehrere Kajakfahrer zu uns. Wir befanden uns so nah am Strand, dass sogar ein Stehpaddler es bis zu uns schaffte. Ich hatte längst aufgehört, die Kälte und die Nässe zu registrieren, und es kümmerte mich auch nicht, dass ich absolut kein Gefühl mehr in meinem Hintern hatte. Nach etwa zwei Stunden kehrten Charlotte – die bis zu dem Tag noch nie in ihrem Leben einen Wal gesehen hatte – und ich zusammen mit dem Rest unserer Gruppe den Walen den Rücken und machten uns auf den Weg zurück zum Ufer, vollkommen erschöpft und tief beeindruckt.
Wir hatten etwa die Hälfte der Strecke zum Hafen hinter uns, als plötzlich zehn Meter vor uns ein erwachsener Buckelwal aus dem Meer brach und so unglaublich hoch in die Luft schoss, als sei plötzlich ein großes Gebäude aus dem Wasser gewachsen, wie Charlotte es später beschrieb. Ein Wal im Wasser ist wie ein Eisberg: Man sieht nur einen Bruchteil von ihm und hat keine angemessene Vorstellung von seiner Größe. Jeder «foot» (Fuß = 30,48 Zentimeter) Buckelwal wiegt etwa eine Tonne, und erwachsene Tiere sind zwischen 30 und 50 Fuß lang (zwischen neun und elf Metern). Ein Tier, dreimal so schwer wie ein Doppeldeckerbus. Können Sie sich vorstellen, wie es aussieht, wenn so etwas über Ihnen dräut? Eben noch fahren wir auf dem spiegelglatten, ruhigen Meer nach Hause, und im nächsten Moment ist diese gewaltige lebende Masse aus Muskeln, Blut und Knochen in der Luft und beugt sich über uns. Ich weiß noch, dass mir die Furchen am Hals auffielen. Bauchfalten, dachte ich bei mir. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich unter Wasser bin.
Ein Buckelwal ist dreimal so groß wie der größte T-Rex; seine fünf Meter lange Brustfinne ist der größte und mächtigste Arm in der Geschichte des Lebens auf der Erde. Würde man die Brustfinne eines Buckelwals röntgen, sähe man den eigenen Arm monströs vergrößert: ein Schulterblatt, in das sich der Oberarmknochen schmiegt, der Elle und Speiche verbindet, Handknochen und Finger – ein Erbe des Lebens an Land, bevor ihre Vorfahren ins Meer zurückkehrten. Als der Wal auf uns niederging, wurde das Kajak von der Kraft des Aufpralls unter Wasser gedrückt, und wir wurden zusammen mit dem sinkenden Wal in die Tiefe gezogen, nichts als eine Gischtexplosion hinterlassend, wo eben noch wir gewesen waren. Aus dem Kajak geschleudert, wirbelte ich, ein Spielzeugmensch, im eiskalten Wasser und überschlug mich schneller, als ich für möglich gehalten hätte, der Magen drehte sich mir um, ein Gefühl, wie wenn man von etwas sehr Hohem springt. Meine Augen waren offen, aber ich sah nichts als Weiß. Ich spürte, dass der Wal noch sehr nah war. Und dann merkte ich, dass er sich, ohne mich zu berühren, entfernte. Das Weiß der Explosion verwandelte sich in dunkles Meerwasser. Und erst in dem Moment verspürte ich Angst. Bis dahin war es eine Angelegenheit von Fakten gewesen: Ein Wal hatte sich über mir aufgetürmt, und ich würde sterben. Irgendein Reptilienteil meines Gehirns schloss jetzt, dass ich nur deshalb noch nicht tot war, weil ich mich im Schockzustand befand und nicht spüren konnte, dass mein Körper in Stücke zerbrochen war. Bald würde sicherlich der Schmerz einsetzen und ich würde das Bewusstsein verlieren. Aber wundersamerweise spürte ich, wie meine Rettungsweste mich nach oben zog, und ich strampelte mich mit ihr hin zum Licht.
04 Unter dieser Gischtwolke befinden sich Charlotte, ich, ein Kajak und ein Buckelwal.
Ich war fest davon überzeugt, dass Charlotte tot war. Als ich freie Sicht hatte und mich umschaute, sah ich ihren Kopf. Ihren lebendigen Kopf, der fest am Rest ihres Körpers saß; ihre Augen waren weit aufgerissen, und Adrenalin und Angst hatten ihren Mund zu einem Grinsen verzogen. Ich empfand nichts als reines Glück. Wir waren lebendig.
Wieso zum Teufel waren wir lebendig?
Wir schwammen zu unserem Kajak, das vollgelaufen auf dem Wasser torkelte, und klammerten uns daran fest. Der Bug war von dem Aufprall verzogen und eingedellt und hatte Kratzer von den Seepocken, die auf der Walhaut leben. Erst später begriff ich staunend, wie groß die Kraft gewesen sein muss, wenn der Wal die harte gerundete Plastikschale eines auf dem Wasser treibenden Kajaks eindrücken konnte. Wenn ich in der Badewanne, so stark ich kann, auf eine Gummiente einschlage, hinterlässt das keinerlei Spuren. Wissenschaftler haben diese Kraft einzuschätzen versucht.[5] Um zu springen, muss ein Buckelwal eine Geschwindigkeit von bis zu acht Metern pro Sekunde erreichen, ein erstaunliches Tempo für ein lastwagengroßes Ding, das sich durchs Wasser bewegt. Damit ein großer erwachsener Wal sich aus dem Wasser katapultieren kann, würde er, so schätzten sie, eine Energie brauchen, die etwa der von vierzig Handgranaten entspricht. Es war, als hätten wir einen Blitzeinschlag überlebt.
Andere Kajakfahrer kamen zu uns herübergepaddelt und wirkten erschütterter als wir – was begreiflich ist, wenn man bedenkt, dass sie geglaubt hatten, uns sterben zu sehen. Jemand fischte Charlottes Flipflops aus dem Wasser, und ein Walbeobachtungsboot tuckerte neben uns her. Wir blickten hoch zu den Touristen, die sich dicht gedrängt über die Reling beugten. Einige riefen uns laut zu, ob alles in Ordnung sei, während andere uns mit ihren Smartphones aufnahmen. Die meisten hatten in die andere Richtung, aufs offene Meer, geschaut. Sie vermuteten darum, wir seien durch die Wucht des Aufpralls auf dem Wasser aus dem Kajak geschleudert worden, und nicht, dass der Wal uns tatsächlich getroffen hatte. In einem Zustand von Schock und Euphorie hängten wir uns an das Kajak von jemand anderem, während unseres umgekippt und ausgeleert wurde. Wir waren in Sicherheit. Und genau in dem Augenblick bewegte sich ein Wal an der Wasseroberfläche in unsere Richtung. «Er will noch mal!», witzelte ein Kajakfahrer in der Nähe.
Ich lachte, aber eher angespannt. Ich wusste zwar, dass diese Wale keine Menschen fressen und es auch gar nicht können, da sie keine Zähne besitzen und ihr Schlund den Durchmesser einer Grapefruit hat, mir war aber ebenso bewusst, dass sie sich nur selten auf Menschen stürzen. Gerade als der Kopf des herannahenden Wals auf uns zu treffen drohte, senkte das Tier sein Vorderteil und tauchte unter. Wenn Wale sich zum Tauchen anschicken, wölben sie deutlich den Rücken, und die Ausbuchtung vor der Rückenflosse wird sichtbar, von der sie ihren Namen haben. Während sich das lange Rückgrat krümmte und der Kopf des Wals sich zum Meer hin neigte, bewegten sich andere Körperteile von ihm noch immer aufwärts. Wie Waggons eines Zugs hoben sich nacheinander Teile des Wals und verschwanden dann unter uns: die Rückenflosse, dann der dicke, gedrungene Schwanzstiel – wie der Schwanz eines Diplodocus-Sauriers, der sich auf die Breite eines menschlichen Oberkörpers verjüngt –, bis schließlich die riesige, in der Luft glitzernde Schwanzflosse auftauchte und Wasser von den beiden Hälften des massiven Paddels tropfte.
Ich trieb im Wasser, völlig gebannt von diesem Anblick direkt vor uns, den Walbeobachter so lieben. Die riesige schwarze, herzförmige Schwanzflosse, deren Ende allein die Größe eines Pferds hatte, leuchtete im grauen Licht. Das nennt sich also «mit der Fluke schlagen», dachte ich, er macht das, um mit dem Gewicht des Schwanzes seine Auftriebskraft zu reduzieren, damit er sinken kann.[6] Dort, wo er abgetaucht war, hinterließ er im Wasser das Muster eines großen Pfannkuchens. Den Fußabdruck eines Wals. Hätte ich meine Füße unter mir ausgestreckt, hätte ich womöglich seinen Körper berührt, als er unter mir hertauchte. Stattdessen wickelte ich meine schwachen, kurzen Landbeine um das Kajak, an dem ich wie ein Faultier klebte. Und da wurde mir bewusst, dass gerade eben ein Wal auf uns gesprungen war und wir überlebt hatten. Ich drehte mich zu Charlotte um und sagte ihr das. In etwas bildlicherer Sprache erwiderte sie, sie habe es auch bemerkt, aber ich solle doch bitte den Mund halten, bis wir wieder an Land seien.
Irgendwann wandten sich die Walbeobachter wieder ihren Walbeobachtungen zu, und wir kletterten in unser inzwischen geleertes Kajak. Sean, der sichtlich erschüttert war, vertäute sein und unser Kajak mit einem Seil und steuerte Richtung Hafen. Die zwei riesigen Schornsteine des stillgelegten Elektrizitätswerks hinter Moss Landing ragten aus dem Nebel, von dem nur noch ein schmaler Streifen übrig war. Inzwischen zitterten wir. Unterwegs begegneten wir Schulkindern mit ihren Lehrern auf der Fahrt hinaus aufs Meer. Alle waren ziemlich aufgekratzt. «Auf uns ist ein Wal gelandet», rief ich, als wir an einer der Gruppen vorbeikamen, doch sie grinsten nur über diesen komischen, nassen Briten und fuhren weiter. An der Landestelle angekommen, bekamen wir jeder eine Monterey Bay Kayaks-Baseballmütze und heiße Schokolade. Niemand redete groß mit uns.
Alle verhielten sich seltsam befangen, als sei etwas Peinliches vorgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob auch nur einer von uns das Außerordentliche dessen, was geschehen war, und das Grauenhafte dessen, was beinahe geschehen wäre, wirklich ermessen konnte. Vielleicht befürchtete der Kajakverleih, wir würden sie verklagen. (Später erfuhr ich, dass sie aufgehört hatten, Walführungen mit Kajaks anzubieten; es hieß, ihre Versicherung werde das nicht mehr abdecken.) Ein Freund brachte uns zu unserem gemieteten Airbnb, und auf der Fahrt dorthin brach Charlotte schließlich in Tränen aus. Als ich mich hinunterbeugte, um meine Schnürsenkel zu binden, strömte mir Meerwasser aus der Nase, das sich bei meinen Unterwassersaltos in den Nebenhöhlen gesammelt hatte. Alles, was ich denken konnte, war, dass ich für einen Moment Teil einer grandiosen Gewalt gewesen war und dass niemand uns glauben würde. Mir fiel ein, dass ich meine beiden GoPro-Kameras morgens im Auto gelassen hatte. Charlotte hatte vorgeschlagen, ich solle sie mitnehmen, aber ich war dagegen gewesen – denn eigentlich sahen sämtliche Walvideos immer gleich aus.
In dem gemieteten Strandhaus trafen wir wieder auf unsere Freunde. Es war das Ende eines langen gemeinsamen Gruppenurlaubs, und alle waren im Begriff, zum Flughafen aufzubrechen. Ich wollte noch länger bleiben, um mit anderen Freunden in der Nähe zu campen.
«Ihr seid spät dran», sagte unsere Freundin Louise. «Wir mussten eure Sachen für euch packen, und ihr habt das Frühstück verpasst.»
«Ein Wal ist auf uns gesprungen», sagte ich.
«Ja, schön», erwiderte Louise, «aber wenn wir jetzt nicht bald aufbrechen, müssen wir 25 Dollar Strafe für den verspäteten Start bezahlen.»
Ich umarmte Charlotte, die fast völlig verstummt war. Sie hatte versucht, ihrem Mann Tom zu erklären, was passiert war, aber der war hauptsächlich verstimmt, weil er beides liebte, Wale und riskante Heldentaten. Wir aßen noch Reste vom Frühstück. Und dann zogen alle los. Charlotte wurde auf dem Heimflug ohnmächtig und musste mit Sauerstoff versorgt werden.
Ich saß draußen vor dem Strandhaus auf der Straße und wartete auf meinen Freund Nico und seine Eltern, die mich abholen wollten. Mir wurde klar, dass die einzige Person, die meine unglaubliche Geschichte bestätigen konnte, abgereist war. Ich quetschte mich zu Nicos Mutter und seiner damaligen Freundin Tanya auf den Rücksitz und erzählte ihnen, was passiert war. Ich hatte zwar den Eindruck, dass sie mir glaubten, aber Nicos Mutter schien mehr daran interessiert, was Tanyas Eltern machten. Aber ich konnte die Geschichte nicht einfach dauernd wiederholen, deshalb wandten wir uns anderen Themen zu. Einige Stunden später erreichten wir oben in den Bergen von Big Sur die Campinganlage inmitten von Kiefern, und als es dunkel wurde, blickte ich von dem staubigen Berghang hinaus auf den Pazifik und trank ein Bier, während ein paar andere Camper in der Nähe Musik machten. Weil wir dort oben keinen Empfang mehr hatten, musste ich das Geschehene für mich allein verarbeiten. Ich fragte mich, ob mir überhaupt irgendwer glauben würde. Im Ernst, wer glaubt denn wirklich, ein Dreißig-Tonnen-Wal sei auf uns niedergekracht?
Als ich in jener Nacht schlaflos in meinem Zelt lag, blickte ich hoch in die Dunkelheit und sah einen unvorstellbar großen Körper über mir; Meerwasser floss an ihm herab, knollige Tuberkel – das sind Beulen, in denen Walschnurrhaare sitzen – waren unregelmäßig auf seinem Kopf verteilt, Seepocken klebten an den Rändern seiner Flossen. Er hatte in der Luft so viel größer als im Meer gewirkt, aber gleichzeitig auch wie ein absurder Witz. Während in dem Moment selbst kaum Zeit zum Angsthaben blieb, merkte ich, wie mein Herz jetzt beim Nachdenken über das Erlebnis raste. In den Jahren danach haben Menschen mich häufig gefragt, ob ich eigentlich traumatisiert gewesen sei, aber ich glaube, das war ich nicht. Ehrlich gesagt, war ich sogar total aufgekratzt. Was für ein Anblick, was für ein Gefühl! Ich lag in meinem Zelt, schloss die Augen und brannte mir die Bilder dessen, was geschehen war, ins Gedächtnis, damit ich es nie vergessen würde.
Am nächsten Tag fuhren wir zurück nach San Francisco, und als wir aus dem Nationalpark heraus waren, hatten wir wieder Empfang. Tanya und Nicos Mutter gerieten in einen Streit über Haustiere; Nico schlichtete ihn. Neben sie gequetscht, surfte ich im Internet auf der Suche nach irgendetwas – einem Foto, einem Blog, irgendeinem Beweis für die Echtheit des Erlebten. Und da war er! Aufgrund eines bizarren Zufalls hatte ein Mann namens Larry Plants von einem nahen Walbeobachtungsboot aus genau den Moment mit seinem Smartphone gefilmt, in dem der Wal aus dem Meer sprang. Man kann sehen, wie wir dort entlangpaddeln und wie plötzlich der Wal auftaucht und auf uns kracht und Charlotte und ich für einen Moment in einer weißen Gischtexplosion verschwinden und erst nach sechs langen Sekunden wieder auftauchen. Das Video war komplett hochgeladen, mitsamt der gespenstischen Tonspur, wenn Larry triumphierend ruft: «Ich hab es, ich hab es auf Video!», und eine Frau ganz in der Nähe «Das Kajak, das Kajak!» schreit. Er hatte das Video an die Walbeobachtungsgesellschaft geschickt, die es dann bei YouTube einstellte. Und zu dem Zeitpunkt war es schon über hunderttausendmal angeklickt worden.[7]
05 Ein Screenshot von Larry Plants’ Video.
Als mir klar wurde, dass demnächst noch viel mehr Menschen das Video ansehen würden, dachte ich, ich sollte wohl besser meine Mutter Caroline anrufen. Ich erzählte ihr also, dass ich beinahe von einem herabstürzenden Wal getötet worden sei, dass es mir aber gut gehe und ich jetzt nach Hause käme. «Also echt, Tom», sagte sie. Und dann: «Was hätte dein Vater wohl dazu gesagt?» Das war auch mein erster Gedanke gewesen. Mein Vater Michael liebte seltsame Wassertiere und Geschichten übers Meer. Aber wir konnten Dad nicht mehr fragen, weil er wenige Monate zuvor gestorben war. Ich befand mich in der Trauerphase, in der ich ihn immer noch anrufen wollte, wenn etwas Interessantes passiert war, bis mir in einer merkwürdigen Mischung aus Schock und Verlegenheit einfiel, dass es ihn nicht mehr gab.
Noch am Flughafen rief Good Morning America mich wegen eines Interviews an. Und als ich am nächsten Tag in London landete, war das Video bereits vier Millionen Mal angesehen worden, Tendenz steigend. Unsere Begegnung hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet und führte inzwischen ein digitales Eigenleben. Ich nahm die U-Bahn von Heathrow und stieg an der Haltestelle Dalston Kingsland aus. Es war ein herrlicher früher Herbstabend mit tief stehendem, goldenem Licht. Auf den Straßen tranken und lärmten die Menschen, als wäre nichts geschehen. Wie konnte es sein, dass sich nichts geändert hatte, obwohl sich doch zwei Tage vorher ein Wal in der Luft über mir aufgebäumt hatte? Ich erinnerte mich an ein ähnliches Gefühl, als ich am Tag nach dem Tod meines Vaters auf demselben Weg wie jetzt von seinem Cottage nach Hause gegangen war. Ich hatte die anderen Menschen in dem Bewusstsein angeschaut, dass die Welt nicht mehr dieselbe war, und trotzdem verhielten sich all diese Leute so, als wäre nichts geschehen. Mehr als sechs Millionen Menschen sahen sich das Video an. Es schien eine gewisse makabre Faszination auszuüben, diese überraschende, spektakuläre Kollision eines riesenhaften, meist unsichtbaren, mysteriösen Tieres mit zwei winzigen menschlichen Wesen.
Unserem Beinahe-Untergang einen Sinn zu verleihen, war vermutlich vergebliche Liebesmüh; als würde ein Eichhörnchen zu verstehen versuchen, warum ein Lastwagen auf einer Landstraße nur wenige Zentimeter an seiner Nase vorbeigedonnert ist. Doch einige Tage später schrieb mir eine Freundin, Professorin Joy Reidenberg an der Icahn School of Medicine im New Yorker Mount Sinai, sie habe über den Sprung nachgedacht. Joy ist eine Walexpertin, mit der ich in vielen Filmen zusammengearbeitet habe; sie hat ihr ganzes Leben dem Studium der Anatomie dieser Tiere gewidmet. Aus ihrem Labor siebzehn Stockwerke über dem Central Park, inmitten von Schwertwalschädeln und Medizinstudenten, die menschliche Leichen sezierten, schrieb sie, der Sprung, den der Wal vollführt hatte, komme ihr komisch vor – dass er erst in die eine Richtung startete und dann plötzlich in der Luft über uns seinen Kurs änderte. Anstatt auf uns zu landen, drehte und entfernte er sich und erwischte uns nur mit seiner Flosse. «Ich glaube, ihr zwei habt überlebt, weil der Wal versucht hat, euch nicht zu treffen», schrieb sie.[8]
06 Charlotte und ich, froh und lebendig.
Hatte sie recht? Hatte er wirklich versucht, uns nicht zu treffen? Er zerschmetterte uns nicht beim Fallen und verletzte uns auch nicht im Wasser und entfernte sich schließlich sehr langsam. New-Age-Freunde stimmten Dr. Reidenberg zu und sahen darin eine Geste aus dem Universum. Andere Walexperten äußerten allerdings abweichende Meinungen. Einige sagten, es sei wahrscheinlich ein aggressiver Akt, der Wal habe uns treffen wollen. Andere glaubten, sein Sprung sei einfach ein typisches Verhalten nach dem Fressen, er habe anderen Walen etwas signalisiert.
Es wurde deutlich, dass es allein schon deshalb schwierig war, zu verstehen, was der Wal tat, als er auf uns sprang, weil wir nicht wissen, warum Wale überhaupt springen. Das finde ich bemerkenswert. Eines der größten Tiere in der Geschichte des Lebens auf der Erde kann sich aus dem Element, in dem es lebt, hinauskatapultieren und ein spektakuläres Ballett mit Spezialeffekten aufführen, und wir wissen nicht, warum. Manche glauben, Wale sprängen, um sich von den gigantischen Läusen und Seepocken zu befreien, die auf ihrer Haut sitzen. Andere halten die Sprünge für eine Demonstration der Stärke oder für Spiel- oder Trainingsverhalten. Die gängigsten Theorien sehen in den Sprüngen irgendeine Art von Kommunikation: Wale benutzen bekannterweise Vokalisierungen, um zu interagieren, aber das Meer kann laut sein, und die Geräusche bei einem Sprung sind extrem laut und im Wasser – das sehr viel besser leitet als Luft – können sie kilometerweit gehört werden. Waren wir also in eine Walkommunikation geraten und hatten zufällig eine Nachricht aus Spritzern unterbrochen? Sprünge könnten für Wale in der Tat all dies bedeuten oder gar nichts davon. In Joys Worten: «Niemand weiß in Wirklichkeit, worum es bei den Sprüngen geht. Niemand kann tatsächlich sagen, was euch widerfahren ist. Es ist, als ob man jemanden, der die Straße entlangtanzt, fragt: ‹Warum tanzt du die Straße entlang?› Vielleicht ist er glücklich, vielleicht ist er verrückt, oder vielleicht hat er eine Ameise im Schuh. Man kann nicht in seinen Kopf schauen und auch einen Wal nicht fragen: ‹Warum machst du das?›»
Und das stimmte. Einen Wal kann man nicht fragen.
Das Nachrichtenkarussell schnappte sich uns, und es lief wie geschmiert. In der ganzen Welt waren wir die besondere Geschichte am Ende der Nachrichten; wir standen in jeder Zeitung, wurden in der Zeitschrift Time vorgestellt,[9] in japanischen Spielshows erwähnt. Korrekte und falsche Berichte kursierten in der Welt: Bei einem Auftritt im Frühstücksfernsehen fragten die Interviewer absurderweise: «Als der Wal auf Sie sprang … haben Sie da begriffen, dass es ein Wal war?»[10] Ja, erklärte ich ihnen, wir haben in der Tat begriffen, dass es ein Wal war. Wir wurden ein Internet-Meme, ein GIF, ein teilbares Video als Symbol für grandioses Scheitern. Der Comiczeichner der Sunday Times verwandelte uns in einen Sketch mit Charlotte als Premier David Cameron und mir als Schatzkanzler George Osborne im Ruderboot, während Jeremy Corbyn der auf uns springende Wal ist. Mit fasziniertem Grusel schaute ich mir das Video vom Unfall immer wieder an. Als ich es in Zeitlupe abspielte, fiel mir auf, dass die Gestalt hinten im Kajak zurückschreckt, als der Wal fällt. Das war ich, der versuchte, das Boot umzukippen. Aber das Strichfrauchen im Bug bleibt stehen, unbeweglich und sehr aufrecht. Charlotte war dem Wal so viel näher gewesen als ich. Sie hatte ihn die ganze Zeit angeblickt, bis nichts mehr von ihm zu sehen war außer Gischt. Unsere Mütter wurden in den Nachrichten zitiert: Charlottes sagte, ihre Tochter dürfe nie wieder aufs Meer hinaus, meine erklärte, sie sei froh, dass es mir gut gehe, aber sie finde, es wäre durchaus ein passender Tod für mich gewesen. Und dann folgten neue Sensationen, und das war’s.
Aber das Leben war nicht mehr dasselbe. Ich war der Typ mit dem Wal, der Blitzableiter für Walfanatiker, und jeder, dem ich begegnete, schien eine Wal- oder Delfingeschichte auf Lager zu haben. Ein pensionierter U-Boot-Matrose aus Yorkshire erzählte mir, wie er Walen gelauscht habe, die singend sein Schiff umkreisten, während es die Tiefe durchpflügte, und ihre Rufe seien durch den Rumpf gedrungen. Er habe den Eindruck gehabt, sie hätten mit dem U-Boot gespielt. Eine Wissenschaftlerin berichtete mir, wie sich ihr in einer mexikanischen Lagune ein Grauwal genähert, den Kopf gehoben und mit offenem Maul gegen ihr kleines Boot gestupst habe. Sie habe in sein Maul gegriffen und seine enorme, zitternde Zunge gerieben, während sie beide einander die ganze Zeit in die Augen sahen. Eine Verlegerin erzählte mir, sie sei in Australien mit wilden Delfinen geschwommen. Einer habe sich ihr genähert und sie umschwirrt, als horche er ihren Körper mit den sonarähnlichen Echoortungsorganen in seinem Kopf ab. Er war außerordentlich interessiert an ihr, und zwar nur an ihr. Die Führer berichteten ihr später, es sei ein schwangeres Weibchen gewesen. Wenige Tage darauf stellte die Verlegerin fest, dass auch sie schwanger war.
Ich erhielt jede Menge Botschaften von Kindern und versuchte auch in Schulen zu erklären, was geschehen war. Ein Kind schrieb mir: «Lieber Tom … Und Wie isT Wal auf Dich Gesprungen?», und weiter: «und Hast du welche Ferunde?» Der Wal hatte mir in der Tat viele Freunde beschert. Menschen, die seltsame Erlebnisse mit Waltieren gehabt hatten – und Menschen, die besessen von ihnen waren. Ich selbst habe Wale schon als kleines Kind geliebt. Eine meiner frühesten Erinnerungen betrifft die Enttäuschung darüber, dass die englische Grafschaft Wales kein riesiges Delfinarium ist. Unsere Fotoalben mit den Familienurlauben sind voller Postkarten mit Schwertwalen, und meinen ersten Sommerjob als Teenager hatte ich auf einem Walbeobachtungsboot. Bis ich irgendwann selbst im Wal-YouTube landete, hatte ich daran nie als an eine Informationsquelle gedacht – aber nach dem Vorfall verfolgte ich jede noch so abwegige Walspur. Schon bald verbrachte ich so viel Zeit mit dem Angucken von Videos mit Walen und Delfinen, dass die Algorithmen meines Internetbrowsers das mitkriegten und mich mit Werbung für Walkreuzfahrten in die Antarktis und Aquaparks bombardierten.
Es gab ein Video von einem Sporttaucher, der nachts Teufelsrochen in schlammigem Wasser gefilmt hatte, das von Unterwasserfackeln beleuchtet wurde.[11] Ein Großer Tümmler nähert sich ihm; in seiner Brustflosse steckt ein großer Angelhaken, dessen Nylonschnur sich ganz und gar um den Vorderkörper des Delfins gewickelt hat. Der Taucher beugt sich zu dem ihn umkreisenden Tier, das daraufhin direkt zu seiner Hand schwimmt und dann im Wasser stillhält, während der Taucher sich an der Schnur entlang zu dem Haken vortastet und ihn vorsichtig lockert. In den folgenden Minuten befreit er die Flosse mit Händen, Messer und Schere von dem Angelgerät, fährt dabei mit den Fingern bis hinauf zum Maul des wilden Tiers und wieder zurück und löst dabei das verhedderte Schnurgewirr vom Fleisch. Kann es wirklich sein, dass der Delfin um Hilfe gebeten hat? Hat er seine Flosse wirklich dem menschlichen Wesen hingehalten? Während meiner Ausbildung als Biologe habe ich einen Anthropomorphismusalarm gegen solche Überlegungen entwickelt. Aber wie hätte das Geschehen sonst erklärt werden können?
Ein anderes Video stammt von einer Wissenschaftlerin, die gerade zwei Buckelwale unter Wasser filmt, als sich der eine auf den Rücken rollt und sie mit seiner Flosse vor sich herschiebt.[12] Als sie schließlich auf ihr Boot flüchten kann, rufen ihre Kollegen ihr zu, im Wasser sei ein Tigerhai gewesen und der Wal habe sie beschützt. «Ich liebe dich, vielen Dank!», ruft sie dem Wal zu, der sich noch eine Weile in der Nähe des Schiffs aufhält. In Kanada wiederum singt ein Kajakfahrer einer Gruppe leuchtend weißer Belugawale etwas vor – und zu seiner Überraschung imitiert einer der Belugas ihn und singt zurück. Er steigt aus seinem Kajak, schwimmt in dem grünen Wasser und singt gurgelnde menschliche Unterwasserlieder, und der Beluga fiepst und zirpt dazu, während er neben ihm herschwimmt und ihn beäugt.[13] Was bedeutet dieses artüberschreitende Unterwasserduett, falls es überhaupt etwas bedeutet? Mir wurde plötzlich klar, dass solche auf Video festgehaltene Erlebnisse in der Zeit vor iPhones und Profikameras Anekdoten gewesen wären, die man immer wieder erzählte, und man konnte froh sein, wenn sie halbwegs geglaubt wurden. Aber als Videos konnten sie nicht so leicht bezweifelt werden. Natürlich hörte ich sofort den Wissenschaftler in mir sagen, es gibt aber das Phänomen der vorurteilsbehafteten Auswahl: Es gibt Videos von Delfinen, die Taucher ignorieren, von Belugas, die sich stumm von Kajakfahrern abwenden, und von Buckelwalen, die sich entfernen und Schwimmer der Verletzungsgefahr durch Haie überlassen, aber die verbreiten sich eben nicht mit rasender Geschwindigkeit. Und trotzdem verschlang ich jede weitere Interaktion zwischen Menschen und Walen und fragte mich, was ich denn von dem allen halten sollte. Ermöglichten diese digitalisierten Begegnungen vielleicht Einblicke in speziesübergreifende Interaktionen? Selbst in London, wo ich wohne, schienen Wale ständig in den Nachrichten vorzukommen. Ein Belugawal begann in der Themse zu leben,[14] ein strahlend weißes arktisches Meerestier, länger als ein Pferd und nur eine U-Bahn-Stunde entfernt von einer Stadt mit sieben Millionen Menschen, von denen die meisten noch nie von solch einer Kreatur gehört hatten. Der Wal schwamm die Flussmündung hinauf und surrte und schnalzte wochenlang, bis er wieder verschwand.
Das waren Vorkommnisse, die nach Erklärungen und Antworten verlangten, doch in vielen Fällen schien das, was man hörte, ohnehin schon intuitiv klar zu sein. Die Wale und Delfine gingen mit Menschen um, sie kommunizierten vielleicht sogar mit ihnen. Was – falls überhaupt etwas – wollte der Buckelwal uns sagen, als er auf uns sprang? Dann meldete sich wieder mein Anthropomorphismusalarm, und ich kam mir blöd vor. Dennoch, die Frage blieb. Ich konnte sie nicht gänzlich abschütteln.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zehn Jahre lang Tierfilme gedreht und mich auf Naturschutz und auf Geschichten spezialisiert, in denen Menschen und Natur einander begegnen. Da erhielt ich den Auftrag, für die Natural-History-Redaktion der BBC und den amerikanischen Sender PBS einen Film zu drehen über die Anwohner der Monterey Bay und darüber, wie ihr Leben mit den Walen dort verbunden war.[15] Ich wollte so viel wie möglich über das herausfinden, was mir passiert war, und die Untersuchung dann ausweiten auf die größere Geschichte über die Buckelwale und was mit ihnen vor der Küste Kaliforniens im Pazifik geschah, um schließlich auf den Mensch-Wal-Umgang in der ganzen Welt zu kommen. Ich verbrachte Monate auf Schiffen mit Wissenschaftlern, besessenen Walbeobachtern, Rettungsmannschaften und Fischern. Bücher und Forschungsberichte über Wale drängelten sich in meinem Kopf neben all jenen verrückten YouTube-Videos. Unsere kleine dreiköpfige Mannschaft machte sich jeden Tag im Morgengrauen auf den Weg, um die Wale zu filmen, und war draußen auf dem Wasser, bevor die Nachmittagswinde das Meer aufwühlten und ruhiges Drehen unmöglich machten. Wenn das Meer sehr unruhig war oder wir nicht an die Wale herankamen, schliefen wir auf Stapeln aus Schwimmwesten. Wir blickten durch den Sucher, um einzuschätzen, wo ein Wal auftauchen könnte, bewegten den Fokus der Kamera an ihren Körpern entlang, um herauszufinden, wie sich ihre kolossalen Umrisse ins Bild bekommen ließen, wiederholten ihre Atemfontänen und die Schläge mit ihren Flossen in Superzeitlupe, verstärkten ihre Geräusche und wiederholten sie in Schleifen, erwischten manchmal ihre Augen, die uns direkt anstarrten – und je mehr Zeit ich in ihrer Nähe verbrachte, umso rätselhafter wurden mir diese Geschöpfe. Wie ist es wohl, ein Wal zu sein? Bewegten auch sie Gedanken und Gefühle, die irgendwie den unsrigen ähnelten? Am Ende eines jeden Tages schloss ich, vom Wind verbrannt und erschöpft, die Augen und sah immer noch das Meer, und mein inneres Gyroskop torkelte vom stundenlangen Starren durch eine Kameraröhre auf den schwankenden Horizont.
Im Laufe der Dreharbeiten geschahen drei Dinge. Als Erstes: Es schien so, als würden jede Woche neue Entdeckungen aus der Welt der Zetazeen verkündet. Neue Walpopulationen wurden gefunden, neues Verhalten beobachtet, sogar neue Arten wurden entdeckt. Stellen Sie sich vor, es würden mit solcher Regelmäßigkeit neue Elefantenarten gemeldet. Dabei können diese Tiere bis zu zwanzigmal größer sein als ein Elefant, und doch haben Wissenschaftler in den letzten Jahren in der Antarktis eine «mit hoher Wahrscheinlichkeit» neue Art von Säugetiere jagenden Orcas,[16] einen geheimnisvollen neuen Tiefseewal aus Neuseeland mit Namen Ramari-Schnabelwal[17] sowie eine sehr große neue Bartenwalart mit Namen Rice-Brydewal im Golf von Mexiko entdeckt.[18] Im Indischen Ozean führten die Aufzeichnungen von Unterwassermikrofonen, die eigentlich Atombomben aufspüren sollten, zur Entdeckung zweier neuer Populationen von Zwergblauwalen; unterscheiden ließen sie sich an ihrem ausgeprägten Gesang.[19] Und in jeder neuen Gruppe ließen sich neue Verhaltensmuster, neue Kommunikationsweisen und, wie viele Wissenschaftler glauben, neue Formen des Miteinanderumgehens feststellen. Selbstverständlich sind sie nur für uns neu; die Wale selbst gab es dort schon lange vor unserer Zeit.
07 Der Autor filmt einen mit dem Schwanz schlagenden Buckelwal in der Monterey Bay.
Als Zweites fiel mir bei unserer Filmerei auf, dass ich von lauter Maschinen umgeben war, nicht nur meinen eigenen Kameras. Über uns flogen Drohnen, die die Wale filmten und maßen; Forschungsschiffe hängten Richthydrophone ins Wasser; und sogar der Meeresboden war mit Kameras, Mikrofonen und anderen Sensoren bestückt. Mit Maschinen wurden Walausscheidungen, Schleim und DNA analysiert. Manche Wissenschaftler lenkten per Fernsteuerung Fahrzeuge mit Roboterarmen und Sonden; zwei Meter lange raketenförmige Fahrzeuge fuhren monatelang unter den Wellen weit hinaus aufs Meer. Andere Wissenschaftler befestigten Aufnahmegeräte an den Walen, verfolgten ihre Bewegungen und dokumentierten ihre Welt aus der Walperspektive, während Satelliten ihnen vom Weltraum her folgten. Und zu allem Überfluss begaben sich jeden Tag Tausende Touristen hinaus aufs Wasser, filmten und fotografierten jeden Wal, den sie erspähten, auf jedem Walbeobachtungsboot gab es private Drohnenlenker, andere hielten Kameras an Stöcken über die Reling, und alle besaßen ihre eigenen digitalen Fotodatenbanken. Wale werden vollständiger, aus größerer Nähe und regelmäßiger registriert als jemals zuvor. Diese außerordentlich innovativen Geräte haben die Möglichkeiten in unserem Verhältnis zur Welt der Natur verändert – und keines von ihnen hatte es schon gegeben, als ich um die Jahrhundertwende meinen Abschluss in Biologie machte. So wie das Zeitalter der mikroskopischen Entdeckungen durch Antoni van Leeuwenhoeks Vergrößerungsgeräte eingeleitet wurde, ist auch dieses goldene Zeitalter der Walbiologie getrieben von Technologie … und Neugier.
Als Drittes wurde mir während des Filmens klar, dass all diese gesammelten Informationen erst nach der Auswertung durch weitere neue, leistungsfähige Maschinen sinnvolle Erkenntnisse ergaben. Und diese Tatsache hatte Auswirkungen für mich persönlich. Einheimischen Bürger-Wissenschaftlern war es gelungen, mithilfe neuer Datensätze von Buckelwalfotos, die wenige Wochen vor unserem Beinahe-Tod entstanden waren, den Wal zu identifizieren, der auf Charlotte und mich gesprungen war. Sie nannten ihn den «Hauptverdächtigen». Die Entdeckung hatte sich aus einem Computeralgorithmus ergeben, der speziell dazu entwickelt worden war, Muster in Buckelwalfotos zu finden. Ein weiterer Algorithmus wurde auf jahrelange Tonaufnahmen vom Meeresgrund angesetzt, und mit seiner Hilfe konnte festgestellt werden, dass die Wale in der Monterey Bay sangen – eine Überraschung für viele, die glaubten, Wale sängen nur in ihren tropischen Winterrevieren. Wie sich herausstellte, sangen sie Tag und Nacht, den ganzen Winter lang. Das ist ein anschauliches Beispiel für einen außerordentlich tiefgehenden Wandel, der sich in der gesamten Biologie vollzieht. Alle möglichen neuen Technologien schenken uns inzwischen mehr Informationen, als wir uns je erträumt hätten, sie machen immer schnellere Analysen möglich und bringen uns diesen fantastischen Geschöpfen, die sich die Welt mit uns teilen, immer näher.
Was bedeutete all dies, und worauf würde es hinauslaufen – dieses Zeitalter der Entdeckungen, diese Maschinen des Aufspürens und der Mustererkennung? Wenn dies erst der Anfang war, was würden Computeralgorithmen in all diesem neuen Waldatenmaterial sonst noch herausfinden?
Am Ende der Dreharbeiten wurde ich von zwei jungen Männern aus dem Silicon Valley besucht. Sie hatten mit der Gründung von Internetfirmen ein Vermögen gemacht, und jetzt wollten sie sich im Naturschutz engagieren. Sie erzählten mir etwas absolut Unglaubliches – sie hätten vor, mit den neuesten Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz Tierkommunikation zu entschlüsseln, so etwas wie ein «Google Translate» für Tiere zu entwickeln. Ich musste sofort wieder daran denken, was Joy gesagt hatte, als wir über die Beweggründe des «Hauptverdächtigen» spekuliert hatten. «Du kannst nicht einfach einen Wal fragen: ‹Warum hast du das gemacht?›»
Ich dachte an all das, was ich gesehen hatte, und an die radikale Veränderung in dem, was Biologen neuerdings registrieren und in ihren Aufnahmen entdecken können. Warum eigentlich konnten wir einen Wal nicht einfach fragen? Was stand uns im Weg? Was daran war, wissenschaftlich gesprochen, letztendlich unmöglich? Ich beschloss, dass ich das unbedingt herausfinden wollte.
2Ein Gesang im Ozean
Nur wer etwas liebt, macht sich die Mühe, daran zu arbeiten.[1]
Barbara Kingsolver
Seit ich begonnen hatte, mich in die Welt der Waltiere zu vertiefen, nannten die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, immer wieder einen Mann. Für viele waren es seine Forschungen gewesen, die sie zuerst berührt und dann dazu bewegt hatten, ihr Leben der Arbeit mit diesen Tieren zu widmen. Er war es dann auch, von dem ich lernte, wie großartig und wichtig es ist, die Kommunikation der Waltiere zu entschlüsseln. Dr. Roger Payne ist der Mann, der dem Wal seinen Gesang schenkte.
Es stellte sich heraus, dass dieser legendäre Walforscher fern vom Meer, tief in den Wäldern Vermonts lebte. An einem Freitag im Juni bog ich vom Highway ab in eine lange, kurvenreiche Straße, die durch einen Wald führte. Es war ein herrlicher Tag, und das durch die Bäume dringende Sonnenlicht sprenkelte die Straße. Bob Dylan krächzte aus meinem Autoradio, und ich ließ meine Gedanken wandern. Da tauchte vor mir rechts ein sehr großer, dunkler Hund am Waldrand auf. Ich drosselte mein Tempo für den Fall, dass er auf die andere Straßenseite wechseln würde, und das tat er auch. Erst da begriff ich, dass es sich um einen Schwarzbären handelte. Er trabte auf meiner Straßenseite weiter, blickte kurz zurück zum Auto, warf den Kopf herum und verschwand im Gebüsch und weiter den Hang hinunter zu einem unsichtbaren Fluss. Die raschelnden Pflanzen verrieten, wo er entlanglief. Wenige Minuten später erreichte ich ein hohes, weiß gestrichenes, holzverkleidetes Farmhaus. An der einen Seite entdeckte ich Bienenstöcke und an die Fenster montierte Futterspender für Kolibris. Das Haus blickte auf eine grasbewachsene Lichtung und auf die hügelige Baumlandschaft dahinter; soweit ich sehen konnte, gab es keine Anzeichen anderer menschlicher Behausungen. Ich fühlte mich so weit entfernt vom Meer und von Walen, wie man nur sein konnte.
Ich klopfte an der Tür, und es erschien ein hochgewachsener, strahlender Mann in grauem Hemd und Khakihose und mit einer Brille mit Drahtfassung. Er wirkte nicht wie dreiundachtzig, was ich auch sofort hinausposaunte. «O nein, würden Sie in meinem Kopf stecken, käme ich Ihnen sehr wie dreiundachtzig vor», sagte er, doch seine Bewegungen waren flink, und seine Augen funkelten jugendlich.





























