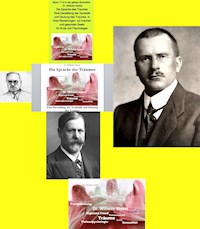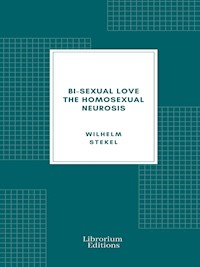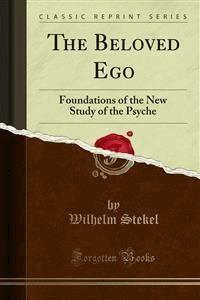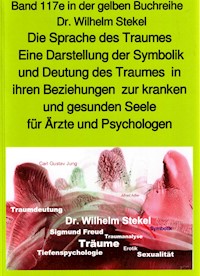
Die Sprache des Traumes – Symbolik und Deutung des Traumes – Teil 2 in der gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Wilhelm Stekel
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Der Autor dieses Buches, Dr. Wilhelm Stekel, der Anfang des 20. Jahrhunderts, wie auch Sigmund Freud, Alfred Adler und Carl Gustav Jung das Unbewusste im Menschen erforschte und durch die Traumanalyse neurotisch kranke Menschen heilte, sagt: Alles seelische Geschehen wird von dem Gesetze der "Bipolarität" beherrscht. Jedem Triebe entspricht ein Gegentrieb; jeder Tugend ein Laster; jedem "Oben" ein "Unten"; jeder Stärke eine Schwäche. Niemals werden wir das Wesen eines Menschen verstehen können, wenn wir auf diese Erscheinung keine Rücksicht nehmen. Dieses Buch behandelt die Geheimnisse der menschlichen Seele. Wollte man die Menschen nur nach den Ergebnissen dieser Forschungen beurteilen, man täte ihnen Unrecht. Denn dieses Buch handelt vom Bösen im Menschen und zwar nur vom Bösen. Wir dürfen aber nie vergessen, dass es auch ein Gutes gibt. - Rezension zur maritimen gelben Reihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Stekel
Die Sprache des Traumes – Symbolik und Deutung des Traumes – Teil 2 in der gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski
Band 117e – in der gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Dr. Wilhelm Stekel
Vorwort des Autors
Die Bedeutung der Symbolik
Auf der Oberfläche der Probleme
Der Traum vom Rathaus
Der Traum vom zügellosen Leben
Der Traum vom versunkenen Baum
Die Traumentstellung
Der Traum vom Zuckerbäcker
Der Traum von der heuchlerischen Liebe
Die Spaltung der Persönlichkeit im Traume
Villa und Strafanstalt
Transformationen und Bisexualität
Was fünf Finger bedeuten
Träume eines Zweiflers
Leben und Sterben im Traume
Der Affekt im Traume
Was die Tiere im Traume bedeuten
Drei Träume einer Nacht
Ein Wespentraum
Der Traum vom Gewächshaus
Der Traum vom Reisigholz
Der Traum von den Erdbeeren
Die Rolle des Kindes und der Verwandten im Träume
Wortneubildungen und unverständliche Worte
Der Traum im Traume
Das Erlebnis im Traume und Rettungsträume
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Hinweise
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche, ein 140-Betten-Hotel für Fahrensleute.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leserreaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen.
Inzwischen erhielt ich unzählige positive Kommentare und Rezensionen, etwa: Ich bin immer wieder begeistert von der „Gelben Buchreihe“. Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrt-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Während meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen hatte ich das Glück, einige gute Dozenten im Fach Psychologie zu haben. Besonders bei Dr. Walter Uhsadel – später Universitätsprofessor – lernte ich viel über die Erkenntnisse eines Sigmund Freud über Traumanalyse und die Tiefenpsychologie, seine Begriffe „Libido“, das „Ich“ und „Es“ und das „Über-Ich“, des „Ödipus“- und „Elektra-Komplexes“, der „Verdrängung“, des „Abreagierens“ und der „Sublimierung“. Ferner belehrt er uns über den Freund-Schüler Alfred Adler und dessen Erkenntnisse über den Macht- und Geltungstrieb des Menschen. Besonders der Schweizer Carl Gustav Jung mit seiner „komplexen Psychologie“ und seine Begriffe „Selbst“, „Persona“, das persönliche und „kollektive Unbewusste“, die „archetypischen Symbole“, die Instinkte im kollektiven Unbewusstsein, die „Anima“ und den „Schatten“ vermittelt er uns. Auch über den Berliner Arzt Fritz Künkel berichtet er. Ich lese dessen Buch „Die Arbeit am Charakter“.
Seitdem interessierte ich mich sehr stark für alle psychologische Fragen und mögliche therapeutische Hilfen für meine Klienten.
Darum möchte ich auch dieses Buch von Dr. Wilhelm Steckel neu auflegen.
Vieles hat sich inzwischen in unserer Gesellschaft im Umgang mit der Sexualität geändert. Die Prüderie des 19. Jahrhunderts spielte bei den Traumanalysen bei Freud und Stekel noch eine große Rolle. Aber Perversionen sind auch heute noch zu beobachten. Die Notwendigkeit psychotherapeutischer Bemühungen ist weiterhin unbestritten.
Hamburg, 2020 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz des Herausgebers – hier entstanden die weit über 100 Buchbände.
* * *
Dr. Wilhelm Stekel
Dr. Wilhelm Stekel
Aus seinem Leben laut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Stekel
Wilhelm Stekel wurde am 18. März 1868 in dem zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörigen Bojan in der Bukowina als Sohn aufstrebender jüdischer Kleinbürger geboren. Nach der Matura studierte er ab 1887 in Wien Medizin. Am 10. Juni 1893 promovierte er an der Universität Wien als Doctor der gesamten Heilkunde. 1895 veröffentlichte er den Aufsatz „Über Coitus im Kindesalter“, auf den sich Freud später in seiner Theorie der infantilen Sexualität bezog. Stekel hatte Sigmund Freud vielleicht schon 1891 im Kassowitz-Institut kennengelernt, in dem Freud Leiter der neurologischen Abteilung war.
Um 1901 ließ er sich als Patient von Freud wegen Potenzstörungen behandeln, in anscheinend nur wenigen Sitzungen. Von dessen Entdeckungen war er so begeistert, dass er zum bedeutendsten publizistischen Propagandisten der Psychoanalyse wurde. „Ich war Freuds Apostel und Freud war mein Christus“, schrieb er in seiner unvollendeten und postum herausgegebenen Autobiographie.
Sigmund Freud – 1905
1902 veranlasste er Freud, einige interessierte Ärzte, darunter auch Alfred Adler, zu Gesprächen in Freuds Wohnung einzuladen.
Alfred Adler
Daraus entwickelte sich die Mittwochsgesellschaft und in ihrer Folge die Wiener Psychoanalytische Vereinigung und die Internationale Psychoanalytische Vereinigung. In der Mittwochsgesellschaft war Stekel ein aktiver Teilnehmer, der seine eigenen Ansichten hatte und Freud in den „Onaniedebatten“ und bezüglich der Entstehung von neurotischer Angst widersprach. 1908 erschien sein erstes Werk, Angstzustände und ihre Behandlung. Es kam in Zusammenarbeit mit Freud zustande, der ein Vorwort schrieb, welches bei der dritten Auflage (1921) wegblieb. Sein zweites Buch war Die Sprache des Traumes (1911), das Freud zwar hart kritisierte, sich aber darauf in späteren Auflagen seiner eigenen „Traumdeutung“ bezog. Bei der Gründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (März 1910 Kongress in Nürnberg) rebellierten die Wiener unter Führung von Adler und Stekel gegen Sigmund Freud, der Carl Gustav Jung zum Präsidenten auf Lebenszeit machen wollte.
Carl Gustav Jung
Freud musste nachgeben, und Jung wurde für nur zwei Jahre gewählt. Der Beschluss, lokale wissenschaftliche Vereinigungen zu gründen, wurde auch in Wien verwirklicht. Adler wurde Präsident und Stekel Vizepräsident der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, die als Verein am 12. Oktober 1910 offiziell gegründet wurde. Zusammen mit Alfred Adler gründete Stekel ebenfalls 1910 das Zentralblatt für Psychoanalyse und war als dessen Schriftleiter tätig. Wenig später trat Alfred Adler im Dissens mit Freud aus der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung aus. Im Gefolge einer Intrige um das Zentralblatt, bei der sich Freud durch Stekel hintergangen fühlte, veranlasste er Stekel ebenfalls zum Austritt. Obwohl Stekel immer wieder versuchte, eine Versöhnung mit Freud herbeizuführen, wollte Freud nichts mehr mit ihm zu tun haben und lehnte eine Begegnung zum letzten Mal ab, als beide im Londoner Exil waren. Stekel entwickelte eine eigene Therapieform, die „Aktive Psychoanalyse“, die in der Fachliteratur als erste Form einer Kurzpsychotherapie gilt. Im Unterschied zur „klassischen Psychoanalyse“, welche sich mehr und mehr der Durcharbeitung von Widerstand und Übertragung gewidmet hatte, wodurch der Behandlungsprozess länger dauerte, versuchte Stekel die zentralen unbewussten Konflikte des Patienten direkter zu bearbeiten, auch mit suggestiven und pädagogischen Mitteln sowie Beratung in Lebensfragen. Seine Behandlungen sollen von einigen Wochen bis zu anderthalb Jahren gedauert haben, jedoch mit mehreren Sitzungen pro Woche (im Sitzen, das Liegen lehnte er ab).
Unter dem Druck der politischen Verhältnisse floh er am Tage des Anschlusses Österreichs, am 11. März 1938, über die Schweiz nach England und hatte in London eine psychoanalytische Privatpraxis. Durch die Flucht verlor er sein gesamtes Vermögen. Er schrieb seine Erinnerungen, die posthum herausgegeben wurden, und beteiligte sich an kulturellen Aktivitäten der österreichischen Flüchtlinge.
Stekel verübte wegen einer schweren Erkrankung Selbstmord im Pembroke Hotel in London im Alter von 72 Jahren. Als Todesursache wurde eine „selbstverursachte Aspirin-Vergiftung“ angegeben.
* * *
Vorwort des Autors
Vorwort des Autors
Alles seelische Geschehen wird von dem Gesetze der „Bipolarität“ beherrscht. Jedem Triebe entspricht ein Gegentrieb; jeder Tugend ein Laster; jedem „Oben“ ein „Unten“; jeder Stärke eine Schwäche. Niemals werden wir das Wesen eines Menschen verstehen können, wenn wir auf diese Erscheinung keine Rücksicht nehmen.
Mein Werk behandelt die Geheimnisse der menschlichen Seele. Wollte man die Menschen nur nach den Ergebnissen dieser Forschungen beurteilen, man täte ihnen Unrecht. Denn dieses Buch handelt vom Bösen im Menschen und zwar nur vom Bösen. Wir dürfen aber nie vergessen, dass es auch ein Gutes gibt.
Vielleicht kann ich mich am besten durch einen Vergleich verständlich machen. Ein Fremder kommt in eine ihm unbekannte Stadt; er besichtigt mit großer Gründlichkeit und Begeisterung die Stätten der Kunst und entzückt sich an allem Schönen und Sehenswertem, das die Kultur bietet. Er verlässt dann die Stadt mit dem Bewusstsein, sie bei einer Gründlichkeit genau kennen gelernt zu haben. Ein anderer Reisender sagt sich, nachdem er das Programm des Reiseführers absolviert hat: Jetzt will ich auch etwas von der Kehrseite des Erhabenen kennen lernen. Er lässt sich durch die Stätten des Elends, des Lasters und des Verbrechens führen. Er weiß, dass es hinter der prunkvollen Außenseite auch ein weniger schönes Inneres gibt, und er lernt aufs Neue, dass nur der die Lichtseiten beurteilen kann, der auch die Schattenseiten studiert hat.
Meine Forschungen befassen sich mit den Abgründen der menschlichen Seele.
Sie sind nicht für unerfahrene Laien berechnet, in deren Köpfen sie leicht Verwirrung anrichten könnten, statt Klarheit zu bringen.
Ärzten, Juristen, Seelsorgern, Pädagogen und Psychologen werden sie gewiss manche Anregung und eine Erweiterung ihres geistigen Horizontes erschaffen. Es ist höchste Zeit, dass wir den Phänomenen des Traumlebens mehr Aufmerksamkeit schenken. Hier eröffnen sich Einblicke in die Tiefen der menschlichen Seele, die uns eigentlich erst das Verständnis alles Psychischen ermöglichen.
Ich habe mich bei der Abfassung dieses Buches, das die Frucht jahrelanger, mühevoller Arbeiten darstellt, hauptsächlich von praktischen Gesichtspunkten leiten lassen. Das Theoretische und die bisherige Literatur über den Traum finden sich bei Freud so vorzüglich behandelt, dass ich alle, die sich für dieses Thema interessieren, auf das grundlegende und gedankenreiche Werk dieses Autors verweise.
Meine Arbeit will nicht nur gelesen, sie will auch nachgeprüft werden. Jede Kritik ist mir willkommen, wenn sie nicht von blinder Voreingenommenheit diktiert wurde. Denn manches in diesem Buche wird dem nicht in die Probleme der Traumdeutung Eingeweihten gesucht und gekünstelt vorkommen.
So ist es mir selber ergangen, als ich mich mit den Träumen zu beschäftigen begann. Eine Überzeugung kann nicht durch Lektüre allein, sie muss durch eigene Nachprüfung erworben werden.
Eine Tatsache möchte ich noch hervorbeben: Die Traumdeutung ist eine werdende Wissenschaft. Alles ist im Fluss, alles im Entstehen.
Auch dieses Buch soll nur eine Stufe sein. Wer kann es jetzt ermessen, wie stolz einmal der Bau ragen wird, zu dem diese Stufe hinauf führt?
Wien im Januar 1911.
* * *
Die Bedeutung der Symbolik
Die Bedeutung der Symbolik
„Wahrlich, währen die Menschen sinniger,
die feinen Winke der Natur zu beobachten
und zu deuten, dieses Traumleben müsste
sie aufmerksam machen. Sie müssten finden,
dass von dem großen Rätsel, nach dessen Lösung
sie dürsten, die Natur uns hier schon
die erste Silbe eingeflüstert hat.“ Kürnberger.
Die Kunst der Traumdeutung ist eine uralte. Die ältesten Überlieferungen erzählen uns von gedeuteten Träumen. Der Traum war der Mittler zwischen den höheren Gewalten und dem Menschen. Meistens war es die Stimme der Gottheit, die im Traume zu einem sprach. Auch Dämonen und alle finsteren Mächte konnten durch den Traum mit den Menschen verkehren. Es war eine Zeit, die wir Nüchternen uns kaum vorstellen können. „Die Beleuchtung und die Farben allerdings" — sagt Nietzsche — „haben sich verändert! Wir verstehen nicht mehr ganz, wie die alten Menschen das Nächste und Häufigste empfanden — zum Beispiel den Tag und das Wachen: Dadurch, dass die Alten an die Träume glaubten, hatte das wache Leben andere Lichter."
Doch das einfache Volk hat im Gegensatz zu den Gelehrten die Träume niemals als Schäume betrachtet. In ihm schlummerte das Bewusstsein von der Wichtigkeit dieses psychischen Materials. Nur bestand es hartnäckig auf dem Glauben, den wir den „historischen" nennen dürfen: es wollte aus dem Traume die Zukunft erschließen. Der Traum galt als der unfehlbare Prophet. Wer Träume deuten konnte, dem war die Gabe gegeben, die Rätsel der Zukunft zu lösen. Eine Abspaltung dieses Glaubens ist die Verwendung des Traumes zu Zwecken des Gelderwerbes. Die Umdeutung der Traumbilder in Nummern wird noch heute fleißig geübt und spielt eine große Rolle im Volke. (Ich will bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass ich es nicht verschmäht habe, die verschiedenen ägyptischen und persischen Traumbücher durchzusehen. Ich wollte mich überzeugen, ob unsere aus Traumanalysen erworbenen Kenntnisse durch die Überlieferungen gestützt würden. Das ist nur selten der Fall gewesen. Die Traumbücher, die im Volke zirkulieren, machen mir den Eindruck von willkürlichen Machwerken. Die Umdeutung von Traumbildern in Nummern ist offenbar dem erst einige Jahrhunderte alten Lotteriespiele zu verdanken.)
Die „Gebildeten“ hielten es für ihre Pflicht, über diese Tendenzen erhaben zu lächeln. Der Traum wurde als ein müßiges Spiel einer vom Bewusstsein nicht gelenkten Phantasie betrachtet. Allerdings hätte die einfache Überlegung sagen müssen: Auch in dieser verzerrten Form handelt es sich um psychisches Rohmaterial. Lasst uns nachsehen, was wir daraus gewinnen können. Hie und da fanden sich auch Forscher, die den Versuch wagten, das Rätsel des Traumes zu lösen. Mehr als glückliche Anfange und missglückte Theorien kamen nicht zutage. Es ist das unsterbliche Verdienst von Freud, dieses große Werk in Angriff genommen und siegreich durchgeführt zu haben. Mit seinem grundlegenden Werke „Die Traumdeutung“ (F. Deuticke, III. Aufl. 1911) beginnt eine neue Epoche der Traumwissenschaft.
Die neue große These, die Freud aufgestellt hat, hieß: Der Traum ist eine Wunscherfüllung. Diese neue Erkenntnis stützte er durch eine große Reihe von geistreichen Traumanalysen. Er zeigte, dass die Sprache des Traumes gewissen Gesetzen unterworfen ist und durch den Prozess der Traumentstellung unkenntlich gemacht wird. Er bewies, dass der Unsinn der Träume nur ein Schein ist, der dazu dient, den wahren Sinn zu verbergen. Wir sollen nicht erfahren, was wir bei Nacht denken.
Auf diese Erkenntnisse kam er bei seinen Studien über die Hysterie und über die anderen Neurosen. Er führte einen neuen Begriff in die Medizin ein: der Unbewusste. Wer sich nur um die Regungen des Bewusstseins bekümmerte, für den war der Traum in der Tat ein nebensächliches psychisches Produkt. Dem Forscher, der an unbewusste Regungen glaubte, musste sich der Traum als wichtigstes unbewusstes Gebilde aufdrängen.
Bestand die neue Lehre von Freud darin, dass man hinter den neurotischen Symptomen unbewusste Vorstellungen finden konnte, so musste gerade der Traum einen Zugang zu diesen unbewussten psychischen Gebilden verschaffen können.
Diese Voraussetzungen erfüllen sich im reichsten Maße. Heute ist die „Traumdeutung“ ein wichtiger Bestandteil der Psychoanalyse. Heute muss sich der Arzt mit der Traumdeutung beschäftigen, wenn er auch Seelenarzt sein will. Und wie könnte ein wahrhafter Arzt etwas anderes sein wollen als ein Seelenarzt? ...
Es ist nicht so leicht, sich diese Kenntnisse anzueignen. Es bedarf darin einer eigenen Schulung und großer Ausdauer. Es bedarf gewissenhafter Nachprüfung der bisher gefundenen Resultate, bis man einmal selbst eine Überzeugung gewonnen hat und an die Dinge glaubt.
Die eigene Schulung zum Lesen des Traumes besteht in einer veränderten Auffassung der Sprache, in einem Aufspüren der Zweideutigkeiten und einer Kenntnis der Symbolismen und Vorgänge der Traumentstellung.
Die Bedeutung der Symbolik für das menschliche Leben wird noch immer unterschätzt. „Alle Kunst ist Symbolik“, sagt Feuchtersleben. „Als die wichtigste Aufgabe meines Lebens“, sagt Hebbel, „betrachte ich die Symbolisierung meines Innern.“
Wir sind durchsetzt von Symbolik. Die Sprache, die Gebräuche, die Gesten, die Gedanken sind mehr oder minder versteckte Symbolismen. Es ist das Verdienst von Rudolf Kleinpaul, in verschiedenen Werken, besonders in seiner „Sprache ohne Worte" und in dem groß angelegten Werke „Das Leben der Sprache“ (Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1888) die ungeheure Bedeutung von Symbolismen für das Leben nachgewiesen zu haben.
Was ist eigentlich ein Symbol?
Ricklin (Schriften zur angewandten Seelenkunde. II. Franz Deuticke. Wien und Leipzig. 1909) sagt: „Ein Symbol ist ein Zeichen, eine Abkürzung für etwas Kompliziertes. Wenn ich im Fahrtenplan ein Posthorn neben dem Stationsnamen sehe, so sagt es mir, dass die Station eine Postverbindung hat nach Orten, die nicht an der Bahnlinie liegen.“
„Dem Symbol ist aber noch viel mehr eigen. Warum steht im Fahrplan für den Begriff ‚Postverbindung‘ und was damit zusammenhängt nicht irgendein anderes Zeichen? Das Posthorn ist etwas, was ursprünglich zur Post gehörte. Obwohl es kein nötiger Bestandteil derselben ist, so war es früher eine der sinnfälligsten Merkmale derselben, weniger fürs Auge, als für das Ohr. Wir haben also schon wieder zwei neue Momente, welche dem Symbol zukommen. Das zum Symbol gewählte Zeichen steht zum Bezeichnenden in einem assoziativen inneren oder äußeren Zusammenhang und es ist sinnenfällig. Ferner ist es umso mehr zum Symbol geeignet, als Geschichte und Entwickelung an ihm sind, wobei es aber meist nicht ohne Bedeutungswandel abgeht. Gegenwärtig sind die schönen Zeiten bei uns wohl so ziemlich vorbei, wo der Postillion lustig ins Horn blies. — Das Horn als Zeichen ist aber geblieben, im Fahrplan, beim Militär als Abzeichen der Feldpost und noch an vielen anderen Orten.“
„Mit dem Begriff Symbol ist meist auch etwas Geheimnisvolles verbunden. Symbole werden oft gebraucht als Erkennungszeichen für geheime Gesellschaften, nennen wir z. B. das Abzeichen der Freimaurer. Das Geheimnisvolle liegt auch darin, dass nur der Eingeweihte die Bedeutung des Symbols kennt. Das war z. B. der Fall mit der Runenschrift, welche nur bestimmte Leute lesen konnten; das gibt auch den kirchlichen Zeremonien ihre zauberhafte Wirkung auf die empfängliche Seele. Schon die Entwickelung und die damit verbundene Wandlung in der Bedeutung tragen dazu bei, dass nur der Eingeweihte den vollen Sinn des Symbols zu erkennen vermag.“
„Weil das Symbol nur ein Zeichen ist, nur ein Teil des ursprünglich Darstellenden, so ist gerade während seiner weiteren Entwickelung gegeben, dass es allmählich das Zeichen wird für verschiedene Dinge: das Posthorn kann je nach dem Ort, der Umgebung, im psychologischen Sinne je nach den damit verknüpften Assoziationen verschiedenes bedeuten: Fahrpostverbindung, wenn es beim Stationsnamen im Fahrplan steht, Briefpostverbindung, wenn es auf einem Einwurf steht. Im abgelegenen Gebirgsdorf bedeutet es noch viel mehr und auf dem Ärmel einer Uniform wieder etwas anderes.“
„Durch diese Summierung der Bedeutungen kommt es auch dazu, dass das Zeichen eine Verdichtung und eine Häufung aller dieser einzelnen Vorstellungen in sich birgt. Das charakterisiert z. B. das Traumsymbol, in das tausend Assoziationsfäden zusammenlaufen. Es kommt gleichzeitig auch zu einer Vielseitigkeit des Symbols, der „dunkle Sinn" kann auf alle mögliche Art ausgelegt werden. Wer nicht eingeweiht ist und das Symbol nicht nach allen Richtungen kennt, legt es falsch oder nur nach seinem Sinne aus. Die Bibel z. B. hat den Vorzug und Nachteil, dass sie viele Symbole enthält, die in verschiedenstem Sinne ausgelegt werden.“ (Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen)
Ohne die Kenntnis der Symbolik ist die Traumdeutung unmöglich. Der große Irrtum der modernen Traumforscher bestand gerade in dem Umstande, dass sie sich mit der Symbolik nicht befreunden konnten. Darin waren uns die Alten überlegen. Wie herrlich ist die Symbolik des Traumes in der Bibel dargestellt! Und wie vollendet erscheint die Symbolik bei Artemidoros aus Daldis, dessen Buch „Die Symbolik der Träume (In vortrefflicher deutscher Übersetzung von Friedr. S. Krauss bei Hartleben in Wien (1881) erschienen. Leider fehlt das wichtigste Stück: Die Symbolik der Geschlechtsvorgänge.) noch heute für den Psychoanalytiker lesenswert ist!
Ehe wir mit der Darstellung der Traumdeutekunst beginnen, wollen wir uns kurze Zeit mit den Träumen der Bibel und mit der Deutekunst der Griechen befassen. Ich wüsste keine schöneren Beispiele zur Einführung in die Symbolik des Traumes.
Am bekanntesten ist ja die Traumdeutekunst Josefs aus dem ersten Buch Moses. Josef verdankte seine große Stellung nur seiner außerordentlichen Fähigkeit, die Träume seines Herrschers treffend deuten zu können. Der erste Traum, den er seinen Brüdern erzählte, lautet:
(1.) „Wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und stand; und eure Garben wieder neigten sich vor meiner Garbe.“
Die Brüder deuten diesen Traum sofort dahin, dass Josef sie überragen sollte: „Sollst du unser König werden und über uns herrschen?" Auch wir Kinder der neuen Zeit könnten diesen Traum nicht anders deuten. Nur dass wir aus diesem Traume den Schluss ziehen, ein Ehrgeiziger habe ihn geträumt. Und da Ehrgeizige es bekanntlich sehr weit bringen, wenn sie die nötige Klugheit mit nicht erlahmender Energie verbinden, so könnten wir fast günstige Schlüsse auf die Zukunft eines Menschen ziehen, der in seiner Jugend von solchen Träumen erfüllt ist. (Die Träume Ehrgeiziger äußern sich häufig mit den Ausdrucksmitteln der modernen Zeit; Die Menschen fliegen hoch über den Köpfen der anderen im Luftballon, mit einem Aeroplan oder nach alter guter Tradition als Engel. Mitunter fliegen sie ohne Flügel durch eine bloße Bewegung der Arme und des Körpers.) Auch der zweite Traum Josefs ist ein solcher Ehrgeiztraum:
(2.) „Mich däuchte, die Sonne und der Mond und die elf Sterne neigten sich vor mir.“
Dieser Traum sollte sein Verderben werden und war der Anfang seines märchenhaften Glückes. Ebenso wunderbar sind die weiteren Deutungen Josefs:
(3.) „Die sieben hässlichen mageren Kühe, welche die sieben schönen fetten Kühe auffressen“, wurden von ihm genialerweise als sieben magere Jahre der Hungersnot, die den sieben fetten Jahren der Fruchtbarkeit folgen würden, gedeutet. Alle diese Deutungen zeigen uns ein wunderbares Erfassen der Traumsymbolik. In gleichen Bahnen bewegte sich die Deutekunst der Griechen, von der ich hier zwei Beispiele aus dem Artemidoros anführen will:
(4.) „Es träumte jemand, er wäre mit einer Kette an das Postament des Poseidon am Isthmus gefesselt. Er wurde Poseidon Priester; denn als solcher musste er vom Orte des Heiligtums unzertrennlich sein.“
Dieser Blick in die Zukunft ist ebenso wohlfeil, als die nächste Prophezeiung des Artemidoros, die ich bald mitteilen werde. Es wird keiner Priester, der es nicht vorher lebhaft wünschte, es sei denn, er würde dazu gezwungen werden...
Der zweite Traum aus dem Artemidoros zeigt uns eine Symbolik, die uns noch des Öfteren beschäftigen wird. Das Sexuelle wird in diesem Traumgesichte als Fleisch dargestellt. Das Fleischliche im Menschen durch das Fleisch eines Tieres.
(5.) „Einer träumte, dass er sein eigenes Weib verführe und abopfere, das Fleisch einschrote und feilbiete, und dass ihm daraus ein großer Gewinn erwachse. Darauf träumt er, er empfinde darüber Freude und mache den Versuch, das zusammengebrachte Geld, um dem Neide der Umstehenden zu entgehen, zu verstecken." „Dieser Mann verkuppelte sein eigenes Weib und zog aus der Schande Gewinn. Diese Einnahmequelle erwies sich für ihn zwar als sehr ergiebig, war aber angezeigt, geheim gehalten zu werden.“ Auch diesem Mann ist der Wunsch vor der Tat Gevatter gestanden. Er träumte zuerst das, was er auszuführen noch nicht wagte. Da er den Traum als eine Mahnung der Götter auffassen konnte, löste der Traum möglicherweise eine Tat aus, die wahrscheinlich auch ohne Traum geschehen wäre. Vielleicht nur einige Zeit später. Der Traum ist ein Ungeduldstraum. Der Träumer kann es kaum erwarten, seine Frau zu verkaufen und den Gewinn einzuziehen.
Von der Traumdeutekunst der Orientalen könnte man auch manche köstliche Probe gehen. Ich beschränke mich auf die Mitteilung eines Schwankes von Buadem, der nach Dr. Müllendorf nur ein von dem Herausgeber Mehemed Tewfik gefundener Deckname für den bekannten Schwänkedichter Nassr-ed-din ist. Dieser türkische Eulenspiegel soll im 14. Jahrhundert gelebt haben. In schlagender Weise legt der folgende Schwank dar, dass der Traum eine Wunscherfüllung ist: Buadem (Deutsch: Dieser Mann.) war kaum fünf bis sechs Jahre alt, da erzählte er eines Morgens seinem Vater folgenden Traum:
(6.) „Vater, heute Nacht habe ich im Traum Kuchen gesehen." „Mein Sohn, das ist eine gute Vorbedeutung. (Im Scherz) Gib mir zehn Para (Kleinste in Konstantinopel kursierende Scheidemünze, nicht ganz 5 Pfennig.), und ich will dir den Traum auslegen!“ „Wenn ich zehn Para hätte, so hätte ich nicht von Kuchen geträumt.“ („Die Schwänke des Nassr-ed-din und Buadem“. Reclam 2735.)
Machen wir jetzt einen kühnen Sprung ins 16. Jahrhundert und teilen wir einen Traum des berühmten Arztes, Philosophen und Mathematikers „Cardanus" mit, der ein Buch „De somniis“ geschrieben, und dessen Glaube an die prophetische Wahrheit seiner Träume so unerschütterlich war, dass er seine Gattin, die Tochter eines Straßenräubers nach einem Traumgesicht wählte; der Traum hatte ihm bei dieser Frau das Erwachen seiner bisher schlummernden Natur vorhergesagt. Er war bis zum 34. Lebensjahre impotent. Dass ein Impotenter sich darnach sehnt, in den „Garten der Liebe“ einzudringen, dürfte jedermann verständlich sein. Hören wir, wie Cardanus dies ausdrückt.
(7.) „Ich befand mich einstmals des Nachts in einem schönen von Blumen und Früchten erfüllten Garten. Es wehte eine sanfte Luft, so dass kein Maler, kein Dichter, kein menschlicher Gedanke etwas Angenehmeres hätte hervorbringen können. Ich befand mich am Eingange des Gartens. Die Türe stand offen, als ich ein Mädchen in weißem Kleide erblickte. Ich umarmte und küsste sie; aber beim ersten Kusse schon riegelte der Gärtner die Türe zu. Ich bat ihn inständigst dass er sie offen lassen möchte. Es kam mir also vor, indem ich darüber traurig war und immer noch an dem Mädchen hing, dass ich hinausgeschlossen wurde." Wovon soll ein phantasiereicher Mensch träumen, wenn ihm der Garten der Liebe verschlossen ist? An diesem schönen Beispiel sehen wir die Tageswünsche in einer nur halbverhüllten Symbolik. Aber nicht immer ist die Symbolik so durchsichtig, wie in diesem Falle. Oft kann ein ganzer Traum im Dienste einer symbolischen Darstellung stehen. Ich will den komplizierten Problemen, die wir zu besprechen haben werden, hier aus dem Wege gehen. Ich möchte nur zu der Art, wie der Traum die Redewendungen durch Bilder ausdrückt, ein Beispiel aus der Traumdeutung von Freud anführen.
Im Traume einer Dame heißt es:
(8.) „Ein Stubenmädchen steht auf der Leiter wie zum Fensterputzen und hat einen Schimpanse und eine Gurillakatze (später korrigiert: Angorakatze) bei sich. Sie wirft die Tiere auf die Träumerin; der Schimpanse schmiegt sich an die letztere an, und das ist sehr ekelhaft.“ „Dieser Traum hat seinen Zweck durch ein höchst einfaches Mittel erreicht, indem er nämlich eine Redensart wörtlich nahm und nach ihrem Wortlaute darstellte. „Affe“, wie Tiernamen überhaupt, sind Schimpfwörter, und die Traumsituation besagt nichts anderes als „mit Schimpfworten um sich werfen“. (Traumdeutung S. 250.) Wir sind also hie und da gezwungen, die Situationen und Bilder des Traumes auf Redewendungen zurückzuführen. Der Traum nimmt die Rede wörtlich; wir müssen die Vorgänge bildlich nehmen. Das erfordert eine eigene Kunst und eigene Übung. Die will erst erworben sein. Zur Illustration des Gesagten will ich hier noch einen kleinen Traum sehr sonderbaren Inhaltes mitteilen. Ein an Angstzuständen leidender Herr namens Beta (Ich habe für häufig wiederkehrende Träumer willkürliche Namen gewählt. Auch sonst sind die Namen häufig verändert, um das Erkennen der Personen zu verhindern. Das ist der große Nachteil dieses Werkes. Aber es geht nicht anders. Die erste Pflicht des Psychotherapeuten ist Diskretion.) träumt:
(9.) „Ich sehe ein großes hölzernes Christusbild vor mir. Ich nehme mir ein Stück heraus." Auch dieser Traum ist symbolisch aufzufassen. Der Träumer ist in seinem Innern noch gläubig, sogar strenggläubig, nach außen hin ein fanatischer Freidenker. Er hatte am Tage vor dem Traume ein Buch gelesen, das sich „La folie de Jésus“ (Dr. Binet-Sanglé: „La folie de Jésus". Paris. A. Maloine. 1908.) betitelt. Er musste plötzlich in der Lektüre abbrechen. Er kann nicht angeben, warum. Es war wie ein Zwang. Wie ein Gebot: Jetzt höre auf, zu lesen! Die tieferen Beweggründe enthüllt uns dieser Traum. Er hat sich etwas gegen seine Gottheit herausgenommen.
Auf die weitere Bedeutung dieses Traumes und auf die Beziehungen von Angst und Wunsch will ich an dieser Stelle nicht mehr eingehen. Ich habe nur den Versuch gemacht, die Grundlinien der Traumsymbolik mit einigen Strichen zu zeichnen. Das Verständnis der Symbolik ist die Grundlage der Traumdeutung. Wir haben auch vor Freud eine Ahnung gehabt, welche Bedeutung die Symbolik im Leben des Menschen spielt. So hat Schubert und Kleinpaul auf die symbolische Auffassung des ganzen Lebens hingewiesen. Diese Forscher haben auch ungescheut auf die sexuelle Symbolik aufmerksam gemacht. Ist es nicht sonderbar, dass unsere Sprache die Worte nach dem Geschlechte unterscheidet? Erst wenn wir uns mit Traumanalysen beschäftigen, bemerken wir, wie unglaublich tief uns das symbolische Denken und besonders das sexualsymbolische Denken innewohnt. Im Traume kann alles Lange einen Penis und alles Runde eine Vagina repräsentieren. Aber nur im Traume? Man höre einmal, was Kleinpaul in dem Werke „Das Leben der Sprache“ (II. Band in dem Kapitel „Die Psychopathia sexualis des Volkes“, S. 490, 1. c.) ausführt. Er weist darauf hin, wie die ganze Sprache symbolisiert und sexualisiert ist. Die Sprache wimmle von sexuellen Symbolen. „Ja, die Menschheit“, sagt er, „ist liebestoll. Man kann nicht umhin, ihre ewige, auf das Geschlechtliche gerichtete Phantasie halb krankhaft, halb lächerlich, am Ende langweilig zu finden. Sie hat geradezu den Verstand verloren. Das Männliche, das Weibliche will ihr gar nicht mehr aus dem Sinn, sie kann keinen Stiel und kein Loch sehen, ohne daran zu denken — und wenn es ein Turm ist, darin die Gefangenen schmachten, so nennt sie ihn il maschio di Volterra.“ „Nicht deshalb, weil man ein Mädchen darin sieht, heißt der Augapfel: das Mädchen des Auges. Sondern die Iris ist selbst ein Mädchen. Weil sie in der Mitte ein Loch hat — dazu braucht es keine Anatomie, das Schwarze im Auge erschien eben als ein Loch im Auge. Loch, Τϱὺπα, Trou ist in allen Sprachen ein Name für das Weib, das schon in der Genesis (I, 27) die Gelochte heißt, und weil das Auge klein ist, betrachtete man das Auge als ein junges Mädchen.“
„Besonders nehmen die Gedanken diese erotische Richtung dann, wenn eine Hervorragung in die Höhlung passt, wie der Fuß in den Schuh oder wie das Messer in die Scheide, wenn beide Dinger für einander gemacht sind und ineinander stecken. Dann stellen sie das große Glück aller Geschlechtswesen, die geschlechtliche Vereinigung und das dar, was sie am Ganges Lingam nennen.“ „Qual Buco, tal Cavicchio“, sagen die Italiener sprichwörtlich, wie Fischart einmal bemerkt: Es war eben ein Zapff für diese Flasch, denn faul Eyer und stinkend Butter gehören zusammen, oder wie sich das Volk bei uns ausdrückt: Auf jedes Töpfchen gehört sein Deckelchen. Es ist eben recht dahinterher, und unzählige technische Ausdrücke lassen sich nur durch seine unablässige Adam- und Eva-riecherei erklären. So die vielen Mütter, Nonnen und Matrizen in den Gewerben.“
„Mutter, Nonne, Weib auch Schnecke; auf der anderen Seite Vater, Mönch und Mann stehen hier nur für den wesentlichen Teil. Das lässt tief blicken: Mönch und Nonne. Oft ist es so, dass die männliche Hälfte noch einen vernünftigen Namen führt, wie Stempel oder Spindel, und nur die bessere weibliche poetisch verklärt wird. Ein eheliches Verhältnis scheint für die Schraube zu bestehen (Spindel und Mutter).“
Wahrlich, Kleinpaul hat recht: die Sprache wimmelt von sexuellen Symbolen. Wir müssen eigentlich nur den Geist der Sprache erfassen, und wir können manche Träume deuten. Ein junger Bursche von 16 Jahren, dessen Vater ein berühmter Künstler und ein liebenswürdiger, von allen Frauen vergötterter Don Juan ist, erzählt mir einen Traum:
(10.) „Der Vater entdeckt in den Zimmern verschiedene Löcher. Ich ärgere mich, dass er sie alle allein verstopfen will.“
Als ich ihn frage, warum er sich geärgert habe, sagt er: Weil er sich der Mühe unterzieht. Ich konnte ihm ja helfen. Das ist keine passende Arbeit für einen so großen Künstler.“ Er rationalisiert — nach dem treffenden Ausdrucke von Jones seinen Traum. Aber wir fassen den Traum lieber wörtlich auf. Der junge Mann ist ein Alexander, der sich ärgert, weil Philipp ihm nichts zu erobern übrig lässt. Alle Frauenzimmer im Hause verehren den Vater: die Mutter, die Tante, die Französin, die Sekretärin. Er verdächtigt den Vater grob sexueller Beziehungen. Vielleicht nicht mit Unrecht. Die Löcher in der Mauer sind im Sinne Kleinpauls aufzufassen.
Wir haben mit der allgemeinen harmlosen Symbolik begonnen — man denke an die Garben im Felde (Vielleicht lässt auch der Traum Josefs noch eine zweite, erotische Bedeutung zu. Größenwahn und der Wunsch einer außerordentlichen Potenz, eines außerordentlichen Phallus gehen oft Hand in Hand. Paranoiker mit Größenwahnideen pflegen sich zu rühmen, sie hätten 1.000 Frauen, 1.000 Söhne und dergleichen Renommistereien mehr.) — und sind schon mitten in der tiefsten Erotik drinnen. Das ist schon das Schicksal der Traumdeutung. Wer sie betreiben will, muss sich auf ärgere Dinge gefasst machen.
Ich möchte hier noch einen Vorgänger Freuds anführen, den bekannten Traumforscher Scherner („Das Leben des Traumes“, Berlin, Heinrich Schindler, 1861.), der sich in die Hypothese verrannt hatte, alle Träume auf Leibreize zurückzuführen. Diese Hypothese hat sich als ganz unhaltbar erwiesen. Trotzdem drängte sich diesem Forscher die Sexualsymbolik in vollkommen richtiger Form auf. Manches mag lächerlich erscheinen. Aber Tatsachen verlieren dadurch, dass sie lächerlich erscheinen, nichts von ihrem Werte. Scherner bemerkt zum Thema der Sexualsymbolik: „Die Geschlechtsregung symbolisiert sich in Form von Nachbildungen des erregten Organs selbst oder in Bildern und Phantasieaktionen, welche das erregte Verlangen nach Geschlechtsbefriedigung ausdrücken. Auch hier herrscht aber das verhüllte Schaffen, welches die malerische Kraft der Phantasie aufrechterhält. Z. B. man findet auf der Straße des Ortes, wo man gerade geht, den oberen Teil einer Klarinette, daneben den gleichen Teil einer Tabakspfeife, daneben wieder einen Pelz (die oberen Teile von Klarinette und Tabakspfeife stellen unverkennbar die annähernde Form der vordringenden männlichen Gliedmasse dar, die röhrenartige Beschaffenheit des Gefundenen die durchgehende Röhre des Geschlechtorganes; die gefundenen Gegenstände sind aber doppelt gesetzt aus Anregung des paarigen Gesichtssinnes, welcher beim Erblicken des Gefundenen wesentlich interessiert ist. Endlich steht der wolligste Pelz für das Schamhaar, so wie die Bürste für die Augenbrauen und Wimpern sich vorfindet, anstatt des sonst üblichen symbolischeren Geästs; alle drei Bilder nebeneinander gefunden, bedeuten die Zusammenverbindung des dadurch Ausgedrückten). Oder man findet in Verbindung mit Harnreizen eine ganz kurios zusammengeschrumpfte kurze Tabaks- oder Zigarrenpfeife, womit sich der Gesamtriss der männlichen Organik versinnbildlicht. Schärfer ausgeprägt aber erscheint die Symbolik bei angespanntem Zustande der Sexualität, welcher gemeiniglich dem Harnreize folgt, und es steht der schärfere symbolische Ausdruck dem schärferen Reize kongruent. Z. B, man sieht durch das Geäst von Bäumen hindurch, unter welchen man steht, nach einem hochragenden Turm der Gegend, an dem (aus der Wirklichkeit bekannten) Turme gewahrt man zur Verwunderung, dass seine oberste Spitze eine abgestumpfte Gestalt angenommen habe und indes man die runde Kuppel darunter betrachtet, meint man, ein zweiter Knopf (der niemals in Wirklichkeit war) müsse herunter gefallen sein; während dieses aufmerksamen Hinsehens aber sieht man sich unter Frauen, oder solche an sich vorübergehen. Der hochragende Turm steht für die Gespanntheit des aktiven Organs, die Turmspitze erscheint abgestumpft der oberen Struktur des Organes gemäß; die Phantasie sucht mit Gewalt zwei Kuppeln, wo nur eine vorhanden ist, um die Paarigkeit des unteren Organes auszudrücken; sie lässt den Träumer unter dem Geäst hervor auf den ragenden Turm blicken, weil das aktive Organ aus dem umgebenden Schamhaar (Geäst) hervortretend gesetzt ist. Turm, Spitze, doppelte Kuppel, Baumgeäst aber drücken allzusammen nur einen zusammengehörigen Begriff aus, weil die Phantasie durch die Aktion des Sehens, welche aus dem Geäst hervor nach dem Ziele des Blickes verläuft, alle Bilder in eins verschmilzt.“ (Das Leben des Traumes, S. 197 l. c.)
Nun hören wir einmal einen Traum eines sitzengebliebenen 30 jährigen Mädchens an:
(11.) „Papa geht im Zimmer herum und schneidet allen Figuren die Spitzen der Blätter ab. Ich ärgere mich darüber und will es verhindern. Ich denke: Ist er denn verrückt geworden?“
Das Mädchen erzählt uns, ihr Papa wäre immer schrecklich eifersüchtig gewesen. Er hatte es nicht einmal geduldet, dass sie fremden Männern die Hand reiche. Es kamen nie junge Leute ins Haus. Sie durfte keinen Ball besuchen.
So kam es, dass sie sitzen blieb. Wir können auch diesen Traum grob sinnlich nehmen. Der Vater hat alle Spitzen entfernt und sie vor der Gelegenheit bewahrt, einen Phallus kennen zu lernen. Im Traume findet sie die Kraft, ihn deshalb zur Rede zu stellen, was sie im Leben leider nicht getan hat. Sie war der Typus einer gehorsamen Tochter. Sie denkt an eine Figur, die vorne ein Feigenblatt hat. Wir merken den Umweg, den die Traumgedanken machen. Wozu die Verhüllung? Wozu das Feigenblatt, wenn es der Spitzen beraubt erscheint? Sie merkt, wie sinnlos das Benehmen des Vaters gewesen. Sie erkennt das Krankhafte (Verrückte) seines Benehmens.
So haben wir an zwei Träumen gesehen, wie das „Loch" und die „Spitze“ aufgefasst werden. Die Sprache des Traumes benutzt die geheimen Kräfte, aus denen die Sprache des Tages geschaffen wurde.
Diese Symbolik gilt nicht nur für die Träume! Sie zieht sich durch die Märchen, Mythen, durch die Folklore und durch die Witze.
Am schönsten lässt sich die Symbolik am Märchen nachweisen. Traum und Märchen! Welche wunderbare Zusammenstellung! Was die Kinder erleben, das träumen die Alten. Neue Erkenntnisse tun sich auf. Wir kehren die alten Wahrheiten um und sagen: Umgekehrt ist's richtig: Was die Alten erleben, das träumen die Kinder. Das ist kein leeres Spielen mit Worten.
Freud hat uns einen Schlüssel zur Deutung der Träume gegeben. Mit diesem Schlüssel versucht Dr. Franz Riklin in den Zaubergarten des Märchens einzudringen. Und siehe da! Der Versuch gelingt. Es erweist sich, dass die Märchen der Kinder eine innige Beziehung zu den Träumen der Großen haben, dass sie durchsetzt sind von einer geheimen sexualen Symbolik die an Eindeutigkeit meistens gar nicht zu wünschen übrig lässt. Die „Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen“ von Riklin beweist: Das Märchen hat eine geheime sexuelle Bedeutung! Auch das Märchen bildet gleich dem Traum eine „Wunscherfüllung“ im Sinne Freuds.
Die einfachen Märchen stellen gewissermaßen die einfachen Wünsche des Volkes dar, Riklin führt eine Reihe sehr bezeichnender Beispiele vor. Wer kennt nicht das reizende Märlein vom „Tränenkrüglein“ aus Bechsteins Märchenbuch? Eine Mutter weint drei Tage und Nächte um ihr innigst geliebtes Kind. Da tut sich des Nachts leise die Tür auf und das tote Kind im Hemdlein erscheint mit dem Tränenkrüglein, in dem die Tränen der Mutter gesammelt sind. Noch einige Tränen und das Krüglein ist übervoll, und das Kind kommt um seine Ruhe und Seligkeit. „Drum weine nicht mehr, denn dein Kind ist wohl aufgehoben und Engelein sind seine Gespielen“, Das Kind verschwindet. Die Mutter hütet sich vor weiteren Tränen. Das Kind soll ja nicht um den Himmelsfrieden kommen. Riklin sagt mit Recht, das Märchen könnte ebenso gut die Erzählung eines wirklich von einer einzelnen Person erlebten Traumes sein. Nun ist es nicht ein einzelnes Erlebnis, sondern dies Heilmittel ist zum allgemeinen, psychisch zweckmäßigen Glauben geworden, dass die Toten durch übermäßige Trauer in ihrer Ruhe gestört werden. Das ist nicht für die Toten ein Heilmittel, sondern für die Überlebenden. Das Motiv zeigt sich in unzähligen Variationen. In einer japanischen Erzählung von der „Nonne des Tempels von Armida“; in anderer Fassung bei Grimm als „Totenhemdchen“; in den von Rittershaus herausgegebenen „Neuisländischen Volksmärchen". Immer ist der Wunsch der Erwachsenen, ihren Kummer rasch los zu werden, das geheime Motiv des Märchendichters gewesen.
Noch tiefer als die „Wunscherfüllung“ führt uns die sexuale Symbolik in das Wesen des Märchens. Hier lernen wir vorerst, dass die Alten dem Kinde das erzählen, was sie selber gern hören. Freilich in symbolischer, das heißt in versteckter Form.
Wir unterschätzen die Bedeutung symbolischer Handlungen und symbolischer Darstellung für das gewöhnliche Leben. In Wirklichkeit können wir ohne Symbole gar nicht existieren. Riklin sagt: „Ist nicht fast jedes Wort ein Symbol? Die Schriftzeichen sind Symbole, die Worte sind Symbole, unsere Mimik, unsere Gesten sind zum großen Teile symbolisch. Eine geographische Karte ist ein Symbol. Bemerkenswert sind die sinnfälligen Symbole für Abstrakta: das Auge Gottes, die Waage, das Kreuz; die Farbensymbole: schwarz, rot; die Uniformsymbolik usw." Welche ungeheure Macht hat erst die sexuale Symbolik! Sie durchsetzt unser ganzes Leben. Es gibt keinen Gegenstand, der nicht unter Umständen ein sexuelles Symbol darstellen kann. Eine besondere Betonung, eine bezeichnende Geste, ein gewisser Augenaufschlag können aus einer harmlosen Rede eine zweideutige machen. Man denke nur an die ordinäre Symbolik des „Telephonliedes", das eine Soubrette jahrelang unter tosendem Beifall vorgetragen hatte.
Mit dem Schlüssel der sexuellen Symbolik entschleiern sich uns die verschiedenen Mythen der Völker. Auch die religiösen Überlieferungen. Ein schönes Beispiel bietet die Schlange, die in vielen Märchen eine große Rolle spielt. Sie war es schon, die Eva im Paradiese verführte, Sie erscheint jungen Mädchen („Oda und die Schlange“, Bechstein), und wenn diese den Ekel überwinden und die kalte Schlange ins Bett nehmen..., nun da verwandelt sich die schreckliche Schlange in einen jungen Prinzen, der auf diese Weise entzaubert ist. Die schlüpfrige, kalte, hässliche Schlange ist ein sexuelles Symbol, gleich der hässlichen Kröte, die zur Königstochter ins Bett steigt. (Der Froschkönig“ und „Der arme Heinrich" bei Grimm.) Auch hier bringt der überwundene Ekel einen strahlenden Märchenprinzen. Weitere Beispiele müssen in Riklins Büchlein nachgelesen werden.
Was die Märchen für den einzelnen bedeuten, das stellt der Mythus für die sozialen Verbände dar. Der Mythus ist ein Völkertraum und enthält in einer geheimen symbolischen Sprache unbewusste Wunschregungen und Wunscherfüllungen des Volkes. Auch er enthält eine mehr oder weniger versteckte manchmal sogar offen durchbrechende Sexualsymbolik, die eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Traum zeigt, worauf Abraham in seiner interessanten völkerpsychologischen Studie: „Traum und Mythus“ (Wien und Leipzig, 1909) mit überzeugender Darstellungskunst hingewiesen hat.
Das Studium dieser Mythen war von jeher von den Völkerpsychologen eifrig gepflegt worden, da sie berechtigterweise hoffen konnten, vom Mythus aus einen Eingang in das Seelenleben der verschiedenen Völker zu finden. Denn so wie Träume des Menschen sein geheimes Gedankenleben verraten, müssen auch die Mythen uns in unwiderleglicher Weise die Ideale und Wünsche der Völker vor Augen führen. Es zeigte sich ja, dass eine Reihe von Mythen, die bei den verschiedensten Völkern zu verschiedenen Zeiten aufgetreten waren, eine auffallende Ähnlichkeit miteinander aufwiesen, so dass sich einigen Forschern unwillkürlich die Tatsache aufdrängte, die Mythenbildung beruhe auf einem für alle Menschen fast identischen Seelenvorgang. Dagegen glauben andere Mythologen, die Gleichheit der Mythen entstehe durch Überlieferung, Entlehnung oder Wanderung desselben Mythus. Was uns bisher jedoch bei der Mythenforschung fehlte, das war der Zusammenhang der Mythenbildung mit dem Seelenleben des Individuums. Sollte es einmal gelingen, die Brücke von den Traumen des Menschen zu den Träumen der Menschheit zu schlagen, so wäre damit ein bedeutender Schritt nach vorwärts in der Erforschung dieses dunklen Gebietes gemacht.
Man kann es mit Freuden begrüßen dass, diese Verbindung des Sozialen mit dem Individuellen Otto Rank, dem wir schon die feine Studie: „Der Künstler“ (Wien und Leipzig, 1907) verdanken, für ein beschränktes Gebiet der Mythen, nämlich für den „Mythus von der Geburt des Helden“ vollkommen gelungen ist. An einer Reihe von Geburtsmythen weist Rank das Typische, Übereinstimmende dieser Völkerphantasien mit den Phantasien des Individuums in überzeugender Weise nach.
Wir werden bei der Besprechung der Geburtsträume auf die Arbeit Ranks noch zurückkommen. Wir wollten hier nur bei Besprechung der Symbolik diesen Zusammenbang wenigstens streifen; denn Träume und Mythen, Märchen und Sagen, sie sind die gleichen psychischen Gebilde. Man kann einwenden, die Heldensagen seien von Dichtem erfunden, die Märchen habe der dichtende Genius des Volkes geschaffen. Auf diesen Einwand kann ich mit einem treffenden Worte Hebbels antworten: In den Dichtern träumt die Menschheit.
Eine schier unerschöpfliche Fundgrube für die Symbolik bieten die vom bekannten Folkloristen Dr. F. S. Krauss herausgegebene „Anthropophyteia" betitelten Sammelwerke. (Leipzig. Deutsche Verlagsaktiengesellschaft.) Das ungeheure, daselbst aufgestapelte Material bedarf noch der zusammenfassenden Bearbeitung im Dienste der Traumsymbolik. Ich will an einzelnen Stellen auf die Zusammenhänge zwischen der Sprache des Volkes und der des Traumes hinweisen. Auch die Witze bringen uns Kunde aus der Werkstatt des Unbewussten (Vergl: Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten F. Deuticke 1905).
Ich habe hier nur einige bescheidene Proben gegeben, die uns die Bedeutung der sexuellen Symbolik darlegen sollen. Wir können keine Traumanalyse schreiben, ohne die Erotik zu berücksichtigen. Es gibt eigentlich keinen anerotischen Traum.
So gewaltig ist die Macht des Geschlechtstriebes, dass er uns vielleicht keine Sekunde unseres Lebens aus seinem Bann lässt. Wir werden später an den plötzlichen Träumen, an den hypnagogen Bildern (Träumen vor dem Einschlafen) sehen, wie das Sexuelle eigentlich beständig auf den Moment lauert, sich des Menschen zu bemächtigen.
Die Symbolik des Traumes ist hauptsächlich eine sexuelle. Wenn in den folgenden Zeilen das Erotische die Hauptrolle spielen wird, so ist es nicht meine Schuld. Ich kann nichts anderes tun, als das Material, das ich habe, auszubreiten. Ich habe bis heute noch keinen Traum gefunden, der keine sexuelle Beziehung aufweist. Noch einen Faktor gibt es, der eine bedeutende Rolle im Traumleben spielt: Das Kriminelle. Der geheime Verbrecher in uns tobt sich im Traume ans. Doch das Kriminelle steht fast immer im Dienste des Sexuellen. Vielleicht ist jeder Verbrecher ein Sexualverbrecher — vielleicht. — Ich hoffe in den folgenden Kapiteln den Beweis zu erbringen, dass wir das Erotische nicht in den Traum hineinlegen. Wir unterstreichen es nicht einmal. Es ist einfach da. Wer offene Augen hat, der muss es sehen, dass die Symbolik in unserem Geistesleben die wichtigste Rolle spielt.
Warum gebrauchen die Menschen so selbstverständlich die Symbolik in den Witzen und haben ein so feines Verständnis für die symbolischen Anspielungen des Flirts? Mit Recht macht Hitschmann (Dr. Eduard Hitschmann, Freud‘s Neurosenlehre. Leipzig und Wien, Franz Deuticke 1911) aufmerksam, „dass dieselben Menschen in der zynischen Stimmung der Kneipe, des Kabaretts und bei der Lektüre des Witzblattes plötzlich ausreichend über das Verständnis für die Sexualsymbolik verfügen!"
Was für einen Sinn hätte es, sich vor den Tatsachen des Lebens zu verschließen, weil sie uns nicht passen? Dieses Buch ist eine Darstellung von Tatsachen. Wer es mit Phantasterei und Gedankenarbeit abtun wollte, täte mir und der Traumdeutung Unrecht...
Doch wiederholen wir die gewonnenen Erkenntnisse. Sie lauten: Der Traum ist eine Wunscherfüllung und ist deutbar. Der Traum spricht eine symbolische Sprache und ist erst in die Sprache des Alltags rückzuübersetzen. Der Inhalt der Träume ist fast immer ein sexueller.
Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet wollen wir an die Analyse eines großen Traumes gehen.
* * *
Der Traum vom Telephon
(Analyse eines einfachen Traumes.)
Hebbel macht in seinen Tagebüchern die Bemerkung: „Wenn sich ein Mensch entschließen könnte, alle seine Träume ohne Unterschied, ohne Rücksicht, mit Treue und Umständlichkeit und unter Hinzufügung eines Kommentars, der dasjenige umfasste, was er etwa selbst nach Erinnerungen aus seinem Leben oder seiner Lektüre an den Träumen erklären könnte, niederzuschreiben, so wurde er der Menschheit ein großes Geschenk machen. Doch so, wie die Menschheit jetzt ist, wird das wohl keiner tun; im Stillen und aus eigener Beherzigung es zu versuchen, wäre auch schon etwas wert.“
Ich habe solche Tagebücher gesehen. Sie nützen uns nicht viel, weil wir die geheime Symbolik des Träumers nicht kennen.
Der große Fortschritt der Freudschen Traumdeutung besteht eben in dem Umstand, dass sie ein neues Hilfsmittel zur Deutung der Träume eingeführt hat; den Einfall des Träumers. Auf dem Wege der Assoziationen fällt dem Träumer das traumbildende Material ein. Doch der Einfall versagt manchmal. Dem Träumer fällt wiederholt aus Gründen innerer Widerstände gar nichts ein. Über diesen toten Punkt hilft uns die Kenntnis der Traumsprache und der Symbolismen hinweg. Je einfacher das Geistesleben eines Menschen ist, desto einfacher sind seine Träume. Es gibt eine große Zahl von Träumen, für die die Forderungen Hebbels passen. Kennt man das Leben der Träumer, so versteht man, was sie ausdrücken wollen. Es gibt auch Traume, die ihren Inhalt verraten, ohne dass man etwas aus der Lebensgeschichte des Träumers erfahren hat.
Hier zweigen meine Forschungen von Freud ab. Freud legt das größte Gewicht auf das Material, das hinter der manifesten Traumfassade aufgestapelt ist. Ich habe mich bemüht nachzuweisen, dass der manifeste Trauminhalt uns schon das Wichtigste vom Inhalt, von den latenten Traumgedanken verrät. Auf diesem Wege bin ich zu überraschenden Resultaten gekommen. Ich habe Zusammenhänge gefunden (z. B. die Symbolik des Todes), die ich nie und nimmer von den Einfällen des Träumers erfahren hätte. Ich habe die Traumdeutung unabhängiger vom Willen des Analysierten gemacht. Das geht nicht bei allen Träumen. Denn wie schon gesagt: Die Träume sind verschieden aufgebaut. Einfache Menschen haben andere Träume als komplizierte Naturen. Der Traum besteht aus einzelnen Traumstücken, die sich zu einem Ganzen — eben zum Traumbild zusammensetzen. Die Analyse eines Traumes muss von der Analyse der einzelnen Traumelemente ausgehen.
Doch wie ist das Traumelement zu deuten? Welchen Sinn bat es? Welchen Zusammenbang zur Wunscherfüllung?
„Es ist im Allgemeinen“, sagt Freud, „bei der Deutung eines jeden Traumelementes zweifelhaft, ob es:
a) im positiven oder negativen Sinne genommen werden soll (Gegensatzrelation);
b) historisch zu deuten ist (als Reminiszenz);
c) symbolisch, oder ob
d) seine Verwertung vom Wortlaute ausgehen soll. Trotz dieser Vieldeutigkeit darf man sagen, dass die Darstellung der Traumarbeit, die ja nicht beabsichtigt, verstanden zu werden, dem Übersetzer keine größeren Schwierigkeiten zumutet als etwa die alten Hieroglyphenschreiber ihren Lesern.“ (Traumdeutung S. 245.)
Die Träume sind eben verschieden. Manche sind dunkel und verworren und bedürfen mühsamer langwieriger Arbeit. Der Traum muss mit Hilfe aller Finessen in seine Elemente aufgelöst werden. Wir wollen als leichtes Schulbeispiel einen Phantasietraum analysieren, der sich eigentlich auf eine einzige Symbolisierung zurückführen lässt.
Es gibt nämlich auch solche Träume, die man mit einem einzigen Schlüssel auflösen kann. Wenn beispielsweise
(12.) eine Frau in die Fleischbank geht, um Einkäufe zu machen, die Fleischbank offen findet, ein großes hartes Stück Fleisch in Form einer Wurst wählt, es in die Tasche steckt, in die es kaum hineingeht, weil es in der Wärme der Tasche aufgeht, so wird jedes Detail des Traumes verständlich, wenn man weiß, dass es sich um fleischliche Gelüste und um Einkäufe auf dem Liebesmarkt handelt. Einen solchen Traum, bei dem das „Telephon“ eine erotische Bedeutung hat, will ich hier mitteilen. Er ist sehr lang und anschaulich, enthält eine Unsumme Details, die natürlich für die Analyse ebenfalls von Bedeutung sind und über die ich vorläufig hinwegsehen will. Bemerkenswert ist dieser Traum noch aus dem Grunde, weil er mit einer poetischen Produktion abschließt. Gedichte im Traume sind keineswegs sehr selten. Einzelne Verse kommen in Träumen vor und sind mitunter sehr gelungen. Ich will hier der Versuchung widerstehen, auf das interessante Kapitel von der Produktion im Traume einzugehen. Dichtung und Traum sind beide Produkte des wussten (Vergleiche meine Studie „Dichtung und Neurose“, Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens. J. F. Bergmann 1909.) und zeigen natürlich eine innige Verwandtschaft.
Der lustige Traum der Frau „Alpha“ der mit einer Ballade abschließt, lautet also (Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass ich alle Traume in dem Wortlaute bringe, wie die Träumer sie mir niedergeschrieben haben. Die unscheinbarste Redewendung, ein Verschreiben, die Wahl der Interpunktionen — dass alles kann bei der Analyse eine große Bedeutung haben.):
(13.) „Ich mache bei meiner Schwester einen Besuch und treffe bloß meinen Schwager zu Hause. Es klingelt am Telephon. Erstaunt frage ich, seit wann ein solches in der Wohnung eingeführt wäre. Mein Schwager wirft mir einen geringschätzenden Seitenblick zu und sagt, ob ich denn keine Zeitung lese. Ich antworte, dass ich dies wahrscheinlich nicht mit gebührender Aufmerksamkeit besorge, und erkundige mich um den diesbezüglichen telephonischen Zusammenhang. Der Schwager erklärt mir, es sei jetzt eine Reform im ganzen Telephonwesen und dadurch, dass man die dummen, unverlässlichen Telephondamen durch Herren ersetzt hat, die den gebildetsten Ständen angehören, sich freiwillig angeboten haben und abwechselnd stundenweise den Dienst versehen, gibt es keinen Anlass zu Ärger und Beschwerde mehr. Es existiert bereits keine anständige Familie in ganz Wien, die nicht ihr eigenes Telephon hat, und die Gebühr ist dadurch, dass die Zahl der Teilnehmer ins Ungeheure gestiegen ist, bedeutend verbilligt. Mir leuchtet sofort die Notwendigkeit dieses Sprachrohres ein und mit Begeisterung entschließe ich mich auch zu dieser Anschaffung. „Ein Schuft, wer kein Telephon hat“, beteuere ich voll Eifer und frage nach der Gebühr. „Bloß 100 Kronen pro Jahr“, meint der Schwager. „Lächerlich, diese Kleinigkeit“, sage ich, nobel, wie ich schon bin, und zaubere sofort aus meiner an Leere gewohnten Tasche die genannte Banknote hervor. Mit Ungeduld dränge ich, dass nur rasch meine Teilnehmerschaft eingeleitet wird. Mein Schwager nimmt mir das Geld ab und ich höre ihn telephonisch unterhandeln. Da erscheint ein Herr, bartlos, schwarz, klein, mit unsympathischem Äußeren und dröhnend lauter Stimme. Er stellt sich als Bassist der Hofoper vor und sagt, er wäre derjenige, dessen Obsorge meine Telephonnummer anvertraut sei. Der Schwager nimmt mich beiseite und unterweist mich, ich soll recht liebenswürdig mit dem Herrn sein und ihn ab und zu zum Nachtessen einladen, da werde ich dann ganz anders berücksichtigt. Ich sage ihm ganz offen, dass ich die Stimme des fürchterlichen Menschen nicht vertrage und bei der Vorstellung, der Grässliche werde mir künftig in die Ohren brüllen, lieber auf das Telephon verzichte. „Gib mir mein Geld zurück“, sage ich sehr ernüchtert. „Das kann ich nicht mehr, denn ich habe bereits eingezahlt“, erhalte ich zur Antwort. Von höchster Seligkeit zu tiefstem Jammer ist bei mir stets bloß ein kleiner Schritt und trostlos, mit dem Telephon behaftet zu sein, frage ich, ob denn nicht lieber der Tenor der Hofoper mir zugeteilt werden könnte. Tenöre haben viel nettere Stimmen! Da erscheint wieder ein Herr, groß, bartlos mit roten Backen wie ein Borsdorfer Äpfelchen, stellt sich mir als Tenor der Hofoper vor und fragt wegen des Telephons an. Ich erkläre ihm sofort, sein Organ sei mir viel sympathischer als das des Bassisten und ich wünschte sehr, die Herren vertauschen zu können. In der Gesellschaft des Herrn befand sich eine Dame, die er mir als seine Schwester, welche Schauspielerin ist, vorstellt Der Herr ersucht meinen Schwager, mit dem Bassisten wegen des Tausches zu verhandeln. Dieser tut es mit sichtlichem Widerwillen und gleich darauf höre ich, nach einem erregten Wortwechsel, dessen Sinn ich nicht verstehe, den Bassisten sich schimpfend entfernen. Mein Unglück ist geschwunden und überselig fordere ich Herrn und Dame auf, Platz zu nehmen. Ich bemühe mich, liebenswürdig zu sein und, eingedenk der Weisung meines Schwagers, bringe ich meine Einladung zum Abendessen vor, die bereitwilligst angenommen wird. „Nein, werden das genussreiche Abende sein“, schwärme ich entzückt. Die Schauspielerin stellt mir in Aussicht, gelegentlich deklamieren zu wollen und meine Freude kennt keine Grenzen, „Übrigens trage ich Ihnen, wenn Sie es gern hören, gleich etwas vor“, sagt das entzückende Geschöpf und beginnt zu sprechen. Angeblich ein unbekanntes Gedicht von Baumbach: „Der arme Igel“, das ich sehr aufmerksam anhöre. Darauf erwache ich und notiere das Gedicht:
Der arme Igel. (Ballade.)
Ein Igel fand Gefallen
Einst an der Jungfer Maus,
Der putzigsten von allen
Im kinderreichen Haus
Beim guten Feldmausvater,
Dem Wirt: „Zum schwarzen Kater“.
Da hielt, wie sich gebühret
Um Mausi Igel an,
Der Vater ward gerühret,
Gab seinen Segen dann.
Und selig führt die liebe Maus
Der Igel in sein Igelhaus!
Im Rausch des Glücks versunken,
Voll Zärtlichkeit den Sinn,
Naht er sich liebestrunken
Der süßen Mauselin.
Sein Herz schlug vor Verlangen
Sie liebend zu umfangen.
Kaum hat er sie umfasset
Mit treuem, starkem Arm,
Voll Schreck er von ihr lasset,
Sie piepst, dass Gott erbarm.
Doch wird‘s dabei dem Ehmann klar,
Dass er als Igel stachlig war.
Trotz aller Liebesgluten
Blieb Igels Glück beschränkt;
Es bat bei Maus, der guten.
Die Furcht die Lieb' verdrängt
Und nimmer dürft, o — wehe
Der Maus er in die Nähe.
Dem Igel stieg zu Kopfe
Der Stachelunglückswahn.
Er ward zum irren Tropfe
Und kränkelnd starb er dran;
Man hat nach dreien Tagen
Zu Grabe ihn getragen.
Moral:
Drum Igel frei in klugem Sinn
Stets nur um eine Igelin.
Dieser anscheinend so heitere, von Humor übersprudelnde Traum enthält die Tragödie eines Lebens. Die Ballade vom armen Igel ist die Geschichte ihrer Ehe. Sie ist unglücklich verheiratet. Ihr Mann ist ihr unsympathisch; sie bringt es nicht über sich, seine Liebkosungen zu dulden. Wenn er einen Koitus versucht, beginnt sie plötzlich, mitten im Akte, laut aufzuschreien und ihn von sich zu stoßen. Sie fürchtet ihre eigene Libido. Könnte sie ihm ohne libidinöse Erregung angehören, sie würde es tun. Da sie aber für ihn nicht empfinden will, stößt sie ihn von sich. Sie hat alle möglichen Vorwände gefunden, um ihn fernzuhalten. Heute hat sie Migräne, morgen Influenza, übermorgen hat sie die Menstruation, die bei ihr viele Wochen dauert, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Schließlich wurde die Angst vor den Umarmungen des Mannes ihre überwertige Idee und sie flüchtete in eine schwere Neurose, die ihr ein keusches Leben ermöglichte. Dass sich ihre Keuschheit nur auf ihren Mann bezog, dem gegenüber die Furcht „die Liebe verdrängt hat“, wie es in der Ballade heißt, erhellt aus der Analyse des Telephontraumes und ihrer anderen Träume. Einer ihrer ersten Träume, den sie mir brachte, schilderte eine sehr verfängliche Situation. Der Mann, den sie wirklich geliebt und nicht geheiratet hatte, lag bei ihr im Bette und bewährte sich als feuriger, nie ermüdender Liebhaber. Ich trete ein und das Liebespaar lässt sich nicht stören, worauf ich die Verse spreche:
„Zur Liebe ist es nie zu spat.
Wie man es jetzt gesehen hat.“
Darauf erwidert der Liebhaber:
„Heil! Heil! Heil!
Schön ist ihr Hinterteil.“
(Die Dame hatte die Gewohnheit und Fertigkeit tagelange in Versen zu sprechen. Deshalb ist die Komponierung der Ballade im Traum durchaus glaubwürdig.)
Ihre sexuelle Abneigung gilt also nur dem armen Gatten, der von ihr bewusst gehasst wird. In der traurigen Ballade lässt sie ihn sogar wahnsinnig werden und in drei Tagen an Liebesgram sterben. Das hat einen tiefen Sinn. Der Mann Ist tatsächlich nicht normal und leidet an einer milde verlaufenden progressiven Paralyse. Ihr Hausarzt sagte ihr, er könne es vielleicht noch drei Jahre mitmachen.
Ihre erste Liebe war ein Tenor. Das erklärt uns in diesem langen Traumgebilde den Gegensatz von Bassisten und Tenor. Ihr Mann hat eine tiefe, sonore Bassstimme, die ihren Ohren weh tut und ihr „ekelhaft“ erscheint. Sie hat sich angewöhnt, an ihm vorbei zu hören. Sie hört einfach nicht zu, wenn er spricht. Das macht uns den telephonischen Traum verständlich. Die sexuelle Symbolik des Telephons war in Wien eine Zeitlang sehr bekannt und geradezu aktuell. In einem der heiteren Muse gewidmeten Vergnügungslokal sang eine populäre Soubrette durch ein Jahr und noch darüber hinaus ein Telephonlied, das von Anzüglichkeiten strotzte. Eigentlich war es eine deutliche Schilderung eines Geschlechtsaktes, wobei die verschiedenen technischen Telephonbezeichnungen in überaus geschickter Weise verwendet wurden. Ein junger Mann will das Telephonieren lernen. Die Dame, die den Apparat bedient, gibt ihm die „Muschel“ in die Hand, er läutet an, die Zentrale gibt die Antwort; er verlangt eine andere „Nummer“ telephoniert so stürmisch, dass er fast den ganzen Apparat ruiniert usw.