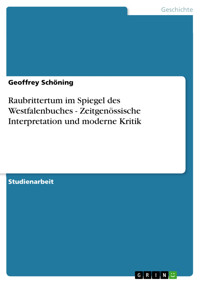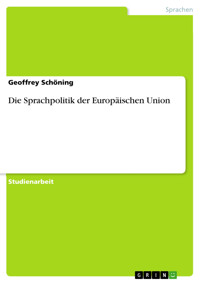
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Romanistik - Fächerübergreifendes, Note: 1,0, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Romanisches Seminar), Veranstaltung: Proseminar: Fremdsprachenpolitiken im deutsch-französischen Vergleich, Sprache: Deutsch, Abstract: „Wenn ich noch einmal anzufangen hätte, würde ich nicht mit der Wirtschaft, sondern mit der Kultur beginnen.“1 Angesichts der bevorstehenden Einführung des EURO, des freien Binnenmarktes, der seit mehr als acht Jahren zollfreien Warenverkehr über die Grenzen Europas erlaubt, wirkt dieses Zitat wie ein Anachronismus. Dies um so mehr, als es von einem der geistigen Gründerväter des europäischen Einigungsprozesses stammt: Jean Monnet, 1952-1955 Vorsitzender der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 50 Jahre gemeinsamer europäischer Geschichte also von den falschen Vorstellungen geleitet? Zumindest scheint selbst den von Haus aus wirtschaftlich orientierten Eurokraten die Bedeutung von Kultur, und damit auch von Sprache für ein geeintes Europa bewusst geworden zu sein. In alle Felder der Politik, so tönt es aus der Brüssler Schaltzentrale, habe dieser Gedanke mittlerweile Eingang gefunden. Lohnende Ausgangsbasis einer Untersuchung, in wie weit sich Sprachpolitik wirklich unter den traditionellen Schlagwörtern europäischer Politik – „Binnenmarkt“, „Europa der Bürger“ oder „Europa der Regionen“ – behauptet.2 Welche Ideen tragen sprachpolitische Maßnahmen der EU, und vor allem: Wo und mit welcher Konsequenz treten Fragen sprachlicher Natur im Prozess der Einheitsbildung auf? Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, Motivationen und Tendenzen der Sprachpolitik in Europa offen zu legen und zu analysieren. Deshalb soll zunächst ein allgemeiner Blick au die sprachliche Situation des Kontinents geworfen werden, um anschließend die Problematik sprachwissenschaftlicher Einteilungsmuster zu beleuchten. Ganz unwillkürlich kommt dabei die Rolle von Minderheiten zur Sprache, die Aufschluss über den grundsätzlichen Umgang Europas mit seiner sprachlichen Vielfalt geben kann. Nach einem kurzen Verweis auf allgemeinpolitische Strömungen, richtet sich die Aufmerksamkeit dann besonders auf das Problem der Sprachwahl in den Organen der Gemeinschaft. Sie ist richtungsweisend für die elementare Frage europäischer Sprachpolitik: Wie ist Mehrsprachigkeit mit der Union Europas in Einklang zu bringen? Lösungskonzepte gibt es allenthalben. Bildungspolitische Initiativen von EU und Europarat verraten schließlich, auf welches Modell für einen europäischen Gesamtstaat zurück gegriffen wird – im Übrigen das zentrale Motiv der EU: Vielheit in Verbindung mit der Einheit [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 2
geistigen Gründerväter des europäischen Einigungsprozesses stammt: Jean Monnet, 1952-1955 Vorsitzender der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 50 Jahre gemeinsamer europäischer Geschichte also von den falschen Vorstellungen geleitet? Zumindest scheint selbst den von Haus aus wirtschaftlich orientierten Eurokraten die Bedeutung von Kultur, und damit auch von Sprache für ein geeintes Europa bewusst g eworden zu sein. In alle Felder der Politik, so tönt es aus der Brüssler Schaltzentrale, habe dieser Gedanke mittlerweile Eingang gefunden. Lohnende Ausgangsbasis einer Untersuchung, in wie weit sich Sprachpolitik wirklich unter den traditionellen Schlagwörtern e uropäischer Politik„Binnenmarkt“, „Europa der Bürger“ oder „Europa der Regionen“ - behauptet.2Welche Ideen tragen sprachpolitische Maßnahmen der EU, und vor allem: Wo und mit welcher Konsequenz treten Fragen sprachlicher Natur im Prozess der Einheitsbildung auf? Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, Motivationen und Tendenzen der Sprachpolitik in Europa offen zu legen und zu analysieren. Deshalb soll zunächst ein allgemeiner Blick au die sprachliche Situation des Kontinents geworfen werden, um anschließend die Problematik sprachwissenschaftlicher Einteilungsmuster zu beleuchten. Ganz unwillkürlich kommt d abei die Rolle von Minderheiten zur Sprache, die Aufschluss über den grundsätzlichen U mgang Europas mit seiner sprachlichen Vielfalt geben kann. Nach einem kurzen Verweis auf allgemeinpolitische Strömungen, richtet sich die Aufmerksamkeit dann besonders auf das Problem der Sprachwahl in den Organen der Gemeinschaft. Sie ist richtungsweisend für die elementare Frage europäischer Sprachpolitik: Wie ist Mehrsprachigkeit mit der Union Europas in Einklang zu bringen? Lösungskonzepte gibt es allenthalben. Bildungspolitische Initiativen von EU und Europarat verraten schließlich, auf welches Modell für einen e uropäischen Gesamtstaat z urück gegriffen wird - im Übrigen das zentrale Motiv der EU: Vielheit in Verbindung mit der Einheit.
2Vgl. Anne Gellert-Novak: Europäische Sprachenpolitik und Euroregionen. Ergebnisse einer Befragung zur
Stellung der englischen und deutschen Sprachen in Grenzgebieten, Tübingen 1993, S. 11.
Page 3
2. Überschaubare Ordnung? Sprachen im vereinten Europa
Der reinen Faktenlage nach zu urteilen, nimmt sich die Sprachkarte Europas recht simpel aus. Gerade drei Prozent der auf der Erde beheimateten Sprachen - insgesamt nicht mehr als 255werden auf dem europäischen Kontinent gesprochen.3Und diese Zahl reduziert sich noch einmal erheblich, wenn man von der Grundfläche der Europäischen Union ausgeht. Auf dem Boden ihrer derzeit 15 Mitgliedstaaten4finden sich 11 Sprachen von offiziellem Status: Im Skandinavischen Raum Schwedisch, Finnisch und Dänisch, bei den Mittelmeeranrainern Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Griechisch, i n Mitteleuropa schließlich Französisch, Niederländisch, Deutsch und, nicht zu vergessen, Englisch.
EU-weit sind darüber hinaus das in Irland gesprochene Gälisch und die dritte Amtssprache Luxemburgs, das Letzeburgische, als Nationalsprachen anerkannt.5
Doch der Schein trügt: Die Sprachkarte Europas ist längst nicht so überschaubar wie die Klaviatur der EU-Sprachen vermuten lässt. Was in dieser Betrachtung fehlt, ist das Bretonische, das Walisische oder beispielweise Baskisch - Regional- und Minderheitensprachen also. Z udem müssten auch Plansprachen, Kommunikationssysteme wie die Gebärdensprache und nicht zuletzt die zahlreichen Sprachen der nicht-europäischen Zuwanderer, sogenannter a llochthoner Minderheiten - etwa Türkisch oder Arabisch - ins Blickfeld gerückt werden. Unzweifelhaft: Die europäische Sprachsituation ist weitaus komplexer als ursprünglich angenommen. Unter dieser erweiterten Perspektive ergeben sich denn auch neue Fragestellungen: Warum zum Beispiel ist Katalanisch mit zirka acht Millionen Sprechern lediglich regionales Idiom, wenn fünf Millionen Dänen bereits die Basis einer anerkannten Nationalsprache bilden?6Gibt es Aspekte, die eine derartige Hierarchisierung rechtfertigen? Letztlich geht es ganz allgemein um die Maßstäbe, welche der sprachlichen Gliederung Europas zu Grunde liegen.
3Manfred Kienpointner: „Sprachen der Welt - Sprachen Europas. Zahlen und Fakten“, in: Sprachen in Europa.
Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern, hrsg. von Ingeborg Ohnheiser/Manfred Kienpoint-
ner/Helmut Kalb, Innsbruck 1999, S. 1-10; hier S. 2.
4Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxe m-
burg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien.
5Konrad Schröder: „Zur Problematik von Sprache und Identität in Westeuropa. Eine Analyse aus sprachpoliti-
scher Perspektive“, in: Europäische Identität und Sprachenvielfalt, hrsg. von Ulrich Ammon/Klaus J. Matthei-
er/Peter H. Nelde (Sociolinguis tica 9), Tübingen 1995, S. 56-66; hier S. 63.
6Reiner Arntz: Das vielsprachige Europa. Eine Herausforderung für Sprachpolitik und Sprachgestaltung (Hil-
desheimer Universitätsschriften, Bd. 4), Hildesheim 1998, S. 9.