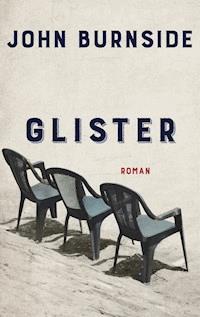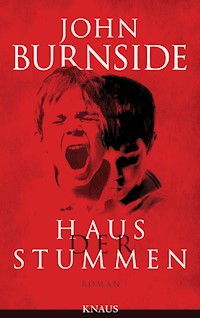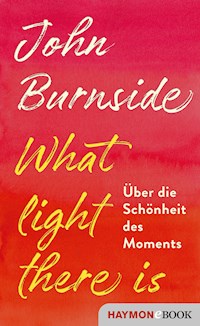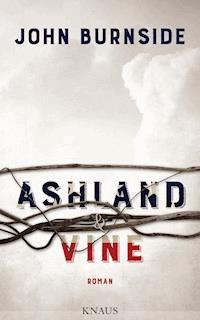3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Einer der brillantesten Romanciers unserer Zeit.« Die Weltwoche
Michael Gardiner lebt mit seiner Frau zurückgezogen am Rande des schottischen Küstenortes Coldhaven. Eines Morgens liest er in der Lokalzeitung, dass sich seine Jugendliebe Moira umgebracht und ihre beiden kleinen Söhne mit in den Tod genommen hat – nur ihre Tochter Hazel ließ sie am Leben. Moiras Selbstmord lässt in Michael schlagartig Erinnerungen wach werden, die er lange Zeit verdrängt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
John Burnside
Die Spur des Teufels
Roman
Aus dem Englischen von
Bernhard Robben
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel
«The Devil’s Footprints. A Romance» bei Jonathan Cape, London.
© der Originalausgabe 2007 by John Burnside
© der deutschsprachigen Ausgabe 2008
by Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-17062-2
www.knaus-verlag.de
Lieber den Teufel, den man kennt,
als den Teufel, den man nicht kennt.
Altes Sprichwort
Die Spur des Teufels
In Coldhaven, einem kleinen Fischernest an der Ostküste Schottlands, wachten die Menschen vor langer Zeit an einem düsteren Morgen Mitte Dezember auf und sahen nicht nur, dass ihre Häuser tief und traumverloren unter einer so dicken Decke Schnee begraben lagen, wie sie nur ein- oder zweimal in jeder Generation ausgebreitet wird, sondern dass darüber hinaus, während sie geschlafen hatten, etwas Seltsames geschehen war, etwas, was sie sich nur mit Geschichten und Gerüchten zu erklären wussten, die sie allerdings, da sie ein braves und gottesfürchtiges Volk waren, höchst ungern weitererzählten, Geschichten, in denen der Teufel vorkam oder ein Gespenst, Geschichten, die widerstrebend eine verborgene Macht in der Welt anerkannten, deren Vorhandensein sie die meiste Zeit lieber ignorierten. Coldhaven sah in jenen Tagen kaum anders aus als heute, ein Gewirr aus Häusern, Gärten und mit Unrat übersäten Bootsliegeplätzen, das sich in engen, regenfarbenen Straßen und schmalen Kopfsteinpflastergassen zum Meer hinabzog. Die Menschen damals waren die Vorfahren jener Nachbarn, mit denen ich seit nunmehr über dreißig Jahren zusammenlebe: ein raues Seefahrervolk mit sonderbarem Aberglauben, ureigener Logik und Erinnerungen an Sandbänke, Gezeiten und die Tücken der See; doch auch wenn ihre Kindeskinder den nahen Bezug zum Meer verloren haben, glaube ich, diese Menschen zu kennen, wenn auch nur ein wenig und wie aus großer Entfernung. Es mag reine Phantasie sein, so selten diese auch vorkommt, doch bilde ich mir ein, ich könnte in ihren lethargischen Abkömmlingen die Geister jener alten Seefahrer ausmachen, die allzu viele Male gezwungen waren, sich durch dichten Nebel oder gnadenlosen Sturm den Weg nach Hause zu suchen, oder die jener Frauen, deren Blick am Horizont nicht innehielt, sondern weiterwanderte zu den Riffen und Untiefen, die sie nur von Karten und Wettervorhersagen kannten, was sie zu Seherinnen machte, zu Orakeln und Harpyien. Es muss eine grauenhafte Last für sie gewesen sein, eine schreckliche, wenn auch alltägliche Fertigkeit, diese für wenige kritische Augenblicke entwickelte und auf ein ganzes Leben ausgeweitete, zu starren Mienen der Voraussicht und Vorahnung verzerrte und entstellte Sehweise. Einen solchen Blick habe ich sogar in den Augen der Postbotin erkannt, eine Gabe, die sie nicht braucht, die sie aber auch nicht ablegen kann. Letzte flüchtige Spuren davon fand ich selbst in den Augen von Schulmädchen und einigen jungen Frauen, die, während sie ihrer Arbeit nachgingen, auf die Katastrophe warteten.
Jene, die am lang vergangenen Wintermorgen als Erste aus den Betten waren, die Bäcker und Schiffsausrüster, Frauen, die aus dem Haus traten, um Kohlen zu holen, und Männer, die an diesem Tag nicht zum Fischen gefahren, aber aus Gewohnheit oder Rastlosigkeit früh aufgestanden waren; sie sollten die Ersten sein, die jenes Phänomen bemerkten, das die ganze Stadt später «die Spur des Teufels» nannte, eine Bezeichnung, die nicht nur haftenblieb, sondern aus Gründen, die sich die Bewohner von Coldhaven nie eingestanden, zugleich eine verschroben klingende Umschreibung dessen war, was für Außenstehende und die eigene Nachwelt stets in Unglaube oder Ironie gehüllt bleiben sollte. Die Spur des Teufels: ein Titel wie der einer Ballade oder eines an einem verregneten Nachmittag aus der Bücherei entliehenen und später als eine seltsame alte Ansammlung von Unsinn abgetanen Buches, Worte, die stets nur gleichsam mit Anführungszeichen ausgesprochen wurden, falls man sie denn überhaupt laut aussprach, so als wäre der von ihnen gewählte Name für das Gesehene von der falschen Seite des Jenseits gekommen, geradeso wie die Spuren im Schnee, diese sauberen, tintenklecksigen Fährten eines spalthufigen Wesens, einer Kreatur, die nicht nur auf zwei Beinen von einem Ende des Städtchens zum anderen durch die Straßen und Gassen spaziert, sondern auch die Hausmauern hinaufgestapft war und hohe, von Krähenspuren übersäte Dächer auf ihrem schnurgeraden Weg über die Schlafgemächer hinweg überquert hatte. Auf der Suche nach einer Erklärung, die es ihnen erlaubte, unbeschwert und sorgenfrei an ihre Küchenherde zurückzukehren, zu ihren Fischernetzen und Spülbecken, sollten sie das Phänomen später ein wenig genauer in Augenschein nehmen und feststellen, dass die Spuren an der Küste begannen, gleich vor dem kleinen Friedhof am westlichen Ende der Stadt, so als wäre das Geschöpf dem Meer entstiegen, hätte den schmalen, flutgespülten Strand überquert, auf dem kein Schnee liegen geblieben war, um dann lautlos und zielgerichtet über die James Street zu staksen, der Shore Street zu folgen, das Dach der Kirche hinauf und wieder hinab, über das Rinnsal von einem Bach zu hüpfen, der Coldhaven Wester von Coldhaven Easter trennte, und so weiter, auf und ab, über die Dächer der Häuser in der Toll Wynd zu laufen, ehe es sich am anderen Ende dann in die Felder schlug, dem Landesinneren zu, wohin ihm zu folgen niemand der Sinn gestanden hatte. Sie sollten nie erfahren, wie weit jene Reihe ordentlicher schwarzer Abdrücke noch reichte, nur waren sie sich später, als der Schnee schmolz und Gegenteiliges nicht mehr hätte bewiesen werden können, hinsichtlich der Natur der Kreatur, die diese Spuren hinterlassen hatte, alle sicher oder doch zumindest einig. Das waren nicht die Fußspuren eines Menschen, sagten sie, auch nicht die eines Tieres, jedenfalls keines Wesens, weder vom Lande noch aus der See, das man in diesen Teilen der Welt je gesichtet hätte. Es waren scharf umrissene, dunkle Hufabdrücke, die Spuren eines trittsicheren Geschöpfs, das sich rasch – der Eindruck schneller Bewegung war unbestritten, wenn auch durch nichts belegt – durch ihre eng bebaute Siedlung bewegt hatte, so als flöhe es vor einem grausigen, übernatürlichen Entschluss oder jagte ihm hinterher. Es gab welche, die behaupteten, es müsse eine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen geben, jene, die meinten, alles unter dem Himmel müsse sich erklären lassen, denn Gott allein entzöge sich der Erkenntnis, doch fanden sich die meisten Einwohner mit der Behauptung ab, es sei der Teufel gewesen, der vorbeigekommen war, ein Geschöpf, das man nie gänzlich für real gehalten, aber dennoch für eben eine solche Gelegenheit in Reserve gehalten hatte, so wie den Butzemann, die Elfen oder übrigens auch Gott selbst.
Das war natürlich nur Gerede. Mir wurde diese Geschichte als Kind erzählt, beziehungsweise habe ich sie damals heimlich aufgeschnappt. Ich habe hier ein Bruchstück gehört, dort einige Schnipsel erlauscht und sie nach und nach zusammengesetzt, Details hinzugefügt, Verbesserungen angebracht, habe sie lebhafter gestaltet, freundlicher, rätselhafter und überzeugender. Habe sie erfunden. Ich stellte mir die Fußspuren vor, wie sie durch einen schmalen, schneebedeckten Garten verliefen, über das Dach einer Räucherkammer tänzelten, und ich folgte ihnen den Hügel hinauf und weiter, vorbei an Mrs. Collings’ Haus, den halb zerfallenen Überresten von Ceres House und dem alten Kalkschuppen. Ich stellte mir ein Kind am Schlafzimmerfenster vor, einen Jungen wie jener Junge, der ich damals gewesen war, als ich noch in der Cockburn Street wohnte, wie er im ersten Licht in den wundersam fallenden Schnee starrte und die tiefen schwarzen Abdrücke in der frisch glitzernden Kruste entdeckte. Ich stellte mir den Teufel vor, wie er über Kamine stiefelte: kein Mensch, nicht ganz jedenfalls, aber doch ein lebendiges Geschöpf, irgendetwas zwischen Engel und Bestie, zwischen Ariel und Caliban. Mein Verstand sagte mir, dass es nicht realer als der Nikolaus oder der weißgesichtige Erzengel in meiner illustrierten Kinderbibel sein konnte, doch mit dem Herzen glaubte ich ausnahmslos an sie alle. Als ich in der Schule nachfragte, reagierten die Lehrer verlegen, taten mich lachend ab oder machten sich, wie einmal Mrs. Heinz, meine Lehrerin in der dritten Klasse, die Mühe, das Unerklärbare doch zu erklären. Die Geschichte, sagte sie, sei ein alter Mythos, den es schon länger als die Christen in diesem Land gebe. Manche behaupteten, der Teufel sei ein alter heidnischer Gott, ein piktischer Geist, der in dieser Gegend gehaust habe; allerdings sei es selten, solche Geschichten an der Küste zu hören, denn eigentlich gehörten sie in die Bauerndörfer und dunklen Wälder im Landesinnern. Hier, am Wasser, drehten sich die Mythen eher um Untiefen im Meer, um Wellengeister und seltsame Fabelwesen, die sich in den Netzen verfingen, halb Fisch, halb Mensch. Es sei nichts Böses an diesen alten Geschichten, sagte sie, solange man nicht vergesse, dass es eben nur Geschichten seien. Dann lieh sie mir ein Buch mit dem Titel Mythen und Legenden der Griechen und Römer und trug mir auf, es zu lesen. Das tat ich, aber darin stand nicht, wonach ich gesucht hatte.
Der Evening Herald
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr fand man eine Frau namens Moira Birnie sowie ihre beiden Söhne, den vierjährigen Malcolm und den dreijährigen Jimmie, tot in einem ausgebrannten Auto sieben Meilen vor Coldhaven. Moira war zweiunddreißig und mit einem Mann namens Tom Birnie verheiratet, einem harten Burschen, mit dem sie eine Parterrewohnung am klammen, unteren Ende der Mashall’s Wynd teilte. Eine Wohnung, die ihr, wie ich zufällig weiß, vom heute ebenfalls bereits verstorbenen Henry Hunter vermietet wurde, zu seiner Zeit ein notorisch knausriger Hausherr und Unternehmer, dessen Ruf, eine Vorliebe für zweifelhafte Geschäfte zu haben, dreißig Jahre und länger bis in jene Zeit zurückreichte, in der er sein erstes Haus gekauft hatte, drüben, gleich neben der Imbissbude in der Sandhaven Road, um es – mitsamt maroder Elektrik und schlechter Belüftung – an eine Gruppe Studenten vom Fischereikolleg zu vermieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom und Moira Birnie eine hohe Miete für ihre Behausung bezahlt haben, doch wie viel es auch gewesen sein mochte, es war zu viel. Henry Hunter war schließlich für seine Habgier bekannter als für sein Verantwortungsgefühl.
Die Lokalpresse berichtete über das Feuer und stellte es anfangs als außergewöhnlichen Unfall dar, doch als weitere Einzelheiten bekannt wurden und sich das ganze Ausmaß dessen, was Moira getan hatte, abzuzeichnen begann, wurde der Fall auch von der Landespresse aufgegriffen. Zufällig erfuhr ich von den Ereignissen, die zu der Tragödie führten, sowie die grausigen Details des Brandes erst am Samstag nach der Tat, als Amanda drüben auf Besuch bei ihrer Mutter war. Ich breite die Samstagszeitungen gern auf dem ganzen Küchentisch aus, löse Kreuzworträtsel, lese die ein oder andere merkwürdige Geschichte, halte mich hinsichtlich dessen, was während der Woche passiert ist, auf dem Laufenden und schneide mir Rätsel, Rezensionen und interessante Artikel für später aus. Möglicherweise hätte ich diesen Artikel übersehen, hätte die Polizei nicht zwei Tage zuvor eine Meldung veröffentlicht, der zufolge das Feuer im Auto absichtlich gelegt worden war und man den Fall nun als verdächtig einstufe. Als die großen Zeitungen Wind von der Sache bekamen, wurde daraus eine Titelstory, eine Geschichte von tragischen, gar verabscheuungswürdigen Ausmaßen: Moira Birnie hatte ihre kleinen Söhne betäubt, war auf einen abgelegenen, sandigen Weg nahe einer örtlichen Touristenattraktion gefahren und hatte dann den Wagen, in dem sie mit ihren Jungen saß, angezündet. Niemand schien zu wissen, was sie zu dieser Tat veranlasst hatte, aber die maßgeblichen Stellen hegten keinen Zweifel, bei wem die Schuld lag. Die einzige Frage, die jedermann beschäftigte, lautete: Wie konnte eine Frau, eine , so etwas Schreckliches tun? Und warum hatte sie nur die Jungen getötet, nicht aber die vierzehnjährige Tochter, die sie zuvor auf einem einsamen Feld allein und verängstigt abgesetzt hatte?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!