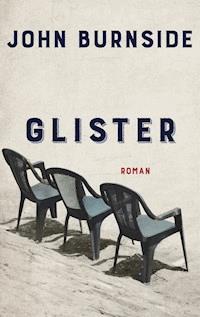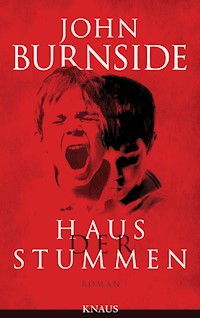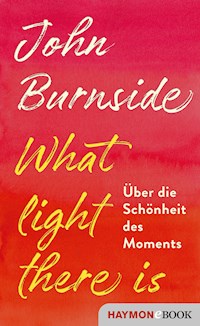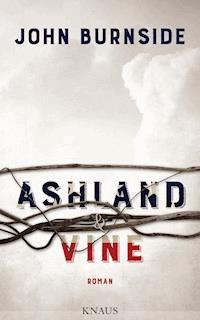
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Amerikaroman von John Burnside
Mit dem Mord an ihrem Vater, Rechtsanwalt und Gegner der Rassentrennung, endet die behütete Kindheit der jungen Jean. In ihrer Lebensgeschichte spiegeln sich die politischen Entwicklungen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Amerika tief gespalten haben: von der Kommunistenverfolgung der McCarthy-Ära über die erstarkende Bürgerrechtsbewegung zur Black Panther Party, Vietnam und dem Kalten Krieg. Als der Traum von einer gerechten Welt immer weiter in die Ferne rückt, zieht sich Jean in die Einsamkeit zurück. Bis eines Tages eine junge, alkoholkranke Frau vor ihrer Tür steht und ihre Hilfe braucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Der Tod ihres Vaters wirft die Studentin Kate aus der Bahn. Sie trinkt zu viel und ist in einer destruktiven sexuellen Beziehung gefangen. Erst die Begegnung mit der seltsam alterslosen Jean Culver reißt die junge Frau aus ihrer Lethargie. Über Wochen erzählt ihr Jean Culver die Geschichte ihrer Familie, spricht über ihren Vater, der 1935 in Saint Louis, Missouri, auf offener Straße erschossen wird. Angeblich wegen einer Frauengeschichte, aber jeder in der Stadt weiß, dass der Anwalt, der gegen die Rassentrennung ist, mächtige Feinde hat. Der Mord an ihrem Vater prägt die achtjährige Jean Culver und ihren Bruder Jem für immer. In der Lebensgeschichte der beiden spiegeln sich die politischen Entwicklungen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Amerika tief spalten: von der Kommunistenhatz der McCarthy-Ära über die erstarkende Bürgerrechtsbewegung zur Black Panther Party, Vietnam und dem Kalten Krieg. Kate erkennt, dass nur im Erzählen, im Nichtverdrängen Vergebung und eine Versöhnung mit der Vergangenheit und sich selbst möglich ist.
Über den Autor:
John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis. Sein Prosawerk erscheint auf Deutsch seit vielen Jahren im Knaus Verlag.
John Burnside
Ashland & Vine
Aus dem Englischen vonBernhard Robben
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»Ashland & Vine«
bei Jonathan Cape, London
Das Zitat von Robert Penn Warren stammt aus
»All the King’s Men«, dt. »Das Spiel der Macht«. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Heyne Verlag, München.Der Abdruck der Zeilen aus Emily Dickinsons Gedicht »I measure every Grief I meet« erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlag, München.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe by John Burnside 2017
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagabbildungen: shutterstock/Venus Kaewyoo,
Shebeko, Baimieng und Chantal de Bruijne
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21264-3V002
www.knaus-verlag.de
Für Claudia Vidoni
Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité; le bien est toujours le produit d’un art.
CHARLES BAUDELAIRE
Der Prozess der Veränderung an sich ist weder moralisch noch unmoralisch. Wir können nur das Resultat beurteilen, nicht den Prozess selbst. Ein unmoralisches Agens kann eine moralische Tat ausführen. Das moralische Agens kann eine unmoralische Tat ausführen. Vielleicht muss der Mensch seine Seele verkaufen, um die Macht zu bekommen, Gutes zu tun.
ROBERT PENN WARREN
Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeglicher in seiner Bilderkammer? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, sondern der Herr hat das Land verlassen.
HESEKIEL, 8,12
Aber ja, einerseits stimmt das, es war leicht, in Amerika unterzutauchen.
BILL AYERS
Backe Kuchen, hacke Holz
Der Tag, an dem ich Jean Culver kennenlernte, war auch der Tag, an dem ich mit dem Trinken aufhörte.
Lange wollte ich mir einreden, dass dies eher Zufall war. Sicher, Jean Culver hatte das Experiment vorgeschlagen, aber fast beiläufig und ohne Nachdruck. Ich konnte tun, was ich wollte, so viel war stets klar. Sie verurteilte mich nicht, erwartete nicht, dass ich für immer aufhörte, verlangte auch nicht, dass ich mich einer Selbsthilfegruppe anschloss. Ich sollte einfach nur für eine Weile nüchtern bleiben, zeigen, dass ich es konnte. So hat sie mich zu Anfang getäuscht. Sie ließ mich glauben, dass ich längst aufhören wollte. Und wenn nicht wollte, dann doch sollte. Ehrlich gesagt, ich brauchte eine Pause. Ich brauchte etwas Abstand zu Laurits, musste zurück zu etwas, das nicht so klar definiert, auf jeden Fall aber geheim war und die Kraft zur Veränderung besaß, wie jene Orte, an die man sich in alten Popsongs zurückzieht. Vor allem aber musste ich damit aufhören, das Ende eines jeden Tages in so beliebigem wie flüchtigem Vergessen auszulöschen, musste lernen, mit dem zu leben, was mich erwartete – den Erinnerungen, den Zweifeln, den Wiederholungen derselben alten Fragen. Ich musste aus der schieren Eintönigkeit meines immer gleichen Alltags ausbrechen: sich betrinken, nüchtern werden, paranoid werden, sich wieder betrinken. Vielleicht war das längst schlimmer als alles andere. Dieser Überdruss am eigenen Ich. Nicht der Überdruss an mir, nein, sondern ein Überdruss an der eigenen Persönlichkeit als willkürlicher Last, mir auferlegt dank des wunderlichen Einfalls eines übelwollenden Besuchers aus einem uralten Märchen. Oder aus einer Sage, etwa aus den Wäldern Estlands, wohin, wie Laurits stets behauptete, er eigentlich gehöre.
Wie auch immer, an jenem ersten Morgen habe ich nichts dergleichen gedacht. Eigentlich habe ich überhaupt nichts gedacht und nur das Übliche getan. Als ich das Tor zu ihrem Garten öffnete, ahnte ich nicht mal, dass es Jean Culver gab, und nichts wäre mir lieber gewesen, als nach Hause zu gehen, mich in mein schmales, kreideweißes Schlafzimmer zu legen und auf ein Wunder zu warten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits drei Stunden gearbeitet, falls man denn Arbeit nennen will, was ich tat, mich durch die Hitze zu schleppen mit immer denselben elf Fragen für jeden, der an die Tür kam und bereit war, mir einige Minuten seiner Zeit zu opfern. Meist blieben die Türen geschlossen und die Fragen unbeantwortet, was aber nicht weiter ungewöhnlich war, auch nicht in einer eher freundlichen, gutbürgerlichen Gegend wie dieser. Dennoch, nachdem ich meinen Brummschädel über ein Dutzend Auffahrten zu Häusern geschleppt hatte, die leer waren oder doch so aussahen, war ich kurz davor aufzugeben und mir den Rest des Tages freizunehmen. Ich weiß nicht, was mich veranlasste, es ein letztes Mal zu versuchen, ehe ich zu dem zurückkehrte, was als mein Zuhause durchging. Vielleicht dachte ich daran, was Laurits sagen würde, wenn ich wieder einmal, wie so oft, mit leeren Händen zurückkäme; vielleicht war es auch schlicht Neugier: Jean Culvers Haus stand schließlich nicht einmal auf meiner Liste, was seltsam war, da Laurits es mit diesen Dingen sonst sehr genau nahm.
Laurits: Er war der Grund, warum ich mich hier draußen aufhielt; glühend, verschwitzt, verkatert, mit einer Zunge wie Schleifpapier und Krämpfen in den Beinen. Laurits – nichts weiter, kein Vorname, nur Laurits, was, wie er behauptete, Estnisch sei. Mein Freund, mein Mitbewohner und angeblich auch mein Mitarbeiter – nur, wie er dieses Projekt für eine Gemeinschaftsarbeit halten konnte, blieb mir schleierhaft, da ich die Einzige war, die durch die Hitze stolperte, der Türen vor der Nase geschlossen wurden, Zielscheibe für Spott und Mitleid oder auch beides. Ich wusste nicht, was ich tat, oder warum ich es tat, denn als ich ihn bat, es mir zu erklären, antwortete er, ich bräuchte mich nur an die Anweisungen zu halten, die er mir gegeben hatte: Suche dir eine Gegend aus, mehr oder weniger vorstädtisch, wo sich auch tagsüber vielleicht Leute zu Hause aufhalten – alte Leute sind immer die besten Kunden –, und stell die vorbereiteten elf Fragen. Fragen wie: Woran erinnern Sie sich aus Ihrer Kindheit? Was war der glücklichste Augenblick in Ihrem Leben? Wenn Sie in anderer Gestalt wiedergeboren werden könnten, wofür würden Sie sich entscheiden?
»Und was dann?«, fragte ich. »Ich meine, mal angenommen, sie reden mit mir, soll ich sie dann was unterschreiben lassen? Oder kann ich einfach loslegen und mit der Aufnahme beginnen?«
»Keine Aufnahme«, sagte er. »Wir brauchen nur die Geschichten.«
»Also schreibe ich sie auf.«
»Nein. Du machst dir bloß Notizen. Keine wortwörtliche Mitschrift, nichts dergleichen. Nur gerade genug, damit du, wenn du wieder hier bist, dich mehr oder weniger an das erinnern kannst, was sie gesagt haben.«
»Mehr oder weniger?«
»Ja.« Er sah mich aufmerksam an, um herauszufinden, ob ich verstanden hatte, was von mir erwartet wurde. Er hatte mir, mehr als einmal, erzählt, dass er immer sehr präzise wisse, was er wolle, dass es ihm nur schwerfalle, es anderen Leuten zu erklären. »Ich möchte, dass du dir die Geschichten anhörst, dann nach Hause kommst und sie mir mit eigenen Worten nacherzählst. So gut du dich erinnern kannst. Es braucht nicht perfekt zu sein. Nur das, woran du dich erinnerst – und vielleicht, hoffentlich, fügst du noch Eigenes hinzu.«
»Hinzufügen?«
»Ja.« Er lächelte. »Kleine … Verschönerungen.«
»Und was dann? Filmst du mich, wie ich die Geschichte anderer Leute erzähle?«
»Vielleicht.«
»Und du bestimmst die Fragen.«
»Aber ja.« Sein Lächeln wurde breiter. »Darin besteht mein Teil der Zusammenarbeit.«
Das war so typisch für ihn. Er klagte, dass er es schwierig fände, etwas zu erklären, dann aber hielt er seine Erklärungen absichtlich vage und reicherte sie noch mit einem Hauch Absurdem an. So war Laurits, der – ja, was eigentlich war? Ein Künstler? Ein Filmemacher? Nein – niemand gab sich noch die Mühe, Filme zu machen, jedenfalls nicht laut Laurits. Zumindest nicht, wie man sie früher gemacht hatte. Heutzutage war jeder ein Anthropologe. Und dennoch drehte er Filme, stellte vielmehr Collagen aus gefundenem Filmmaterial her, um von ihm selbst gedrehte Szenen verlängert, die, auch wenn sie keine Geschichte erzählten und meist von woanders Stammendes, aus Kontexten Zusammengesetztes enthielten, doch immer noch Filme waren. Laurits gehörte zum Fachbereich Creative Arts am Scarsville College; er bekam Stipendien und Geld aus dem Forschungsfond zur Förderung seiner Arbeit; er besaß einen Doktor in Filmwissenschaften und gab Seminare über Literatur und Film, aber er sei kein Filmemacher, behauptete er, sondern Anthropologe. Filmemacher erzählten Geschichten, selbst wenn sie das nicht wollten, er aber interessiere sich nicht für Geschichten. Für Laurits war eine Geschichte nur eine Schnur, auf der die wahren Perlen aufgereiht wurden. Stattdessen wollte er Atmosphäre, Textur, Wetter. Wenn Menschen Geschichten erzählen, sagte er, lügen sie, was die Ereignisse betrifft, aber nicht über die anderen Dinge, da lügen sie nicht – zumindest nicht absichtlich.
Laut Laurits war dies das Evangelium der Erzähltheorie. Ich lief durch die Junihitze, zog von Tür zu Tür als Teil einer anthropologischen Studie über die verschiedenen Weisen von Menschen zu lügen, wenn sie sich an die Vergangenheit erinnerten. Wenigstens meinte ich, deshalb hier draußen zu sein. Bei den meisten Projekten tat Laurits selbst gar nichts. Er gab seinen sogenannten Mitarbeitern nur eine ungefähre Anleitung – er hatte mehrere Mitarbeiter, die alle so verwirrt und auf Erklärungen angewiesen waren wie ich – und ließ sie dann die Einzelheiten herausfinden. Der einzige Unterschied zwischen mir und den anderen war, dass ich mit ihm zusammenlebte. Wir teilten uns eine Wohnung. An den meisten Abenden betranken wir uns. Und manchmal liebten wir uns, wobei ich nicht weiß, ob Liebe hier das richtige Wort ist.
Ich lernte Laurits im Sidetrack kennen, einer Bar, die am Scarsville College einem Treffpunkt für künstlerisch angehauchte Studenten noch am nächsten kam. Hinter mir lagen gerade die Anfangswochen meiner zweiten Collegekarriere. Die erste hatte ich aufgegeben, als mein Dad gestorben war; und nachdem ich vergebens darauf gewartet hatte, dass sein Geist mich heimsuchte, bewarb ich mich am Scarsville College um einen Platz, den ich zu meiner Überraschung auch bekam. Das Haus in Stonybrook gab es da schon nicht mehr, und ich hatte kaum noch Geld. Um Miete zu sparen, bezog ich ein billiges Zimmer in der unschönsten Gegend der Stadt und aß nichts weiter als Reis und Obst. Dad war seit Monaten tot, aber ich wachte noch jeden Morgen panisch mit dem Gedanken auf, dass es ihn eigentlich nie gegeben hatte. Dass ich ihn nur geträumt hatte – vielmehr, dass er ein ganz anderer als der gewesen war, den ich gekannt und dass ich ihn mir nur so vorgestellt hatte, wie ich ihn gern gehabt hätte. Ehrlich gesagt, wäre er zurückgekommen und hätte in meinen Kopf sehen können, hätte er sich wohl selbst nicht wiedererkannt. In diesem Teil der Stadt gab es eine andere Art Dämmerung, ein langsames, unverbindliches Licht, das durch die Nebenstraßen sickerte und zwischen den Häusern gelegentlich auf Inseln früherer Zeiten stieß, zerbrochene Blumentöpfe, kaputte Zäune und Höfe, in denen es früher Hunde gab, wo sich heute aber nichts weiter als Glasscherben und ausgelaugte Erde fanden. Alles, nur kein Zuhause. Zu Hause war es so – frisch. Sauber. Sonne auf den Steinplatten, die zu verlegen ich Dad geholfen hatte, ihm zugesehen hatte, wie er mit der Sorgfalt eines Mannes arbeitete, der wusste, dass er, zumindest was Landschaftsgärtnerei betraf, kein Meister seines Faches war. Natürlich brauchte ich, verstört wie ich war, kaum eine Woche, um mich mit den falschen Leuten einzulassen, wie das in alten Filmen hieß. Und natürlich dachte ich selbst anders darüber, dachte im Grunde gar nicht darüber nach, ließ mich nur treiben, war erst betrunken, dann nüchtern, dann verbittert, dann rührselig nachts vorm Radio, hörte die Songs, die mein Dad gemocht hatte, und trotz des äußeren Dramas empfand und dachte ich eigentlich gar nichts. An jenem ersten Abend fühlte ich mich nicht mal besonders zu Laurits hingezogen. Wenn überhaupt, hielt ich ihn für einen Irren, für einen gelangweilten Mann, der seine Zeit mit Leuten vergeudete, die er nicht einmal sonderlich mochte. Ich meine, es war schließlich nicht so, als ob sich unsere Blicke über eine Menschenmenge hinweg gefunden hätten – oder irgend so ein Unsinn. Eher schon trafen wir uns durch Zufall, während andere sich treiben ließen und von Platz zu Platz zogen, um zu jenen vorzudringen, die sie über eine Menschenmenge hinweg erspäht hatten. Man könnte also behaupten, dass alles ungewollt geschehen ist. Allerdings traf dies für Menschen wie Laurits und mich auf das meiste zu, was in jenen Jahren geschah. Wir gehörten nicht zu denen, die nachts loszogen, weil sie eine Beziehung suchten. Für uns lag in diesem Wort eine emotionale Unehrlichkeit, angesichts der uns keine andere Wahl blieb, als zu verzichten – und eine Alternative existierte im Grunde nicht. Alles, was wir in solch einer Situation je fühlen, denken oder sagen konnten, stand bereits irgendwo in einem Drehbuch und war schon im Fernsehen gelaufen. Für uns gab es nichts mehr zu sagen. Uns blieb allein die Qualität unserer Verweigerung.
* * *
Im Seminar zum amerikanischen Film saß eine Studentin aus Minnesota, dunkle Augen, eine schöne Frau. Sie war nicht nur enorm intelligent, sondern auch eine Dichterin. Eine richtige Dichterin, meine ich. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, habe ich in einer Studentenzeitschrift einiges von ihr gelesen, und sie war gut, keine Frage. Das Problem war nur, dass sie auch schön war und beliebt und dass sie alle Welt zu kennen schien, was letzten Endes wohl der Grund dafür gewesen ist, weshalb wir zu dieser Clique älterer Leute stießen, zu der auch Laurits gehörte, eine gemischte Gruppe von vielleicht zehn Postgraduierten sowie Typen aus der freien Theaterszene, im Schnitt Ende zwanzig, die um zwei große Tische hockten, alle halb betrunken, und die Laurits zuhörten, der sich mit jemandem in der Gruppe stritt, jemandem, der nicht richtig dazugehörte – einem Mitläufer, eher toleriert als akzeptiert. Er hieß Eric, wie ich bald herausfand, da Laurits zu den Leuten zählte, die ihre Widersacher ständig mit Namen anredeten, ihn im Streit übertrieben oft und völlig unnötig wiederholten. Eric hatte sich gerade für eine gewisse Art Reichtum ausgesprochen und das Übliche angeführt. Dass die Mega-Reichen gut für die Wirtschaft wären, dass sie für Beschäftigung sorgten und immer wieder Stiftungen gründeten, die Geld an Bedürftige vergaben, nicht zuletzt an die Kunst, vor allem ans Theater und eben auch an Filmemacher wie Laurits, weshalb es, zog man all das in Betracht, sicher besser sei, von ihrem Erfolg zu lernen und ihnen nachzueifern, als sie die ganze Zeit zu verteufeln, als wären sie Verbrecher. Und sei der Grund, weshalb die USA eine so erfolgreiche Nation waren und wir uns von einem Land wie Estland unterschieden (bei dieser Anspielung bekam Erics Stimme einen höhnischen Klang, was ich damals noch nicht verstand), nicht eben unsere Fähigkeit, hart zu arbeiten, zu wachsen und nach etwas zu streben, eine Fähigkeit, die Amerika groß gemacht hatte?
Laurits hörte höflich zu. Es war nicht zu übersehen, dass Eric für ihn bedeutungslos war, dass seine Argumente keine Antwort lohnten. Ebenso unübersehbar aber war, dass er spielen wollte – und dass er gern vor Publikum auftrat. Dass Laurits ein geborener Schauspieler war, lässt sich kaum leugnen, selbst wenn er nur agierte, weil er sich langweilte. Dies war der einzige Grund für all sein Tun, auch wenn ich das damals noch nicht wusste. Er langweilte sich, also drehte er Filme und schrieb Artikel für obskure Gazetten. Er langweilte sich, also stritt er sich mit intellektuell unterlegenen Leuten in Bars oder Pizzerien. Er langweilte sich, also trank er. Heute sage ich mir, dass unser Arrangement anders war, dass es etwas bedeutet hat, aber sicher kann ich mir da nicht sein. Allerdings kann ich auch nicht genau sagen, was mich überhaupt zu ihm hinzog. Er war groß, sah gut aus, war fantasievoll und hochintelligent; er war ein Künstler mit einem Portefeuille, das dies bewies; und noch interessanter machte ihn eine dunkle Seite, die ihn bereits einige Male in Schwierigkeiten gebracht hatte. Ich hielt diese Geschichten für übertrieben, bis ich erlebte, wie er in eine Schlägerei geriet. Sie waren nicht übertrieben. Er hatte eine dunkle Seite, und die war nicht nett. Dennoch, wenn ich heute an ihn denke, dann nicht als an jemanden, den ich geliebt habe. Wie ich schon damals sagte und es heute gern wiederhole, hatten wir ein Arrangement, fast alles unausgesprochen, aber eben doch ein Arrangement. Und allein dieses Wort sagt schon, was über meine Beziehung mit Laurits gesagt werden muss.
»Sicher, Eric«, sagte er. »Du hast völlig Recht. Es ist viel besser, nach Reichtum zu streben, als ihn zu besitzen. Auf den Weg kommt es an, stimmt’s? Die Leiter aufsteigen, hart arbeiten, das Beste aus sich herausholen und sein gottgegebenes Talent nutzen, nicht wahr, Eric? All dieses Geld zu besitzen, ist so ätzend; auf all die Menschen herabzusehen, die man auf dem Weg nach oben beschissen hat, das ist so ätzend, Eric, und es ist ätzend, den Fernseher einzuschalten und diese vielen hungernden Kinder in einem Flüchtlingslager zu sehen, nackt und allein, die Familien vertrieben, der Stamm vom Aussterben bedroht, vom Aussterben, Eric – nur damit sich irgendeine Arschgeige in der sogenannten entwickelten Welt eine noch größere Yacht leisten kann. Abertausend Meeresvögel, angespült an irgendeinen fernen Strand, nur weil deine Firma ein bisschen was sparen konnte. Besser auf dem Weg nach oben, als selbst die Arschgeige zu sein, denn sollte sich herausstellen, dass du tatsächlich noch einen Funken Anstand im Leib hast, dass du doch noch nicht so durchgeknallt bist zu glauben, dass die ganze Welt dein Spielball ist, dann wirst du versagen, Eric, und versagen tut weh. Versagen tut weh, selbst wenn es ehrenwert ist. Hollywood behauptet ständig, dass der gute Mensch, der Mensch mit Herz, glücklicher ist als der Milliardär in seiner Villa, allein und ohne jemanden, der ihn liebt, aber das stimmt nicht, Eric. Das stimmt nicht. Es sollte stimmen, aber jeder weiß es, auch in Amerika: Wer kein Geld hat, ist ein Niemand. Und eben das ist das Problem, nicht wahr, Eric? Du würdest gern sagen, überlasse es dem anderen, diesem durchgeknallten Psychopathen, aber wenn man in Amerika nicht selbst dieser Typ sein kann, ist man ein Versager. Und die ganze Zeit weißt du, der Typ ist eine Arschgeige, auch wenn er noch so sehr das Gegenteil zu beweisen versucht; jedermann weiß es, und das ist so ätzend für ihn – fast so ätzend wie für dich, ein Versager zu sein. Es ist so ätzend, keine Yachten, Alte Meister und Schlösser in Schottland mehr sammeln und keine Stiftung mehr in deinem Namen gründen zu können. Das ist echt ätzend, Eric, aber so ist es schon immer gewesen. Denk an John D. Rockefeller. Denk an Henry Clay Frick. Sie alle hatten ihre Stiftungen, ihre guten Gründe, aber die waren letztlich nur ein Deckmantel für das, was wirklich vor sich ging. Ich meine, du hast doch von dem Matewan-Massaker gehört, nicht, Eric? Vom Homestead Act? Oder vom Massaker in Ludlow, Colorado, am 20. April 1914. Allesamt Höhepunkte in der Geschichte amerikanischer Menschenliebe, Eric. Lies ruhig nach.«
Niemand sagte ein Wort. Eric starrte Laurits an, blinzelte hinter der Brille hervor, das angedeutete Lächeln verschwunden. Dann lachten alle und fingen wieder an zu trinken. Jemand in einem ausgebleichten schwarzen Huey-Lewis-T-Shirt, der drei Leute entfernt von Laurits bei einer hübschen, etwas aufgedonnerten Blondine saß, hob sein Glas. »Mann, Laurits«, sagte er. »Hast du das auswendig gelernt? Komm schon. Sag die Wahrheit. Oder hast du dir das alles bloß ausgedacht?«
Laurits schüttelte den Kopf. »Kannst du nachlesen«, sagte er. »Steht in den Geschichtsbüchern.« Er gab sich ernst, doch war ihm anzumerken, dass es sich um eines seiner Lieblingsthemen handelte, eines, von dem er wusste, dass es Huey ärgern würde. »Ihr Amerikaner kennt eure eigene Geschichte nicht …«
Das war sein Steckenpferd: Die vergessene Geschichte Amerikas – und bei den seltenen Gelegenheiten, da ich glaubte, es gäbe einen guten Grund, warum ich durch Straßen lief, in denen ich sonst niemanden sah, dann, weil Laurits glaubte, irgendwer da draußen würde sich an irgendwas von diesem Amerika erinnern. An was auch immer. Und sei es noch so wenig. Seit über einer Woche befasste ich mich nun damit, schlich von Tür zu Tür, verkatert, müde, schweißgebadet, dabei hatte ich nicht eine einzige Geschichte mitgebracht. Alle möglichen Leute hatten mich abgewiesen, ob schnippische Hausfrau oder muskelbepackter Koreaner, der in jeder Faust einen Pitbull am Halsband zurückhielt. Ich war zu einem freundlich wirkenden Haus in einer völlig gewöhnlichen Straße gegangen und hatte – was gefühlt? Die seltsame Ahnung einer Gefahr, eines drohenden Albs, die mich daran hinderte zu klingeln oder zu klopfen, wie sehr ich es auch wollte? Oder geriet ich in Panik, weil ich wusste, da drinnen war etwas, hinter der geschlossenen Fliegengittertür, etwas Schreckliches, das im Flur auf mich wartete? Zwei Tage zuvor war ich durch eine grüne Vorstadtgegend gezottelt, ich hörte Coplands Quiet City über Kopfhörer – die Live-Aufführung unter Bernstein von 1990, die ich nicht hätte hören sollen, da es eines der Lieblingsstücke meines Vaters gewesen war –, und ich lief wie vor eine Wand, blieb stehen, blödsinnig, hilflos, starrte in eine Weide hinauf und schluchzte wie ein Kind, das Gesicht nass vor Rotz und Tränen, das T-Shirt schweißdurchtränkt. Lange stand ich da, konnte nicht weitergehen, und erst nach mehreren Minuten kam ich wieder zu mir und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um. Niemand. Es war niemand auf der Straße oder in einem der Vorgärten. Vielleicht stand irgendwer hinter einem Fenster und beobachtete mich, aber ich sah ihn nicht. Ich zog die Kopfhörer ab und versuchte, mein Gesicht zu trocknen, aber das war sinnlos. Ich sah fürchterlich aus.
Wie ich nun da vor dem Tor zu einem Haus stand, das nicht in der Liste verzeichnet war, dachte ich womöglich, endlich an den richtigen Ort gekommen zu sein. Nur stand er nicht auf der Liste, und ich war unsicher, ob ich es hier versuchen sollte – nicht, weil ich nicht neugierig gewesen wäre, sondern weil ich nicht wusste, was Laurits dazu sagen würde, wenn er herausfand, dass ich auf ein Haus gestoßen war, dass nicht auf der Liste stand. Wenn ich hier jemanden fand, wäre die Geschichte womöglich aus irgendeinem Grund ungültig. Lückenhafte Provenienz, fehlende Unterlagen, so was in der Art. Vielleicht gab es dieses Haus nicht mehr, und wenn ich zur Fortsetzung des Interviews wiederkäme, wäre es nicht mehr da, weil es nicht auf der Liste stand und auch nicht auf der Karte, die er mir gegeben hatte. In meiner jetzigen Verfassung war ich nur zu bereit, an Geister zu glauben.
Nicht, dass es nicht leicht zu verfehlen gewesen wäre, versteckt hinter Bäumen am äußersten Ende der Audubon Road. Fast wäre ich an dem schmalen Eingangstor vorbeigelaufen, hätte mich nicht dieses Geräusch angelockt. Jemand hackte Holz, ein Geräusch, das ich aus einer früheren Welt kannte, einer, in der Dad noch gelebt hatte. Es war ein Geräusch, das ich liebte: ein steter, dunkler, kraftvoller Laut, der lebhafte, schmerzliche Bilder von unserem alten Haus in Stonybrook heraufbeschwor, mein Vater in seinem verwaschenen blauen Hemd, die Axt glitzernd im Sonnenlicht, wie er da schuftete, Scheit um Scheit spaltete mit einem einzigen sauberen Schlag und nur gelegentlich innehielt, um der Stille des Waldes zu lauschen. Als Kind redete ich mir ein, die Bäume um unser Haus stammten noch aus der Zeit, bevor die ersten Siedler gekommen waren; altes Irokesenland mit Blauhähern, Kardinälen und Rudeln von sanftem Rotwild mit weichen Lippen. Als ich ein Kind war, bot der Wald mir mein ureigenes, verwunschenes Reich, erste Ahnung eines Himmels und zugleich Beleg für die Geschichte, die mein Vater sich zuschrieb, denn stammte er nicht zumindest teilweise von den amerikanischen Ureinwohnern ab, weshalb es ihm erlaubt war, mit anderem Blick als seine Nachbarn zu jenen Bäumen hinüberzusehen? Wie das Haus sind heute auch die Bäume verschwunden und ebenso mein Vater, gestorben an einer Krankheit, die er mir verschwieg, nicht aber seiner Geliebten, seiner Louise, bis es schließlich zu spät war, auch nur Lebewohl zu sagen.
Nach der Beerdigung glaubte ich lange noch, er käme zurück. Nicht lebendig, nicht wie Lazarus, doch als Geist, käme nachts ins Haus aus der Dunkelheit der Wälder, wo er sich den vielen Geistern seines Stammes angeschlossen hatte. Nie zuvor war ich allein gewesen, war nie zuvor in ein solches Vakuum geraten, und ich dachte, es sei das mindeste, was er tun könnte, das mindeste, von dem er wusste, dass er es tun sollte – zurückzukommen und mir zu erscheinen. Mein ureigener Spuk, mein ureigener geheimer Geist. Ich bräuchte ihn nicht zu sehen. Er würde sich nicht zeigen müssen wie die Gespenster in alten Filmen. Ich suchte nach keiner nebligen Kontur am frühen Morgen im Hof, erwartete nicht, bei Abendanbruch sein Ebenbild in der Küche vorzufinden. Ich wollte einfach nur spüren, dass er dort war, seine Präsenz, wollte dann und wann seine Stimme hören. Vielleicht nur eine winzige, gar bezweifelbare Abweichung im natürlichen Gewebe der Dinge. Das Gefühl, dass sich jemand in einem der oberen Zimmer aufhielt, während ich in der Küche saß und in den Schnee starrte. Eine Tasse oder ein Glas, Geschirr, das mysteriöserweise zum Spülbecken gefunden hatte, obwohl ich davon überzeugt war, es im Flur stehengelassen zu haben. Was Belege anging, verlangte ich nicht viel, brauchte keinen Lebensbeweis, bloß die Ahnung eines Jenseits, wenn er sich umdrehte und zurückblickte, einen Moment lang nur, ehe er weiterging in das, was auch immer danach kommen würde.
* * *
Auf seine typische, halb wirre, halb scherzhafte Art sagte Dad gern, die besten Häuser seien die, von deren Existenz man nichts wisse, sofern man nicht bereits weiß, dass sie da sind. Auf unser altes Haus traf das zu, und es stimmte auch für dieses hier, eine erste Ähnlichkeit, doch was mich zu diesem fremden Haus hinzog – vielmehr zu diesem fremden Garten, da ich das Haus von hier aus noch gar nicht sehen konnte –, was mich anzog, so wie ein Kind im Märchen unwillkürlich von einem Hexenhaus angezogen wird, das war diese nagende Erinnerung, eine, die besagte, ich sei tatsächlich einst glücklich gewesen und könne, darauf aufbauend, auch wieder glücklich werden. Die Bäume waren anders – meist Pappeln, während es früher Birken und Kiefern waren –, alles andere aber verbreitete denselben Charme natürlicher Unordnung, einer Unordnung, die ich bei den übrigen Häusern dieser vorstädtischen Straße mit ihren perfekten Rasenflächen und den Gartenzäunen mit verzierten, ein wenig lächerlichen Pfosten nicht bemerkt hatte. Briefkästen in Form von Vogelhäuschen, und Vogelhäuschen, die wie Briefkästen aussahen. An Miniaturflaggenmästen auf den Veranden flatterte die amerikanische Flagge. Entlang der überraschend langen Auffahrt, die zum Haus führte, wucherten Wildblumen unter Hartriegel und Sommerjasmin, die genügend Halbdunkel und Deckung für die übrigen Lebensformen boten – flinke Schatten, die über nächtlichen Rasen huschten, Müllfresser, Schädlinge, Fabelwesen –, welche die Gärten der Nachbarn fernzuhalten suchten. Dieses Grundstück aber kannte keinen Gärtner. Hier gab es keine Ordnung oder doch nichts, das aus Büchern oder Landschaftsgärten abgeguckt worden war. Das hier war wild, zumindest so wild wie nur möglich – und das erinnerte mich ebenfalls an zu Hause. Während ich der Auffahrt folgte und unter den Bäumen um die sanfte Kurve bog, lockte mich dieses Geräusch an, Holzhacken, der stete Rhythmus, typisch für jemanden, der wusste, was er tat. Wie mein Vater. Vielleicht erwartete ich also, einen Geist mit einer Axt zu sehen, einen wahrnehmbaren, alltäglichen Geist, der in einem verwaschenen blauen Hemd in dieser Nachmittagshitze arbeitete.
Doch der Anblick, der sich mir bot, zeigte keinen Geist. Das verwaschene Hemd war mehr oder weniger identisch, alles andere anders. Ich schätze, ich hatte damit gerechnet, einen Mann vorzufinden, Axt in der Hand, der auf einem breiten, sonnigen Platz zwischen Bäumen und Haus arbeitete; vielleicht hatte ich auch mit jemand Jüngerem gerechnet. Stattdessen sah ich eine Frau, die mir den Rücken zuwandte, Ende fünfzig, Anfang sechzig, soweit sich das sagen ließ. Sie war groß, schlank, nicht gerade spindeldürr, doch so mager, dass man vermuten würde, diese Arbeit wäre zu schwer für jemanden ihres Alters und ihrer Statur; eine ältere Frau in einem alten Hemd, cremefarbenen Jeans und verschrammten, knöchelhohen Stiefeln. Während ich ihr zusah, ihr Bild in mich aufnahm, schien sie völlig in ihrem Tun aufzugehen, und da ich annahm, sie wäre sich meiner Gegenwart nicht bewusst – einer Fremden in ihrem Hof, die sie anstarrte –, wusste ich nicht, was ich als Nächstes tun sollte. Ein langer Augenblick verstrich; und dann, gerade als ich entschied, wieder zu verschwinden, solange ich noch konnte, zurück zur Straße, drehte sie sich um, die Axt in der Hand, als wollte sie mich damit erschlagen, falls ich es wagen sollte, sie zu täuschen.
»Und?«, fragte sie. Sie klang brüsk, wirkte aber nicht feindselig, kam nur gleich zur Sache. Vielleicht war sie auch gar nicht brüsk, sondern verhielt sich nur der Situation angemessen. Sie gab sich förmlich und sprach mit einem leichten Akzent, den ich aber nicht einordnen konnte. »Was führt Sie an meine Tür? Die US-Mail hat hier schon seit geraumer Zeit nichts mehr verloren, und für Besucher habe ich nicht viel übrig.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Art, wie sie mich anschaute, die Neugier, die unter ihrer äußerlichen Förmlichkeit durchschimmerte, fand ich verstörend, und ich brachte keinen Ton heraus, fühlte mich idiotisch, ein dummer, unbefugter Eindringling, der ihren perfekt geordneten Tag störte und nichts vorzubringen wusste. Aufgebrochen war ich mit einer gewissen Grundanleitung, doch angesichts dieser Axtfrau wurde mir klar, dass ich die noch nie angemessen gefunden hatte.
»Ich führe eine Umfrage durch«, sagte ich und sagte damit genau das, was ich Laurits zufolge niemals sagen sollte. Ich bot den Leuten eine Gelegenheit an, ihre Geschichte zu erzählen, keine Umfrage. Eine Chance, gehört zu werden, das verborgene Gewebe aus Wahrheit und Lüge, das jeder in seinem Herzen birgt – und worauf man nur anspielt, es höchstens halb offenbart –, ins freundliche Licht der Aufmerksamkeit eines anderen Menschen zu rücken. Nicht alles könne oder solle offenbart werden, hatte er gesagt. Er sei auf Andeutungen aus, auf Hinweise und Stellen, an denen die persönliche Sicht von der offiziellen Version abweiche. Das Narrativ der Seele. Danach dann, sobald dies enthüllt sei, bleibe es den Umständen überlassen, wie weit man das Ganze noch fortführen wolle. Sah ich erst jetzt, Aug in Aug mit Jean Culver, wie beleidigend das wäre, falls es je dazu käme?
»Eine Umfrage?« Die leiseste Andeutung eines Lächelns huschte über ihr Gesicht, nicht unfreundlich, doch unterlegt mit einem Hauch fast von Verachtung, die allerdings nicht mir galt, was etwas in ihrem Ausdruck verriet, auch wenn ich nicht wusste wie. »Was für eine Art Umfrage?«
Ich schüttelte den Kopf. »Na ja«, sagte ich, »es ist nicht direkt eine Umfrage. Eher so etwas wie eine …« Ich suchte nach einer akzeptablen Beschreibung. »Eher eine … also, ich sammle Geschichten. Lebensgeschichten … mündliche Überlieferungen.«
»Verstehe.« Sie wischte sich mit dem Hemdsärmel über die Stirn. »Sie sind darin aber nicht besonders gut, oder?«
»Es ist ein Studienprojekt«, erwiderte ich und fand plötzlich, dass es wichtig war, nicht einfach abgewiesen zu werden. Warum hätte ich nicht sagen können, aber mit einem Mal fühlte ich mich verzweifelt, allein auf der Welt wie ein auf dem Rummel verlorenes Kind, und einen Moment lang fürchtete ich, dass mir die Tränen kamen. Ich versuchte es erneut: »Der Ansatz unterscheidet sich von der üblichen Herangehensweise bei der Aufzeichnung mündlicher Überlieferungen, wo man …«
»Hat es was mit dem Jahrtausendwechsel zu tun?«
Das überraschte mich. Bis dahin waren es nur noch wenige Monate, aber der Jahrtausendwechsel interessierte mich nicht, ein Thema fürs Fernsehen, für Publikumszeitschriften. »Nein«, erwiderte ich. »Es geht um ein narratives Projekt, das …«
Da verzog sie das Gesicht und winkte ab – ich hätte nicht sagen können, was an ihr anders schien, aber plötzlich fiel mir auf, dass sie deutlich älter war, als ich sie eingeschätzt hatte. Eigentlich verriet dies weniger ihr Gesicht als ihre Art, sich zu bewegen. Eine Sparsamkeit, die sie über die Jahre entwickelt hatte, um jeden Kraftaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dabei gebrechlich zu wirken. »Vergessen Sie’s«, sagte sie. »Es ist ein heißer Tag, und ich bin müde von all dem Holzhacken, Brennholz, das ich vermutlich nicht mal mehr brauchen werde.« Sie lächelte, als hätte sie gerade einen Witz gemacht, dann schaute sie mich an und brach in ein abruptes, aber keineswegs unangenehmes Lachen aus. »Ich kann einfach nicht anders«, sagte sie. »Muss jeden Tag ein bisschen Holz hacken. Das ist so meine Art, mir die Milzsucht zu vertreiben und den Kreislauf in Schwung zu bringen.« Sie schaute mich an, als wollte sie prüfen, ob ich das Zitat erkannte, dann lachte sie aufs Neue. »Kommen Sie ins Haus«, sagte sie. »Ich mache Ihnen einen Kräutertee.« Sie musterte mich von oben bis unten, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich würde Ihnen ja was Stärkeres anbieten, aber ich fürchte, das scheint mir nicht ratsam.« Wieder lächelte sie. »Kommen Sie.« Diesmal klang ihre Stimme freundlich, doch nach einer Freundlichkeit, an die sie sich gerade erst erinnerte und für die sie normalerweise nichts übrighatte.
Ich fühlte die Spitze ihrer Bemerkung, wusste aber nichts dagegen vorzubringen. Mir war nicht danach, ins Haus dieser fremden Frau zu gehen – was seltsam war, offiziell zumindest, denn Einlass in ein Haus zu finden war ja genau der Grund, weshalb ich mich draußen in dieser schwülen Hitze aufhielt –, nur fehlte mir die Energie, etwas anderes zu tun. Die Frau drehte sich um und ging zur Seitenterrasse. Die offene Tür führte in die Stille des Waldes, lenkte den Blick darauf, was dort draußen sein mochte, und erinnerte mich daran, dass Dad es genauso gemacht hatte, dass er im Sommer früh die Tür aufriss und den ganzen Tag offen stehen ließ, wie um jedermann willkommen zu heißen. Sogar im Winter, selbst wenn Schnee auf die blassblaue Fläche zwischen unserem Haus und dem Birkenwald fiel, ließ er die Tür manchmal halb offen, weshalb man die kalte, frische Luft roch, wenn man sich einen Kaffee machte.
Jean Culver blickte nicht zurück, um sich zu vergewissern, ob ich ihr folgte. Ich schätze, ihr war es egal. Sie war müde, es wurde Zeit für eine Pause, und wenn ich kommen wollte, würde ich schon kommen. Also folgte ich ihr ins Haus, vielleicht, weil sich ein Gefühl in mir zu regen begann – eine Ahnung nur, denke ich, da es nichts gab, worauf es fußen konnte –, dass nämlich diese Frau anders als alle Menschen war, die ich je kennengelernt hatte. Sie war jemand, der seinen Frieden mit der Welt geschlossen hatte, zu ihren eigenen Bedingungen, jemand, der sich nicht länger um unbedeutendere Dinge sorgte und sich auf das konzentrierte, worauf es wirklich ankam. Nicht, dass ich eine Vorstellung davon gehabt hätte, was für eine alte Frau, die allein im Wald lebte, wichtig sein könnte. Denn als ich mich den Terrassenstufen näherte und die Stille im Haus spürte, war ich mir sicher, dass sie im Grunde allein auf der Welt war – und dass es ihr so gefiel. Die Terrasse war sauber und ordentlich aufgeräumt, am Rand entlang standen kleine Bäume in Ziertöpfen, und an der Wand lehnten einige Stühle; im Haus führte ein schmaler Flur direkt in die Küche, in der die Frau bereits Wasser in einen altmodischen, nicht elektrischen Kessel füllte.
»Ich habe Kamille, Zimt, Apfel und Minze«, sagte sie mit Blick auf die Arbeitsfläche neben dem Herd. »Was noch? Rooibos, aber für den habe ich mich nie recht begeistern können. Bergtee und Sanddorn, den hat mir jemand geschenkt, aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert.« Sie sah zu mir hinüber, ob ich ihr auch zuhörte. »Lapsang Souchong, Orange Pekoe, Darjeeling. Oder hätten Sie lieber eine Tasse Kaffee?« Sie wartete geduldig auf meine Antwort, auch wenn sie mir vermutlich ansah, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Ich wollte einfach nur eine Weile sitzen, still sein. Sie lächelte, immer noch. »Versuchen wir’s mit Sanddorn«, sagte sie dann. »Wie ich gehört habe, soll er sehr erfrischend sein.«
Ich nickte. Die Küche war ein großer, hoher Raum, schien dank der offenen Fenster aber nicht allein zum Haus zu gehören, sondern enger noch mit dem Garten verbunden zu sein. In der Mitte stand ein wuchtiger, viereckiger, vermutlich aus Pechkiefer gefertigter Tisch, der so alt aussah, dass man sich vorstellen konnte, er sei aus den salzverwaschenen Planken der Pequod zusammengesetzt, die Maserung offen, lang, dunkel von Jahren. Zimmerpflanzen zierten Tisch und Stellflächen, auf dem Fensterbrett, das vom Spülbecken in der Ecke bis zur Tür reichte, eine lange Reihe Geranien und Usambaraveilchen. Davon abgesehen wirkte die Küche aufgeräumt, funktional, wenn auch nicht kahl, eher, als hätte sich seit fünfzig Jahren nichts darin geändert. Sie schien frisch und sauber; alles war gut erhalten, was mich aus irgendeinem Grund an ein Gedicht von Marianne Moore denken ließ, an Verse über kannelierte Säulen, die Kalkweiß bescheidener mache.
Das Wasser kochte, und Jean Culver begann in aller Ruhe, den Tee zuzubereiten. Auch wenn ich mir mittlerweile sicher war, dass sie allein in diesem Haus lebte, machte sie doch nicht den Eindruck einer einsamen Alten, die jede Gelegenheit zur Gesellschaft ergriff, die sich ihr bot. Im Gegenteil. Es war offensichtlich, dass sie mit ihrer eigenen Gesellschaft vollauf zufrieden war. Es gab auch keine Anzeichen für Haustiere, keine Katzen, die mit hocherhobenem Schwanz über den sonnenhellen Fußboden schlichen und mich auf Anzeichen von Boshaftigkeit oder Schwäche prüften, kein hechelnder kleiner Hund, der irgendwo im Haus bellte oder an einer Tür kratzte. Ihre Bemerkungen wirkten wohlüberlegt und kein bisschen aufdringlich; ich fand sie weniger neugierig als um eine Freundlichkeit bemüht, die gewisse Erkundungen erforderte, Fragen nach dem Zuhause oder zumindest nach der Herkunft, nach Familie, beruflichem Werdegang und derlei. Mir entging auch nicht, dass sie sich nicht weiter nach meiner angeblichen Umfrage erkundigte. Als der Tee fertig war, deckte sie den Tisch – Tassen und Untertassen, eine schlichtweiße Teekanne aus Porzellan, ein Zierbecher mit schwerem, dunkelgoldenem Honig und ein Teller mit selbstgebackenen Keksen. Wir setzten uns. Es folgte eine lange Stille, in der sie offensichtlich darauf wartete, dass ich das Wort ergriff. Und ich erinnerte mich an meine Umgangsformen und erkundigte mich nach ihrer Familie, was, wie ich gleich begriff, keine Frage war, die sie erwartet oder sich von mir erhofft hatte.
»Nach dem Tod meiner Eltern bin ich bei Verwandten aufgewachsen«, erzählte sie, der Ton sachlich, gar ein wenig barsch. »Bis vor kurzem hatte ich auch einen Bruder.« Sie schaute mir offen ins Gesicht, als wollte sie etwas ergründen. »Er ist letzten Herbst gestorben.«
»Tut mir leid, dass …«
»Muss es nicht«, sagte sie, nun mit etwas schärferer Stimme. »Er war alt. Noch älter als ich, auch wenn ich Ihnen ansehe, wie schwer es Ihnen fällt, das zu glauben.«
»Nein, gar nicht.«
Sie lächelte. »Das Alter hat seine Vorteile«, sagte sie. »Einer ist, dass man weiß, der Tod ist nicht mehr fern. Der eigene Tod, der Tod anderer, egal. Eines Tages klingelt das Telefon. Du bist gerade beim Backen, in der Pfanne gebackene Apfeltaschen, also legst du die Teigrolle hin und nimmst ab … Dann machst du weiter und backst die besten Apfeltaschen, die du je gebacken hast. Sein Lieblingsgebäck, aber das war Zufall, deshalb hatte ich sie nicht gemacht.« Sie lächelte wieder, traurig wie es schien, als hätte sie sich an etwas erinnert, das sie normalerweise zurückhielt. Ein altes Glück, zu mühsam, um es länger im Gedächtnis zu halten. »Dann war es an der Zeit, etwas Schwarzes herauszusuchen und einen Flug zur Beerdigung nach Virginia zu buchen, eine ziemlich kärgliche Veranstaltung, nur ich und zwei Leute, die er von der Arbeit kannte. Ich kannte sie nicht, und sie haben hinterher nicht viel geredet. Ein paar Sätze aus dem Buch der Prediger – wir waren beide nie religiös, aber es schien angebracht.« Sie hob leicht den Kopf, als wollte sie einige Zeilen aufsagen, überlegte es sich dann aber anders. »Ist man erst in meinem Alter, sind die meisten Freunde tot. Nur denkt man so nicht an sie. Man erinnert sich an ihre Leben, nicht an die Toten. Für Beerdigungen hatte ich nie viel übrig, aber man tut seine Pflicht. Unterdessen gibt es Kuchen zu backen und Holz zu hacken. Ich finde so ein Leben längst gut genug.« Sie schenkte mir noch Tee nach; er roch grün, sommerlich und ein wenig bitter. »Ich rede nicht von Glück. Höre ich Leute über Glück sprechen, habe ich keine Ahnung, wovon sie da reden, und letztlich ist es auch nichts, worüber man sprechen kann; Glück liegt allein in dem, was man tut. Kuchen backen, Holz hacken. Und ab einem gewissen Alter ist das reine Leben Freude genug.« Sie stieß ein abruptes, kurzes Lachen aus. »Meine Güte, was rede ich nur«, sagte sie – und ihr Akzent, woher auch immer, schien ausgeprägter denn je, Virginia, hatte sie gesagt, aber ich war mir nicht sicher, ob sie wirklich von dort stammte. »Einige von uns brauchen ein Leben lang, um herauszufinden, dass die besten Dinge im Leben die langweiligen, alltäglichen Dinge sind.« Sie nahm sich ein wenig Honig. »Dabei sind sie im Grunde natürlich nicht langweilig. Wenn wir jung sind, fehlt es uns nur an der nötigen Fantasie, um erkennen zu können, was diese tagtäglichen Pflichten und Rituale in Wahrheit sind. Und all die großen Abenteuer«, sie rührte mit dem Löffel in ihrem Tee und lächelte, fast nur vor sich hin, doch fühlte ich mich nicht ausgeschlossen. »Na ja, wenn sie geschehen, sind sie nicht so toll.« Sie musterte mich aufmerksam. »Sie können das noch nicht wissen«, sagte sie. »Aber Ihnen bleibt noch Zeit. Später dann, das verspreche ich Ihnen, werden die Dinge klarer, als Sie es je erwartet haben.«
Ich hatte natürlich keine Ahnung, wovon sie sprach. Ehrlich gesagt, vieles von dem, was sie an diesem Nachmittag sagte, habe ich nicht verstanden. Und doch bekenne ich, dass sie mich faszinierte. Nicht weil das, was sie sagte, für mein Leben besonders zutreffend gewesen wäre – was wusste sie schließlich schon über mein Leben, außer, dass ich einen Kater hatte? Nein: Mich faszinierte, wie sie war, wie sie sich bewegte, diese eigenartige Genügsamkeit, der Eindruck von einem gänzlich in sich ruhenden Menschen, den das nicht die geringste Mühe zu kosten schien. Der Tee war bitter, die Kekse waren ein wenig trocken, aber das scherte mich nicht. Mir war sogar egal, dass ich das Gespräch mit ihr manchmal verwirrend fand, besonders, wenn sie über mein Leben sprach, als würde sie alles darüber wissen. Entscheidend war, dass ich sie beneidete. Ich beneidete sie um ihre Genügsamkeit, um dieses In-sich-Ruhen. Ich wollte sein wie sie, was absurd war, da ich im Verlauf des Nachmittags genügend Muße hatte, ihr Gesicht aus größter Nähe zu betrachten – und da sah ich, dass sie wirklich schon sehr alt war. Auf jeden Fall viel zu alt, um Holz zu hacken. Zu alt sogar, um allein zu wohnen. Ich wollte sie fragen, wann sie zur Welt gekommen war, nur um zu sehen, ob ich mit meiner Einschätzung richtiglag – die Einschätzung von was? Ich wusste es nicht. Ich stellte sie mir vor in diesem Haus, allein, im Winter. Wie sollte das gehen? Kam sie jemand besuchen? Hatte sie ein Auto? Ich begann, Fragen zu formulieren, und wollte sie stellen, aber sie wich mir immer wieder aus, als wäre das ein Spiel oder als wüsste sie, was ich wissen wollte, und wäre nicht bereit, auf indirekte Fragen zu antworten. Sie wollte nicht, dass ich mich langsam vortastete. Sie wollte nicht, dass ich höflich tat. Wenn ich was wissen wollte, sollte ich sie fragen. Direkt. Rundheraus.
Schließlich fand ich eine Lücke im Gesprächsfluss. Sie hatte über Essen geredet, über das Rezept für die Apfeltaschen, das von ihrem Vormund stammte. Sie versprach, sie würde mir irgendwann einmal welche backen – was mir eine Gelegenheit bot. »Und?«, sagte ich. »Ist das typisch für Virginia? Apfeltaschen, die in der Pfanne ausgebacken werden?«
Sie lächelte und gestattete sich ein kurzes Nicken. »Nicht nur Apfeltaschen«, sagte sie. »Man kann sie auch mit Pfirsichen machen. Mit Aprikosen. Bei Äpfeln nehme ich ein wenig mehr Zimt.«
»Da sind Sie also her?«, fragte ich. »Ich höre Ihren Akzent, kann ihn aber nicht ganz …«
»Ich bin aus keiner Gegend, die Sie kennen«, unterbrach sie mich, »habe aber in vielen Gegenden gewohnt, unter anderem in Virginia.« Ihre Augen funkelten. Ja, dieses alte Klischee – aber sie wirkte wacher und lebendiger als die meisten jungen Leute, die ich kannte. »Gehört das zur Umfrage?«
»Nein.«
»Mir egal«, sagte sie.
Ich schüttelte den Kopf, war mir plötzlich aber nicht mehr sicher. Wenn meine Neugier nicht in gewisser Weise Teil der Umfrage war, was dann? »Ich dachte nur«, sagte ich. »Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihr Bruder in Virginia wohnte, und ich meine, mich erinnern zu können …«
Sie stieß ihr kurzes Lachen aus und nickte. »Tja«, sagte sie, »demnächst werde ich irgendwohin müssen, aber wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen meine Geschichte. Nicht heute, aber bald. Ich denke, Sie werden sie interessant finden.« Sie beugte sich vor und hielt mich mit ihrem Blick gefangen. »Dafür müssen Sie mir allerdings etwas versprechen.«
Ich war verblüfft, natürlich. »Was soll ich Ihnen denn versprechen?«, fragte ich.
»Sie müssen mir versprechen, fünf Tage lang nicht zu trinken.«
Und genau das war der Moment. Ihre Forderung war absurd, und doch war dies der Augenblick, in dem sich mein Leben änderte. Nicht ihrer Worte wegen, sondern weil ich nicht beleidigt reagierte, nicht die Küche verließ und zurückkehrte in meinen täglichen Kreislauf von Alkohol, benebeltem Sex mit Laurits und der Sehnsucht nach einem Geist, von dem ich wusste, dass er nie erscheinen würde. Ich brachte nicht einmal vor, dass es sie nichts anginge, was ich tue und was nicht. Ich spürte bloß ein seltsam luftiges Gefühl in der Brust, ein Gefühl, das ich nur mit einer Windböe vergleichen kann, die durch ein offenes Fenster weht, die Vorhänge aufbläht und leer zurückfallen lässt. Als ich schließlich etwas sagte, klang meine Stimme dünn, weit fort und so unsicher, dass man auch ein Schuldeingeständnis heraushören könnte. »Wie bitte?«
Sie schüttelte den Kopf und schenkte mir ein Lächeln, das traurig wirken mochte, beinahe, als beginne sie bereits zu bereuen, was sie nun sagen würde. »Wenn Sie bis nächsten Dienstag nüchtern bleiben können, kommen Sie zurück. Vielleicht nehme ich Sie mit ins Sacred Grounds. Wir könnten es als Ausflug verstehen. Kennen Sie es?«
Ich nickte. Das Sacred Grounds war ein Stadtcafé. Ich war nie dort gewesen, hatte aber davon gehört. Vor einem Jahr war irgendeine große Kette in die Stadt gekommen und hatte fünf Häuser weiter ein Café eröffnet, sich dort eingenistet und darauf gewartet, das Sacred Grounds übernehmen zu können. Die übliche Vorgehensweise eben, und normalerweise funktionierte sie. In diesem Fall aber wehrten sich die Leute. Sie organisierten einen Boykott. Sie verteilten Flugblätter. Das Sacred Grounds lief besser als je zuvor. Die Kette zog sich zurück.
»Ist allerdings ein Café«, sagte sie. »Alkohol wird da nicht verkauft.«
»Das weiß ich.«
Sie lachte. »Schon gut«, sagte sie. »Ich nehme Sie doch nur auf den Arm. Daran müssen Sie sich schon gewöhnen, wenn Sie sich mit alten Leuten abgeben.«
Und das war’s. Ich brauchte nichts zu sagen und wusste, sie würde auch nicht überprüfen können, ob ich die nächsten fünf Tage nüchtern blieb, doch schien eine Übereinkunft getroffen worden zu sein, und nun, da der Tee ausgetrunken und zwischen uns ein unausgesprochenes Abkommen geschlossen war, verstummte sie, und wir saßen da wie zwei alte Bekannte, die nicht viel zu reden brauchten, in einer Küche, die, wie ich spürte, einst das Herz des Hauses gewesen war, ein schon fast öffentlicher Ort, man kam und ging, Familie, Freunde, vielleicht auch ein, zwei Nachbarn, bevor das Viertel zu einer Abfolge adretter Vorstadtstraßen verkommen war, in dem ein Haus wie das ihre fehl am Platze wirkte. Vielleicht aber war es anfangs nicht so gewesen, damals, als sie ankam. Vielleicht wuchsen Pappeln und wilde Blumen entlang der Straße, Tiere stromerten ungestört durch die Gärten, nachts riefen Eulen. Ich weiß nicht, warum ich das annahm, doch schien mir, es gab hier Geschichten zu erzählen, und als sie mich zurück durch den Flur begleitete – durch eine halboffene Tür erhaschte ich einen Blick auf ein großes Zimmer mit reihenweise Bücherregalen und nahm einen Geruch wahr, den ich nicht zuordnen konnte –, spürte ich, dass ich mehr als nur die Aussicht auf eine Geschichte mit mir davontrug.
Gregory Peck
Als ich zurück in die Wohnung kam, saß Laurits in einen Sessel drapiert und sah fern, auf dem Boden eine Reihe Flaschen seiner bevorzugten Kleinbrauerei. Am Bildschirm starrte Gregory Peck unergründlich in die Ferne, dieser klassische Gregory-Peck-Blick; ich kannte den Film, konnte mich allerdings nicht an den Titel erinnern, was aber nicht weiter von Bedeutung war. Ich hatte keine Lust, über Filme zu reden, und auch wenn ich Jean Culvers abstrusem Nüchternheitspakt nicht zugestimmt hatte, wollte ich keinen Drink, nicht mal ein Bier. Ich wollte duschen und mich dann ins eigene Bett legen. Laurits mietete die Wohnung von einem Freund; offiziell gesehen war ich keine Mieterin, nur eine Freundin, die bei ihm wohnte, doch hatten wir beide unser eigenes Zimmer, und meist schliefen wir allein. Mein Zimmer war klein, schmal, sehr weiß und nahezu perfekt. Die Art Zimmer, in dem eine Nonne wohnen könnte, vielleicht keine christliche Nonne, aber eine eines anderen Glaubens. Sagen wir, eine buddhistische Nonne, falls es die gibt, aber da es buddhistische Mönche gibt, denke ich, wird es auch buddhistische Nonnen geben. Nicht, dass es auf den Glauben ankäme. Ich wollte bloß kein Kreuz im Zimmer haben, keine Bibel oder dergleichen. Nur die weißen Wände und eine tröstliche Enge, als nähme ich exakt gerade so viel Platz ein, wie ich zum Schlafen, Aufwachen und Anziehen brauchte. Laurits hatte das größere Zimmer, das aber dunkler war, aufwendiger eingerichtet, voll mit alten, womöglich antiken, jedenfalls aber bedeutungsschweren Landhausmöbeln, meist aus dem Laden eines Freundes, Blue Barn Antiques, jedes Stück mit Patina, Charakter und von garantiert regionaler Herkunft. Wenn wir Sex hatten, dann in Laurits’ Zimmer. Das war eine stillschweigende Übereinkunft, die für mich etwas damit zu tun hatte, dass ich meine kleine Nonnenzelle intakt bewahren wollte, was sie für Laurits bedeutete, wusste ich nicht. Ich glaube, er fand die Atmosphäre bei ihm angemessener. Sein Zimmer hatte etwas Narratives. Das war so eines seiner Wörter: narrativ – was nicht bedeutete, dass etwas eine Geschichte hatte, sondern vielmehr, dass diesem Etwas, ob nun einem Ort, einer Person oder einer Situation, die Möglichkeit einer Geschichte anhaftete, die Möglichkeit des Erzählens selbst, und das bedeutete mehr, als dass die Dinge einfach nur geschahen. Laurits hatte jede Menge Theorien über das Narrative. Einer Gruppe SIU-Studenten, die wir in einer Pizzeria in Scarsville kennengelernt hatten, erklärte er einmal lang und breit, die wahre Tragödie des amerikanischen Lebens habe damals, in den sechziger Jahren, nicht darin bestanden, dass der Präsident erschossen worden war, sondern dass man ihn in Dallas, Texas, erschossen hatte, an einem Ort, der für Laurits so gut wie überhaupt keinen narrativen Wert besaß. Wäre das Attentat in Washington passiert oder in New York – oder auch nur St. Louis – wäre alles anders gewesen. Aber Dallas? Was war schon Dallas? Ein Grashügel. Ein Aufbewahrungsort für Bücher. Keine Geschichte, keine Tradition, keine – Provenienz. Von so was war Laurits wie besessen. Amerikanische Narrative. Amerikanische Geschichte, die nie ganz das war, was Historiker darunter verstanden, oder so, wie europäische oder japanische Historie Geschichte war. Deshalb verwechselten die Amerikaner auch so leicht ihre Geschichte mit dem, was sie in Filmen sahen, erklärte Laurits, denn die Geschichte, die ihnen blieb, war sehr viel uninteressanter als die Geschichten, die sich eine beliebige Gruppe von Drehbuchschreibern an einem einzigen Nachmittag in ihrem Büro zusammenfabulieren konnten. Laurits behauptete, Leute kennengelernt zu haben, die nicht wussten, dass es das Attentat auf Kennedy wirklich gegeben hatte. Sie dachten, es wäre aus einem Film. Ein Typ hatte ihn sogar gefragt, wer JFK im Film gespielt hatte, nicht im Remake, sondern im Original.
Natürlich war Laurits ein Lügner. Alles an ihm war gelogen. Er behauptete, aus Estland zu stammen – und richtig war, er hatte einen estnischen Namen, doch war er selbst nur ein einziges Mal in Estland gewesen, ein Ausflug über ein verlängertes Wochenende, damals, als er durch Europa reiste; seine Familie lebte in New Jersey. Estnisch war eine Nationalität mit narrativem Gehalt, die er einsetzen konnte, wie es ihm passte, da niemand in Scarsville auch nur eine Ahnung hatte, wo Estland lag. Ja, sicher, der eine oder andere vom Typ Politikwissenschaftler konnte auf einer Landkarte darauf deuten und erklären, Estland sei ein ehemaliger Satellitenstaat der Sowjetunion, aber das war es dann auch schon, und damals, in einer Welt, in der es noch kein Wikipedia gab, war unser mutmaßliches Wissen deutlich begrenzter als heute. Laurits allerdings wusste alles, zumindest glaubten wir das, gab es doch keine Möglichkeit, irgendwelche Fakten zu überprüfen, die er mit offenkundig atemberaubender Präzision über ein Land von sich gab, das er für heilig hielt, ein vor Bedeutung strotzendes Land mit unverwechselbaren Volksliedern, unübertroffen in seiner Schönheit, seiner tragischen Anmut, ein Land, dessen Wälder noch relativ intakt wirkten, da sie noch nicht abgetreten worden waren an irgendein Holzfällerkonsortium oder eine Bergarbeitergesellschaft mit genügend Geld, die nötigen Schmiergelder zu zahlen. Doch wenn Laurits all dies von seiner vermeintlichen Heimat erzählte, diesem frisch dem Joch der Sowjetunion entronnenen Land, das zu den ältesten, vielfältigsten Kulturen Europas zählte, hörte es sich nie so an, als kritisierte er Amerika. Zumindest nicht das wahre Amerika, von dem er annahm, dass alle darunter das Gleiche verstanden wie er – das Volk nämlich, jene, die arbeiteten oder um ihre Arbeit gebracht worden waren, die Armen, die kaum über die Runden kamen, sowie das gute Volk auf dem Land, das sich für seine Mammutbaumwälder einsetzte und ums blaue Prärie-Bartgras kämpfte.
Mir war all das unbekannt. Estland, das Attentat auf Kennedy, das sowjetische Joch – für mich waren das nur Wörter. Was mir an Laurits gefiel, wenn wir zusammen waren – oder nein, was mich in seiner Nähe zur Ruhe kommen ließ, war, dass er grundlos log, er hatte bloß seinen Spaß und flunkerte beim Erzählen drauflos, so wie Dad es gern getan hatte, wenn er auf seine indianischen Wurzeln zu sprechen kam, auf seine Erinnerungen an dieses Land, wie er es als junger Mann noch gekannt hatte. Land, das rasch verschwand, das Indianern gehören sollte und nicht Christen. Land, das nach fünfhundert Jahren im Besitz der Weißen nur noch wenig mehr war als Rauch und Geister. Was ich etwas seltsam fand, da Laurits ansonsten so gar nicht meinem Vater glich. Eigentlich war er in den meisten Dingen sogar das genaue Gegenteil. Während Dad sanft gewesen war, humorvoll, jemand, der um sich herum stets Platz für andere schuf, war Laurits neugierig, spöttisch, provokant, und wenn er seine narrativen Regeln rigoros anwandte, konnte er auch rücksichtslos sein, sogar grausam. Aber das kümmerte mich nicht. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, und auch jetzt ist es eigentlich nicht weiter wichtig, denn der einzige Grund, weshalb ich mit Laurits zusammenlebte, war der, dass er so viel redete. Das und mein weißes Zimmer, für das ich anteilig Miete bezahlte, wenn auch nicht viel, und in manchen Wochen erließ er sie mir auch, wenn er wusste, dass ich kein Geld hatte. Auf das Reden kam es an. War ich mit Laurits zusammen, brauchte ich nicht zu reden. Brauchte niemand zu sein. Ich musste nicht einmal zuhören. Ich konnte überall hin und einfach nur trinken und alles über mich hinwegrieseln lassen, das Gerede, die Empörung, das Gelächter. Eine Weile machte es dann nichts, dass Dad nicht da war, gab es doch Momente, spät am Samstagabend oder bei einer der Feierabendpartys, die Laurits in seiner Wohnung veranstaltete, da hörte es sich fast so an, als wäre er da gewesen.
* * *
Dad hat nie viel von seiner Kindheit erzählt, als hätte sein Leben erst begonnen, nachdem er sein Zuhause irgendwo oben im Norden von New England verlassen und sich bis nach Pennsylvania hatte treiben lassen. Nicht weit, aber weit genug. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, ehe er meine Mutter kennenlernte und er – so seine eigenen Worte – zu jung heiratete. Anfangs müssen sie glücklich gewesen sein, nur weiß ich wiederum nicht, wie lang ihr Glück hielt. Nachdem meine Mutter gegangen war – ich war damals sechs Jahre alt –, sagte er oft, doch ohne spürbare Verbitterung, die Ehe sei zur Jugend das einzige Gegenmittel. Er sagte es über sich, nicht über meine Mutter, mit deren Verschwinden er bereits einige Zeit gerechnet hatte, und nach wenigen Monaten, in denen er neue Abläufe schuf, um mich zur Schule zu bringen und versorgt zu wissen, solange er bei der Arbeit war, sah er die ganze traurige Geschichte seiner Ehe mit fast so etwas wie Humor. Das entsprach einer Seite an ihm, die er bewusst entwickelt hatte, um mit der offiziellen Welt der Arbeit, der Institutionen und all dem Gesellschaftlichen fertigzuwerden – seine Fähigkeit nämlich, alles in Systemen zu denken. Ich wusste nicht, was er tat, wenn er ins Büro ging, wo er als Senior Designer arbeitete, doch verstand ich, als ich älter wurde, dass er seiner Natur nach zwar einen Hang zur Wildnis hatte, zu Wald und Fluss – weshalb er manchmal auch tagelang ins hinterletzte Nirgendwo verschwand –, für sich aber beschlossen hatte, die einzige Möglichkeit, mit der sozialen, der offiziellen Welt umzugehen, bestünde darin, sie für eine Reihe ineinandergreifender Systeme zu halten. Dieses Prinzip galt ausnahmslos, auch für seine Ehe; als meine Mutter verschwand, sah er ihre Abwesenheit allein als ein Systemproblem, das sich leicht überwinden ließ, wenn man ihm mit gesundem Menschenverstand, Geld und Gefasstheit begegnete. Und das Prinzip funktionierte – zumindest dem äußeren Anschein nach.
Dennoch wusste er nicht recht etwas mit sich anzufangen, bis Louise auftauchte, acht Jahre später. Er behauptete gern, nicht genügend Zeit gehabt zu haben, um die Freuden der Einsamkeit kennenlernen zu können. Da meine Mutter fort war, musste er mich allein aufziehen – und er war ein guter Vater, immer da, wenn ich ihn brauchte; er saß an meinem Bett und hielt meine Hand, wenn ich nicht einschlafen konnte, redete mit mir, wenn ich aus einem Albtraum aufschreckte, bis ich das blassgoldene Licht in meinem Zimmer wieder wahrnahm. Er erzählte mir Märchen – ich weiß nicht, woher sie kamen, vielleicht hat er sie sich ausgedacht –, Geschichten, die stets damit endeten, dass ein böser alter König vertrieben wurde aus seinem Palast, den man dann für alle Welt öffnete, ein Palast, in dem Kinder tanzen und singen durften, und das umliegende Gelände wurde zu einem Garten, in dem jeder, selbst die Ärmsten des Königreiches, picknicken oder in den Zirkus gehen durften. Diese Geschichten waren anders als alles, was ich sonst las oder hörte, nie handelten sie von einem echten König, der seinen Thron zurückeroberte oder vom siebten Sohn eines siebten Sohnes, der die Prinzessin für sich gewann. Und immer endeten sie mit dem Sieg des einfachen Volkes. Nach einer Weile begann ich zu verstehen, worauf er hinauswollte, aber ich ließ mir nie etwas anmerken. Es war die einzige Erziehung, die er mir bieten konnte. Ein Gefühl für das, was sich gehörte. Gleichheit und Gerechtigkeit für alle. Ein gutes System.