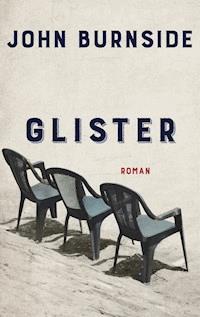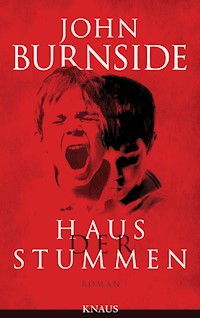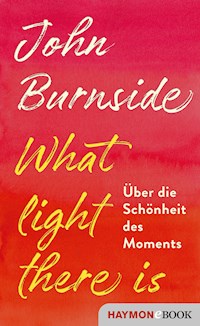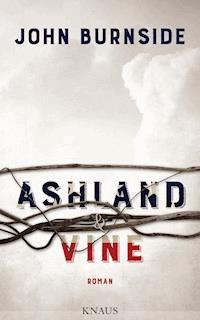12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ganze Verletzlichkeit des Lebens in nur einem Moment
Was macht eine gute Beziehung aus? Was ist Liebe – und was nicht? John Burnsides Geschichten tauchen in das Leben von Männern und Frauen ein, die – in einer Ehe gefangen, gebeutelt von falschen Erwartungen, dem Alkohol verfallen – alles andere als ideale Paare verkörpern. Untreu, einsam, krank, begegnet man seinen Heldinnen und Helden bevorzugt nachts auf leeren Straßen. Von so etwas wie Glück können sie nur träumen, ihre Gefühle bleiben meist sprachlos. Und doch könnten sie unsere Nachbarn sein.
Burnside ist einer der besten Gegenwartslyriker und zugleich bemerkenswerter Essayist und Romancier. Mit dem vorliegenden Band lässt er sich nun erstmals in deutscher Sprache auch als Autor von Kurzgeschichten kennenlernen. Jede der zwölf Erzählungen der von ihm eigens zusammengestellten Auswahl zeigt die ganze Verletzlichkeit eines Lebens in nur einem Moment – und besitzt dennoch das Gewicht und die Dichte eines großen Romans.
»Ein schottischer Raymond Carver.« Independent
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Was macht eine gute Beziehung aus? Was ist Liebe – und was nicht? John Burnsides Geschichten tauchen in das Leben von Frauen und Männern ein, die – in einer Ehe gefangen, gebeutelt von falschen Erwartungen, dem Alkohol verfallen – alles andere als ideale Paare verkörpern. Untreu, einsam, krank, begegnet man seinen Heldinnen und Helden bevorzugt nachts auf leeren Straßen. Von so etwas wie Glück können sie nur träumen, ihre Gefühle bleiben meist sprachlos. Und doch könnten sie unsere Nachbarn sein.
Burnside ist gefeierter Gegenwartslyriker und zugleich bemerkenswerter Essayist und Romancier. Mit dem vorliegenden Band lässt er sich nun erstmals in deutscher Sprache auch als Autor von Kurzgeschichten kennenlernen. Jede der zwölf Erzählungen der von ihm eigens zusammengestellten Auswahl zeigt die ganze Verletzlichkeit eines Lebens in nur einem Moment – und besitzt dennoch das Gewicht und die Dichte eines großen Romans.
JOHN BURNSIDE, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis. Sein Prosawerk erscheint auf Deutsch im Penguin Verlag.
BERNHARD ROBBEN, geboren 1955, übertrug und überträgt u. a. die Werke von Ian McEwan, John Williams und Salman Rushdie ins Deutsche. 2013 wurde er mit dem Ledig-Rowohlt-Preis für sein Lebenswerk geehrt.
»Burnsides Prosa glänzt.« Independent on Sunday
»John Burnside gehört unter den großen zeitgenössischen Schriftstellern zu den ganz großen, zu den allerbesten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
www.penguin-verlag.de
John Burnside
So etwas wie Glück
Geschichten über die Liebe
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Die vorliegenden Erzählungen wurden vom Autor eigens für diesen Band zusammengestellt:
Fügung erschien erstmals 2013 als Hörspiel beim SWR, in der Übersetzung von Bernhard Robben.
Kates Garten erschien im Original in der Kurzgeschichtensammlung Burning Elvis (Jonathan Cape, London 2000).
Alle anderen Erzählungen erschienen im Original in der Kurzgeschichtensammlung Something Like Happy (Jonathan Cape, London 2013).
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds, der diese Arbeit mit einem Stipendium gefördert hat.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich
auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © John Burnside 2022
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Renate Haen
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © plainpicture/NaturePL/Bence
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29594-3V001
www.penguin-verlag.de
Die Kälte draußen
Als sich der Krebs zurückmeldete, überraschte mich das nicht. Ich machte mir Sorgen wegen Caroline, schließlich war mir klar, dass ich es ihr irgendwann sagen musste, und mich beunruhigte zudem, wie sie es dieses Mal aufnehmen würde. Sogar für Malky tat es mir leid; verlässliche Fahrer sind schwer zu finden, und er ist immer ein guter Chef gewesen. Trotzdem hat es mich nicht überrascht, jedenfalls nicht, als es mir gesagt wurde. Dass irgendwas schieflief, damit hatte ich gerechnet, mindestens seit dem Sommer, als Sall und ich überlegt hatten, nach Montreal zu Caroline zu fliegen, um ihren neuen Freund kennenzulernen, das Vorhaben dann aber wieder aufgaben. Sall wusste, wie gern ich sie wiedersehen würde: Caroline war schon immer Daddys kleiner Liebling gewesen, und seit ihrem Auszug ließ sich nur mit Mühe verhehlen, wie leer sich das Haus ohne sie anfühlte – eine Mühe, zu der ich mich manchmal nicht aufraffen konnte. Sall wusste bestimmt so gut wie ich, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb, weshalb sie sich anfangs allen Anschein gab, die Reise zu planen, ehe sie dann davon redete, wie teuer das Ganze war, wie ermüdend es für mich sein würde, nach Glasgow zu fahren und sieben Stunden lang im Flugzeug zu sitzen, um nach alldem auch noch durch Zoll und Grenzkontrolle zu müssen, was meist ewig dauerte. Wie sie darüber redete, hätte man glauben können, sie hätte die Reise bereits gemacht, hatte sie aber nicht. Sie war nie aus Schottland rausgekommen, und was sie da redete, stammte von Caroline, die in den sechs Jahren, seit sie die Stelle in Montreal angenommen hatte, dreimal wieder nach Hause gekommen war. Kurz vor ihrem letzten Besuch hatte sie diesen neuen Freund kennengelernt und mit einigem Nachdruck erklärt, dass wir nun an der Reihe wären, sie zu besuchen.
»Ich weiß, es ist ein weiter Weg«, hatte sie gesagt. »Aber wenn ihr erst mal hier seid, gefällt es euch bestimmt. Das wird ein toller Urlaub, das könnt ihr mir glauben. Außerdem fragt Jim ständig, ob es euch wirklich gibt. Er denkt, ich habe euch bloß erfunden.« Sie hatte gelacht, aber die Einladung war ernst gemeint, auch wenn Caroline, als sie sich damit an uns wandte, Sally kaum ansah, sondern ihren Blick auf mich gerichtet hielt. Seit die beiden nicht mehr im selben Haus zusammenleben mussten, fand Caroline sich mir zuliebe damit ab, ihre Mutter nicht weiter zu beachten. Für sie lief alles auf präzises Management hinaus, darauf, Gelegenheiten zu vermeiden, bei denen etwas gesagt werden könnte, was sich nicht mehr zurücknehmen ließe. Schon vor ihrer Abreise war sie stets wie ein Geist aufgetaucht und wieder verschwunden, nur damit sie nicht mit Sall allein sein musste. Den Grund dafür habe ich nie richtig verstanden. Einmal hörte ich Caroline sagen, ihre Mutter könne in einem leeren Zimmer einen Streit anfangen, aber das war eigentlich nicht fair. Den beiden fiel es einfach schwer, sich zusammenzusetzen, ohne dass gleich irgendeine Unstimmigkeit oder ein Missverständnis aufkam. Unvereinbarkeit zweier Persönlichkeiten, so etwas gibt es häufig und unter allen erdenklichen Umständen, schockierend ist es bloß, wenn es zwischen Mutter und Kind geschieht.
Immer wenn Caroline eine ihrer vagen Einladungen aussprach, hätte ich am liebsten gesagt, wir kommen so bald wie möglich, aber Sall war immer schneller als ich. »Mal sehen« war alles, was sie erwiderte, ehe sie dann anfing, jeden Gedanken an Montreal zu hinterfragen. Das hatte sie den ganzen Sommer über getan, hatte Einwände vorgebracht, Ausreden gesucht und so lange darüber geredet, bis die Reise nicht mehr infrage kam und wir stattdessen für traurige zwei Wochen Regen und Teestuben zu Salls Bruder Tom und dessen zweiter Frau nach Hertfordshire fuhren. Ich begriff, was ablief und sagte mir, angesichts des Verhältnisses, das die beiden zueinander hatten, wäre es so vielleicht am besten, nur machte mir der vorgebliche Urlaub dann doch mehr zu schaffen als erwartet. Anfangs schob ich die Schuld auf meine übliche Enttäuschung über Salls Spielchen und mein Unvermögen, ihr die Stirn zu bieten, doch irgendwann während dieser Zeit, als ich gerade in Stevenage in einem schäbigen Trödelladen herumstöberte, wurde mir klar, dass ich meine letzte Chance vertan hatte, jemals nach Montreal zu reisen.
Dieses Wissen existierte also bereits irgendwo in meinem Hinterkopf und wartete nur darauf, in Worte gefasst zu werden, als der Arzt mir Bescheid gab. Und ich war auch fast bereit, fand mich fast damit ab, so wie es in all den Geschichten, die man sich übers Sterben erzählt, von einem erwartet wird. Nicht vollständig, aber doch beinah; ich wollte bloß noch hören, wie es für mich ablaufen würde, damit ich die Klinik danach verlassen und mit dem Rest meines Lebens fortfahren konnte. Ein paar Monate blieben mir noch, meinte der Spezialist, und ich dachte, dass ich jetzt tun könne, wozu immer ich Lust hatte. Ich war frei. Nur gab es nichts, was ich noch unbedingt tun wollte, höchstens Caroline sehen, und ich wusste, wie Sall jetzt dazu stehen würde. Ich hatte es oft genug gehört: dass ich immer bloß Zeit für mein kleines Mädchen hätte, für niemanden sonst, dass ich sie völlig verzogen hätte. Wenn man Sall so reden hörte, konnte man glauben, was zwischen den beiden ablief, sei allein meine Schuld, aber wenn ich zurückdenke und versuche, eine Erinnerung zu finden, ein Bild, das die beiden glücklich zeigt, ist da nichts. Nicht einmal aus der Zeit, in der Caroline noch ein Baby war. Ich sah mich nur am Fenster des Hinterzimmers stehen, wie ich versuchte, sie in den Schlaf zu wiegen und ihr dabei Weihnachtslieder vorsang, weil das die einzigen waren, deren Text ich kannte; und ich sah uns beide, Caroline etwa sechs, wie wir im Flamingo Park auf Pferden endlos im Kreis ritten, während Sall für sich blieb und uns zusah, mit einem neugierigen, leicht verwirrten Ausdruck im Gesicht, fast als genierte sie sich oder als wäre ihr etwas peinlich. Ich konnte Caroline über meine schlichten Witze lachen hören, wenn ich sie morgens zur Schule brachte, und ich sah uns im Garten eine Reihe Schneemänner bauen – vier nebeneinander, alle identisch. Deshalb war ich so gern auf Achse, und deshalb machte es mir nichts aus, so bald schon wieder auf der Straße zu sein, denn wenn ich da draußen war, allein für mich, sah ich mir diese Bilder in meinem Kopf an und war zufrieden.
Jedenfalls saß ich am Tag nach der Diagnose wieder hinterm Steuer, lieferte Sirup aus. Ich wäre wohl auch ein, zwei Tage zu Hause geblieben, aber als Malky abends anrief, sagte Sall, mir gehe es gut und ich käme am Morgen wieder zur Arbeit. Ich machte ihr das nicht zum Vorwurf; wir brauchten das Geld. Sicher, ich hätte enttäuscht sein können, weil sie mich nicht zu Hause haben wollte, nicht mal so kurze Zeit, aber ich war nicht enttäuscht. Ich wusste, eigentlich traf sie keine Schuld. Sie verstand bloß nicht, wie man mit so was umging. Noch ehe ich die Klinik verließ, konnte ich spüren, dass sie sich innerlich abwandte, so wie immer, wenn es Probleme gab. Sie zog sich an ihren ureigenen Ort zurück, wie seit jeher, schon seit unserer Hochzeit, als die Dinge anders waren als erwartet und wir uns gestrandet fühlten, sprachlos und unfähig, einander zu berühren oder auch nur anzusehen, allein in der Stille des leeren Hauses mit einem Regal voller verblasster Fotos in farblich aufeinander abgestimmten Shaker-Rahmen, die Sall bei Oxfam gekauft hatte.
Ich mache ihr also keine Vorwürfe. Ich war nur froh, wieder auf der Straße zu sein und nicht zu Hause sitzen und Trübsal blasen zu müssen. Außerdem habe ich Sirup seit jeher gern ausgefahren. Melasse, um genau zu sein. Immer mal wieder geht’s raus aufs Land, und ich liefere die warme, dunkle Brühe an Bauern, die damit das Viehfutter anreichern, den Sirup unter Gerste mischen, um daraus einen süßen, malzigen Brei zu machen, von dem die Tiere gar nicht genug kriegen können. Ich fahre gern auf die Gehöfte, die mitten am Tag so still daliegen, so einsam; und ich unterhalte mich auch gern mit den Bauern, höre mir die Geschichten dieser Männer an, die in all den Jahren ihres Lebens nie irgendwo anders gewesen waren als auf ihrem oft kaum vierzig Hektar umfassenden Land, erwachsene Männer, vom eigenen Besitz in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ehrlich gesagt, mache ich nichts lieber, als Melasse zu liefern. Es gibt Tage, an denen ist sie so dick, dunkel und zähflüssig, dass man drauf laufen könnte, und wir arbeiten angestrengt, um den Saft in die großen Tanks zu pumpen, die meist so alt und klapprig sind, dass man fürchten muss, sie könnten bald in sich zusammenfallen. Was sie gelegentlich auch tun. An einem wirklich warmen Tag wird eines der Rohre platzen, vielleicht wird auch eine Behälterwand nachgeben, und dann ist überall Sirup: Sirup und dieser Geruch nach Sirup, von dem einem ganz schwindlig wird; so süß ist er und so stark.
Die Arbeit war schwer, aber die Beschäftigung tat gut. So blieb weniger Zeit zum Grübeln. Und als ich an jenem Wintermorgen aufbrach, wusste ich, dass ich mich abends, wenn ich nach einem Tag getaner Arbeit nach Hause käme, besser fühlen würde, da ich mir bewiesen hatte, dass ich noch nicht völlig nutzlos geworden war. Den ganzen Tag, während ich im frostigen Licht die Höfe abfuhr, dachte ich darüber nach, wie ich weitermachen wollte, bis ich nicht mehr weitermachen konnte. Letztlich bleibt dem Mann nur die Arbeit und sein Selbstwertgefühl, das geheime Leben, das er in sich verwahrt und von dem außer ihm niemand etwas wissen kann. So war es schon immer gewesen, auch daheim: Mein wahres Leben blieb getrennt vom Alltäglichen, über das Sall Bescheid wusste oder an dem ihr doch gerade genug lag, um die jeweiligen Entscheidungen zu fällen. Nicht dass ich sie nicht geliebt hätte, zumindest zu Beginn; in den ersten Jahren haben wir uns durchaus vertragen. Nur sind wir auf unsere je eigene Art immer Privatmenschen geblieben. Und vermutlich hat uns genau das erlaubt, nach Carolines Auszug weiter zusammenzuleben. Wir wussten, wie jeder für sich bleiben konnte, eine Fähigkeit, die wir im Laufe der Jahre perfektioniert hatten, ohne je zu ahnen, wie vollständig wir sie beherrschten.
Es war spät am Nachmittag, über den Feldern ging langsam die Sonne unter, und entlang der Straße beim alten Krankenhaus sickerte letztes Licht durch Bäume und Gebüsch. »Das erste Abendgrün«, hatte meine Mutter diese Stunde gern genannt, wenn sie daheim auf den Stufen am Hintereingang saß und die in der Dämmerung verblassenden Inkalilien und Montbretien betrachtete. Ich habe nie herausgefunden, ob sie sich das selbst ausgedacht hatte oder ob es ein Zitat von irgendwoher war, vielleicht aus einem Hörspiel oder aus einem Kinderbuch, das sie mir vorgelesen hatte, als ich noch so klein war, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Kam ich früh nach Hause, hatte ich meist Zeit für mich. Während Sall sich in der Küche zu schaffen machte, saß ich im Esszimmer, die Zeitung ausgebreitet auf dem Tisch, oder ich hörte Radio, starrte in den Garten und spielte derweil an den Knöpfen, um einen besseren Empfang zu bekommen. An jenem Tag aber hatte man mir eine lange Tour zugeteilt, weshalb ich erst bei Anbruch der Dunkelheit auf der Jacob’s Well Farm fertig wurde. Es war ein guter Tag gewesen, trotzdem wusste ich, dass ich es nicht übertreiben sollte, weshalb ich eigentlich ganz froh war, als ich mich endlich von Ben Walsh verabschieden konnte, der Jacob’s Well früher mit seinem Dad betrieben hatte und jetzt, da seine Frau von ihm gegangen war, als Letzter hier wohnte, keine Kinder, auch die Eltern tot. Mittlerweile lebte er schon seit Jahren allein, und vielleicht war das der Grund, weshalb er sich so sehr für die wenigen Leute interessierte, denen er begegnete. Am heutigen Tag hätte ich auf dieses Interesse allerdings gut verzichten können, auch wenn er natürlich nicht wusste, welche Probleme mich plagten. Er bot mir eine Tasse Tee an. Als ich sagte, ich sollte mich lieber auf den Heimweg machen, schien ihn das nicht weiter zu stören. Er schenkte mir ein verhaltenes Lächeln und schüttelte den Kopf. »Wie läuft’s mit der besseren Hälfte?«, fragte er. »Alles in Ordnung?« Er redete über Sall meist, als wäre sie leicht behindert – was sie in gewisser Weise ja auch war.
»Kann mich nicht beklagen«, sagte ich.
»Das ist gut.« Er musterte mich mit einem seltsam scheuen Blick. »Es macht Ihnen hoffentlich nichts aus, wenn ich trotzdem sage, dass Sie ein bisschen mitgenommen aussehen.«
»Ach was«, erwiderte ich. »Mir geht’s gut.«
»Wirklich?«
»Bin nur ein wenig müde, schätze ich. Das vergeht wieder.«
Er nickte. Er war neugierig und, so glaube ich, auch ehrlich besorgt, wusste aber, dass er nicht weiter nachbohren sollte. »Nun, wollen wir es hoffen«, sagte er. »Passen Sie auf sich auf. So kurz vor Weihnachten wollen Sie sicher nicht noch krank werden.«
Ich rang mir ein Lächeln ab. »Das können Sie laut sagen«, erwiderte ich. »Ist aber heute die letzte Tour vor den Feiertagen. Zeit, mich mal richtig auszuruhen. Passen Sie auch auf sich auf.« Ich gab ihm die Hand und ging zurück zum Laster. Einen Moment lang wünschte ich mir, ich hätte eingewilligt, mit ihm Tee zu trinken, wäre geblieben und hätte über nichts Bestimmtes mit ihm geredet, nur seine Gesellschaft noch eine Weile genossen. Weihnachten, dachte ich, würde für ihn bestimmt auch nicht allzu festlich ausfallen, so ganz allein, nur mit den Tieren.
Für mich selbst konnte ich mir erst recht keine allzu festliche Weihnacht vorstellen, jetzt, da alles entschieden war. Ich freute mich nicht gerade auf die Ruhe der Feiertage oder darauf, mit Sall all jene Rituale zu absolvieren, auf die sie bestehen würde – schließlich war Weihnachten. Vielleicht würde Caroline anrufen, irgendwann am Nachmittag, würde den Anruf gleich als Erstes erledigen, damit sie den Rest des Tages in dem Wissen angehen konnte, ihre Pflicht erfüllt zu haben. Ich hatte ihr natürlich kein Wort vom Krebs erzählt. Beim ersten Mal hatte ich zwar kurz geschwankt, aber sie hätte sich nur Sorgen gemacht und sich vielleicht verpflichtet gefühlt, uns zu besuchen. Diesmal dachte ich keine Sekunde lang daran, da ich genau wusste, dass ich sterben würde, und das wollte ich auf meine Weise. Ich wollte mit einem gewissen Anstand aus dem Leben scheiden oder doch zumindest mit einer gewissen Aufmerksamkeit für das, was geschah, statt stummer Zuhörer eines großen Dramas zu sein, in dem Sall und Caroline sich darüber stritten, wie ich mich ihrer Meinung nach zu verhalten hatte. So war es über weite Abschnitte meines Lebens oft gewesen: Ich hatte keines der großen Ereignisse verpasst, hatte mich aber auch nie völlig anwesend gefühlt, während sie stattfanden. In jenen letzten paar Wochen nahm ich jedoch alles wahr. Fast als würde die Zeit mich plötzlich einholen und ich sähe mich selbst einen Brief öffnen oder eine Tasse Tee zubereiten, sähe mich von oben, wie ich diese alltäglichen Dinge erledigte und dabei ein seltsames Vergnügen empfand, obwohl ich nicht sagen könnte warum, es sei denn, weil es vielleicht das letzte Mal war, dass ich einen Brief öffnete oder mir eine Tasse Tee machte.
Mir fielen zudem Dinge draußen auf der Straße auf, Dinge, die ich tausendmal gesehen hatte und immer mit Vergnügen, ohne den Grund dafür zu kennen. Kleine, mein Leben lang schlicht als dumm abgetane Details und Einbildungen, die aber plötzlich wichtig wurden. Wie die Strecke auf dem Rückweg von Glasgow, wenn ich am Abzweig nach Larbert vorbeikam. Ich weiß nicht, wie oft ich es gesehen habe: ein blaues Straßenschild und eine sich in der Ferne verlierende Reihe Cherry-Cola-Straßenlampen: Larbert, A9. Schon seltsam, welches Vergnügen mir dieses Schild bereitete. Anlass, nach Larbert zu fahren, hatte nie bestanden. Es gab keine Touren in diese Richtung, aber vielleicht hat mir der Name ja gerade deshalb immer gefallen. Larbert. Das klang wie eine Stadt, in der die Teenagerjahre ewig währten, all die grauen Tage am Wasser und merkwürdig schmeckende Süßigkeiten, die im Mund prickelten und einen an die Möglichkeit von Sex glauben ließen. Nicht dass ich als Teenager viel über Sex gewusst hätte, abgesehen von dem wenigen, was ich aus Filmen kannte, und diesem seltsam angenehmen Unbehagen, das mich jedes Mal überkam, wenn Rita Compton meine Schwester besuchte.
Dergleichen ging mir durch den Kopf, als ich den Jungen sah, wenige hundert Meter tief im Wald, beim Einsetzen eines Wolkenbruchs. Es waren noch fünfzig Kilometer bis nach Hause, als das Unwetter begann, ein heftiger Graupelschauer, der später vielleicht in Schnee übergehen würde, vielleicht auch nicht. Es war schon so dunkel, dass ich die Scheinwerfer einschalten musste, aber als ich den Wald erreichte, unter die Buchen abtauchte, war es, als führe ich in ein kleines Theater; Lichter flackerten durchs Dunkel, der Wald schwarz und still wie eine Kulissenwand. Das hat mir am Wald schon immer gefallen, die Art, wie er mich plötzlich umschließt, fast als sollte eine Geschichte erzählt werden. Wie damals, als ich noch ein Junge war und der Ansager von Listen with Mother fragte: »Sitzt ihr auch bequem? Dann will ich anfangen.« Meist war die Straße leer, nur gelegentlich ein Scheinwerferpaar – kein Mensch, nicht einmal ein Auto, nur ein Lichteffekt –, das in entgegengesetzter Richtung vorbeirauschte. An jenem Abend aber gab es noch jemanden in der Geschichte, wenn auch niemand aus einem der Kinderbücher, die ich kannte.
Erst glaubte ich, es sei eine Frau. Hätte ich das nicht geglaubt, hätte ich vielleicht nicht angehalten. Jedenfalls sah er aus wie eine Frau: ein schwarzes Kleid, kein Mantel, Netzstrümpfe, hochhackige Stiefeletten, schulterlanges, gewelltes Haar. Sie ging langsam, hatte fast das Ende der kurzen Buchenallee erreicht, und ich konnte nicht viel erkennen, doch als die Scheinwerfer sie erfassten, drehte sie sich um, und ich sah, dass etwas an ihr eigenartig war, seltsam schwer. Nicht dass ich auf Anhieb einen Jungen in ihr vermutet hätte. Es war dunkel, es regnete, und als ich sie dann besser sehen konnte, lenkten mich die blauen Flecke in ihrem Gesicht ab: die Flecken, das zerzauste Haar, das Dunkle am rechten Bein, das wie Blut aussah, kurz unterm Saum ihres Kleides.
Ich nahm selten Tramper mit. Früher hatte ich es öfter getan und die Unterhaltung genossen, meistens jedenfalls. Nicht immer, aber doch so oft, dass es sich lohnte. In letzter Zeit zog ich es allerdings vor, in der Fahrerkabine allein zu sein, nur mit meinen eigenen Gedanken zur Gesellschaft. Wenn ich auf den schmalen Straßen, die nach Perth führten oder nach St Andrews, im Dunkeln nach Hause fuhr und mich anhand eigener Orientierungshilfen an den Weg erinnerte, an den Hecken und Trockenmauern und den Lücken dazwischen, die andere gar nicht bemerkten, dichtem Ilexgebüsch oder dem Licht der Laternen, wenn ich durch eine Stadt fuhr, dann begriff ich an manchen Abenden mit einem Gefühl angenehmer Überraschung, dass ich mir gefiel, wie ich war, dass ich mein Leben mochte und dass es mir zugleich nicht viel ausmachte, es aufgeben zu müssen. Ich war über das Stadium hinaus, in dem ich auf meinen Touren Gesellschaft angenehm fand; und ich muss zugeben, dass ich auch an jenem Abend kurz erwog, einfach weiterzufahren, selbst nachdem mir die Wunde an ihrem Bein aufgefallen war. Ich brauchte keinen Ärger, und alles, was nicht zum üblichen Ablauf gehörte, fand ich mittlerweile unnötig kompliziert. Trotzdem wurde ich langsamer und hielt neben ihr – immer noch in dem Glauben, die Person an der Straße sei eine Frau, womöglich eine Frau in Not –, nur um wenigstens nachzufragen, ob alles in Ordnung sei. Ich kurbelte das Fenster herunter und beugte mich zur Beifahrerseite vor. »Sie sehen aus, als hätten Sie Ärger gehabt«, rief ich und bemühte mich, den Motorenlärm zu übertönen, zugleich aber nicht so laut zu rufen, dass ich sie vielleicht erschreckte.
In dem Moment, da ich auf die Bremse drückte, blieb sie stehen – und erst jetzt sah ich, dass sie keine Frau war. Sie blickte auf, und alles an ihr bestätigte meinen Eindruck: die Art, wie sie dastand, das Dunkle in ihrem Gesicht, die Schwere. Es war ein Junge, keine Frau. Auch kein Mann, nur ein Junge, achtzehn, zwanzig, eher gedrungen und überhaupt nicht feminin. Als er zu mir aufblickte, sah ich trotz feuchtem Make-up und zerlaufener Wimperntusche die Angst in seinem Gesicht, eine Angst, die er verbergen wollte, was ihm aber nicht ganz gelang. »Alles gut«, sagte er, blieb aber stocksteif stehen, wartete.
»Wohin wollen Sie?«, fragte ich, stellte den Motor ab und versuchte, mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
»Nach Hause«, sagte er und murmelte dann noch etwas, was ich nicht verstehen konnte.
»Wie war das?«
Er schüttelte den Kopf. Er schien verzweifelt, doch war ich mir nicht sicher, ob er verzweifelt darauf hoffte, dass man ihm half oder darauf, dass man ihn in Ruhe ließ – zumindest war ich mir unsicher, bis er den Mund aufmachte. »Mir geht es gut«, sagte er.
Da wusste ich, er wollte mir vertrauen, zumindest so weit, dass er sich wohlbehalten von mir nach Hause bringen lassen konnte. Ich wusste aber auch, dass er niemandem vertraute, jedenfalls nicht in diesem Moment. »Tja«, sagte ich. »Ich heiße Bill Harley. Ich fahre Melasse aus, bin nach einer langen Tagestour auf dem Weg nach Hause, und es ist bald Weihnachten, also werde ich Sie nicht hier im Dunkeln stehen lassen.«
Irgendwas machte da in ihm Klick. Vielleicht fand er es komisch, dass ich Melasse erwähnte, jedenfalls schien etwas in ihm nachzugeben. Er trat näher an den Laster heran und versuchte, ins Innere zu sehen. »Ich bin auch auf dem Weg nach Hause«, sagte er. »Ist gleich die Straße runter.« Er schaute mir ins Gesicht. »Mir geht es gut«, sagte er noch einmal, klang jetzt aber weniger überzeugend.
»Ach kommen Sie«, sagte ich. »Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Ich fahre Sie nach Hause, und Sie haben Zeit, sich ein bisschen zurechtzumachen.« Ich öffnete die Beifahrertür.
Der Junge nickte. Wahrscheinlich hatte er das Für und Wider abgewogen und war zu dem Schluss gekommen, dass er das Risiko eingehen konnte. Vielleicht war er aber auch darüber hinaus, sich Sorgen zu machen, und konnte einfach der Aussicht auf Schutz vor dem Regen nicht widerstehen. »Na gut«, sagte er. »Sehr freundlich von Ihnen.«
Ich nickte und wartete, während er auf den Beifahrersitz kletterte. Das Kleid und die hochhackigen Schuhe, die, wie ich annahm, für ihn ungewohnt waren, machten es ihm nicht gerade leicht, aber schließlich saß er und zog die Tür zu. Im goldenen Licht der Deckenlampe sah ich kurz zu ihm hinüber, dann ließ ich so beiläufig wie möglich den Motor an. »Nun«, sagte ich ein wenig lauter, damit er mich trotz des Lärms verstehen konnte. »Wo soll’s denn hingehen?«
»Coaltown?«
Ich nickte und lenkte auf die Fahrbahn zurück. Bis dahin waren es gut dreißig Kilometer, nicht gerade nur die Straße runter, aber es lag auf dem Weg.
»Sie kennen die Stadt?«
»Hab früher da gearbeitet«, sagte ich. »Lange her.«
»Tja«, sagte er. »Sie werden merken, da hat sich nicht viel verändert. Das kann ich Ihnen garantieren.«
»Glaub ich gern«, sagte ich und löste die Handbremse. Dabei fiel mein Blick auf die Schnittwunde an seinem Bein. Sie sah übel aus, blutete aber nicht mehr. Dreck klebte an Beinen und Händen, die Netzstrümpfe waren schmutz- und blutverkrustet. Und sein Gesicht sah ziemlich zugerichtet aus, so, als hätte er mehrere Faustschläge abbekommen. Ich wandte mich ab und sah wieder auf die Straße, spürte aber, dass ihm mein Blick nicht entgangen war.
»Ist nichts weiter«, sagte er, »nur ein paar Kratzer und Schrammen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ist ein bisschen mehr als das.«
Er stieß ein kurzes, trocknes Lachen aus, so, als hätte ich einen Witz auf seine Kosten gemacht. »Schätze, das stimmt«, sagte er – und da war etwas mit seiner Stimme, nicht dass er lallte, doch die schwere Zunge verriet mir, dass er was eingeworfen hatte.
»Tja«, sagte ich, »geht mich auch nichts an, aber da ist ein Erste-Hilfe-Kasten.« Ich wies mit dem Kopf nach hinten. »Bedienen Sie sich, wenn Sie wollen.«
»Mir geht’s gut«, sagte er, »trotzdem danke.« Er warf mir einen raschen Blick zu, ehe er wieder beiseitesah. »Hab schon Schlimmeres durchgemacht.«
»Ehrlich?«
»So lauten nun mal die Spielregeln«, sagte er. »Ist nicht so übel, wie es aussieht. Bin nur auf der falschen Party gewesen.« Er sah zum Seitenspiegel nach draußen. »War wohl ein Fehler, sich für den Aileen-Wuornos-Look zu entscheiden.«
Ich musste einen Moment nachdenken, ehe ich darauf kam, dass er von dieser amerikanischen Serienmörderin sprach, und er sah mir an, dass ich den Namen kannte, denn er lachte wieder, lauter diesmal und etwas selbstsicherer.
»Keine Sorge, Bill«, sagte er. »Ich habe keine Waffe dabei.«
Darüber musste ich lächeln. »Tja«, sagte ich. »Da bin ich aber froh.«
Er lachte wieder, diesmal ein gut gelauntes, herzliches Lachen, und plötzlich freute es mich, dass ich angehalten hatte. »Und?«, fragte er. »Wohin sind Sie unterwegs, Bill Harley?«
»Nach Hause«, sagte ich und merkte auf einmal, dass ich nicht an Zuhause denken wollte, jetzt jedenfalls nicht. Ich wollte weiter unterwegs sein, an einem Winterabend auf der Straße ohne Ziel, wollte Zeit mit jemandem verbringen, den ich nie wiedersehen würde.
»Ach ja«, sagte er. »Nach Hause.« Einen Moment lang hing er dem Wort nach, ehe er weitersprach. »Ist bald Weihnachten.«
»Ja, dauert nicht mehr lang.« Ich sah zu ihm hinüber; er beobachtete mich, aufmerksam, studierte mich, suchte wohl nach etwas, wovon er glaubte, ich wolle es verborgen halten – und mit einem Mal musste ich an Caroline denken, daran, dass sie mich manchmal, als sie noch jünger gewesen war, so beobachtet und auf einen Hinweis gehofft hatte, der ihr verriet, was hinter der Fassade lag, die ich ihrer Meinung nach so angestrengt aufrechterhielt. Vielleicht war es diese Erinnerung, die mich sagen ließ, was ich als Nächstes sagte und was mich selbst genauso wie den Jungen überraschte. Ich sagte es nicht sehr laut, sagte es eigentlich auch nicht zu ihm, sagte es aber laut genug, um trotz Motorenlärm verstanden zu werden. »Ein letztes Mal Weihnachten«, sagte ich. »Sollte lieber das Beste draus machen, oder?«
Ich hatte nicht vorgehabt, das zu sagen, aber ich bereute es auch nicht. Nur war mir nicht danach, es weiter auszuführen, jetzt, da es gesagt war – und ich glaube, das hatte er verstanden, denn nachdem er mir Zeit genug gelassen hatte, dem Gesagten noch etwas hinzuzufügen, ließ er es ohne ein weiteres Wort auf sich beruhen, und wir fuhren schweigend weiter, starrten von unseren unterschiedlichen Plätzen in die verregnete Dunkelheit, die Gesichter nur gelegentlich erhellt, wenn ein Auto in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Wir kamen langsam voran, aber die Stille machte mir nichts aus; wenn überhaupt, dann fühlte sie sich fast angenehm an, so, als hätte man einen Beifahrer und wäre doch allein. Irgendwann aber nahm der Junge das Gespräch wieder auf, begann jene Art bedächtiger, zielloser Unterhaltung, zu der es zwischen einander wohlgesinnten Menschen kommt, die sich nicht besonders gut kennen: über Fußball – was mich überraschte, obwohl es eigentlich gar nicht so überraschend war – und über einen Dokumentarfilm, den er gesehen hatte. Es hätte sonst wer mit mir im Lkw sitzen können, zumindest zu Beginn, dann aber fing er an, über andere Sachen zu reden, meist über Unwichtiges aus seiner Schulzeit, und auch wenn lustig war, was er erzählte, wusste ich, dass es eigentlich um etwas anderes ging, um eine Geschichte über sich selbst, die er gern losgeworden wäre, nicht weil er es unbedingt musste, sondern weil sie interessant war. Wie etwa die Erinnerung an den Schulatlas, den er für den Erdkundeunterricht bekommen hatte, daran, wie gut es ihm gefiel, dass die Welt vollständig kartografiert war, all die Farben, Linien und Grenzen, so präzise und perfekt, eine Welt, in der man gern leben mochte, eine gänzlich fiktive Welt, in der nichts und niemand verloren gehen konnte, da jedermann und alles an einen bestimmten Platz gehörte. Das gefiel mir, solang es währte, teils weil es sich neu anfühlte, auf diese Weise unterwegs zu sein, mit einem Jungen im Kleid, einem Jungen mit zerlaufenem Make-up, vor allem aber weil ich es so angenehm fand, ihn an meiner Seite zu haben. Als wir schließlich den Abzweig nach Coaltown erreichten, beugte er sich leicht vor. »Wenn Sie mich dann hier rauslassen könnten«, sagte er.
Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte ihn nicht einfach im Dunkeln auf irgendeinem nichtssagenden Straßenabschnitt aus dem Laster lassen. »Ich fahre Sie bis vor die Tür«, sagte ich. »Ist kein Problem.«
»Danke, Bill«, sagte er, »aber nehmen Sie es mir nicht übel, von hier aus würde ich lieber zu Fuß gehen.« Er sah mich an, und selbst aus den Augenwinkeln merkte ich ihm an, dass er hoffte, mir damit nicht wehzutun.
»Ist okay«, sagte ich, bog von der Hauptstrecke ab und fuhr noch einige hundert Meter in Richtung Küste, ehe ich anhielt.
»Danke.«
»Nicht der Rede wert«, sagte ich.
Er griff nach der Tür, als wollte er gehen, dann wandte er sich um und lächelte, ein Lächeln, das weniger mir als etwas galt, woran er gerade gedacht hatte. »Es ist nicht so, wie Sie denken«, sagte er. Ich wand mich innerlich, fast als würde er gegen zuvor vereinbarte Regeln verstoßen und wollte mir ein Geheimnis anvertrauen, das ich besser nicht kannte. »Die meiste Zeit macht es mich froh, wie die Dinge sind«, sagte er. Es war, als würde er sich an jemand anderen richten, wollte versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass das, was er sagte, der Wahrheit entsprach. Jemand anderen oder sich selbst, vielleicht ein bisschen auch alle beide. »Diese Frage in Ihrem Kopf«, sagte er, »die können Sie ebenso gut vergessen.«
Ich nickte, erwiderte aber nichts. Ich wollte wirklich kein Aufheben darum machen, selbst wenn es eine Frage in meinem Kopf gäbe, da es bestimmt nicht jene Frage war, von der er annahm, dass ich sie stellen wollte. Ich musste nichts über sein Leben wissen, nichts über seine sexuelle Orientierung, über das, was er gern machte oder was auch immer. Und schon gar nicht wollte ich wissen, auf welcher falschen Party er gewesen war oder wie er sich die Kratzer und blauen Flecken zugezogen hatte. Etwas in mir war auf ihn neugierig, vor allem auf seine Zufriedenheit, da ich glaubte, er wollte, dass ich fand, er sei zufrieden, und ich fragte mich, warum ihm das wichtig war. Vielleicht überraschte mich auch nur, dass er fähig war, zufrieden zu sein – und vermutlich war das der Grund, warum ich die Frage stellte, die er meiner Meinung nach von mir hören wollte. Obwohl wir uns erst so kurz kannten, mochte ich ihn nämlich, und ich wollte ihn in Sicherheit wissen. Meine Frage war eine Art Ersatz, fürchte ich, für all die anderen Fragen, jenen nach Glück und nach Alleinsein und dem Sicher-nach-Hause-Kommen. Zugleich war sie ganz unwichtig. »Wissen Sie eigentlich, was Sie tun?«
Der Junge lachte. »Nein, nie«, sagte er mit ein wenig zu viel Nachdruck. »Aber, Bill, man muss immer so tun, als ob.« Einen Moment lang sah er mich an. »Tut man das nicht«, sagte er, »ist man verloren.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete, verstand ihn aber dennoch. Was er meinte, war, dass er nicht anders konnte. Er konnte nicht anders, ebenso wenig wie alle anderen. »Tja«, sagte ich. »Passen Sie auf sich auf.« Das klang ein bisschen lahm, aber er wusste natürlich auch diesmal, was ich damit meinte.
Er ließ sich vom Beifahrersitz herab und wandte sich zu mir um. »Sie auch, Bill«, sagte er, und als er erneut meinen Namen sagte, fiel mir plötzlich auf, dass ich seinen nicht kannte. »Schöne Weihnacht.«
»Ihnen auch«, erwiderte ich, legte einen Gang ein, löste die Handbremse und fuhr los, ließ ihn im sanften, dunklen Schneeregen hinter mir zurück. Ich sah nicht in den Spiegel, sah also nicht, was er als Nächstes tat, und erst als ich einige Kilometer weit gefahren war, wurde mir klar, dass er überhaupt nicht über sich selbst geredet, dass er mir nur etwas zurückgegeben hatte; und das nicht rechtzeitig verstanden zu haben tat mir leid, aber es freute mich auch, denn da draußen, auf der Straße, in der Kälte, ist jedes Geschenk besser als nichts.
Nachdem ich ihn abgesetzt hatte, klarte es ein wenig auf, und die nächsten fünfzehn Kilometer legte ich im Handumdrehen zurück. Mir gefiel dieses letzte Stück, eine Weile führte die Straße direkt an der Küste entlang, das Meer weit und leer im Süden, die Felder und die flachen, hier und da mit den Lichtern von Bauernhöfen und fernen Cottages gespickten Hügel. Als ich abbog und die Anhöhe nach Hause nahm, hatte der Schneeregen gänzlich aufgehört; wenige Kilometer später kam mein Dorf in Sicht, kaum mehr als eine Reihe Häuser, die sich eine Landstraße entlanghangelten, eine kurze Ablenkung auf dem Weg nach irgendwo. Das Licht hier fand ich seit jeher trüber und bräunlicher als das märchenhafte Silberlicht, das ich von der High Road sah, und manchmal, wenn ich spät heimkehrte, kam mir der Gedanke, dass ich diesen Ort zu gut kannte. Ich kannte all seine Geschichten. Ich wusste, was die Menschen hinter diesen Fenstern taten. Ich konnte die Tische mit den Resten des Abendessens sehen, die steinernen Spülküchen, die schmutzigen Stiefel auf der Türmatte, die Häufchen frisch geöffneter Briefe auf der Anrichte, die stummen Bewohner in der Küche, in den zerschlissenen Sesseln vor dem Fernseher.
Ich stellte den Laster auf dem Parkplatz gegenüber von meinem Cottage ab, nahm die Seitenpforte und ging durch den Garten zur Hintertür, die nie abgeschlossen wurde. Es war still im Haus, fast dunkel, nur im Esszimmer brannte Licht, ein Raum, den wir kaum nutzten, da wir es vorzogen, in der animalischen Wärme der Küche zu essen. Allerdings überraschte es mich nicht, dass Sall im Esszimmer saß, denn dort bewahrten wir auf, was für sie das wahre Leben ausmachte, das gute Porzellan, die Familienalben, die gerahmten Bilder aus jenen Tagen, die sie vermutlich für ihre besseren Zeiten hielt. Ich öffnete die Hintertür und ging so leise ich konnte durch die Küche – leiser in diesen letzten Monaten als je zuvor, fast als hätte die Aussicht auf den nahen Tod eine Behutsamkeit in mir zutage gefördert, die ich nie vermutet hätte – und ich sah Sall im großen Sessel vor dem Kamin schlafen, auf dem Boden zu ihren Füßen eine Zeitschrift, im Schoß eine leere Tasse. Wie sie da schlief, so ungeschützt, den Kopf weit zur Seite geneigt, sah sie alt und müde aus, aber wenigstens schienen die Sorgen verschwunden zu sein, die ihr sonst ins Gesicht geschrieben waren, und wie ich da stand und sie ansah, kam mir der Gedanke, dass sie träumte. Ich wusste, sie würde ärgerlich werden, wenn sie wach wurde und feststellte, dass ich nach Hause gekommen war, während sie schlief, trotzdem blieb ich noch einen Moment länger stehen, sah ihr beim Träumen zu und fragte mich, wie sie den Tag verbracht, was sie gedacht, was sie getan hatte. Bald aber wurde es mir unangenehm, sie so zu beobachten, und ich ging weiter zur Küche und ließ sie schlafen.
Es war jetzt kälter als zuvor, doch hatte es aufgeklart, und direkt über dem Garten schob sich aus den Wolken ein heller Mond, eisig und weiß in einen Pfuhl indigoblauen Himmels. Ich setzte den Kessel auf, ging nach draußen auf die Terrasse und blickte über die Felder zur Baumgruppe und zur langen Steinmauer, die, wie ich wusste, in der Dunkelheit gleich dahinter aufragte, schwarz und unabweisbar massiv. Es war nahezu völlig still: Von Zeit zu Zeit bellte ein Hund am Ende der Straße, oder eine gelegentliche Bö verfing sich in der Buchenhecke hinter Salls Blumenbeet; und dann, ein, zwei Augenblicke später, begann der Kessel leise zu singen, und noch während ich spürte, wie mir die Stille entglitt, versuchte ich, alles einzufangen, in mich aufzusaugen, ehe Sall aufwachen und ich nicht länger allein sein würde. Dies hier war mein Leben, dies die Zeit, in der ich am ehesten ich selbst war: in diesen halben Stunden hier oder dort, wenn ich mich allein im Haus fühlte oder während jener flüchtigen Augenblicke auf der Straße, wenn ich ein Tor öffnete und über einen leeren Hof fuhr, mir selbst ein Fremder in der Stille des Nachmittags. Die beste Zeit des Tages war die Morgendämmerung, wenn ich aufstand und in die kühle, graue Küche hinunterging, zum dunklen Garten, der wartend vor der Tür lag wie ein neugieriges, vom Feld hereinstreunendes Tier, eine beiläufige Anteilnahme im aufkommenden Licht, das bereit schien, mich einzuschließen, wie es auch alles andere in seine sanfte, fremde Stille einschloss. Das waren die besten Momente, denn ich wusste, Sall würde im Bett bleiben, bis ich ging, ob wach oder nicht – Augenblicke wie heute Abend waren jedoch fast genauso gut. In letzter Zeit passierte es häufiger, dass ich nach Hause kam und wusste, Sall würde schlafen, irgendwo, auf dem Boden die Zeitschrift, in der sie gelesen hatte, auf dem Beistelltisch eine kalte Tasse Tee. Es war, als würde ich in ein anderes Haus heimkehren, an einen Ort voller Geheimnisse, die Kindheit noch da, intakt in den grünen Schatten unter der Treppe. Erste Liebe auch – nein, nicht Sall, auch wenn ich nie jemand anderen gekannt habe, nicht so wie sie. Nein: Wenn mich dreißig Jahre Ehe und Aufziehen eines Kindes etwas gelehrt hatten, dann, dass alles, all die Weihnachten und Geburtstage, all die Missgeschicke und Missverständnisse, dass so gut wie nichts gemeinsam durchlebt worden war. Was geschehen war, war jedem von uns allein geschehen, und anschließend fühlte es sich zumindest für mich seltsam abstrakt an: eine aus Fotoalben und Samstagsmatineen rekonstruierte Ehe, eine Liebe, die nie ganz wahr wurde, eine Reihe anderer Leben, in denen ich eine Zeit lang eine Rolle spielte, die dann aber scheu entflohen wie ein Tier, sobald man eine falsche Bewegung macht und es daran erinnert, wer man wirklich ist.
Der Kessel pfiff, und ich spielte mit dem Gedanken, ihn pfeifen zu lassen, damit Sall aufstand und die Gasflamme abdrehte. So könnte ich vorgeben, ich hätte sie nicht schlafen gesehen, denn das fühlte sich zu nah an, fast als würde ich Regeln brechen, die wir in jahrelangem Bemühen aufgestellt hatten, die Regeln unseres Systems kleiner Aufmerksamkeiten, Vermeidungen und bedächtiger, flüssiger Gespräche, die tagelang andauerten, Aufgeschnapptes und Neues aus dem Dorf, das beim Essen oder bei einer Tasse Tee ausführlich gewendet wurde, um die verwirrende Stille zu vertuschen, die uns befallen hatte. Manchmal war das peinlich, aber es funktionierte und war besser als jede der möglichen Alternativen. Einen Moment lang dachte ich an den Jungen auf der Straße und fragte mich, ob es für ihn je so sein würde, ob er je nach Hause kommen und jemanden antreffen würde, schlafend im Sessel, jemanden, an dem ihm etwas lag, den er aber nicht länger liebte. Ich glaube, es war ein zärtlicher, kein trauriger oder sentimentaler Gedanke, und er hatte auch nichts mit Tod zu tun. Es war einfach nur ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging, während ich darauf wartete, dass der Kessel zu pfeifen aufhörte.
Nur hörte er nicht auf, und nach einer Weile ging ich wieder ins Haus, um den Herd auszuschalten. Und in ebendiesem Moment kam Sall in die Küche, mit verquollenen Augen und einem seltsam entrückten Blick im Gesicht. Sie schien überrascht, mich zu sehen, als hätte sie den Kessel gar nicht gehört, sondern sei gerade erst in einem Haus aufgewacht, in dem sie allein zu sein glaubte – und zum ersten Mal kam mir der Gedanke, wie schwierig es für sie sein würde, dass ich als Erster starb.
»Du bist zurück«, sagte sie, und es klang wie ein Vorwurf. Sie sah zur Uhr, sagte aber nichts weiter.
»War eine lange Tour«, sagte ich. »Bin gerade erst zur Tür rein.«
Sie nickte. »Ich hab nichts gekocht«, sagte sie. »Ich wusste nicht, wann du kommst.«
»Kein Problem«, sagte ich. »Ich bin nicht hungrig.«
Sie warf mir einen raschen, besorgten Blick zu. »Aber du musst doch was essen.«
»Ich esse später vielleicht ein Omelett«, sagte ich. »Ich koche gerade Kaffee. Willst du auch eine Tasse?«
»Lass mich den machen«, erwiderte sie. »Setz dich, du hast einen langen Tag hinter dir.«
Ich nickte, rührte mich aber nicht. Die Tür stand noch offen, gerade weit genug, dass ich die Kälte draußen riechen konnte, und ich hörte den Hund bellen – jetzt offenbar weiter fort, irgendwo am dunkleren Ende der Straße, die an unserem Haus vorbei in die Hügel führte, vorbei an den goldenen Lichtern der Höfe und Molkereien, an den schmalen Schafspfaden durch den Ginster, wo es vielleicht schon schneite, richtig schneite diesmal, kein Schneeregen mehr, Schnee, wie er fiel, als ich durch die Wälder gefahren war und den Jungen traf. Für den Bruchteil einer Sekunde – nicht länger – wollte ich zurück in den Laster, wollte hinaus in die Dunkelheit, mitten hinein in den beginnenden Schneesturm, nur um allein dort draußen zu sein, so wie der Junge allein im Wald gewesen war. Doch noch während Sall mich neugierig ansah, vielleicht auch ein wenig verängstigt, gab ich den Gedanken auf und ging ins Wohnzimmer, in dem die Vorhänge bereits zugezogen waren und die Nacht nichts weiter schien als eine Geschichte, die man sich am warmen Feuer erzählt. Leise dudelte im Hintergrund das Radio, weshalb die Welt sich vertraut anfühlte und mir mehr oder minder so glücklich schien wie die Zukunft, die möglich war, wenn man nicht ans Sterben dachte oder an jene pastellfarbenen Karten im Kinderatlas, denen man unwillkürlich vertraute, obwohl man wusste, dass sie nicht länger bedeuteten, was sie besagten.
So etwas wie Glück
Das erste Mal traf ich Arthur McKechnie, als er mit einigen Schecks an meinen Schalter trat. Ich hatte gerade erst in der Bank angefangen, kam frisch aus der Schule und war wohl auch ein bisschen nervös, aber mir gefiel, wie er sich benahm, höflich und wortgewandt, was mehr war, als ich von einigen anderen Kunden behaupten konnte. Am Ende unserer ersten, fast wortlosen Transaktion hatte ich für mich bereits entschieden, dass er ein bisschen zu