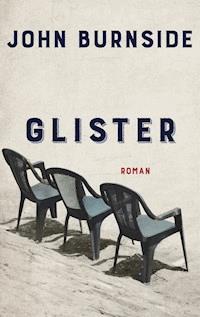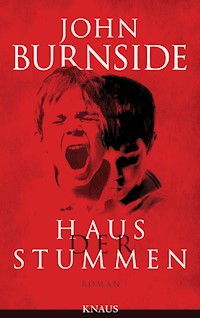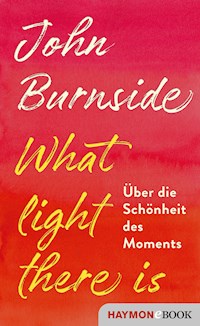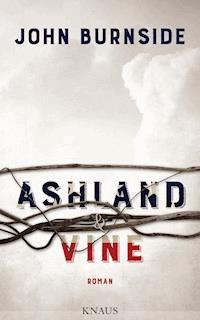10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das autobiografische Projekt
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von alttestamentarischer Wucht – John Burnsides großer Text über seinen Hass auf den Vater
Am Ende wünscht John Burnside seinem Vater nur noch den Tod. Er hat für den Mann, der über Jahre die Familie terrorisiert, der lügt und säuft, einzig Hass übrig. Doch er verbirgt seine Gefühle und schweigt. Bis die Begegnung mit einem Fremden ihn zwingt, sich seinen Erinnerungen zu stellen und diese Geschichte von alttestamentarischer Wucht zu erzählen.
Der Vater war ein Nichts. Als Säugling auf einer Türschwelle abgelegt. Zeitlebens erfindet er sich in unzähligen Lügen eine Herkunft, will Anerkennung und Bedeutung. Er ist brutal, ein Großmaul, ein schwerer Trinker, ein Tyrann. Seine Verachtung zerstört alles, die Mutter, die Familie, John. Dieser hat als junger Mann massivste Suchtprobleme, landet in der Psychiatrie und erkennt in den eigenen Exzessen den Vater. Erst die Entdeckung der Welt der Literatur eröffnet ihm eine Perspektive. Nur einem Autor vom Kaliber John Burnsides kann es gelingen, eine solche, auch noch autobiographische Geschichte in Literatur zu überführen. So ist dieses Buch ein radikal wahrer Blick in die menschlichen Abgründe und zugleich eine Feier der Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
John Burnside
Lügen über meinen Vater
Aus dem Englischen vonBernhard Robben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »A Lie About my Father« bei Jonathan Cape, London.
Der nachfolgende Text stammt aus: »Der Alb der Perversheit«, übersetzt von Hans Wollschläger, aus: Edgar Allan Poe Werke, hrsg. v. Kuno Schuhmann u. Hans Dietrich Müller. Aus dem Englischen von Arno Schmidt und Hans Wollschläger. IV Bde., Insel Verlag 2008. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld
Copyright © 2006 by John Burnside
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 beim Albrecht Knaus Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umsetzung Ebook: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Dieses Buch liest man am besten als ein Werk der Fiktion. Wäremein Vater hier, um mit mir darüber zu reden, gäbe er mirbestimmt recht, wenn ich sagte, es sei ebenso wahr zu behaupten,dass ich nie einen Vater, wie dass er nie einen Sohn hatte.
Wir stehen am Rande eines Abgrundes. Wir spähen hinab in den Schlund – es wird uns schlimm und schwindlig. Unser erster Antrieb ist zurückzuweichen vor der Gefahr. Doch unerklärlicherweise bleiben wir. Ganz langsam gehen Übelkeit und Schwindel und Schauder in einem Gewolk von unbenennbarem Fühlen auf. Stufenweis’, doch gar unmerklicher noch, nimmt dies Gewolk Gestalt an, wie’s der Dunstrauch bei der Flasche tat, aus welcher sich der Geist in den »Arabischen Nächten« erhob. Doch aus dieser unserer Wolke an des Abgrunds Rand erwächst, zum Greifen deutlich bald, eine Gestalt, weit schrecklicher denn jeder Dämon oder gute Geist in einem Märchen, und dennoch ist’s nur ein Gedanke, wennschon ein fürchterlicher, dessen Horror in uns so wildes Entzücken weckt, dass wir ins Mark unserer Knochen hinein erschauern. Es ist bloß die Vorstellung, was wir beim rasend jähen Sturz aus solcher Höhe wohl empfinden würden. Und dieser Sturz ins Nichts, in das Vernichtetsein – aus ebendem Grunde, dass er das eine allergrässlichste und -widerwärtigste von all den grässlichen und widerwärtigen Bildern des Todes und des Leidens in sich beschließt, die je vor unserer Einbildung aufgestiegen sind – aus ebendieser einen Ursache verlangt es uns nun umso heftiger danach. Und weil uns unsere Vernunft mit aller Macht von der Kante zurückreißen will, darum grad zieht es uns nur umso ungestümer zu ihr hin. Es gibt in der ganzen Natur keine Leidenschaft von so dämonischer Gewalt, wie sie ein Mensch empfindet, der schaudernd am Rande eines Abgrunds steht und solcherart dann einen Sprung erwägt. Auf einen Augenblick nur der Versuchung des Gedankens daran nachzugeben, heißt unentrinnbar verloren sein; denn ruhige Überlegung drängt uns, davon abzusehen, und eben darum, sag’ ich, können wir es nicht. Wenn dann kein Freundesarm zur Stelle ist, uns zurückzuhalten, oder wenn es uns nicht gelingt, uns in jäher Anstrengung aller Kräfte rückwärts vom Schlunde weg niederzuwerfen, so springen wir – und springen ins tiefe Verderben.
So sehr wir diese und ähnliche Verhaltensweisen auch untersuchen mögen, stets werden wir finden, dass sie einzig aus dem Geiste der Perversheit resultieren. Wir handeln nur darum so, weil unser Gefühl uns sagt, wir sollen’s nicht. Dahinter steht keinerlei intelligibles Prinzip; und tatsächlich läge der Gedanke nicht fern, es sei diese Perversheit ein direktes Werk des Erzfeinds, wüssten wir nicht von ihr, dass sie gelegentlich durchaus dem Guten zur Förderung wirke.
Edgar Allan Poe: Der Alb der Perversheit übers. v. Hans Wollschläger
Wo aber, wo in so später Zeit und aus welcher tiefen und doch so hohen Verborgenheit ward im Augenblick mein freier Wille hervorgerufen, dass ich meinen Nacken unter dein sanftes Joch beugte und meine Schultern unter deine leichte Bürde …
St. Augustinus: Bekenntnisse, 9. Buch, 1. Kapitel
Birdland
… fell on his knees and looked up and cried out,»No, daddy, don’t leave me here alone,Take me up, daddy, to the belly of your ship,Let the ship slide open and I’ ll go inside of itWhere you are not human …«
Patti Smith
Jedes Jahr kommt es wie eine Überraschung. Die Blätter flammen auf, werden purpurrot und buttergelb, und dann, am frühen Morgen, schlägt das Wetter um, das satte Grün des Spätsommers weicht sanftem Grafit und gelegentlich wundersamem Wachtelgrau. Alles leuchtet noch einmal auf, ehe es fortbrennt; so wie den Sterbenden plötzlich neue Hoffnung packt, nur Stunden bevor sein Leichnam in einem kühlen Nebenzimmer ausgelegt, gewaschen und zum letzten Mal angekleidet wird. Mir wurde in meiner Kindheit nicht beigebracht, dass die Toten an Halloween wiederkehren, doch wurde die Möglichkeit auch nie ganz ausgeschlossen; nein, nicht die Toten kehren wieder, sondern deren Seelen: Ob als einzelner Atemhauch schwindenden Bewusstseins oder als konzentrierte, kompakte Masse, darauf kam es nicht an. Ich wusste nur, da draußen geisterte die Seele in einer ihrer vielen Gestalten umher, als Gespenst oder Wiedergänger, als Lufthauch, Licht- oder Feuergespinst, vielleicht auch nur als unerklärliche Erinnerung, ein im Hinterstübchen meines Gedächtnisses archivierter Schnappschuss, ein Bild, von dem ich bis zu diesem Augenblick nichts geahnt hatte.
So kommt es, dass ich Halloween mein Leben lang mit dem üblichen Anschein von Skepsis und einem Gefühl beinahe absoluter Gewissheit begangen habe. Wann immer möglich, bin ich in all den Jahren an diesem Tag zu Hause geblieben. Ich mache diesen Tag zu etwas Besonderem, zu meinem privaten Fest der Buße und des Gedenkens, und dies zu mehr oder weniger gleichen Teilen. Ich denke an die eigenen Toten da draußen unter den Millionen wiederkehrenden Seelen, denen es in dieser einen Nacht gestattet ist, Orte aufzusuchen, die sie einst kannten, Häuser, in denen sie gewohnt haben, Straßen, auf denen sie zur Arbeit oder zu einem heimlichen Stelldichein gegangen sind. Und ich rufe mir in Erinnerung, warum in meinem Teil der Welt die Lebenden an diesem Tag Feuer aufschichten, die, sobald die Nacht anbricht, überall im dunkelnden Land zur selben Zeit angezündet werden. Anders, als es der schlichte Aberglaube will, geschieht dies nicht, um böse Geister zu vertreiben. Nein, Zweck dieser Feuer ist es vielmehr, den Weg zu erhellen und den Geistern ein wenig Wärme zu bieten, sind sie uns doch so ähnlich, dass wir untereinander austauschbar scheinen – die Lebenden und die Toten, Gast und Gastgeber, Hauseigner und Geist, mein Vater und ich. Eines Tages sind wir womöglich alle Geister, und die Geister, die wir heute bewirten, werden wieder leben und atmen. Vielleicht hat in der Vergangenheit jeder von uns einmal gewusst, wie es ist, nach Hause zu kommen und das eigene Heim seltsam fremd vorzufinden, den Garten verändert, die Küche voller Unbekannter.
Damit Halloween seinen rechten Lauf nimmt, muss zusammengearbeitet werden. Die Toten wie die Lebenden haben ihre Rolle zu spielen. Der Grund, warum ich an Halloween möglichst zu Hause bleibe – wo auch immer zu Hause für mich gerade sein mag –, ist nicht nur der, dass ich mir meiner Rolle in diesem Ritual bewusst bin, sie zu übernehmen gar für meine Pflicht halte, sondern auch weil ich weiß, wie verletzlich ich in diesen Zeiten bin. An Halloween nämlich kommt es nicht nur zu Heimsuchungen, sondern auch zu subtilen Veränderungen und Verwerfungen, zu kaum wahrnehmbaren Transformationen, die, wenn sie sichtbar werden, den Lebensweg bereits auf immer verändert haben. Wenn an Halloween die Geister umgehen, fühle ich mich offener und wachsamer, zugleich aber auch bedroht. Am besten sitze ich an solchen Tagen daheim, bis der Morgen anbricht und ich meine zufriedengestellten Geister wieder fortschicken kann.
Es hat jedoch Zeiten gegeben, da musste ich an Halloween fort sein, auf der Straße, unterwegs nach irgendwo, allein, ungeschützt, um vergessen zu können, was ich zu sein glaubte. So fuhr ich etwa vor zehn Jahren, als sich der Tag der Toten näherte, durch die Region der Finger Lakes im Staat New York, allein in einem Mietwagen. Ende Oktober war ich in Rochester angekommen und suchte nun nach einer Kleinstadt unweit vom Lake Keuka. Ich hatte mich bald verirrt, vielleicht absichtlich, war ich doch in einer Gegend, in der man sich leicht verirren konnte, diese vielen kleinen Straßen, die an so schöne und stille Orte führten, wie ich sie bis dahin noch nie gesehen hatte. Ich hatte an jenem Morgen also gründlich die Orientierung verloren, als ich hielt, um den Clown mitzunehmen. Nur ahnte ich nicht, dass er ein Clown war, dabei hätte sein Aussehen es mir verraten können, auch die Art, wie er an der Straße stand, mit großem Gleichmut, obwohl kaum Verkehr herrschte und er nicht wusste, ob ich ihn mitnehmen würde. Er schien kein Ortsansässiger zu sein, wirkte aber wie jemand, der sich auskannte.
Wir schrieben Mitte der Neunziger, und ein schwieriges Jahr lag hinter mir. Ich war gestresst, müde und dankbar, allein auf der Straße unterwegs zu sein. Ich war meine Arbeit leid, meine Geschichte, vor allem aber war ich es leid, eine Person zu sein (wenn uns der heilige Paulus sagt, dass Gott »die Person nicht ansieht«, sagt er mehr, als wir gewöhnlich verstehen). Ich war es leid zu schauspielern, hatte es satt, sichtbar zu sein. Als ich aber durch diesen ruhigen Winkel der Welt fuhr, durch kleine Städte, vorbei an Veranden, auf denen Kinder große, grinsende oder spöttisch-schaurige Kürbislaternen ausgestellt hatten, hätte ich ebenso gut unsichtbar sein können, ein Mensch von Nirgendwo, zu dem jeder wird, der auf der Durchfahrt ist. Ich war schon eine Weile unterwegs und genoss es, einfach nur umherzukutschieren, gelegentlich anzuhalten, um eine Tasse Kaffee zu trinken und mich dann wieder auf den Weg zu machen, fast wie ein leichter Windstoß, der von den Ortsansässigen, die ihre eigenen Dramen und Possen durchlebten, kaum wahrgenommen wurde – wenn überhaupt.
So freute ich mich, allein zu sein, die Ruhe desjenigen zu genießen, der ich bin, wenn niemand sonst bei mir ist, und ich spürte kein Verlangen, irgendwas an dieser Situation zu ändern, bis ich zum Mittagessen in einer Kleinstadt hielt. Ich weiß nicht mehr, wo es war oder warum es mir gerade dort gefiel, ich erinnere mich nur noch an das schmale, spärlich möblierte Restaurant und daran, dass es leer war. Leer bis auf die Frau, die mir die Speisekarte brachte, eine Malerin, die als Kellnerin jobbte (ich habe noch nie eine Kellnerin getroffen, die als Malerin jobbt, oder einen Hamlet-Darsteller, der bloß darauf wartet, dass die nächste Tellerwäscherstelle frei wird, aber ich glaubte ihr, damals und auch heute noch). Sie war eine sehr schöne Frau, was ich zu jener Zeit merkwürdig fand, da ich, bis ich ihr begegnete, amerikanische Frauen nie schön gefunden hatte. Für mich sahen sie immer zu neu aus, so als kämen sie gerade vom Fließband. Allerdings hatte ich mich bis dahin hauptsächlich in Kalifornien aufgehalten, wo alles zu neu aussieht.
Wie es an stillen Tagen so geht, unterhielt ich mich ein wenig mit dieser schönen Frau – ich will sie Frances nennen –, zahlte schließlich und ging. Es war eine dieser kurzen Begegnungen, zu denen es auf der Durchreise kommt, eine Begegnung ohne weitere Bedeutung für beide Beteiligten, nichts weiter als ein angenehmes, höfliches Gespräch. Frances hatte in mir nur ein freundliches Gesicht gesehen – einen Fremden, jemanden, mit dem sie sich an einem nicht gerade hektischen Tag entspannt unterhalten konnte –, und ich hatte nur eine leichte, ruhige Mahlzeit erwartet, eine Abwechslung von der Langeweile des Fahrens; nach einigen Kilometern aber merkte ich, dass Frances mich aus meiner Einsamkeit aufgeschreckt hatte und ich anfing, über sie nachzudenken, zu sinnieren und zu grübeln, so, wie es wohl nur möglich ist, wenn nichts als eine Landstraße vor einem liegt und kein Zuhause wartet, keine Verpflichtungen, keine drängenden Existenzfragen. Ich reagierte ungehalten, war verärgert, gleichzeitig fasziniert und kam mir blöd vor, fand meine eigene Blödheit aber auch ein bisschen rührend. Mit etwas Countrymusik, sagte ich mir, und mit dem keineswegs schwierigen, letztlich sogar amüsanten Problem, den Weg zum Haus meines Freundes finden zu müssen, sollte diese Stimmung spätestens in einer Stunde verflogen sein, doch hatte ich mich schon eine ziemliche Weile nicht bloß geografisch verirrt, als ich einen Tramper sah und anhielt, um ihn mitzunehmen.
Ich werde ihn Mike nennen. Er sei aus New York gekommen, erzählte er, um seinen Vater zu besuchen. Wir fingen an, über die Stadt zu reden, über die Seen und schließlich darüber, warum Mikes Vater für den Sohn das seltene, lebende Beispiel eines jener Männer war, die zumindest für mich ins Reich der Fabeln gehörten: kompetent, gelassen, großzügig, in sich ruhend, ein Mann, der in einer nahe gelegenen Kleinstadt ein Geschäft für Baubedarfbetrieben hatte,jetzt aber im Ruhestand lebte und seit dem Tod seiner zweiten Frau allein in einem schlichten Haus draußen im Wald unter den rotgoldenen Bäumen wohnte, aus praktischen Gründen nicht weit vom nächsten Nachbarn entfernt, doch weit genug, um wahre Abgeschiedenheit zu finden.
Ich weiß nicht, warum mir das wichtig war, aber damals entschied ich spontan, dass Mikes Vater – der in dieser Geschichte Martin heißt – zu jenen Leuten gehörte, die am frühen Morgen gern allein aufwachen und auf die Veranda treten, um zum Wald oder zu dem schmalen Sandweg hinüberzublicken und zu sehen, was es zu sehen gab. Ein Mann – ich konnte ihn mir bei Mikes Worten so leicht vorstellen –, für den es jedes Mal etwas Besonderes war, wenn er Rotwild oder Waldvögel zu Gesicht bekam, selbst wenn ihr Anblick noch so alltäglich sein mochte. Für ihn blieb es etwas Besonderes, denn immer wenn ein Mensch auf ein Reh oder einen Vogel trifft, lernt er etwas Neues oder erinnert sich an etwas Altes, längst Vergessenes. Das gehört zu den vier, fünf Dingen, die Martin in seinem Leben gelernt hatte, und er wiederum gehörte zu den Menschen, die begriffen haben, dass es mehr als genug ist, vier, fünf Dinge zu wissen. Ich sah ihn vor mir, wie er sich draußen, in der Hand eine Tasse heißen Kaffee, eine gute halbe Stunde gönnte, um den Tagesanbruch zu beobachten, ehe er wieder ins Haus ging und Frühstück machte. Den Rest des Tages würde er geduldig seiner Arbeit nachgehen, dem rechtschaffenen Werk des täglichen Einerleis, der ausgefallenen Verrichtung, die nur auf den passenden Moment, die richtige Jahreszeit gewartet hatte, oder der plötzlich notwendigen, drängenden Reparatur.
Ich will damit nicht behaupten, dass mir Mike dies alles – oder auch nur irgendetwas davon – über seinen Vater erzählt hätte, doch durch das, was er sagte, wusste ich, dass Martin genau so ein Mann war. Ich wusste, wie er als verheirateter Mann gewesen war und wie als Witwer: stets selbstgenügsam, erst recht in Bezug auf Frau und Kinder, weshalb es auch nur eine Frage der Zeit war, bis dieser Mann, dieser Vater, mit jenem Idealvater verschmolz, den ich als Heranwachsender zu finden gehofft hatte, ein Mann wie, sagen wir, Walter Pidgeon in seinen besten Filmen: jemand, der eigentlich nicht in derselben Welt wie alle anderen Menschen lebte, der allein hinter seiner Zeitung saß oder mit der Pfeife im Mund seinen Gedanken nachhing. Mein Kindheitstraum von einem Vater war ein Mann dieses so konservativ wirkenden Typs, der willentlich nicht nur das ihm auferlegte Schweigen, sondern auch die ihm so leichtfallende Unsichtbarkeit akzeptierte, der in sich selbst verschwand, in seiner sich stets bestätigenden Welt, die im Lauf der Zeit immer gehaltvoller und ruhiger wurde wie ein Teich im Wald, der jahrelang ungestört daliegt und sich mit Blättern und Sporen füllt, ein dunkles Kontinuum mit Fröschen, durchsetzt von der steten Chemie des Werdens und Vergehens. Am Ende, so malte ich mir aus, wäre dann alles verinnerlicht. Andere würden ihn reserviert finden, ihn vielleicht sogar für distanziert halten, würden das leichte Lächeln nicht sehen, das auf seinem Gesicht spielte, und falls doch, käme es ihnen abwesend oder irgendwie beschwichtigend vor, vielleicht sogar ein wenig verlegen, das Lächeln eines Mannes, der nichts für sich vorzubringen wusste, der nichts zu sagen, nichts zu zeigen, nichts zu beweisen hatte. Dabei könnte es ebenso gut das Lächeln eines Menschen sein, der die gewöhnlichen Ambitionen durchschaute, der ironische, spöttische Gesichtsausdruck von jemandem, der schon früh erkannt hatte, dass es keinen schlimmeren Pyrrhussieg als Erfolg in weltlichen Dingen gibt.
Mike war von anderem Schlag. Er war groß gewachsen, vielleicht zu groß, ein schlaksiger, jungenhafter Mann, der zehn Jahre älter aussah, als er meiner Einschätzung nach war. Er hatte sandfarbenes, bereits leicht schütteres Haar und so seltsam dunkle Augen, als wären sie gefärbt oder getönt. Mit neunzehn Jahren, erzählte er, sei er nach New York gegangen, um Schauspiel zu studieren, hätte aber immer Clown werden wollen. Jetzt gehe er auf ein Clown-College – bis dahin hatte ich keine Ahnung gehabt, dass man so etwas studieren konnte –, und obwohl sein Vater sein Leben lang ein praktisch veranlagter Mann gewesen sei, habe er seinen Sohn bedingungslos unterstützt, auch wenn ihm manchmal nicht klar gewesen sei, was Mike eigentlich erreichen wollte. »Was ich vorhatte, wurde von meinem Vater immer respektiert«, sagte Mike. »Er ist stets für mich da gewesen.« So redete er, wie ein Schauspieler im Fernsehen, aber ich verstand die Kurzform, die er benutzte. »Das muss ich ihm lassen.« Er nickte billigend mit dem Kopf. Ich glaube, Mike war ein guter Clown, denn alles, was er tat, wirkte übertrieben, jeder Satz, den er von sich gab, stammte aus der großen Schatzkiste überlieferter Weisheiten. »Ich kann aber auch ganz andere Sachen«, fuhr er fort, »dafür habe ich gesorgt, schon seinetwegen. « Er schaute hinaus in den Wald. »Ich bin ein ziemlich guter Tischler«, sagte er dann mit einem Anflug von Stolz in der Stimme.
Ich nickte und fragte mich, ob diese Zeilen in einem Skript vorkamen, das er auswendig lernen musste, und ob er sich selbst darin wiedererkannte. Das ist nicht als Kritik gemeint. Ich mochte Mike. Während er erzählte, lenkte ich den Wagen und versuchte, eine Stelle in seiner Geschichte abzupassen, an der ich ihn unterbrechen und herausfinden konnte, wohin wir eigentlich fuhren. Doch ehe es dazu kam, warf er mir einen dieser interessierten Blicke zu, die bei Amerikanern so unwiderstehlich wirken. »Und dein Vater, John? Erzähl mir von ihm«, sagte er.
»Er ist tot«, erwiderte ich.
Das schien ihn zu überraschen, aber vielleicht schreckte er auch nur vor meiner so unamerikanischen Direktheit zurück. »Tut mir leid, das zu hören«, sagte er nach einer Weile. »Wie lang ist er schon tot? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich danach frage.«
Diesmal war ich derjenige, der eine Weile brauchte. »Zehn Jahre jetzt«, sagte ich. »Zehn Jahre – mehr oder weniger.« Ich hatte nachdenken müssen, fand aber nichts dabei, ein bisschen vage zu klingen, da ich hoffte, ihn so auf ein anderes Thema zu bringen.
»Und deine Mutter?« »Sie ist schon vor langer Zeit gestorben«, sagte ich. »Mit siebenundvierzig Jahren.«
»Das ist jung«, meinte er. Mir wurde klar, dass sich dieses Thema nicht so bald erledigt haben würde, und allmählich fand ich, dass Mike sich zu sehr für Familiengeschichte interessierte. Vielleicht aber regte sich in mir auch nur der Verdacht, dass ich mich selbst nicht genug dafür interessierte. Jedenfalls herrschte einen Augenblick lang Stille, und dann stellte Mike die Frage, die ich hatte kommen sehen. »Und? Wie war er so? Dein Dad?«
Jetzt war ich es, der eine lange Pause brauchte. Als ich an diesen Augenblick zurückdachte, nachdem ich Mike abgesetzt hatte und weitergefahren war, fiel mir ein, was ich ihm alles hätte antworten können. Ich hätte sagen können, ich sei zu der Auffassung gelangt, dass jemand, der Vater geworden ist, zu einem anderen Mann als jenem wird – oder werden sollte –, der er bis dahin war. Alles Leben ist eine mehr oder weniger verschwiegene Erzählung, doch wird ein Mann Vater, wird seine Geschichte nicht länger nur für die unablässige Wahrnehmung eines anderen oder einiger anderer gelebt, sondern auch in dieser Wahrnehmung. Vaterschaft ist eine Geschichte, selbst wenn man dies noch so sehr zu vermeiden sucht; eine Geschichte, die nicht nur anderen erzählt, sondern auch von anderen erzählt wird. Zu gewissen Anlässen meines Erwachsenendaseins, bei einem Essen etwa, habe ich mich dabei ertappt, dass ich über Väter und Söhne redete: zu später Stunde, der Kaffee war getrunken, die Kerzen waren zu qualmenden Stumpen herabgebrannt, und am Tisch saßen Männer, die sich an Väter erinnerten, an Väter, die sie auf die eine oder andere Weise verloren hatten. Väter, die gestorben oder auf Abwege geraten waren, schwache Väter, falsche Väter, wohlmeinende, böswillige und solche, die von Anfang an nie da gewesen waren, zumindest in keiner wahrnehmbaren Form. Was meinen eigenen Vater betraf, hätte ich Mike die Wahrheit sagen können. Ich hätte ihm von seiner Gewalttätigkeit erzählen können, von seiner Trinkerei und dem beschämenden, rührseligen Theater gelegentlicher Reuebekenntnisse. Ich hätte ihm vom Glücksspiel erzählen können, von seinen Anfällen manischer Zerstörungswut, hätte ihm stundenlang von seiner Grausamkeit erzählen können, seiner Pingeligkeit, seiner Art, wie ein Besessener alles an mir schlechtzumachen, als ich zu klein und verängstigt war, um mich gegen ihn wehren zu können. Ich hätte ihm sagen können, dass ich meinen Vater mit einer gewissen Dankbarkeit beerdigt hatte und mit jenem Gefühl, das er vor langer Zeit vielleicht mit »Abschluss« umschrieben hätte: beerdigt nicht nur im kalten, klammen Lehm der Stadt mit den stillgelegten Stahlwerken, in der er gestorben war, sondern auch im eisigen Untergrund meines Vergessens. Vor zehn Jahren hatte ich ihn unter die Erde gebracht und war gegangen, Asche zu Asche, Staub zu Staub, das Gedenken trübäugigen Fremden überlassend, die es versäumt hatten, rechtzeitig fortzuziehen oder zu sterben, ehe er seinen letzten Herzinfarkt erlitt – im Silver Band Club zwischen Tresen und Zigarettenautomaten. Ich hätte sagen können, dass ich meinen Vater vor langer Zeit begraben hatte, danach im ersten Nieseln eines nahenden, nachmittäglichen Regenschauers zum Leichenwagen gegangen war und geglaubt hatte, es sei vorbei und ich könne weiterziehen. Ich hätte noch hinzusetzen können, dass ich meinen Vater schon Jahre vor seinem Tod nicht mehr gesehen habe, aber auch, dass ich, solange er lebte, nie wirklich zur Ruhe gekommen war. Für mich war er immer da, drüben, in dem alten Haus, in dem er vor sich hin siechte, mehr tot als lebendig, abgefüllt mit Whisky und Herztabletten, während ein dumpfer Schimmer von Wut und Bedauern die letzten, ramponierten, brandlochgrindigen Möbelstücke verblassen ließ, das Glosen des absurd großen Leihfernsehers in der Ecke, die Küchenschränke, leer bis auf einige Dosen Hundefutter, Reste seiner kurzen Zeit mit einem Dobermann, sowie einigen knittrigen, zollfreien Zigarettenschachteln, die ihm seine Kumpel von ihrem Urlaub in Torremolinos und Calais mitgebracht hatten. Ich hätte Mike erklären können, dass ich meinen Vater jahrelang nicht gesehen hatte, weil ich vor ihm ausgerissen war, in Hemdsärmeln und ohne Geld, ohne zu wissen, wohin, zwei Tage nach der Beerdigung meiner Mutter. Ich hätte sagen können, dass ich mich seit jenem Tag im Jahr 1977 nicht mehr an einen Tisch mit ihm gesetzt hatte, von einigen Familientreffen einmal abgesehen, und dass er mir trotzdem überallhin gefolgt war, ein glühender Funke Selbsthass im Innersten meiner Seele, sengend heiß und unauslöschlich. Ich hätte ihm sagen können, dass ich, zum Teil wegen meines Vaters, zum Quartalssäufer geworden war und immer noch einer bin, einer von denen, die einem manchmal begegnen und die sich vorgenommen haben, so selbstzerstörerisch wie nur möglich zu sein. Ich hätte erzählen können, dass ich mich ganz passabel hielt, dass ich ein verantwortlicher, schwer arbeitender, von einer fast übertriebenen, tollpatschigen Zuneigung für die Meinen erfüllter Mensch war, zumindest zu neunzig Prozent meiner Zeit, und dass ich unter gewöhnlichen Umständen fast jede Beleidigung oder Unverschämtheit hinzunehmen wusste. Ich hätte sagen können, dass ich mir wie die meisten Leute große Mühe gab, jenen Anschein zu wahren, der für ein normales Leben notwendig ist, mich aber auch nach einem spontanen, ehrlichen Ausdruck von Lebendigkeit sehnte und es dennoch nie kommen sah, wenn ich nach Wochen, Monaten oder gar Jahren gequälter, beschämender Verstellung plötzlich die Kontrolle verlor – ein fernes, doch nachhallendes Knacken irgendwo tief in mir drin – und mich mitten in einem Saufgelage wiederfand, das Tage andauern mochte, nur um elendig in irgendeinem anonymen Raum zu enden und mich erschöpft und beschämt zurückzulassen. Ich hätte ihm sagen können, dass ich auf keinen Fall andeuten wolle, eine ungewöhnlich schwierige Kindheit gehabt zu haben, und dass ich, selbst wenn ich sie gehabt haben sollte, nicht die geringste Absicht hege, sie als Erklärung oder als Entschuldigung für irgendetwas anzuführen. Ich wollte das alles einfach nur hinter mir lassen, wollte allein die Verantwortung dafür tragen, wie ich mich heutigen Herausforderungen stellte.
Ich hätte ihm sagen können, dass ich wusste, zu behaupten, mein Vater habe mich verletzt und ich hätte Jahre gebraucht, mich davon zu erholen, ist zu einfach. Ich wusste – natürlich wusste ich es –, dass unsere Erzählungen nie so kompliziert sind wie das Leben. Ich hätte sogar sagen können – hätte ich es gewusst – , dass ich berücksichtigte, wie sehr mein Vater selbst auf eine Weise verletzt worden war, die ich mir nicht einmal annähernd vorzustellen vermochte, etwa als er an einem Morgen im Mai auf der Türschwelle einer fremden Familie abgelegt worden war, und dass er zweifellos sein Leben lang zurückgeblickt und sich die ganze Zeit gewünscht hatte, diesen ersten Schmerz vergeben, hinnehmen oder auslöschen zu können; wenn schon nicht
Findlinge
Wir sind, was wir uns vorstellen.
N. Scott Momoday
1
Mein Vater hat sein Leben lang Lügen erzählt, und da ich es nicht besser wusste, habe ich sie weitererzählt. Lügen waren der Stoff, aus dem meine Welt bestand, Lügen über alles, über große und kleine Dinge. Das Netz seiner Ammenmärchen war so fein gesponnen, so prall gefüllt mit losen Enden und falschen Fährten, dass ich erst wenige Monate vor meiner Begegnung mit Mike hinter die letzte seiner Unwahrheiten gekommen war, hinter die Lüge, die ihn wohl am tiefsten beschämte, auch wenn es sich dabei um ein Märchen handelte, dem er sich unter den damaligen Umständen nur schwerlich entziehen konnte. Es waren Märchen, Fantastereien, mit denen es ihm gelang, andere und damit sich selbst davon zu überzeugen, dass er als Kind gewollt gewesen war, wenn schon nicht von seinen eigenen Eltern, dann doch zumindest von irgendwem. Man kann verstehen, warum er kein Niemand, kein uneheliches Kind sein mochte, doch war es für ihn vermutlich ebenso wichtig, von irgendwoher abzustammen. Zu jener Zeit war es noch von Bedeutung, woher ein Mensch kam, und einfach zu sagen, dass es unwichtig sei, wo ein Mensch geboren worden war oder welche Vorfahren er hatte, wäre einem Luxus gleichgekommen, den ich mir inzwischen erlauben kann, den sich mein Vater aber nicht leisten konnte. Würde, Ehrbarkeit, Verschlagenheit, Fantasie, Integrität, die Fähigkeit, etwas schätzen, oder die Leichtigkeit, sich ausdrücken zu können – zur Zeit meines Vaters glaubten die meisten Menschen, dass so etwas vererbt wurde. Mich erstaunt der Gedanke heute, aber ich glaube, mein Vater hat sich bis zum Tag seines Todes minderwertig gefühlt, und das nicht nur wegen seiner unehelichen Herkunft (damit hätte er leben können), sondern weil er ein Niemand von nirgendwo war, ein verlorenes Kind, das kein Mensch gewollt hatte.
Es hat auch niemand je herausgefunden, woher mein Vater stammte. Er war wirklich ein Niemand, ein Findling, ein Wechselbalg. Seine Lügen sollten diese Tatsache vertuschen, und sie waren so erfolgreich, dass ich erst nach seinem Tod erfuhr, dass er an einem späten Frühlingstag im Jahr 1926 von einer Unbekannten oder auch von mehreren Unbekannten auf der Türschwelle eines Hauses in West Fife abgelegt worden war. Er hatte sich erstaunliche Mühen gemacht, das Geheimnis zu wahren, und letzten Endes habe ich die Wahrheit nur durch Zufall erfahren, als ich, sieben Jahre, nachdem wir ihn beerdigt hatten, meine Tante Margaret besuchte. Die Neuigkeit traf mich wie ein Schock, doch sobald ich sie hörte, kam sie mir völlig plausibel vor. Eine Zeit lang schaffte ich es sogar, mir einzureden, dass sie alles erklärte.
Es war das erste Mal, dass ich jemanden aus meiner Verwandtschaft besuchte, seit ich Mitte der neunziger Jahre nach Schottland zurückgezogen war. Margaret war meine Lieblingstante, wahrscheinlich weil sie meiner Mutter an Jahren und Temperament sehr nahestand. Ich sah mehr oder weniger unangemeldet bei ihr vorbei, und sie bat mich herein, ein wenig überrascht, aber so gastfreundlich, wie ich sie in Erinnerung hatte. Eine Stunde später fragte ich sie, ob sie Näheres über jene Familie wüsste, die meinen Vater adoptiert hatte und angeblich aus High Valleyfield stammte, also nicht weit von dort, wo sie wohnte. Den Geschichten meines Vaters zufolge war er von einem leiblichen Onkel adoptiert worden, einem Bergarbeiter und Laienprediger, nachdem sein wahrer Vater, ein kleiner Unternehmer und ziemlicher Lebemann, eine junge Frau – eine ehemalige Angestellte in einem seiner zwielichtigen Betriebe – geschwängert und sitzengelassen hatte. Einer anderen Version zufolge war er der Sohn eines mäßig erfolgreichen Fabrikbesitzers, der eine seiner Arbeiterinnen mit etwas Geld zum Fortziehen überreden musste, als sie in andere Umstände geriet. Oder er war der Sohn eines Laienpredigers, der auf Abwege geraten war. Oder er war der Sohn …
So ging es in einem fort, abhängig nur von seiner Laune und davon, wie viel er getrunken hatte. Entscheidend war allein, dass er der Sohn von irgendwem gewesen war, dass er einen Vater und eine Mutter gehabt hatte. Aus praktischen oder gesellschaftlichen Gründen hatten sie ihn in die Obhut anderer Leut gegeben, doch hatten sie immerhin existiert. Im Laufe der Jahre kamen mir alle möglichen Varianten dieser Kerngeschichte zu Ohren, einige widersprachen sich offenkundig, andere waren sorgsam durchkonstruiert, doch blieb stets gleich, dass seine Ziehfamilie, meist die Dicks, manchmal auch die McGhees, in High Valleyfield gewohnt hatten, dass mein Vater eine viel ältere Halbschwester hatte, die vermutlich Anne hieß, und dass sein Ziehvater ein stiller, aufrechter Mann gewesen war, ein Gelegenheitsprediger, der im Bergwerk allgemein respektiert wurde.
Tante Margaret war verwirrt. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, mein Junge«, sagte sie und schaute ein wenig besorgt drein, als ich mich nach meinen Halbverwandten, diesen Fantasiegestalten, erkundigte.
»Also«, begann ich von Neuem. »Ich weiß, dass mein Dad adoptiert wurde.« Ich fuhr fort, ihr zu erklären, was ich über seine Geschichte wusste, und erzählte auch Einzelheiten wie jene vom Laienprediger, bei der sich ihr Gesicht zu einem grimmigen Lächeln verzog.
»Ach, dein Vater«, sagte sie. »Der hatte schon ein paar tolle Geschichten auf Lager.«
»Wie meinst du das?«
Ich beobachtete sie, während sie sorgsam ihre Worte wählte. Meine Tante war eine gute Frau, die stets freundlich zu mir gewesen ist, und sie war zudem eine Person von bemerkenswertem Taktgefühl. Wie meine Mutter zog sie bald nach der Heirat nach Cowdenbeath, und die beiden Schwestern blieben sich nah und standen einander in den verschiedensten Heimsuchungen des Lebens bei, bis mein Vater Mitte der sechziger Jahre ganz unvermittelt mit uns in eine Stahlarbeiterstadt in den East Midlands zog. Damals muss sie von dem, was in unserem Haus vorging, weit mehr gesehen – und erahnt – haben, als sie jemals zugegeben hat. Inzwischen war sie eine alte Frau, immer noch mit klarem Blick und fähig, ein Lächeln in ihrem Gesicht aufleuchten zu lassen, dessen Herzlichkeit mich von jeher froh gestimmt hatte; doch kann ich mir vorstellen, dass sie es leid war, es gründlich satt hatte, von ihrem Schwager Tommy Dick oder George McGhee zu hören – oder wie immer er auch gerade heißen mochte. Er hatte ihrer Lieblingsschwester zu viel Kummer gemacht und zu viele Menschen, die ihr wichtig waren, in Verlegenheit gebracht; außerdem glaube ich, dass sie über die Jahre einfach zu viel Unsinn gehört hatte, um diese Lüge noch länger hinnehmen zu wollen. »Dein Dad ist nicht adoptiert worden«, sagte sie. »Zumindest nicht so, wie du dir das vorstellst.«
»Nein?«
»Er war ein Findelkind«, erklärte sie. »Die Leute, die ihn fanden, nahmen ihn bei sich auf, aber nur für eine Weile. Allerdings glaube ich nicht, dass sie aus High Valleyfield stammten.« Sie verstummte für einen Augenblick und dachte an die Jahre kurz vor ihrer Geburt. »Das waren schwere Zeiten«, sagte sie. »Damals, in den Tagen des großen Streiks, da hatten die Menschen nichtviel. Und nach allem, was ich weiß, wurde er ziemlich herumgereicht. Natürlich gab es früher noch keine öffentliche Fürsorge so wie heute.« Sie musterte mein Gesicht und suchte nach einer Reaktion, ehe sie fortfuhr. »Man kann also nicht gerade behaupten, dass er adoptiert wurde. Wenn man jemanden adoptiert, trifft man eine Wahl, eine Entscheidung, aber für deinen Vater hat sich niemand entschieden; er ist nicht ausgewählt, sondern einfach nur – weitergereicht worden.«
Ein Findelkind. Ich glaube nicht, dass ich dieses Wort außerhalb der Welt der Märchen je gehört hatte. Seine Bedeutung vermischt sich mit der des Wortes »Wechselbalg«, diesem verhexten Kind, das Ahnungslosen untergeschoben wird, eine Kuckucksseele mit einem Charakter, den es weder ändern noch verstehen kann, ausgesetzt in der Welt der Menschen. Von Zeit zu Zeit versuche ich mir den Morgen vorzustellen, an dem er gefunden wurde, nackt in eine Decke gehüllt, zumindest laut jener Geschichte, die Tante Margaret gehört hatte; ein mageres, plärrendes Baby des Generalstreiks, in eine Decke eingewickelt und auf der Türschwelle eines Hauses in einer Bergarbeiterstadt in West Fife zurückgelassen. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der gesehen hätte, wie dieses Kind ausgesetzt wurde, also kann ich mir die Szene ausmalen, wie ich will: vielleicht wie eine Begebenheit aus einem Märchen, das namenlose Baby, vor der Tür von ahnungslosen, unschuldigen Menschen zurückgelassen, die den Kleinen aufnehmen und sich um ihn kümmern, so gut sie es eben können, ihn mit den eigenen Kindern großziehen, bis sie nach einer Weile genug haben und ihn weitergeben, erst an Verwandte und später, wie es nun einmal so geht, an beinahe fremde Leute. Ich kann mir einen verregneten, windigen Tag vorstellen, die klatschnasse Decke, das klagende Gejammer des hungrigen, verängstigten Kindes. Meinem Vater hätte dieses Bild nicht gefallen, weshalb er sich größte Mühe gab, Alternativen zu erfinden, von denen manche der Wahrheit nahe kamen, auch wenn sie nie so trostlos und grausam waren, wie für ihn der Gedanke an das ausgesetzte Kind gewesen sein musste.
Ich könnte bei diesem grobkörnigen Realismus eines regennassen Donnerstagvormittags bleiben und würde die Wahrheit damit wohl nicht weit verfehlen, aber ich stelle mir lieber einen Sommermorgen vor. Es muss ein Tag Ende Mai, Anfang Juni gewesen sein, also besteht die Möglichkeit, und sei sie auch noch so gering, dass es einer jener Tage war, an denen es schon früh warm wird und die Sonne in wenigen Minuten den Tau von den Ligusterhecken und von den kleinen Trockenplätzen zwischen den Häusern brennt. Um diese Zeit dürfte es still gewesen sein in der Bergarbeiterstadt: Die Männer der Frühschicht waren bereits zur Arbeit gegangen, die Kinder dösten noch in ihren Betten, die Frauen standen in den Küchen und kochten in riesigen Kesseln mächtige Bündel Wäsche oder knieten draußen vor dem Haus, um die Eingangsstufen und den Streifen Linoleum vor der Tür zu wienern. Zwar gibt es keine Garantie, dass es in West Fife Anfang Juni schon warm wird, doch versuche ich mir einen schönen Tag vorzustellen, weil das Baby auf der Türschwelle eines dieser Bergarbeiterhäuser mein Vater ist. Gleich entdeckt ihn eine der vielen Ziehfamilien, die er in seiner Kindheit kennenlernen wird, Leute, bei denen er jahrelang wohnt, ehe sie ihn weiterreichen in dieser Zeit, in der sich der Generalstreik zur Weltwirtschaftskrise mausert. Nacheinander wird er sich die Namen und Gesichter der jeweiligen Familie einprägen und versuchen, sich dazugehörig zu fühlen, so, wie jedes Kind zu seinen Eltern gehört. Doch dann wird man ihm, ein wenig verlegen und mit gerade so viel Freundlichkeit, wie es die Gelegenheit zulässt, erklären, dass er von nun an bei einer Tante, einer Kusine oder einer Nachbarin wohnen muss, bei jemandem, der eher in der Lage ist, ihn durchzufüttern, da es in der neuen Familie nicht so viele Kinder gibt. Er wird noch oft weiterziehen müssen zwischen diesem Morgen im Juni und jenem Tag, an dem er sich freiwillig zur Air Force meldet, um die Bergwerke hinter sich zu lassen und um jener Jahre willen, die er stets für die beste Zeit seines Lebens hielt. Die Häuser aber, die er kennt, die Leute, die Städte und der Mensch, der er zu sein meint, sie werden sich von einem provisorischen Zuhause zum nächsten kaum unterscheiden. Die Häuser sind gewöhnlich Mietshäuser, die Familien Bergarbeiterfamilien. Der Generalstreik hat sie hart getroffen, und die meisten haben kaum genug für sich selbst. Gut möglich, dass mein Vater aus Gründen ausgesetzt wurde, die mit dem Streik oder mit jenen Zuständen zusammenhingen, die ihm vorausgegangen sind; doch wie dem auch sei, die Menschen hatten in jenem Jahr genügend Anlass, sich Sorgen zu machen. Und sobald er ausgesetzt worden war, hatte man ihn sicher rasch vergessen, diesen obdachlosen Kleinen in seiner schäbigen Decke. In wenigen Jahren würde er ein großer, hungriger, linkischer Bursche sein, ständig im Weg, jemand, den man lieber nur eine Woche im Haus hatte als vierzehn Tage.
Bis mein Vater zur Air Force ging, lebte er in Cowdenbeath und Umgebung. Ich weiß nicht, wie die Stadt in den dreißiger und vierziger Jahren gewesen ist, als mein Vater von einem Jungen zu einem jungen Mann heranwuchs, doch kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich sehr von jenem Cowdenbeath unterschied, in dem ich in den fünfziger und frühen sechziger Jahren lebte. Seit Beginn des Jahrhunderts war die Stadt für ihre Armut und hohe Wohndichte bekannt. Als ich dort wohnte, hatte sich die allgemeine Lage zwar ein wenig gebessert, doch machte der Ort mit den Schlackehaufen und grauen Straßen noch immer den Eindruck einer gewöhnlichen Bergarbeiterstadt. Gegenüber der Schule St. Bride, die ich sechs Jahre lang besuchte, stand ein Fördergerüst mit sich drehendem Rad, obwohl sich die Festlandförderung damals kaum noch rentierte. Zur Zeit meines Vaters musste all das noch in vollem Schwung gewesen sein, auch wenn die Bergleute von den Früchten ihrer Arbeit nicht viel gesehen haben dürften. Deshalb nehme ich an, dass das Cowdenbeath meines Vaters ziemlich identisch mit jener Stadt war, in der ich aufgewachsen bin, höchstens ein bisschen düsterer, ein bisschen beengter, ein bisschen verrauchter. Die Häuser, die er auf seinem Weg von Familie zu Familie kennenlernte, waren spärlicher beleuchtet und kaum möbliert, aber es gab Parzellen und Gärten, in denen die Leute Gemüse anbauten, um ihr karges Einkommen oder die Kriegsrationen aufzubessern. Und wo immer mein Vater später auch wohnte, stets hat er so etwas wie einen Garten gehabt, in dem er allerdings niemals Blumen anpflanzte. Lange habe ich geglaubt, das sei so eine Männersache und er habe Blumen weibisch gefunden, aber wahrscheinlich erinnerten ihn die Gärten an die Parzellen während der Weltwirtschaftskrise, an den Geschmack von frischem Lauch oder neuer, gerade aus der eigenen Erde gebuddelter Kartoffeln. Gegen Ende seines Lebens gehörte zu den augenfälligsten Zeichen seines Verfalls die Tatsache, dass seinen letzten Garten Unkraut und Wildpflanzen überwucherten, weit und breit weder Kartoffeln noch Kohl in Sicht.
Es fällt schwer, mir meinen Vater als Kleinkind oder Heranwachsenden vorzustellen. Ein Hochzeitsfoto ist das erste Bild, das ich von ihm habe, ein linkischer Bursche, stolz auf seine Luftwaffenuniform. Die vorstehenden Zähne lassen erahnen, dass ein Lächeln für ihn etwas Berechnendes hatte, eine Rechnung aber, die schon in dem Moment nicht aufging, als er direkt in die Kamera blickte und sein Bestes gab. Meine Mutter wirkt natürlicher; sie ist hübsch, schon ein wenig rundlich und allem Anschein nach sehr glücklich. An einem anderen Tag im Juni haben sie geheiratet, sechsundzwanzig Jahre nachdem mein Vater ausgesetzt worden war, und wieder fällt es leicht, sich einen warmen Vormittag im Frühsommer vorzustellen; im Garten ihres Vaters blüht der Flieder, und Spatzen balgen sich in der Hecke rund um die Kirche St. Kenneth. Ich versuche, mir Glockengeläut vorzustellen, höre aber nur das Knarren des Förderrads auf der anderen Straßenseite und ein Klirren aus dem Hof des nahe gelegenen Pubs, in dem jemand Kisten mit alkoholfreien Getränken ablädt. Doch da stehen sie, Arm in Arm: In ihren Händen erstarrt der wächsern wirkende Blumenstrauß, während er ein Lächeln ausprobiert, das ich in gut dreißig Jahren nie wieder gesehen habe, jungenhaft, verlegen und entstellt von den großen Zähnen, gewiss, aber zugleich beinahe selbstbewusst und nur in den Augen eine leise Andeutung jener Angst, die er bald Liebe zu nennen lernte. Dieses Bild fand ich schon immer rätselhaft. Waren das da meine Eltern? Warum haben sie in all der Zeit, in der ich bei ihnen aufwuchs, nie wieder so ausgesehen? Vor allem aber: Hatten sie tatsächlich nicht die geringste Ahnung von dem, was ihnen bevorstand? Wussten sie an ihrem Hochzeitstag wirklich so wenig voneinander?
Ich habe andere Hochzeiten erlebt. Fremde, die in Kalifornien, Freunde, die in Croyden oder Devon geheiratet haben, mexikanische, russische, finnische Hochzeiten. Bei einer der schönsten Zeremonien, die ich erleben durfte, sah ich in einer Stadt mitten in Transsylvanien eine Prozession aus der casa de matrimonios kommen, Paare lächelnder, dunkeläugiger Rumäninnen und ernst blickender Männer, die sich zum Fotografieren aufstellten, umweht vom Geruch gebrannten Zuckers und von Holzkohleschwaden, die herübertrieben von den Feuerstellen entlang des Flussufers, an denen Frauen aus dem Ort kleine, floricele genannte Kuchen eigens für die Frischvermählten und ihre Gäste buken. Jedes Mal wenn ich eine Hochzeit sehe, frage ich mich, was sich Braut und Bräutigam erhoffen und warum niemand unter den Anwesenden, den Alten, den schon lang Verheirateten, vortritt und sie warnt. Ich frage mich das, weil ich erlebt habe, wie sich meine Eltern gut zwanzig Jahre lang gegenseitig quälten, bis meine Mutter schließlich aufgab und starb, vor allem wohl aus Enttäuschung, woraufhin mein Vater allein im Haus sitzen blieb und zur Schau stellte, was er unter Trauer verstand. Von meiner eigenen Hochzeit erinnere ich die Angst, ein falsches Versprechen abzugeben, aber auch die plötzliche Erkenntnis, dass es ja genau darum ging: Dass wir hier waren, um ebendieses Risiko auf uns zu nehmen, Versprechen abzulegen, die wir nur hofften, halten zu können, in Krankheit und Gesundheit, Wahn und Normalität, Freude und Furcht, sie alle unerklärlich, gar unaussprechlich, weshalb, meistens jedenfalls, das eine mit dem anderen verwechselt wird.
Ich stelle mir vor, dass sich mein Vater an jenem Tag vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben auf nie zuvor gekannte Weise begehrt gefühlt hat. Im Gesicht meiner Mutter sieht man diesen kleinen, aber vollkommenen Sieg, den eine Frau wie sie genießt, wenn sie beschließt, einen Mann zu lieben, der zum ersten Mal geliebt wird. Ich habe keine Ahnung, was im menschlichen Herzen vor sich geht, aber wenn ich überhaupt etwas weiß, dann weiß ich, dass Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen lieben. Ich glaube, die meisten Männer lieben, was ihnen gefällt, und denken nicht weiter darüber nach; für Frauen aber ist die Liebe ein Akt der Imagination, eine Wahl, gar ein Schöpfungsakt. Vielleicht muss es so sein. Ich zweifle nicht daran, dass es Leute gab, die sich laut gefragt haben, was sie an ihm fand. Er war ein Niemand von nirgendwo, ein uneheliches Kind und obendrein kein Katholik. Also keine gute Partie, nicht mal in seiner Uniform. Falls sie jenen Mann gekannt haben, dem meine Mutter angeblich den Laufpass gab, als sie meinen Vater kennenlernte, weilten ihre Gedanken an diesem Tag sicherlich bei ihm.
Von Hochzeitsfotos geht lange nach der Eheschließung etwas Trauriges aus. Das Bild, das ich von meiner Mutter und meinem Vater habe, zeigt zwei hoffnungsfrohe, tapfer lächelnde Menschen, die ich nie kennenlernte: Ich habe nur jene Enttäuschungen und Lügen erlebt, die ihnen noch bevorstanden und die damals für sie unvorstellbar waren. Wenn ich ihn mir heute ansehe in seiner RAF-Uniform mit der weiß gekleideten Braut an seiner Seite, geht es mir mit meinem Vater besser als zu jener Zeit, in der er noch lebte. Er hat ständig gelogen, auch dann, wenn es unnötig war, doch glaube ich nicht, dass er sich für unehrlich hielt. Ich glaube, er sah sich als jemanden, der ebenso wie jeder andere Mensch das Recht auf eine Geschichte hat; doch wenn er seine »Verwandten«‹ bat, ihm von sich zu erzählen, haben sie mit einem verlegenen Schweigen reagiert oder mit gut gemeinten Märchen, mit Halbwahrheiten, die, in Ermanglung von etwas anderem, für Fremde und Außenstehende genügen mussten. Das wird ihm nicht gereicht haben. Er brauchte eine Geschichte, brauchte ein Ichgefühl. In einem Prozess, der eine ordentliche Portion Verstand erforderte – vielleicht ein wenig mehr, als er besaß – und nur gelegentliche Täuschungsmanöver verlangte, erfand er dieses Ich. Dazu gehörte allerhand; wer will ihm also vorwerfen,
2
Es ist beunruhigend, wenn ein Kind zum ersten Mal begreift, dass es die Eltern schon gab, ehe es selbst geboren wurde – und von diesem Augenblick an wird es immer komplizierter, immer beunruhigender: Ehe sie seine Eltern wurden, hatten sie nicht nur ein eigenes Leben, es gab sogar eine Zeit, ehe sie verheiratet waren, eine Zeit, in der sie sich noch nicht einmal kannten, in der sie andere Menschen waren, mit eigenen Ideen, eigenen Hoffnungen, mit ihren eigenen, flüchtigen Augenblicken glücklosen Verstehens. Vielleicht haben sie einen anderen Menschen geliebt oder sich geschworen, niemals zu heiraten, niemals Kinder zu bekommen. Folgt man dem Gedanken bis ans Ende, dann muss es eine Zeit vor alledem gegeben haben, in der sie selbst Kinder waren, und eine Zeit davor, in der sie noch nicht existierten. Als Kind fand ich diese Vorstellung schrecklich und faszinierend zugleich. Es war einmal, vor langer Zeit, da gab es mich noch nicht. Und davor gab es meine Eltern noch nicht. Und davor … Was war das für eine Welt, in der es niemanden gab, den ich kannte? Was haben die Leute getan? Wie konnte es überhaupt etwa geben, wenn ich nicht da war, es zu sehen?
Was meinen Vater angeht, so weiß ich absolut nichts darüber, wer er war oder was er tat, ehe er mein Vater wurde. Von meiner Mutter habe ich Fotos gesehen, die sie als junge Frau zeigen: dunkelhaarig, blass, den Lippenstift ein wenig zu großzügig aufgetragen, so steht sie am Strand oder posiert mit Freundinnen in einem Garten oder Park, überraschend schlank in gestreiftem Pullover und schwarzen Slacks. Für mich war dieses Mädchen unbegreiflich. Sie schien mir kein bisschen wie meine Mutter zu sein: sorglos, sogar ein bisschen wild und ohne die geringste Ähnlichkeit mit der immerzu geschäftigen Frau, die unser heruntergekommenes Haus auf Vordermann zu bringen versuchte, Einkäufe und Restposten aus den Läden heimschleppte, ständig strickte und stopfte, damit wir etwas Anständiges anzuziehen hatten, die überall alte Zeitschriften und Notizbücher auflas, damit sie mir Lesen und Schreiben beibringen konnte, ehe ich zur Schule kam.
Meine Mutter steckte voller Widersprüche. Eine pflichtbewusste, wenn nicht gar fromme Katholikin von jener schlichten Glaubensart, die Vertreter des klerikalen Gewerbes zu schätzen wissen. Sie hasste den Kommunismus, worunter sie Politik jeglicher Art verstand, verehrte aber die Bergarbeiter, vielleicht, weil mein Vater keiner war, sonst aber jedes männliche Mitglied ihrer Familie einfuhr oder auf irgendeine Weise mit den Gruben zu tun hatte. Und sie konnte uns alles über die Entbehrungen erzählen, die Bergarbeiter zu erdulden hatten, über das, was im Krieg von ihnen geleistet worden war, oder darüber, wie die Grubenbosse im Generalstreik Leute aus ganz Schottland geholt hatten, um den Willen der Kumpel zu brechen, und wie sie standhielten, als alle anderen aufgaben und der Widerstand ins Wanken geriet. Sie konnte auch erzählen, wie die Polizei einmal, laut Familiensage, ihren Vater aufgegriffen und wegen angeblicher Trunkenheit in eine Zelle gesteckt hatte. Das gehörte damals zur typischen Schikane gegen Katholiken oder gegen die »Iren«, wie sie von den Protestanten genannt wurden – und in jenen Tagen waren die Polizisten in dieser Gegend Schottlands ausnahmslos Protestanten. Ein bekannter Katholik verließ eine Kneipe, und obwohl er sich unauffällig benahm, wurde er geschnappt und über Nacht in eine klamme Zelle gesperrt; man leerte seine Taschen, nahm ihm Gürtel und Schuhe ab, eben das komplette Programm an Demütigungen. Mein Großvater ließ es mit jener stoischen, stillen Art über sich ergeben, wie sie nur die tägliche Erfordernis lehrt, doch als man ihn entließ, fehlte der Rosenkranz, den er stets bei sich getragen hatte. Die Stimme meiner Mutter vibrierte vor Stolz, wenn sie erzählte, wie er an jenem Morgen, erst nachdem man ihm mit einer Anzeige gedroht hatte, das Revier verließ, aber wiederkam, Tag für Tag, um nach seinem Rosenkranz zu fragen, bis der diensthabende Polizist schließlich klein beigab.
»Man hat ihn wegen Trunkenheit verhaftet«, erzählte sie, »dabei ist euer Großvater sein Leben lang nicht betrunken gewesen. «
Das stimmte. Mein Großvater vertrug Whisky wie nur irgendwer, aber er hätte sich niemals betrunken auf der Straße gezeigt. Wenn er ausging, war er immer gut angezogen, trug meist einen schon fadenscheinigen, aber sauberen schwarzen Anzug, eine Schieber- oder Schottenmütze und dazu auf Hochglanz polierte Schuhe. In der Brusttasche steckte ein Bild der Jungfrau Maria und in der Jackentasche der Rosenkranz. Auf einer Familienfeier – einer der vielen Hochzeiten, die ein Mann mit zwölf Kindern über sich ergehen lassen muss – nahm er mich einmal beiseite und hielt mir eine kleine Karte hin. Sie sah aus wie eine dieser Sammelkarten, die man beim Kauf von Zigaretten oder Tee bekommt. Es war ein Bild der Heiligen Jungfrau.
»Man sollte immer ein Bild der gesegneten Jungfrau Maria bei sich tragen«, erzählte er.
Ich schaute die Karte an und nickte.
»Nimm schon«, sagte er, »die ist für dich.«
Ich nahm sie.
»Pass gut auf sie auf«, fuhr er fort, als ich die Karte in die Tasche meines Blazers steckte. »Dann passt sie auch auf dich auf.«
Die Wertvorstellungen meiner Mutter stammten von ihren Eltern. Wie ihr Vater mochte sie keine Menschen, die zu viel für Geld übrig hatten, doch wünschte sie sich nichts sehnlicher als schlichtes Ansehen. Wie ihre Mutter mochte sie Blumen und gärtnerte gern. Vor Bildung hegte sie eine Hochachtung, die wie ein Schatten über meine Kindheit fiel: In jeder freien Minute rief sie mich zur Arbeit und ließ mich lernen, lesen, schreiben – dabei hat sie selbst in all den Jahren, die ich sie kannte, nie auch nur ein »richtiges Buch« gelesen, wie sie es nannte. Sie war ein stiller, verschwiegener Mensch und machte, selbst als ich noch klein war, den Eindruck einer Frau, deren Lieben und Freundschaften in der Vergangenheit oder in einer fernen Zukunft lagen. Auf ihre Familie ließ sie nichts kommen, auch nicht, als sie von ihr im Stich gelassen wurde, da vielleicht erst recht nicht.
Die Fotos meiner Mutter – Bilder von ihrer Familie, von Freundinnen, von ihr selbst an Tagen, an denen sie mit Kolleginnen vom Co-op einen Ausflug gemacht hatte, all die Schnipsel und Schnappschüsse, die ihr so wichtig gewesen waren – wurden in einer großen, schäbigen Handtasche aufbewahrt, die mein Vater in Ägypten gekauft hatte, als er dort stationiert gewesen war; von ihm selbst aber gab es nicht ein einziges Foto, das vor seiner Zeit in der Air Force datierte. Taucht er doch einmal auf Bildern auf, ist er meist am hinteren Rand einer Gruppe zu sehen, oft mit einem Glas vor dem Mund, das sein Gesicht verdeckt, ein Mann, der keinen Hehl daraus macht, dass ihm nichts daran lag, sich für eine Aufnahme in Pose zu stellen. Fotos können allerdings auch täuschen. Woran wir uns erinnern, sobald wir uns wahrhaft erinnern – also nicht, wenn wir uns jene Bilder ins Gedächtnis rufen, die uns von anderen eingepflanzt wurden –, ist das einzige Zeugnis, dem wir trauen können, nicht weil es präzise wäre, sondern weil es unser Ureigenes ist. Ein Foto, eine Familiengeschichte, die Erinnerungen eines alten Verwandten auf einer Hochzeit oder einer Beerdigung, Rückblicke in eine Zeit, in der niemand der Anwesenden auch nur geboren war, sind keine Fakten, sondern Artefakte. Schon als ich noch ziemlich klein war, wusste ich, dass alles, was mein Vater mir über sich erzählte, alles, was er mir überhaupt erzählte, mit Vorsicht zu genießen war. Aber warum war er die Ausnahme? Warum sollte irgendwas, das mir erzählt wurde, als definitiv wahr oder absolut falsch hingenommen werden? Wenn Familienmitglieder Geschichten erzählen, wenn sie Bilder herumzeigen, wenn sie sich bei Zusammenkünften erinnern, dann teilen sie nur das mit, was sie offenzulegen beabsichtigen. Die Wahrheit bleibt verborgen.
Mein Vater hatte keine Geschichte, die er zum Besten geben konnte. Niemand hing mit ihm Erinnerungen über die alten Zeiten nach, niemand fischte Schnappschüsse aus einem alten Karton und reichte sie herum, damit alle sehen konnten, wie er als Junge gewesen war. Er besaß nur seine eigenen, unbelegten Storys, seine Apokryphen. Als er mein Vater wurde, war er weniger ein Mann als eine Naturgewalt, etwas, das aus dem Nirgendwo kam, eine unberechenbare, wilde, manchmal absurde Kreatur, die in einem Moment überaus charmant sein konnte, nichts als ein Lächeln, um im nächsten Augenblick Gift und Galle zu spucken. Er war ein breitschultriger Kerl, eins achtzig groß, stark, skrupellos und unglaublich schnell. Flink mit der Hand, sagten die Leute, wenn sie eine beschönigende Umschreibung für häusliche Gewalt brauchten, aber mein Vater wurde nur selten direkt gewalttätig. Er hatte gleichsam instinktiv begriffen, dass eine Drohung wirksamer sein konnte als ein Schlag, denn der Mensch gewöhnt sich – wie er selbst gern sagte – fast an alles. Er jedenfalls hatte sich daran gewöhnt, mit fünfzehn in einer Gummifabrik zu arbeiten, den ganzen Tag in der Hitze und im Gestank zu stehen, und er hatte sich an den Geruch von verkohltem Fleisch gewöhnt, als er beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche Anfang der Sechziger half, die Kadaver zu beseitigen. Im Lauf der Jahre dürfte er selbst manch einen Schlag abbekommen haben und konnte ebenso gut einstecken wie austeilen. Als ich noch klein war, kam er gelegentlich mit Blut im Gesicht und auf dem Hemd nach Hause, mit Schnittwunden am Arm und aufgeschlagenen Knöcheln. Aber die Verletzungen haben ihm nie was ausgemacht. »Ist doch bloß ein Kratzer«, hat er immer gesagt, wenn meine Mutter mit ihm ins Krankenhaus wollte; dann wusch er sich das Blut mit warmem Wasser ab und warf das Hemd in den Mülleimer.
Er schlug selten zu. Er wusste, die Androhung von Gewalt ist schlimmer als die Gewalt selbst. Ganz wie in Horrorfilmen: Sieht man den großen Gummihai oder den Mörder aus dem Jenseits im gespenstischen Make-up, reizt der Anblick eher zum Lachen als zum Schreien. Mein Vater gehörte zu den Leuten, die nur in einem Zimmer zu sitzen brauchten, und jeder spürte es: dieses Brodeln, dieses Gefühl einer unberechenbaren Kraft, die jeden Moment auszubrechen und Schreckliches anzurichten drohte. Manchmal zerbrach er etwas, bedächtig, in voller Absicht, damit wir sahen, welchen Spaß es ihm machte, damit wir begriffen, wie leicht es war. Das Schlimmste aber, was uns passieren konnte, waren seine Anfälle von dumpfem Schweigen. Dann brütete er den ganzen Tag und wartete auf die nichtige Provokation, die den Stein ins Rollen brachte. Ich glaube nicht, dass er es beherrschen konnte, wenn es einmal angefangen hatte, ebenso wenig wie er mit dem Trinken oder dem Spielen aufhören konnte, solange er noch einen Penny besaß. Aber in seinem eigenen Haus schlug er nur selten zu. Jedenfalls nicht in den frühen Jahren. Vielleicht blieb mir das Schlimmste erspart, weil ich noch so jung war. Später schien er ein anderer Mensch zu werden, eine Art Monster; aber womöglich ist er dieses Monster schon immer gewesen und wurde durch meine kindlichen Bedürfnisse verwandelt, wenn schon nicht in einen Beschützer, dann doch in so etwas wie einen Vater. Als ich älter wurde, fragte ich mich, was mit ihm passierte. Ich fragte mich, warum er sich änderte. Dabei änderte er sich gar nicht: Er wurde nur er selbst. Jahrelang hätte ich schwören können, dass ich mich an bessere Zeiten erinnere, doch wenn ich innehalte, um zurückzublicken, kann ich mich an nichts über ihn erinnern, nur an das, was man mir erzählt hat. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann mich selbst kaum sehen.
Meine Erinnerungen beginnen in der King Street, in jenem heruntergekommenen Haus, in dem meine Eltern gleich nach der Heirat wohnten. Über die Zeit vor meiner Geburt wurde mir so viel erzählt, dass ich mir vorstellen kann, beim Tod der Erstgeborenen dabei gewesen zu sein – ein Mädchen, das meine Mutter nach ihrer Mutter Elizabeth genannt hatte –, und war ich nicht dabei, so hätte ich doch dabei sein können. Ich scheine dieses Mädchen zu kennen, erst als Baby, dann als Krabbelkind, ein Mädchen, das mir auf meinem Weg durch die Kinderzeit stets etwas mehr als ein Jahr voraus war. Hübsch, helles Haar, dazu die dunklen, fast reglosen Augen meiner Mutter, so kommt und geht sie über die King Street in dem Amateurfilm, der in meinem Kopf abläuft: ein Kind in einem weißen Konfektionskleid, ein Mädchen, das neben mir im Garten steht und in die Sonne blinzelt, das eines Tages zur Schule geht und verändert heimkehrt, Tintenkleckse an den Händen und den Geruch von getrockneter Farbe im Haar. Ich erinnere mich an dieses Mädchen, weil mein Vater von ihr erzählte, wenn ihn etwas aufgebracht hatte oder er betrunken nach Hause kam, in der Küche saß und vor sich hin brummelte. Heute fällt mir auf, wie typisch es für sie beide war, dass meine Mutter Elizabeths Namen nie wieder in den Mund genommen hat, während mein Vater ständig über sie redete. Selbst in ihrem Kummer waren sie getrennt.