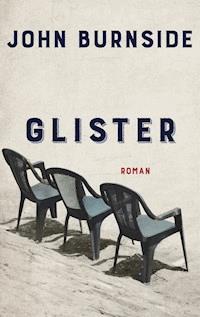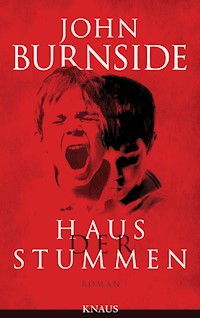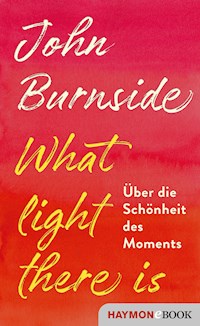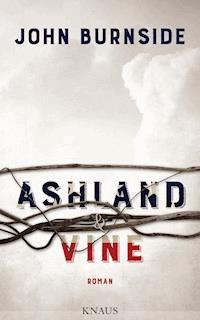10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das autobiografische Projekt
- Sprache: Deutsch
Ein ganz besonderes literarisches Memoir über die Liebe mit ihren Licht- und Schattenseiten
Der hochgelobte schottische Autor John Burnside blickt zurück auf sein Leben und erzählt von den vielen Facetten der Liebe. Von Menschen, die ihn geprägt haben, und von der faszinierenden Kraft, die er in der Sprache und in der Musik entdeckt. Ehrlich und ungeschönt spürt John Burnside den magischen, aber auch abgründig-gefährlichen Seiten der Liebe nach und verwebt Kindheitserinnerungen und Reflexionen über Kunst zu einem einzigartigen poetischen Werk. »Für mich ist dies das tollste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um den größten Schriftsteller unserer Tage handelt.« (Matthias Brandt in »Das literarischen Quartett«)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Burnside
Über Liebe und Magie – I Put a Spell on You
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel I Put a Spell on You
bei Jonathan Cape, London.
Der Abdruck aus Ovid, Metamorphosen,erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Ditzingen
Copyright © der Originalausgabe by John Burnside 2014
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
Penguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23988-6V002
www.penguin-verlag.de
in memoriam Theresa Burnside
Ein sentimentaler Mensch denkt, die Dinge würden dauern – der romantische dagegen hofft entgegen aller Hoffnung, dass dies nicht stimmt.
F. SCOTT FITZGERALD1
Meine Liebe kommt mir wie ein tiefer, bodenloser Abgrund vor, in dem ich immer mehr versinke, aus dem mich jetzt schon nichts mehr retten kann.
LEOPOLD VON SACHER-MASOCH2
Abschweifungen sind unleugbar der Sonnenschein – das Leben, die Seele der Lektüre …
LAURENCE STERNE3
1F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise, New York 1920
2Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz, Stuttgart 1870
3Laurence Sterne, Tristam Shandy, Leipzig 1880, Übersetzung von Adolf Seubert
Inhalt
I Put a Spell on You
Erste Abschweifung: Über glamourie
The Dark End of the Street
Zweite Abschweifung: Über thrawn
You Can’t Do That
Everlasting Love
Dritte Abschweifung: Über Narzissmus
Strange Days
Vierte Abschweifung: Über das Verlorene-Mädchen-Syndrom
Feast of the Mau Mau /Portrait of Hezekiah Trambles
Just My Imagination (Running Away with Me)
Fünfte Abschweifung: Über Mordballaden
Welcome to the Machine
Piano
Miss You
Zwischenspiel: Das Lächeln einer Sommernacht
Running Away
Sechste Abschweifung: Warum sich verirren ein Augenblick des Glücks ist
Humor Me
Siebte Abschweifung: Über die Berge auf dem Mond
Zwischenspiel: Porträt von Mel Lyman
Good Fortune
Nachspiel: A New Kind of Love
Coda (It’s the) Same Old Song
Danksagung
I Put a Spell on You
(Nina Simone, 1965)
Im Frühjahr 1958 zog meine Familie aus einem rattenverseuchten Mietshaus in der King Street in eines der letzten Fertighäuser in Cowdenbeath, das genau auf der Grenze zwischen dem vermüllten Wald an der Stenhouse Street auf der einen und dem kargen Ackerland auf der anderen Seite stand. In mancher Hinsicht war das für uns ein Aufstieg; die Fertighäuser hatte man während des Krieges zwar nur als vorläufige Unterkünfte gebaut, doch waren die klamme Kälte, die kittfarbigen Kondenswasserpfützen an Wintermorgen und die stickige Hitze an Augustnachmittagen für mein kindliches Gemüt kaum von Belang angesichts des Luxus, auf unserem eigenen Gartengrundstück zu leben, überdies in einem frei stehenden Gebäude nur wenige Meter von einem Hain hoher Buchen entfernt, in dem die ganze Nacht Waldkäuze jagten, deren wechselseitige Rufe so nahe klangen, als flögen sie direkt durch das winzige Schlafzimmer, das ich mit meiner Schwester teilte. Gleich hinter dem Hain lag Kirks Hühnerfarm, auf der die Tiere frei in weitläufigen Gehegen gehalten wurden; Mr. Kirk, der in einem Steinhaus wohnte, das mir wie ein altes Herrenhaus vorkam, eilte den ganzen Tag hin und her, brachte Futter, sammelte Eier ein und mistete die Ställe aus. Später, als ich alt genug war, durfte ich ihn begleiten und war stolz darauf, mit einem erwachsenen Mann Schritt zu halten, der seine Arbeit machte, Brutkästen prüfte und schwere Eimer voller Korn von hier nach da schleppte, all das mit einer Miene verhaltener Belustigung. Auf der anderen Seite von unserem Haus, jener zum offenen Land, wie ich gern dazu sagte, erstreckten sich in der einen Richtung Felder bis zum Waldstreifen, in der anderen das graue, egelverseuchte Wasser des Loch Fitty. So oft wie nur möglich stromerte ich draußen herum und bildete mir ein, ein Landkind zu sein, einer der Jungen aus meinen Bilderbüchern oder einer der Kumpane aus den Rupert-Jahrbüchern, von denen mir Tante Sall jedes Jahr eines zu Weihnachten schenkte.
Ich war erst drei Jahre alt, als wir in den Blackburn Drive zogen, aber es dauerte nicht lang, bis ich verstand, dass wir uns tatsächlich auf dem Weg »nach oben« befanden. Ich war sieben, als wir sogar einen Fernseher bekamen, und von da an durften Margaret und ich sonntags länger aufbleiben, obwohl wir am nächsten Tag zur Schule mussten, durften ein Eis von Katys Eiswagen lutschen und uns Sunday Night at the London Palladium ansehen. Mir ist schleierhaft, warum ich das jemals toll gefunden habe; für einen Siebenjährigen war die Show nicht besonders interessant, denn auch wenn gelegentlich Popstars auftraten, zeigte man doch meist bloß irgendwelchen Klamauk und dazu Tanzeinlagen. Bald wurde Sunday Night daher von Juke Box Jury verdrängt, einer Sendung, in der die neuesten Songs liefen und die aufgedonnerten Jurymitglieder mit ihren Beehive-Frisuren so schlank und gut aussahen wie meine Cousine Madeleine, nur nicht so schön.
Wenn Madeleine in unser Haus kam, meist an einem Samstagnachmittag, saß ich stundenlang am Küchentisch, während sie mit meiner Mutter schwatzte, und schaute fasziniert auf ihre langen, schlanken Finger und den kirschroten oder himmelblauen Lack auf ihren Nägeln. Jedes Mal sah sie anders aus – neue Nägel, neue Frisur, neues Kleid –, und doch blieb sie immer Madeleine. Schon als wir uns zum ersten Mal trafen, bei der Hochzeit einer anderen Cousine, hatte ich mich in sie verliebt – und bin es seither auf die eine oder andere Weise geblieben. Sie war zehn Jahre älter als ich und mit einem Matrosen der Handelsmarine namens Jackie verlobt, und sie war es auch, die mich begreifen ließ, dass die Love Songs, die ich bei Juke Box Jury hörte, tatsächlich etwas bedeuteten. Bis dahin hatte ich geglaubt, nur Worte zu hören, irgendwelches sinnloses, übertriebenes Gestammel, das wirklich niemand ernst nehmen konnte. Jetzt wusste ich es besser, denn jetzt war ich verliebt, und die Liebe fühlte sich seltsam an, so als erführe man die ersten Sätze einer Geschichte, deren Ende man niemals lesen würde, da dieses Ende jemand anderem gehörte.
Ich will jedoch gar nicht so tun, als wäre diese Schwärmerei je ein echtes Problem gewesen. Selbst mein neunjähriges Ich wusste, dass ich nur verknallt war; außerdem gab es damals so vieles auf jene leichte, jungenhafte Art zu lieben, von der ich glaube, dass die meisten Männer sich wünschen, sie würde ewig währen. Mit neun liebte ich fast alles und dies nahezu bedingungslos. Das stille Drama des ersten Schnees im Jahr. Dampfendes Tauwasser in den Gossen und Gräben. Der Bogen eines gut geworfenen Balls über den Sommerhimmel. Der abwesende Blick in Judy Garlands Augen, wenn die langweilige Handlung pausierte und sie den Mund öffnete, um zu singen. Die Kyries und die schwarzen Gewänder am Karfreitag. Der Hostienklecks auf meiner Zunge und die Hänseleien der Highschool-Mädchen, wenn ich über die Stenhouse Street und durch den Wald bei Kirks Hof nach Hause ging. Vor allem aber liebte ich die älteren Schwestern meiner Schulfreunde. Noch schlanke Mädchen, die dabei waren, sich in mehr oder minder schöne Frauen zu verwandeln, bislang unversehrt vom Ehestand, herrliche, freie Geschöpfe mit Geld in ihren Portemonnaies und einem süßen Lippenstiftlächeln für den gefühlsduseligen Jungen, der hin und wieder ihre Wege kreuzte. All das machte mich glücklich, und es kümmerte mich nicht, dass dieses Glück nur flüchtig war. Einige Minuten, eine Stunde, ein Septembernachmittag im Park – solche Augenblicke kamen, und dann waren sie vorüber, also blieben sie mysteriös und unbefleckt: eher ein Geschenk als eine Last.
Dann, an einem verregneten Samstagnachmittag, kurz nachdem Madeleine und Jackie geheiratet hatten, nahm meine Mutter mich mit, um die beiden in ihrer neuen Wohnung zu besuchen, und Madeleine spielte uns eine gerade gekaufte Platte vor. Es war »I Put a Spell on You« von Nina Simone, und in jenen zweieinhalb Minuten wurde mir klar, dass dies das Schönste war, was ich je gehört hatte. Alle verstummten, um zuzuhören, und als es vorbei war, saßen wir am Tisch, als hätte es uns die Sprache verschlagen, bis Jackie schließlich aufstand und sie noch einmal abspielte. Ich hatte den Song nie zuvor gehört, weshalb ich annahm, es sei die Originalversion, und dieser magische, wenn auch ein wenig traurige Nachmittag blieb mir jahrelang im Kopf, zusammen mit den Schnappschüssen von meiner Mutter und Madeleine im Pittencrieff Park, dazu der Klang von Janice Nicolls’ Stimme, die auf Thank Your Lucky Stars sagt: »Ich vergebe fünf Punkte«; Stränge im Webtuch meines Ichs, die dort reglos ruhten, aber wie die Kreaturen aus einem Horrorfilm der fünfziger Jahre nur einstweilen in der Schwarzen Lagune schliefen, jederzeit bereit, bei der leisesten Veränderung im Wetter oder in den Gezeiten wieder aufzuwachen.
*
Während des nächsten Jahrzehnts muss ich den Song viele Male in vielen verschiedenen Versionen gehört haben, in jenen Jahren also, in denen mein Vater mit großem Tamtam unsere Flucht aus Cowdenbeath plante, erst nach Australien, dann nach Kanada und schließlich zu meiner herben Enttäuschung nach Corby, indem er dort eine Stelle bei den Stahlwerken annahm. Corby war, dank des New Towns Act von 1946, zur Neuen Stadt erklärt worden, jenem Gesetz, das man erlassen hatte, um »Reißbrettorte« zu schaffen, die dann von den Großen und Mächtigen für das gemeine Volk regiert wurden4. Der Umzug in den Süden trennte meine Mutter von ihrer gesamten Familie und setzte den Besuchen meiner Cousine Madeleine ein Ende, doch beschwerte sich niemand, denn laut meinem Vater würden wir uns wieder einmal verbessern, bekämen ein richtiges Haus, kein Fertighaus, eine bessere Arbeit, bessere Schulen, überhaupt von allem das Bessere. Es musste besser sein, war das Ganze doch von Profis geplant worden, die wussten, was sie taten. Ich schätze, zumindest in dieser Hinsicht hatte er recht.
Corby war in jeder Hinsicht eine Enttäuschung, für meine Mutter aber fast eine Tragödie. Unser »besseres« Haus hatte drei Schlafzimmer, nur war die Küche kleiner als im alten Fertighaus, und wegen der klobigen Einbauschränke blieb kein Platz für einen Tisch. Trotzdem hielt meine Mutter sich wacker. Sie zog los, kaufte ein neues Transistorradio und stellte es aufs Fensterbrett, zu ihrer Unterhaltung, wie sie sagte, beim Backen und Kochen oder wenn sie draußen im Garten Goldlack pflanzte. Mein Vater hatte zudem einen neuen Fernseher gekauft, ein hässliches, sperriges Teil, das auf einem eigenen Tischchen in einer Ecke des mit Flockdruck tapezierten Wohnzimmers stand, von uns übrigen aber ignoriert wurde, weshalb auch das neue Haus bald wieder in die altbekannten Fraktionen zerfiel – Pferderennen und Fußballresultate in der Glotze einerseits, Sing Something Special und die neuen BBC-Sender andererseits. Folglich dürfte ich mit den Jahren mehrere Coverversionen von »I Put a Spell on You« gehört haben, nur achtete ich kaum darauf, bis sich ein Mädchen namens Annie an einem Samstagnachmittag im Charolais Café über die Rückenlehne ihres Sessels beugte und es mir ins Ohr sang, weißen Rum und Nescafé im Atem, das geschminkte Lächeln nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt, ihre Version weniger Nina Simone, eher ein Mix aus Credence Clearwater Revival und Arthur Brown, dazu vielleicht noch ein heiserer Hauch Janis Joplin. Wie auch immer, es war eine ziemlich scharfe Nummer.
Mich verblüffte, was passierte. Ich kannte Annie nicht besonders gut, obwohl sie mir oft aufgefallen war, wenn sie hereinkam, da sie immer lachte, sich immer bemüht und leicht hysterisch über alles und jeden lustig machte: eine naive, etwas furchtsame junge Frau von neunzehn Jahren, die sich blindlings an die irgendwie gewonnene Überzeugung klammerte, dass man sich wegen nichts Sorgen machen müsse, solange man nichts allzu ernst nahm.
Sie war mir also aufgefallen, und wir hatten uns einige Male gegrüßt, aber eigentlich hatte sie mich nie interessiert, und ich fand sie auch nicht attraktiv, was damals stets die Trennlinie war zwischen den Frauen, mit denen man sich abgab, und jenen, die im Hintergrund verschwanden. Allerdings kannte ich eine aus der Gang, mit der sie abhing, eine magere Blondine mit verwaschenen blauen Augen namens Charlotte, und an jenem Tag war mir bewusst, dass Charlotte irgendwo in meiner Nähe war und wie alle anderen im Café diesem Auftritt von Annie zusah, die weitersang, während ich wie erstarrt dasaß, hypnotisiert von ihrer Nähe und davon, dass all dies so öffentlich geschah. Ich war mit Charlotte ausgegangen, mehrere Male sogar, doch nach einem betrunkenen Abend im Coronation Park war die Sache im Sande verlaufen, und als Charlotte anfing, samstagnachmittags im Charolais aufzutauchen, registrierte ich erleichtert, dass sie sich offenbar entschieden hatte, so zu tun, als wären wir uns nie begegnet. Jetzt allerdings beobachtete sie mich mit grimmigem, seltsam rachsüchtigem Blick und wartete ab, was wohl als Nächstes geschehen würde.
Das Charolais war ein Billigrestaurant in Corbys am Reißbrett geplantem Einkaufszentrum, wo die Leute aus den Pubs der Umgebung die Nachmittage mit einem Kaffee oder einem Becher Eiscreme überbrückten. Hierher war es von nahezu überall nicht weit, und das Café lag fast Tür an Tür mit meinem eigentlichen Stammlokal am Samstag, einer dunklen, mit Holzimitat getäfelten Bar, das Corinthian, wo sich alles besorgen ließ, von Benzedrin bis zu einem spottbilligen Brautkleid. Lange Zeit hockte ich da jeden Samstagnachmittag, bis der Barkeeper mich und die letzten Trödler um Viertel vor drei rauswarf, und wechselte dann nach nebenan ins Charolais. Meist hielt ich mich dort stundenlang an einer Tasse Kaffee fest, weil ich fast meine gesamte Barschaft für ein letztes Bier ausgegeben hatte, aber das machte nichts. Ich kam nicht hierher, um zu essen; ich kam wegen der Gesellschaft.
Vielmehr kam ich, um in Gesellschaft zu warten, bis Karen auftauchte. Meist kam sie am frühen Nachmittag nach einem Einkaufsbummel mit ihrer Freundin Kay. Weil sie verheiratet war, setzte sie sich nicht zu mir; allerdings hatten wir ein höchst komplexes System von Zeichen und Andeutungen entwickelt, wodurch es uns möglich war, quer durch den Raum miteinander zu kommunizieren, ein in neun von zehn Fällen so effektives System, dass wir, wenn wir den richtigen Moment abpassten, nach draußen schlüpfen und uns woanders treffen konnten, fern aller neugierigen Blicke. An jenem Tag kam Karen gerade rechtzeitig, um Annies spontane Serenade mitzuerleben, und als Annie dann plötzlich abbrach, sich wieder in ihren Sessel sinken ließ und ihren Freundinnen zulachte, war sie die Erste, die ich unter dem halben Dutzend amüsierter Zuschauer wahrnahm. Sie war offensichtlich gerade erst zur Tür hereingekommen und hatte mich mit einem Blick bedacht, der jedem unbeteiligten Beobachter nichts weiter als amüsierte Verwirrung verraten hätte. Und doch war da noch etwas in ihren Augen, weshalb ich einen Moment lang glaubte, sie sei verletzt, nicht weil sie mir eine Romanze mit Annie unterstellte, sondern weil ich mich als Single und als Mann auf jeden dämlichen Spaß einlassen konnte, während sie daneben stehen und so tun musste, als machte es ihr nichts aus, nicht bloß um meinet-, sondern auch um ihretwillen. Patrick, ihr Mann, war bei den Muskelpaketen des Rangers Club ziemlich beliebt, und sie wusste genau, was passieren würde, sollte unsere Affäre je auffliegen – vor allem, was mir passieren würde. Doch was auch immer ich für eine Regung in ihrem Gesicht wahrgenommen hatte, sie verflog gleich wieder, während Karen kurz nickte, nicht in meine Richtung, sondern zu den Frauen am Nachbartisch, um sich dann zu Kay zu setzen, die in einigem Abstand freie Plätze gefunden hatte. Kay wusste Bescheid, natürlich, aber sie hatte geschworen, das Geheimnis zu wahren – eine Heimlichtuerei, die sie verabscheute, teils weil sie mich für einen Idioten hielt, teils wegen Jimmy, ihres Mannes, der Patricks bester Freund war; und falls unsere Affäre je publik werden sollte, würde Kay allerhand zu erklären haben. Hin und wieder brachte sie deutlich zum Ausdruck, wie sehr sie mich verabscheute, eine echte Bedrohung für unser schäbiges kleines Geheimnis, denn jedermann weiß, wie schmal die Grenze ist, die zwischen Liebe und Hass verläuft, weshalb ein zufälliger Beobachter das eine mit dem anderen verwechseln könnte – mit womöglich katastrophalen Folgen.
*
Meine Mutter hatte anfangs nicht viel für den Fernseher übrig; sie zog es vor, in der Küche zu bleiben und Radio zu hören. Oft sang sie laut mit, wenn Schlager aus ihrer Zeit gespielt wurden – »Mares Eat Oats« etwa oder »What did Delaware, Boys?« –, kam aber ein Liebeslied, hörte sie auf, Kartoffeln zu schälen oder Mehl zu sieben, stellte sich ans Fenster und hörte zu. Ich erinnere mich, dass Andy Williams’ Version von »Can’t Help Falling in Love« zu ihren Lieblingssongs gehörte – gleichsam das Gegenstück zu »I Put a Spell on You«. Willentlich und hilflos jenem womöglich bösen Bann zu verfallen, haftete meiner kindlichen Denkart eine beunruhigende Unschuld an, eine Unschuld, die ich seit jeher aus diversen Gründen betörend fand. Wieder und wieder – hilflos, unweigerlich – drängte ich dorthin, wo selbst Engel Vorsicht walten lassen (»Where Angels Fear to Tread« – noch ein Hit von Andy Williams), um mich gleich darauf schlechten Gewissens, weil ich erneut diesen Fehler begangen hatte, zu fragen, wie ich mich wieder herausdrängen konnte. Nie kam ich dahinter, wie man sich auf angemessene Weise verabschiedet, und ich habe, vielleicht wie meine Mutter, gewartet – denn das Warten kann einem eine grimmige Befriedigung verschaffen, die sich wie Buße anfühlt, auch wenn es keine ist.
Natürlich ist sie unehrlich, diese Art Buße. Wir können auch nicht zulassen, dass unsere sprichwörtlich bessere Hälfte auf Abwege gerät, hilflos in einen zufälligen Fremden vernarrt oder von ihm abgelenkt (auch wenn, da bin ich mir sicher, diese Affären im Falle meiner Mutter pure Fantasie waren, imaginäre Augenblicke mit einem ihrer Idole aus dem Vormittagsprogramm, mit Nachrichtensprechern oder womöglich auch dem einen oder anderen katholischen Priester5). Das Einzige, was wir zu unserer Verteidigung vorbringen können, ist, dass wir wissen, wie sehr der andere fürchtet, nicht von uns, sondern ganz allgemein von irgendwem verlassen zu werden. Es ist ein Schluss, der nach Asche schmeckt, sobald er gezogen wird, aber er lässt sich nicht umgehen, verpasst er unserem reuigen Herzen doch perverserweise einen zusätzlichen kleinen Hieb: Was könnte schließlich besser sein als ein banales und im Grund sinnloses Opfer? Zu bleiben, nicht weil der oder die andere mich braucht, sondern weil er oder sie irgendwen braucht und ich besser als niemand bin. Es dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass Karen auch eine altgediente Büßerin war, die gelangweilte Ehefrau, die ihren Mann niemals verlassen würde, auch wenn sie vermutlich darum betete, dass irgendeine hypothetische andere Frau sie retten möge. So wie ich in den kommenden Jahren immer wieder Anlass fand, mir den perfekten anderen Mann vorzustellen, einen charmanten, fiesen, doch seltsam liebenswerten Kerl, der mit Abercrombie & Fitch-Schal und italienischen Schuhen durch meine Tagträume schlenderte, selbstbewusst, besorgt, letztlich aber so oberflächlich wie irgendein CIA-Agent (gespielt von Cliff Robertson) in einem alten Spionagefilm. Ich habe keine Ahnung, was für eine Frau sich Karen als ihre Retterin erträumte, doch nehme ich an, sie stellte sich irgendwen vor, und sie wusste, wenn diese Fremde nicht bald käme, würde sie niemals mehr entkommen.
*
Etwa eine Stunde nach Annies Serenade wartete ich auf einer Lichtung hinterm Gemeindezentrum auf meine heimliche Geliebte. Die Lichtung war einer unserer speziellen Orte, den wir öfter nutzten: Hier waren wir allein, und sollte irgendwer unterwegs sein in diesem Netz der Wege, das sich zwischen Stadtmitte und dem neuen Bootsteich erstreckte, hörten wir ihn durch das dichte Unterholz näher kommen. Wie gewöhnlich hatten wir das Charolais getrennt verlassen und waren auf unterschiedlichen Routen durch die Stadt gelaufen, vorbei am Schwimmbad und der Lieferzone hinterm Zentrum. Ich war wie stets der Erste, und Karen kam nach, sobald sie wusste, dass die Luft rein war. Kay würde derweil an den Schaufenstern entlangschlendern und Stoff für ein Alibi liefern, falls später eines gebraucht wurde. Dass wir uns entschieden hatten, vorsichtige Ehebrecher zu sein, vorsichtiger als die meisten anderen in der Stadt, war für uns eine Frage des Prinzips, vielleicht auch des Stolzes, und ich zweifle keineswegs daran, dass wir uns beide für schuldig, im Ausleben unserer Affäre aber auch für ziemlich gewieft hielten. In Wahrheit waren wir jedoch nur blauäugig.
Es war ein warmer Tag. An warmen Tagen sah Karen am besten aus; Kälte mochte sie nicht, Regen hasste sie, und dünne Sommerkleider betonten eine Figur, die ich heute im nostalgischen Rückblick mit leichtem Bedauern nur geschmeidig nennen kann. Eine schlanke, eher mädchenhafte Frau Mitte zwanzig mit hellbraunem Haar und einem stets belustigten, forschenden Blick; am besten gefiel mir jedoch ihre Stimme, sanft und melodisch und ohne einen Hauch von Affektiertheit, die mich zu einem Bündel hilfloser Gier reduzieren konnte, sooft sie entschied, »dreckig« mit mir zu reden (was sie hin und wieder tat, auch wenn sie die Wirkung auf mich ein wenig zu offensichtlich genoss). Heute trieb sie allerdings ein anderes Spiel, das uns vertraute Ich-bin-so-eifersüchtig-Spiel, bei dem ich nie genau wusste, wie ich mich verhalten sollte.
»Du solltest dich vor Annie James lieber in Acht nehmen«, sagte sie, sobald sie unter den Bäumen auftauchte und mir gegenüberstand. »Sie ist in festen Händen.«
Ich erwiderte nichts, sah sie nur an und wartete darauf, sie berühren zu können, aber Karen war überraschend ernst geworden. »Sie ist so ein Dummkopf, diese Frau«, sagte sie.
»Wieso?«
»Sie geht jetzt mit Kenny Wilson. Was schon schlimm genug ist. Nur hat Kenny Agnes noch nichts gesagt, und wenn die das herausfindet, wird’s eklig.«
Ich zermarterte mir das Hirn und versuchte, mich an diesen Kenny Wilson zu erinnern, es gelang mir aber nicht, und ich wusste damals auch nicht, dass es sich bei der Agnes, von der die Rede war, um Agnes McCrorie handelte, eine Frau mit trügerisch nettem Gesicht um die dreißig, die sich bereits einen gewissen Ruf erworben hatte. Ich kannte beide nicht, und sie waren mir damals auch egal – ich wollte nur diesen einen Moment, jetzt, mit Karen, in der Frühjahrssonne. »Annie James interessiert mich nicht. Ich will nur dich«, sagte ich, trat einen Schritt näher und legte die Arme um sie – und sie ließ zu, dass ich sie an mich zog, ihr Körper warm und lebendig an meinem, zugleich vertraut und auf eine Weise fremd, von der ich hoffte, es könne ewig so bleiben. Ich berührte ihr Gesicht, und sie legte den Kopf schief, um sich küssen zu lassen, musterte mich dabei aber mit einem kurzen, verzagten Lächeln und murmelte irgendwas, das ich anfangs nicht verstand. Erst später, als wir wieder aufbrechen wollten, uns zu sehr unserer selbst bewusst wie auch der Möglichkeit, jemand könnte unvermutet in unser Versteck stolpern, erst da reimte ich mir zusammen, was ich nur halb gehört hatte, und danach gingen mir ihre Worte noch stundenlang durch den Kopf.
»Aber ich bin auch in festen Händen«, hatte sie gesagt. Irgendwas in diesem Sinne jedenfalls – und wie alle Sünder erlaubte sie sich einen Augenblick des Mitgefühls für jemanden, der, obwohl von ihr grundverschieden, auf gleiche Weise liebestoll und, vorbehaltlich eines so enormen wie unwahrscheinlichen Glücksfalls, ebenso verloren war.
*
Blicke ich heute zurück, sehe ich, dass wir beide, Karen und ich, blauäugig wie wir waren – und fasziniert von den Risiken, die wir eingingen –, sowohl aus Langeweile als auch aus romantischer oder körperlicher Zuneigung handelten. Ich war ein Kneipenhocker, der sich von einem schlechten Deal zum nächsten hangelte, sie eine überdurchschnittlich intelligente Fabrikarbeiterin mit einem ganz und gar enttäuschenden Ehemann, die wusste, dass sie für Corby zu gut war, zugleich aber ahnte, dass sie für irgendwo anders womöglich nicht gut genug sein würde. Natürlich hätten wir es damals nie zugegeben, doch wussten wir beide, dass es, da uns Langeweile und Enttäuschung zusammengebracht hatten, nur eine Frage der Zeit war, bis wir uns auch gegenseitig langweilten und enttäuschten, was zweifelsfrei erklärt, warum ich mich im Lauf der nächsten Wochen immer wieder dabei ertappte, wie ich auf jenen Augenblick wartete, in dem Annie James das Charolais betrat, und dass ich von Zeit zu Zeit trotz Charlottes miesepetrigem Gesicht an Annies Tisch schlenderte, um Small Talk zu machen und nett zu sein. Mir war klar, dass es keinen besonderen Grund dafür gab, warum sie mich als Adressaten ihrer Voodoo-Serenade erwählt hatte. Sie wollte Theater spielen, und ich hatte an jenem Samstagnachmittag zufällig am richtigen Platz gesessen. Ich wusste, in der Geschichte, die Annie sich über die Welt erzählte, kam ich nicht vor – und ich glaube heute auch nicht, dass ich das je wollte –, doch fühlte ich mich unwillkürlich zu ihr hingezogen, weil ich annahm, dass es mit ihrer Wahl eben dieses Songs etwas Geheimnisvolles auf sich hatte. Zudem deutete etwas in der Art, wie sie gesungen hatte, über ihre ursprüngliche, im Wesentlichen ironische Attitüde hinaus. Ihre Freundinnen hatten sie mit Spekulationen darüber aufgezogen, was Agnes McCrorie wohl anstellen würde, sollte sie herausfinden, dass Kenny sie mit einer Teenagerin betrog, und Annies an einen zufällig Anwesenden gerichteter Song war ihre spöttische Antwort darauf gewesen, aber es hatte damit noch mehr auf sich gehabt. Sie sang nur wenige Zeilen, und die erste klang aus ihrem Mund höhnisch und hart, bei der zweiten war irgendwas in ihrer Stimme jedoch weicher geworden, sodass sich I ain’t lying melodischer anhörte: sehnsüchtig, getragen, fast schmerzhaft schön. Ich nehme an, dass sie irgendwo, vielleicht in der Schule, gelernt hatte, wie wirksam die getragene Note war, und sie hatte diesen Song offenkundig schon öfter gesungen, eher für sich selbst als für jemand anderen, bestimmt, um sich keine Kritik anhören zu müssen, zugleich aber auch, um eine gewisse Hoffnung am Leben zu erhalten, die Hoffnung nämlich, dass – wie alle Songs es zu wissen meinen und trotz aller Beweise des Gegenteils – die Liebe wahr ist. Was ich heute weiß, hätte ich damals nicht in Worte fassen können, doch begreife ich jetzt, dass es das war, worauf ich reagierte, diese Hoffnung. Wir alle wollten bloß die Chance, etwas Neues zu tun, etwas, woran unsere Eltern noch nicht gescheitert waren. Ein zufälliges bisschen Glück. Einen sauberen Schnitt. Die Gewissheit, dass all die wohlhabenden Söhne, die Mächtigen und Honoratioren, die unsere Stadt für uns entworfen hatten, nicht zu dem geworden waren, was sie heute sind, weil irgendein naturgegebenes, sie mit vielen Wohltaten segnendes Gesetz dies vorschrieb und uns im Gegenzug zu Unwürdigen erklärte, deren Leben zu Recht unter einem schlechten Stern stand.
*
Von dem Mord hörte ich später im Frühling an einem hellen Sonntagmorgen. Es war gegen zehn Uhr und ich auf dem Weg zum Einkaufen. Ich hatte im Haus meiner Schwester in der Station Road übernachtet; Karen hatte sich fortschleichen und mich dort treffen wollen, aber irgendwas lief schief, weshalb sie nicht kam und ich mich jetzt mit einem alten Sonntagmorgenritual aufzumuntern versuchte, indem ich Orangensaft, frische Brötchen sowie einen Stapel Zeitungen holte, um die Zeit bis zum Mittag totzuschlagen, wenn die Pubs wieder öffneten. Als wir uns trafen, ging es Frank Cronin wohl ähnlich – ein hagerer, etwas zu kumpelhafter Bekannter aus gemeinsamer Schulzeit mit schütterem schwarzem Haarschopf und einer von Tesafilm zusammengehaltenen Kassenbrille, der zu jenem Menschenschlag gehörte, für den die täglichen Sperrstunden, auch wenn er dies noch so sehr mit geschäftigen Aktivitäten und extravaganten Take-aways zu verdrängen suchte, längst zu einem existenziellen Problem geworden waren. Sobald er mich vor dem Sparmarkt sah, eilte er auf mich zu, froh über jede Ablenkung.
»Hallo, Dicko«, sagte er, einen alten Spitznamen benutzend, der mich heute noch zusammenzucken lässt. »Wie geht’s denn so?«
»Bestens«, sagte ich, und er nickte mit Nachdruck, um mir anzudeuten, dass er meine Lüge durchschaute. »Irgendwas los?«
»Nicht viel«, sagte er, um dann wie im Nachklapp noch hinzuzufügen: »Irgendeine Kleine wurde unten auf der Danesholme vor ihrem Haus erstochen.« Er sah mich an. »Kennst sie vielleicht. Annie James. Eine von Charlotte Walshs Freundinnen.«
»Annie James? Wann war das?«
»Freitagabend«, erwiderte er. »Also kennst du sie?«
»Was genau ist passiert?«
Frank sammelte sich, froh, mir ein kleines Drama anvertrauen zu können. »War total verrückt«, sagte er. »Irgendein Typ hat sie nach Hause gebracht, und dann ist aus dem Nichts seine Ex mit einem Messer auf sie los. Einfach so. Hat sechsmal zugestochen und blieb dann stehen, um diesen Typen anzuschreien.« Er schüttelte den Kopf. »Direkt vor ihrem Haus. Vor Zeugen und so.«
»Und – was dann?«, fragte ich. »Geht’s ihr gut?«
Einen Moment lang starrte er mich an, als hielte er das für eine Fangfrage, dann schüttelte er den Kopf. »Scheiße, nein«, sagte er. »Sie ist verblutet. Gleich da auf dem Bürgersteig. Starb, bevor der Krankenwagen kam.«
Ich starrte zurück und konnte nicht so richtig glauben, was er mir sagte. Das Ganze war doch zu offenkundig. Alle hatten gewusst, dass was passieren musste, und jetzt war es passiert. Schweigend standen wir da, eine Minute oder länger, wendeten den Gedanken in unseren Köpfen, dann sah ich ihn an. »Was hat sie gesagt?«, fragte ich.
»Wie?«
»Was hat sie gesagt? Die Freundin.«
Frank machte in diesem Moment ein besorgtes Gesicht, als glaubte er, mir vielleicht zu viel anvertraut zu haben. Als ob mir doch an der Frau gelegen wäre, was aber nicht stimmte, natürlich nicht. Sie war bloß eine Frau aus dem Charolais. »Sie hat den Freund angeschrien«, sagte er. »Nach allem, was ich weiß, hat sie irgendwas gesagt wie: ›Jetzt willste sie wohl nicht mehr küssen, wie?‹ So oder so ähnlich.« Er dachte einen Moment nach, plötzlich selbst betroffen von der Geschichte, die er erzählte. »Scheiße auch«, sagte er, traurig gestimmt und von diesem Detail zugleich leicht beeindruckt. »›Jetzt willste sie wohl nicht mehr küssen, wie?‹«, wiederholte er und schüttelte den Kopf. »Ich meine, echt Scheiße, oder?«
*
Am Abend sah ich Karen im Open Hearth, das unweit vom Haus meiner Schwester lag. Wir kamen getrennt, natürlich, sie mit Kay und ich mit einem Freund, von dem ich wusste, dass ich ihm vertrauen konnte. Eine Weile saßen wir an entgegengesetzten Enden der Lounge, bis wir uns sicher genug wähnten, nach draußen verschwinden zu können – ich zuerst, dann sie, immer in der Reihenfolge –, um auf dem Parkplatz zu reden und zu schmusen. Manchmal konnten wir zu meiner Schwester, meist aber planten wir unser nächstes Stelldichein im Wald oder in ihrem Haus für die Zeit, wenn Patrick Spät- oder Nachtschicht hatte. Auch dafür gab es ein System: An bestimmten Tagen ging ich zu ihr und hielt Ausschau nach dem vereinbarten Signal – Licht, das in einem der oberen Zimmer an- und ausging, die offen gelassene Hintertür, irgendein sichtbar ins Fenster gestellter Gegenstand; es wechselte ständig. Fand ich, was ich suchte, ging ich ins Haus, und sie wartete bei geschlossenen Vorhängen im Wohnzimmer auf mich. Das verlangte allerhand Planung. An diesem Abend aber traf ich sie im Schatten am Rand des Parkplatzes; sie trat auf mich zu und sagte: »Nimm mich in den Arm.« Ich wusste, sie hatte das in einem alten Film gesehen, verstand aber auch, dass ihr irgendetwas Angst machte. Ich legte meine Arme um ihre Schultern, und so blieben wir mehrere Minuten lang schweigend stehen, dachten nicht mal daran, uns zu vergewissern, dass wir nicht beobachtet wurden. Schließlich wand sie sich aus meinen Armen und blickte auf, als wollte sie mir etwas erzählen. Ich wartete. Ich nahm an, dass es mit dem Mord zu tun hatte, mit ihrer Furcht vor einem ähnlichen Schicksal, aber nach einem Moment, in dem sie versuchte, die richtigen Worte zu finden, gab sie auf und wandte sich ab.
»Was ist?«, fragte ich.
»Nichts.«
»Du hast gehört, was passiert ist …«
Sie wirbelte herum. Das Licht einer nahen Straßenlaterne fiel auf ihr Gesicht. »Natürlich habe ich das«, sagte sie. »Aber das hat doch mit uns nichts zu tun …«
»Behaupte ich ja auch gar nicht«, sagte ich. »Ich dachte nur …« Mehr sagte ich nicht, weil ich nicht wusste, was ich dachte. Vielleicht hatte ich aber auch eingesehen, dass das, was ich dachte, banal und ihrer unwürdig war.
Dann lächelte Karen; ein weises, allumfassendes Lächeln, das vermutlich halb real, halb dem Lichteffekt zuzuschreiben war. »Sie war zu unvorsichtig«, sagte sie. »Das waren sie beide. Unvorsichtig – und dumm.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie hatten einfach kein Glück. Niemand hat vorhersehen können, was passiert ist.«
Sie lachte leise und trat ein klein wenig vor, aus dem Licht in den Schatten. »Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied«, sagte sie, wurde wieder sanfter, kam noch näher und lehnte sich an mich.
Ich wusste, ich hätte nichts darauf erwidern sollen, wusste aber auch, dass Jeder ist seines Glückes Schmied Feindesweisheit war, etwas, das die Gutbetuchten verbreiteten, um ihre unangemessene Fortune zu rechtfertigen – und ich konnte nicht an mich halten. »Was glaubst du denn, wie lange das hält?«, sagte ich.
Karen gab keine Antwort – aber ich glaube, in dem Moment begriff sie, vielleicht sogar zum ersten Mal, dass ich nie viel von dem Glück oder dem Schicksal gehalten hatte, nach denen sie ihr Leben ausrichtete –, und gut einen Monat später hörten wir ohne bestimmten Anlass auf, uns zu treffen, drifteten mit dem vagen Gefühl einer Enttäuschung auseinander, ohne die Gründe dafür richtig zu verstehen.
*
Nach so langer Zeit kann ich mich kaum an Karens Gesicht bei unserer letzten Begegnung am Bootsteich erinnern, als uns beiden aufging, dass es für uns nichts mehr zu planen gab; Annie James allerdings sehe ich heute noch so deutlich vor mir, als wäre sie erst gestern gestorben – und ich kann mir nicht erklären, warum mir gerade dieser Tod derart zusetzt. Im Grund habe ich Annie kaum gekannt, und es gibt andere Morde, andere Verhängnisse aus jener und aus späterer Zeit, die erinnert werden wollen. Trotzdem ist mir fast vier Jahrzehnte später gerade diese Unglücksgeschichte geblieben. Meine Schwester und einige Freundinnen aus jener Zeit kennen Annie noch als ein hübsches, liebenswertes, etwas pummeliges und ziemlich albernes Mädchen, ich aber sehe eine unscheinbare, recht verzweifelte junge Frau vor mir, eine Frau ohne besondere Merkmale, die Augen ausgenommen, diese hellen, überaktiven Augen, die an jenem Tag aufleuchteten, als sie sich im Charolais über die Rückenlehne beugte und mir einige Zeilen aus einem von Madeleines Lieblingsliedern vorsang. Zweifellos ist diese Verbindung nicht ohne Bedeutung, schließlich war Madeleine meine erste große Liebe, und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ihre Augen aufleuchteten, wenn das Orchester leiser wurde und Nina Simones Stimme einsetzte. Doch ist da noch was anderes. Dieses leicht Fieberhafte in ihren beiden Augen und mein Gefühl, dass sie beide das Leben, in das sie hineingeboren worden waren, so enttäuschend fanden wie ich, weshalb sie sich in einer verzweifelten Anstrengung immer wieder darum bemühten, die Welt mit jedem Schritt neu zu erfinden. Ich kannte Madeleine eigentlich kaum – ich war zu jung und bewunderte sie zu sehr –, ebenso wenig wie ich Annie kannte, aber das ist nicht weiter wichtig. Wichtig ist allein die Geschichte. Die von Annie war keineswegs so ungewöhnlich, aber sie war real, denn was ihr passierte, geschah jemandem, den ich mehr oder weniger gut kannte und um die ich nach ihrem Tod länger und heftiger trauerte, als zu erwarten gewesen wäre. Es mag sentimental klingen, dies in Worte zu fassen, doch wir sind durch die Toten gesegnet, und auch wenn wir noch so sehr protestieren, wissen wir, dass es stimmt. Sie hinterlassen Räume in unserem Leben, die für manch einen von uns dem Geheiligten so nahekommen wie sonst nichts. Diese Menschen sind da, und dann sind sie fort, und nach einer Weile bemerken wir daran eine gewisse Eleganz – die Eleganz etwa eines Zaubers, wenn der Magier jenen Verschwindetrick vorführt, den wir alle früher oder später einmal bewerkstelligen müssen.
Niemand aus dem mir verbliebenen Kreis von Charolais-Bekannten erinnert sich noch an Agnes McCrorie. Diese Wahl treffen wir nicht selbst, und sie hat nichts mit dem abgegriffenen Klischee zu tun, der Kriminelle habe es nicht verdient, dass man sich an ihn erinnert. Ich nehme an, bei dieser Art Ereignis teilen so einige meiner alten Bekannten mein Es-hätte-leicht-auch-mich-erwischen-können-Gefühl. In einer – und nur in einer – Hinsicht hatte Agnes allerdings mehr Glück als manch einer von uns: Auch falls sie sich kaum an das erinnern sollte, was vorgefallen war, so wusste sie doch, worin ihr Vergehen bestand, denn es gab Zeugen, und sie wurde bestraft. Nicht wenige werden dieses Wissen nie erlangen: Wir durchleben unsere trunkenen, gepeinigten Tage mit der vagen Ahnung, irgendein frevelhaftes Ereignis lauere in den dumpfigen Tunneln einer zwanzig, dreißig Jahre zurückliegenden Zeit, diese düstere Ahnung, die nur selten von einem plötzlichen Lichtstrahl erhellt wird, der ein blutiges Gesicht aufblitzen lässt, eine Messerklinge oder jene seltsame Schwere, die stets dann einsetzt, wenn die brutale Gewalt fast, aber nicht vollständig illuminiert wird. In manchen Fällen dreht sich diese bruchstückhafte Erinnerung um eine Tat, die im eigentlichen Sinne nicht als strafbare Handlung einzuordnen ist; die damit zusammenhängende Scham aber hängt nicht mit dem Ungesetzlichen zusammen, gilt vielmehr der Sünde. Früher habe ich geglaubt, der Begriff der Sünde sei etwas, das von jenen Sonntagen und Festtagen übrig blieb, an denen meine Mutter mich zur Messe mitnahm und wir die adrette Dame mit dem blauen Kopftuch baten, für uns zu beten, doch ich glaube das nicht mehr. Heute denke ich, wenn uns irgendwas von anderen Tieren unterscheidet, im Guten wie im Bösen, dann ist es die Sünde. Die Sünde bindet uns an unsere Mitsünder, sie macht uns zu sozialen Wesen; und die einzigen Menschen, die ich fürchte, sind jene, die meinen, wahrhaft unschuldig zu sein, jene, die annehmen, allein zum Wohle aller zu handeln, oder die glauben, nicht anders zu können.
Daher: Nicht Rechtschaffenheit löschte die Mörderin aus unserem Gedächtnis, sondern die schlichte Tatsache, dass sie, wie die meisten Mörder, nicht sonderlich interessant war. Und an eben diesem Punkt trennen sich die Wege im wahren Leben und jene in der Welt der großen Leinwand: In Filmen über Serienmörder sind selbst bei Agatha Christie die Täter ein Nexus der Faszination, oft attraktiv, auch charismatisch, ein überlegener Verstand oder ein Mensch mit wilderer Seele als all die übrigen Figuren der jeweiligen Erzählung. Im Leben dagegen sind er oder sie meist langweilige, gar armselige Individuen, jemand, bei dem wir uns gedrängt fühlen, den Blick abzuwenden, leise, fast reflexhaft, ein wenig beschämt darüber, dass wir überhaupt hingeschaut haben, und leicht beleidigt angesichts ihrer oder seiner schluffigen Gewöhnlichkeit. Im Leben – sofern wir denn überhaupt Seelen haben und unsere vermeintliche Unschuld aufzugeben vermögen – sind es die Dahingeschiedenen, die unsere Aufmerksamkeit verlangen, die Dahingeschiedenen, die durch das Verbrechen an Glamour gewinnen, die für einen Moment ins Rampenlicht rücken, um interessanter und komplexer zu werden, als sie je in ihrem wunderbar verkürzten Leben zu wirken vermochten. Es ist ein wenig wie bei diesem Kinderspiel – unsere Version davon hieß Toter fällt –, bei dem sie vorgeben, getroffen oder erschossen worden zu sein, um sich dann in einem überaus intensiven Moment wie von außen zu sehen, realer, lebendiger, gleichsam durch einen Lichtblitz vervollkommnet, während sie für einen Moment jenseits von Glück und Schicksal verharren, ehe sie die Pose des Sterbenden einnehmen und sich dorthin fallen lassen, wo die mit Uhren gemessene Zeit aufgehoben ist und jedermann Gnade finden kann. Es ist ein notwendiges Spiel, eine kindliche Version der Buße, und ich wünsche mir, Annie hätte, als sie zu Boden fiel und vor der Tür zum Haus ihrer Mutter verblutete, in Gedanken jenes Kinderspiel spielen können, nur für einen Augenblick, von der Gnade berührt und sich der Hitze nicht länger bewusst sowie des Lärms jener Unglücksgeschichte, aus der sie gerade entlassen worden war.
4New Towns wurden nicht von ortsansässigen Behörden verwaltet, sondern von einer eigens ernannten Entwicklungskommission.
5Ihr Liebling war Franchot Tone, ein hochgewachsener, attraktiver Absolvent der Cornell University, dessen Ehe mit Joan Crawford einer der Gründe für die lebenslange Fehde der Crawford mit Bette Davis war. »Sie hat ihn mir weggeschnappt«, sagte Davis später. »Sie war eiskalt, wild entschlossen und absolut skrupellos. Ich habe ihr das nie verziehen und werde es ihr auch nie verzeihen.«
Erste Abschweifung:Über glamourie
I put a spell on you. In gewisser Hinsicht sind dies nur Worte, bloße Rhetorik, wie sie in nahezu jedem Love Song vorkommt, in anderer Hinsicht aber bergen sie etwas Schönes und Gefährliches, und es gibt Momente, in denen ich glaube, die Sängerin könnte durchaus fähig sein, eine Art Voodoo-Zauber auszuüben. In einer Zeit mehr oder minder vorfabrizierten und betäubenden Entertainments – das Kürzel dafür lautet Prominenz – mag das abgedroschen klingen; längst werden wir geradezu genötigt, den alten Glamour, die Magie zu vergessen oder uns darüber zu mokieren, über die diversen Spielarten von Schönheit und Manie, die unsere Seele zugleich bewhape6 und bestürzen konnten. Heute kann eigentlich jeder, der das nötige Geld besitzt, hübsch genug oder auch nur gierig genug ist, »prominent« werden, und da Prominenz kaum mehr als die Kommerzialisierung einer Maske bedeutet und vor allem finanziell verstanden wird (wir denken an Daisy, deren Stimme, wie Gatsby meint, »nach Geld klingt«), konnte der alte Zusammenhang zwischen glamourös und magisch (im vollen Sinne) nahezu vollständig verschwinden. Niemanden kümmert es heute noch, dass das Wort Glamour dieselbe Etymologie wie das Wort Grammatik hat (womit früher jede Form von Schreiben gemeint war: eine Aktivität, die an sich bereits von der Aura des Magischen umgeben ist, vor allem in Gesellschaften, in denen die meisten Menschen des Schreibens noch unkundig sind) oder wie das französische grimoire, was ein Buch der Bannflüche und Zaubersprüche meint, ein Buch mit hochspezialisierten Texten also, die, wenn sie von der richtigen Person adäquat ausgesprochen werden, die bekannte Welt verändern können.
I put a spell on you. Genau das war es, was Glamour einst bewirkte, er verzauberte – und jene, die diesen Zauber woben, konnten durchaus unattraktiv sein, unvollkommen, arm, in gewisser Weise sogar abstoßend, war ihre Macht doch wahrhaft mysteriös und gänzlich unerklärlich. Kein Hochglanz, kein offenkundiges Narrativ. Jeder kann eine Geschichte erzählen, jenes Schreiben aber, dem Glamour anhaftet, hat mit solch linearen oder logischen Dingen wie einem Plot nichts zu schaffen. Im Grunde ist es letztlich ein Mysterium, bedeutet gar bewilderment7 – und eben das fehlt Prominenten. Bis auf wenige Ausnahmen ist es zudem das, was unsere Konsumgesellschaft geschickt zu meiden weiß. Wenn wir den Fernseher einschalten oder die Spielekonsole wissen wir, dass wir unterhalten werden, und wir wissen auch, dass diese Art Entertainment der Gegensatz zu jeglichem Mysterium ist. Plötzlich ist es zu hell im Haus, und wir sind alle keine Kinder mehr, doch was macht das schon? Sinnlos, dem Actionhelden mit seinen vom Skript vorgeschriebenen Witzeleien widerstehen zu wollen, die nur deshalb witzig sind, weil sie genau den Erwartungen entsprechen, wie man auch die »am besten kalt servierte« Gerechtigkeit schon kennt, für die er am Schluss sorgt, wenn ein loses Ende nach dem anderen fein säuberlich verknüpft wird. In den ersten anderthalb Stunden erlaubt man sich noch, diese Gerechtigkeit (womit nichts anderes als der Schluss gemeint ist) herbeizusehnen, doch wenn das Ende kommt, hat man es gleich wieder vergessen. Sicher, die Filme mit Marlene Dietrich oder Louise Brooks, die uns verzaubern, kennen auch einen Plot, Figuren und vom Drehbuch vorgegebene Doppelbödigkeiten, doch wird all das von uns höflich ignoriert. Entscheidend ist allein der Moment oder vielmehr jene Abfolge atmosphärischer Momente, in denen die Göttin auftritt, vom Entertainment deutlich unterschieden, ihr Mysterium intakt. Wen kümmert da das Drehbuch? Wen die losen Enden? Wird der Zauber gewoben, wird das Drehbuch bedeutungslos, und wir gehen einen anderen Vertrag mit der Welt ein, werden in das versetzt, was im Altschottischen glamourie heißt, in jenen verzauberten Zustand, in dem alles, auch das einfachste Ding, das simpelste Ereignis, voll magischer Möglichkeiten steckt. Glamourie bedeutet eine andere Weise des In-der-Welt-Seins, eine plötzliche, oft beängstigende Offenheit, die Seele offen wie die einen Spaltbreit geöffnete Tür, um es mit Emily Dickinson zu sagen, die physische Welt unmittelbar, vertraut und erotisch, mit neuer Energie belebt, mit neuem Licht, und zugleich wunderbar gefährlich.
Und doch, Prominenz beiseite, besitzen wir tief in uns verborgen vielleicht alle ein wenig glamourie