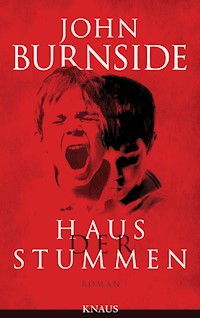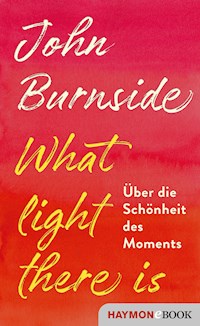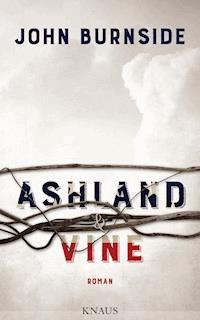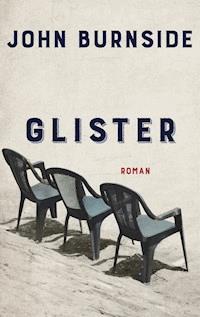
2,99 €
2,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein magisch geheimnisvolles Buch, das in abgründigen Bildern eine Parabel unserer Zeit erzählt.« Hamburger Abendblatt
In einer trostlosen englischen Kleinstadt verschwinden immer wieder Jungen spurlos. Die Polizei behauptet, dass es sich bei den Kindern nur um verantwortungslose Ausreißer handelt. Nur der Polizist Morrison hat etwas Schreckliches gesehen – doch er schweigt. Aber der 15-jährige Leonhard will unbedingt herausfinden, was mit seinen Freunden passiert ist, und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2010
3,9 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Lob
Das Leben ist größer
I - Das Buch Hiob
Homeland
Copyright
Dann schweig. Wie willst du sicher sein, dass nicht ein ganz eigenes, lebendiges, denkendes Wesen unsichtbar und unantastbar just dort steht, wo du jetzt stehst - und auch, wenn du’s nicht willst? In deinen einsamsten Momenten, ist dir nicht manchmal bange, dass jemand dich belauscht?
Herman Melville Moby-Dick; oder: Der Wal; Kapitel 108: Ahab und der Zimmermann
Auf diesem Sarge trieb ich beinah einen Tag und eine Nacht dahin, auf einem weichen Meer, so lind wie eine leise Totenklage. Die Haie, sie glitten harmlos nun vorüber, als wären ihre Rachen fest verschlossen; die wilden Habichte der See, sie schwebten mit verhüllten Schnäbeln über mir. Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher, näher und nahm mich schließlich auf. Es war die umherirrende Rachel; auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nur eine weitere Waise.
Herman Melville Moby-Dick; oder: Der Wal; Epilog Übersetzung von Matthias Jendis
Das Leben ist größer
Wo ich jetzt bin, kann ich noch die Möwen hören. Alles andere verklingt, wie ein Traum gerade dann verklingt, wenn man aufwacht und sich an ihn erinnern will, nur die Möwen sind noch da, wild und heiser krächzend wie immer. Zu Tausenden wogen sie auf und ab und schreien gellend über die Landzunge, laut und ohne Unterlass, weshalb ich nur sie hören kann, sie und ein letztes, fahles Echo der über die Strandkiesel spülenden Flut, ein beharrliches Grollen, das unter dem Gerufe dieser Geistervögel liegt, die ich kaum wahrnahm in dem Leben, das ich hatte, ehe ich durch den Glister ging. Mehr ist von diesem alten Leben auch nicht geblieben: Vögel, die in lauten Schwärmen hungrig über die Landzungen flirren, kaltes, graues Wasser, das ans Ufer schlägt. Nichts weiter. Kein anderes Geräusch und nichts zu sehen als das weite, reine Licht, in das ich aus freiem Willen immer wieder aufs Neue am Ende einer Geschichte trete, die ich bereits zu vergessen beginne.
In jener Geschichte heiße ich Leonard, und solange sie geschah, dachte ich, das Leben sei eine Sache und der Tod eine andere, aber das dachte ich nur, weil ich noch nichts über den Glister wusste. Jetzt ist diese Geschichte zu Ende. Ich will sie in Gänze erzählen, auch wenn ich schon an einen Ort entgleite, der vor dem Nennen und Vergessen von Namen liegt. Ich will sie in Gänze erzählen, auch wenn ich sie dabei vergesse, um durch das Erzählen und Vergessen jenen zu vergeben, die darin vorkommen, auch mir selbst. Denn dort beginnt die Zukunft: im Vergessenen, in dem, was verloren ist. Damals, in Innertown, klebte auf den alten Sirupdosen, die wir immer im Eckladen kauften, ein Etikett mit einem Bild von einem Löwen, tot und verwesend im Staub, und ein Schwarm Bienen strömte durch die Schwären und Schatten in seinem Fell, um Honig aus seinen Wunden zu ernten. Ich habe dem Bild vertraut. Ich wusste, es stimmte - denn es gab eine Zeit, in der die Menschen glaubten, dass dieses dunkle Loch, diese Wunde wirklich der Ort war, von dem der Honig stammte. Sie hatten recht, denn alles wird verwandelt, alles wird, und dieses Werden ist die einzige Geschichte, die nie zu Ende geht. Alles wird zu allem anderen, in jedem Augenblick, immerzu. Das weiß ich jetzt - und hier, wo ich bin, gehe ich diese Geschichte immer wieder durch, zähle die Ereignisse auf, an die ich mich erinnere, und kartografiere die Stellen und Schatten, die das Vergessen zurückließ, klammere mich an Strohhalme, als verginge die ganze Welt, als würde nicht nur ich, sondern das Leben selbst in die Vergangenheit entschwinden.
Doch nichts entschwindet, auch ich nicht. Nichts entschwindet in die Vergangenheit, es wird höchstens vergessen und so zur Zukunft. Es existiert weiterhin an jenem Ort, den manche Menschen in Innertown das Nachleben nennen - obwohl sie in ihrem Herzen wissen, dass es kein Nachleben gibt, weil es kein Danach gibt. Immer ist Jetzt, und alles - Vergangenheit und Zukunft, Problem und Lösung, Leben und Tod -, alles ist gleichzeitig hier, in diesem Moment. Der Ort aber, an dem ich bin, hat viele Namen, je nachdem, welche Geschichte man glaubt: Himmel, Hölle, Tir Na Nog oder Traumzeit. Dabei wissen wir alle, es ist weder dieses noch jenes, sondern nur der Ort, an dem Geschichten beginnen und enden. Und jetzt beginnt meine Geschichte aufs Neue, ein letztes Mal, noch während sie verglüht. Um mich an sie zu erinnern - um sie zu vergessen - brauche ich mir nur einen Mann im Wald vorzustellen, und schon entfaltet sich die Geschichte wie eine jener Papierblumen, die in dem Augenblick, in dem man sie in eine Schüssel mit Wasser gibt, in einem unfassbar prächtigen Farbenspiel aufgehen: Seeblume, Mondblume, Erdblume, Blumen in den Farben des Himmels, Blumen von der Farbe des Blutes. Ich kenne diese Geschichte. Mir ist, als hätte ich sie schon hundertmal erzählt, und jedes Mal, wenn ich sie erzähle, findet ein weiteres kleines Detail seinen Platz. Irgendwann werde ich sie ein letztes Mal durchgehen, und danach verlasse ich diesen Ort. Denn was auch von mir übrig sein mag, es wird eine neue Geschichte beginnen oder, wenn schon keine neue Geschichte, dann doch zumindest eine Variante jener einen Geschichte, die schon immer geschieht.
So wie ich es sehe, hat diese Geschichte ein eigenes Leben. Auch eine eigene Wahrheit, die allerdings nicht jedermann erkennt. Ständig verändert sie sich und entgleitet uns. John, der Bibliothekar, erzählte mir einmal von dieser Idee, die irgendwer gehabt hat, die Idee vom«unzuverlässigen Erzähler». Er fand sie ziemlich lustig. Als wären Geschichten Ansammlungen von Tatsachen, als wäre die Geschichte, die wir leben, bloß eine Aneinanderreihung von Tatsachen: ein A, das ein B ausschließt, ein Y, das ein Z nach sich zieht. John, der Bibliothekar, sagte oft, in Hinblick auf Zuverlässigkeit sollten wir uns weniger um den Erzähler, sondern mehr um den Autor sorgen. Womit er meiner Ansicht nach Gott, das Schicksal oder irgendwas dergleichen meinte. Doch bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm zustimme. Vielmehr glaube ich, dass die Geschichte und nicht der Erzähler unzuverlässig ist - außerdem glaube ich nicht, dass es überhaupt so etwas wie den einen Autor gibt. Es gibt nur eine Geschichte, die immer weitergeht. Manchmal hat man etwas zu erzählen, manchmal nicht. Ich glaube, jeder, der mag, kann das Erzählen übernehmen, doch das hat nicht den geringsten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte.
Das Leben ist größer. Wenn meine eigene Variation dieser einen Geschichte zum letzten Mal aufs Neue beginnt, kurz bevor sie vergessen wird, könnte sie zur perfekten Version werden, zu einer wahren Geschichte, die ein für alle Mal erzählt wird. Wenn das geschieht, dann wird alles verstanden. Alles wird vergeben. Um wieder zu beginnen, um endlich zu vergessen, brauche ich mir nur einen Mann vorzustellen, der allein in einem vergifteten Wald steht - nicht damals, als ich ihn dort sah, sondern früher, in einem Moment, in dem sein Geheimnis noch gewahrt war. In dieser Geschichte heiße ich Leonard, aber ich bin nicht der Mann im Wald. Ich bin ein Junge, der still aus jener Welt verschwindet, die er kannte und die er bereits aufgehört hat zu kennen, mehr oder weniger absichtlich. Der Mann im Wald ist Morrison, Innertowns einziger Polizist. Ehe ich ihn auf immer vergesse, findet er die Hölle oder seine Erlösung, die Welt aber, wie er sie kennt, wird verschwunden sein. Was nicht weiter schlimm ist, auch wenn dies keiner von uns weiß, als die Geschichte beginnt.
I
Das Buch Hiob
Homeland
Am Anfang arbeitet John Morrison in seinem Garten. Nicht im Garten der Polizeidienststelle, den er schon lange vernachlässigt, auch nicht im kurz nach seiner Heirat gepachteten Schrebergarten, sondern im richtigen, dem einzigen Garten, den er im Stillen gern einen Schrein nennt. Ein heiliger Ort, wie etwa der Garten in einem mittelalterlichen Auferstehungsbild. Für jeden zufälligen Passanten sieht er wie eine mit Blumen und unnützem Plunder übersäte Wiese aus, die sich gleich oberhalb der Güterstrecke auf einer Lichtung mitten im vergifteten Wald ausbreitet, doch aus ebendiesem Grund kann auch niemand die wahre Bedeutung des Gartens erahnen. Morrison hat ihn selbst angelegt und kümmert sich seit sieben Jahren darum: ein ordentliches Rechteck mit Mohnblumen und Nelken, hier und da mit geschliffenen Glasscherben und Steinen verziert, die er auf langen Spaziergängen durch Innertown und das umliegende Ödland sammelt, während er vorgibt, seinen Pflichten nachzugehen und doch nur die Taschen seiner Polizeiuniform mit wertlosem Tand füllt. Natürlich hat er eigentlich längst keine Pflichten mehr, jedenfalls keine, an die er glauben kann. Brian Smith hat dafür gesorgt, vor Jahren schon, als Morrison den einen großen Fehler seiner Laufbahn beging - den einen großen Fehler seines Lebens, abgesehen von der Heirat.
Das war an jenem Tag gewesen, an dem ihn Smith überredete, den ersten Vermisstenfall in Innertown zu verheimlichen. Mittlerweile werden fünf Jungen vermisst, und Morrison schämt sich fast, auf die Straße zu gehen. Dabei weiß kein Mensch über die Lüge Bescheid, über den Schwindel, den er ihnen aufgetischt hat. Natürlich wollen die Leute wissen, wohin die Kinder von Innertown verschwunden sind, doch an ihn stellt niemand besondere Erwartungen, sieht man einmal von den Familien der vermissten Jungen ab. Sie wissen, ihm fehlen die Mittel und die nötige Schulung, die Jungen aufzuspüren, und sie wissen auch, dass sich niemand außerhalb ihres vergifteten Areals voller Industrieruinen und Küstengestrüpp auch nur einen Deut darum schert, was mit den Kindern von Innertown geschah. Selbst die Familien geben nach einer Weile auf, versinken in stumme Verwirrung oder verfallen der Apathie und dem Sherry. Nach mehr als einem Jahrzehnt schwindender Hoffnungen für die Stadt und ihre Kinder sind die Menschen fatalistisch geworden und streben nur noch höchst gleichgültig nach der Zuflucht, die sie einst in eher anspruchslosen und meist recht vagen Vorstellungen von jenem bescheidenen Glück gesucht haben, das ihnen von klein auf in Aussicht gestellt worden ist. Manche ziehen es vor, wenigstens nach außen hin an jene offizielle Interpretation der Ereignisse zu glauben, die Morrison mit tatkräftiger Unterstützung von Brian Smith verbreitet hat. Laut dieser Version der Geschehnisse, einer Geschichte voll praktischer und unwahrscheinlicher Zufälle, haben die Jungen, unabhängig voneinander und ohne irgendwem auch nur ein Wort zu sagen, Innertown aus freien Stücken verlassen, um in der großen weiten Welt ihr Glück zu suchen. Manche finden diese Geschichte glaubwürdig und sagen sich, so sind Jungs nun mal. Andere behaupten, sie klinge weit hergeholt; außerdem halten sie es für höchst zweifelhaft, dass diese fünf aufgeweckten Kinder, Jungen von etwa fünfzehn Jahren mit Familie und Freunden, sich plötzlich und ohne Vorwarnung auf und davon gemacht haben sollen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es wiederum welche, die meinen, dass die Jungen ermordet wurden und vermutlich irgendwo inmitten der Trümmer der alten Chemiefabrik zwischen Innertown und dem Meer begraben liegen, dort, wo ihre verstümmelten Leichen rasch verrotten und keine Spuren hinterlassen, die sie von toten Tieren oder sonstigem namenlosen Aas unterscheiden, auf das man dort draußen ständig stößt. Diese letztere Gruppe wird manchmal ruhelos, meist nach einem weiteren Verschwinden. Man verlangt vollständige Aufklärung und will, dass unabhängige Beamte offizielle Ermittlungen durchführen. Briefe werden geschrieben und Anrufe gemacht, aber nichts geschieht.
Gewöhnlich jedoch geht die Stadt ihren eigenen Geschäften nach, auch wenn es dieser Tage den Anschein hat, als wäre der langsame Verfall ihr einziges Geschäft. Morrisons Aufgabe besteht natürlich darin, seine Runden zu drehen, Präsenz zu zeigen und den Eindruck zu erwecken, in Innertown gälten Recht und Gesetz. Das wird von ihm erwartet: gesehen zu werden - aber Morrison hasst es, gesehen zu werden, er wäre gern unsichtbar, würde am liebsten einfach verschwinden; und an diesem warmen Samstagnachmittag Ende Juli ist er draußen in seinem geheimen Garten, rupft und jätet Unkraut, damit die wenigen Blumen, die er letztes Frühjahr gepflanzt hat, nicht von Nesseln und Gras erstickt werden. Anfangs war dieser provisorische Schrein Mark Wilkinson gewidmet, dem ersten Jungen, der verschwand, jenem also, den Morrison selbst gefunden hat. Später dann wurde er ganz allgemein zu einem Denkmal für die verlorenen Jungen, wo immer sie nun auch sein mochten. Niemand sonst weiß von diesem Garten, und Morrison ist immer nervös, wenn er herkommt, fürchtet, ertappt zu werden, oder jemand könnte erraten, was all dies zu bedeuten hat. Der Schrein ist gut versteckt, denn das Ereignis, an das er erinnert, geschah, wie es sich für derlei Vorfälle geziemt, an diesem verborgenen Ort oder doch irgendwo in der Nähe. Einmal hatte man den Garten zertreten und zertrampelt, die Blumen herausgerissen, Glas und Steine verstreut, doch vermutete er gleich, dass es sich bloß um gewöhnlichen Vandalismus handelte. Ein paar Kids aus Innertown waren auf sein Kunstwerk gestoßen und hatten es, ohne auch nur einen Moment nachzudenken, auf jene routinierte Art zerschlagen, in der die Kids von Innertown alles angehen, aber Morrison war sich ziemlich sicher, dass sie gar nicht begriffen hatten, was der Schrein bedeutete, weshalb er ihn einfach wieder aufbaute, Pflanze um Pflanze, Stein um Stein, bis er vielleicht sogar noch schöner war als zuvor. Sooft er kann, kommt er her, um nach dem Rechten zu sehen. Und wenn nachts wieder ein Junge verschwindet, vergrößert er den Garten ein wenig, setzt ein paar weitere Pflanzen ein und verteilt einige neue Häuflein Steine und geschliffenes Glas.
Die besten Steine findet er draußen am Stargell’s Point, längst seine Lieblingsgegend, weil niemand sonst da hingeht. Selbst die Kids meiden den Ort. Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass das ganze Land unrettbar verpestet ist, vergiftet von unzähligen Sickergruben, von jahrelang fließenden Fabrikabwässern, auch wenn niemand genau weiß, wie schlimm die Verseuchung in manchen Gegenden eigentlich ist - Stargell’s Point aber gilt seit jeher als schwarzes Loch, schon in der guten alten Zeit, als man sich noch mit Macht einredete, dass die Chemiefabrik im Grunde genommen doch sicher sei. Das glaubte man, weil man es glauben musste: Innertowns Wirtschaft hing fast vollständig von der Chemiefabrik ab. Noch wichtiger aber war, dass es Leute in Outertown gab, oben in den großen Häusern, denen daran lag, dass alles möglichst ruhig und ohne viel Theater ablief. Die Einwohner von Innertown, jene also, die tatsächlich in der Fabrik arbeiteten, waren von Anfang an auf die Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen worden, die sie bei ihrer Arbeit zu beachten hatten, doch war ihnen immer wieder gesagt worden - vom Konsortium, vom Sicherheitspersonal, von allen maßgeblichen Stellen -, dass die Gefahr nur minimal sei. Sie hatten sich in Sicherheit gewogen, weil sie nirgendwo anders hinkonnten, und sie wollten den Managern und Politikern glauben, weil sie sonst niemandem trauen konnten. Natürlich gaben sie sich größte Mühe, überzeugt zu sein. In der Anfangszeit schmuggelten einige Leute sogar Tüten mit dem Zeugs nach Hause, das sie in der Fabrik herstellten, um es im eigenen Garten zu verteilen. Es war ein Glaubensakt, vollkommen pervers, doch deshalb, hofften sie, umso mächtiger.
Später, als es schon zu spät war, begriffen sie allmählich, was wirklich vor sich ging. Sie hörten Gerüchte von Bestechungen an hoher Stelle, von anonymen Todesdrohungen gegen mögliche Nestbeschmutzer; sie hörten, dass das Konsortium Beziehungen zu einflussreichen Leuten in den angeblich unabhängigen Firmen pflegte, denen man das Wohlergehen und die Sicherheit der Fabrikarbeiter anvertraut hatte, doch wussten sie nicht, was sie dagegen unternehmen sollten. Einige Jahre nach Morrisons Schulabschluss hatte die Fabrik endgültig die Tore geschlossen, doch stehen ihre Ruinen noch immer draußen auf der Landzunge und säumen die ganze Ostseite von Innertown, Hektar um Hektar nutzloses Bauland, von den leer geräumten Verwaltungsgebäuden an der Kreuzung East Road und Charity Street, an einer Reihe riesiger, widerhallender Brennöfen, Lagerhäuser, Abfallbeseitigungsanlagen und verfallener Produktionsstätten vorbei bis hinab zu den Ladekais am Ufer, wo große Tanker am Rand des schleimigen, öligen Fördewassers verrosten. Überall fallen die Auswirkungen der Fabrik ins Auge: Alleen toter Bäume, schwarz und knochig entlang der alten Schienenstränge und Zufahrtsstraßen; große Haufen schwefelhaltigen Gesteins, um die herum Pfützen mit Abwasser in der Sonne verdunsten. Ein paar verwegene Fischer haben mutierte Meeresfauna gefunden, die dort an Land gespült worden ist, wo man einst zigtausend Tonnen Gott weiß welchen Inhalts an Bord riesiger Schiffe verlud, und manche Leute behaupten, sie hätten draußen in den letzten verbliebenen Wäldern bizarre Tiere entdeckt, die nicht krank waren und nicht verendeten mit ihren übergroßen Köpfen und aufgequollenen, verrenkten Leibern, die aber auch irgendwie nicht richtig aussahen.
Der überzeugendste Beweis für die unheimlichen Vorgänge auf der Landzunge war jedoch die Tatsache, dass es den Leuten selbst nicht gut ging, solange die Fabrik existierte. Urplötzlich traten unerklärliche Häufungen seltener Krebserkrankungen auf. Kinder litten unter grässlichen Gebrechen und entwickelten seltsame Verhaltensstörungen. Die Zahl seltener oder unheilbarer Leiden wuchs unverhältnismäßig stark an; außerdem verzeichnete man eine unerklärliche Zunahme an Depressionen, eine wahre Blütezeit dessen also, was in alter Zeit der reinste Irrsinn genannt worden wäre. Auch Morrisons Frau wurde krank im Kopf, und selbst heute kann niemand sagen, was ihr fehlt. Sie sei eine Alkoholikerin, lautet die grausamste Erklärung, dabei hat sie auch früher schon getrunken und ist doch immer fit wie ein Turnschuh gewesen.
Heutzutage gibt man allgemein der Fabrik die Schuld an diesen Problemen, doch fehlt den Leuten die Kraft, dagegen vorzugehen. Die Fabrik war ihr Leben, ihre beste Hoffnung gewesen, und alle kannten ihre Geschichte, zumindest die offizielle Version. Jeder konnte erzählen, wie vor dreißig Jahren ein Konsortium - es hatte irgendeinen ausgefallenen Namen, wurde aber immer nur«das Konsortium»genannt -, wie also ein ebenso nationales wie internationales Konsortium agrarwirtschaftlicher und sonstiger Unternehmen begann, diverse Produkte herzustellen, auch wenn sich heute niemand mehr daran erinnert und damals offenbar auch gar nicht wusste, welche Chemikalien hergestellt und wofür genau sie eigentlich verwendet worden waren. James, Morrisons Vater, hat in der Fabrik gearbeitet und immer darauf bestanden, dass es sich nur um harmlose agrarwirtschaftliche Erzeugnissehandelte: Dünger und Pestizide, Fungizide, Wachstumsbeschleuniger und Wachstumshemmer, komplizierte Molekülketten, die in Wurzeln oder Stängel eindrangen und den Wuchs der Pflanzen beeinflussten, ihre Blütezeit und den Samenansatz. Andere Leute dagegen meinten, es sei viel schlimmer gewesen: Schon möglich, dass der größte Teil dessen, was auf der Landzunge produziert wurde, ziemlich harmlos gewesen sei, doch hätte es spezielle Einrichtungen gegeben, tief in der Fabrik verborgen, in denen chemische Waffen hergestellt oder gelagert worden seien. Schließlich, so behaupteten sie, sei es nicht weiter schwierig, eine Substanz in eine andere zu verwandeln: Man breche hier eine Molekülkette auf, füge dort eine neue Verbindung an, und was ein begrenzt schädliches Herbizid gewesen war, wurde zu einer Kriegswaffe; man ändere die Temperatur, die Struktur oder den Druck, und was man im Haushaltswarenladen kaufen konnte, war in ein Kampfgift verwandelt worden. Bis auf den heutigen Tag behaupten diese Leute, es gebe auf dem Fabrikgelände versiegelte Gebäude, in die man nicht einmal die Sicherheitsinspektoren eingelassen habe.
Als einige Zeit später die ersten Kinder verschwanden, entwickelte man neue Theorien: Die Jungen seien auf eine dieser geheimen Anlagen gestoßen und von einer tödlichen Gaswolke erfasst worden; oder man habe sie für eine Testreihe fortgeholt, von geheimen Regierungswissenschaftlern und manchmal auch von Außerirdischen entführt, die diese Fabrik schon seit Jahrzehnten beobachteten. Morrison weiß natürlich, wie haltlos diese Spekulationen waren, da er die Wahrheit kennt. Das heißt, er kennt sie bloß in einem Fall der verlorenen Jungen, da er das Pech hatte, an einem kalten Herbstabend vor sieben Jahren Mark Wilkinson zu finden, der nur wenige Schritte von dort, wo er jetzt steht, an einem Baum hing. Nur wenige Schritte, mehr nicht, bis zu dieser Parzelle mit Gartenblumen und buntem Glas, auf der er sich neben einem Phantomgrab aufhält und um Worte ringt. Bei seinen Besuchen will er eigentlich nicht beten, sondern nur eine Art Verbindung herstellen: Statt Marks Seele in ein glückliches Jenseits zu befördern, möchte er sie nur so lange aufhalten, dass der Junge ihn verstehen und ihm vergeben kann.
Morrison hat noch nie sonderlich überzeugt, was ihm in der Sonntagsschule beigebracht worden war, dass nämlich Vergebung von Gott komme; er kann nicht einsehen, warum er uns unsere Schuld vergeben soll, wenn er uns doch zu dem machte, was wir sind. An die Vergebung durch die Toten aber hat er schon als Junge geglaubt. Als er noch klein war, nahm ihn die Mutter sonntags zu Spaziergängen auf dem Friedhof an Innertowns Westseite mit, unweit von dort, wo die reicheren Leute wohnten. James Morrison hat sie nie begleitet, er war immer zu beschäftigt, doch seine Frau ging mit John und dessen kleiner Schwester zum Friedhof, und zu dritt setzten sie sich in ihren besten Sonntagskleidern auf eine Bank, um feierlich neben dem Grabstein der Großmutter zu picknicken. Es war ein stilles Mahl, die Stimmung ernst, doch keines wegs morbid. Aus Respekt vor den Toten sammelte Morrison hinterher jeden Splitter Eierschale, jeden geringelten Streifen Apfelsinenschale wieder auf. Die Toten faszinierten ihn durch die Art, wie sie allein in ihren Namen weiterlebten, deutlich voneinander getrennt, und er wollte jede Spur auslöschen, die er oder seine Familie in ihrem einsamen Reich hinterließen. Mit fünfzehn war er einmal mit seiner ersten Freundin auf dem Friedhof gewesen, einem etwas unscheinbaren, aber großmütigen Mädchen namens Gwen. Er hatte nur spazieren gehen wollen, doch kaum hatten sie das Friedhofstor passiert, nahm Gwen ihn am Arm und küsste ihn, gleich dort zwischen den Grabsteinen und den Rhododendren. Mit dem Kuss wollte es nicht recht klappen, weil sie es vorher noch nie probiert hatten und weil beide recht schüchtern waren, außerdem wusste Morrison nicht genau, ob ihm Gwen nur wegen ihres Charakters oder auch wegen ihres Aussehens gefiel. Mag sein, dass er deshalb zögerte, aber in Wahrheit wollte er erst nicht weitermachen, weil ihnen von überall auf dem Friedhof die Toten von ihren diversen Ruheplätzen aus zusahen. Dem Mädchen zuliebe versuchte er es später noch einmal, und diesmal klappte es; wie die Frauen im Film legte Gwen den Kopf in den Nacken, und so kamen sich ihre Nasen nicht in die Quere. Danach hatten sie sich ausdauernd geküsst, bestimmt eine Minute lang, und nicht recht gewusst, wie sie nun wieder aufhören sollten.
Kaum aber hatte er sich von Gwen gelöst, bereitete ihm dieser Kuss einige Sorgen. Er wollte die Toten nicht verärgern oder beleidigen, existierten sie doch allein in ihrer stillen Andersartigkeit - und nur deshalb, begriff er, konnten sie uns auch vergeben. Er hatte nie daran gezweifelt, dass die Toten tot besser dran waren: Sie waren all der kleinlichen Sorgen, trivialen Streitigkeiten und Kümmernisse, mit denen sich die Lebenden herumplagen mussten, enthoben. Sie atmeten mit Gott. So hatte Morrison sie sich als Kind vorgestellt: Gottes Luft atmend, ihn aber niemals sehend, und immer allein. Es lag an ihnen, ein Auge auf uns zu haben und uns leidenschaftslos von fern zu beobachten, nur deshalb vergaben sie so bereitwillig. Es war nicht an Gott, uns etwas zu verzeihen, das war allein ihre Aufgabe. Sie sahen, und sie verstanden, Gott aber konnte nicht verstehen, weil Gott viel zu hohe Maßstäbe anlegte, und weil er immer so verdammt zornig wurde, hier und da und überall vom Himmel herab niederfuhr und zuschlug. Vollkommen, wie er war, hatte er die Toten damit betraut, den Menschen zu vergeben. Dachte man erst einmal darüber nach, war es durchaus logisch. Morrison stellte es sich gern als eine Art Arbeitsteilung vor.
Am Ende einer Kette gewöhnlicher Ereignisse und Vorfälle, die für sich genommen eigentlich zu nichts Ungewöhnlichem hätten führen dürfen, fand er durch Zufall den jungen Wilkinson. Es war Halloween, gegen zehn Uhr abends, und Morrison hielt sich in der alten Pfarrei auf, um einem unbedeutenden Fall von Vandalismus nachzugehen. Er hatte sich zu Fuß auf den Weg gemacht, da er meinte, ein bisschen Bewegung vertragen zu können und weil er damals noch glaubte, die Leute fänden es beruhigend, einen Wachmann seine Runden drehen zu sehen. Das Wetter war ziemlich unangenehm, sehr klar, aber für die Jahreszeit bitterkalt, und als Morrison zum Revier zurückkehrte, um sich eine Tasse Tee zu machen, stieß er auf einen Mann mit zwei Jungen unweit der West Side Road, die zum alten Eisenbahngelände und zu jenem kleinen Wald führte, den man in Innertown nur«den vergifteten Wald»nannte, da die Bäume zwar noch lebten, aber seltsam schwarz aussahen, eine Schwärze, die weder an verkohlte Stämme noch an die Folgen einer Dürre erinnerte, sondern die Vermutung nahelegte, dass dunkler, verseuchter Saft durch die Baumadern aufstieg, schwarz, mit einer Spur von Giftgrün, ein bitteres, urzeitliches Grün wie Wermut oder Galle. Die Jungen sahen verängstigt und unglücklich aus, aber wirkten auch irgendwie verlegen, weshalb Morrison von Anfang an misstrauisch war. Er war noch nicht lange in seinem Job und schützte sich in den meisten Situationen erst einmal mit einer gewissen Skepsis. Ging es denn letzten Endes bei der Tätigkeit eines Ortspolizisten nicht eben darum, Ruhe zu verbreiten und willens zu sein, einen jeglichen Vorfall mit einem Gran Zweifel zu prüfen? Dennoch, diese Kinder hatten Angst, das stand außer Frage, auch wenn er aus ihrer Geschichte anfangs nicht recht schlau wurde und nur verstand, dass es irgendwie um einen Jungen namens Mark ging, um ein altes Versteck beim vergifteten Wald und um eine Rolle Baumwollgarn.
Der Mann, der die Jungen begleitete, ein Witwer mittleren Alters namens Tom Brook, den Morrison durch familiäre Zusammenhänge ein wenig näher kannte, war auch keine große Hilfe. In grauer Strickweste und blauer Kordhose doch trotz Kälte ohne Mantel, machte er den Eindruck eines Mannes, der direkt aus dem gemütlichen Wohnzimmer gestürzt war, um sich die Stiefel überzustreifen und ohne einen weiteren Gedanken in die Nacht hinauszulaufen. Er bot einen Anblick, den Morrison nur zu gut kennenlernen sollte, den Anblick eines durch Zufall - vielleicht auch durch das Schicksal - mitten aus dem alltäglichen Leben heraus Erwählten. Das Problem war, dass Brook bereits eine wirre Version der Geschichte kannte und deshalb Fragen stellte, die Morrison, dem die Zusammenhänge noch unklar waren, nur noch weiter verwirrten.
«Also schön», sagte Morrison schließlich.«Fangen wir noch einmal von vorn an.»Er redete langsam, leise, wie er es sich beigebracht hatte, um andere Leute mit seiner Ruhe anzustecken. Er hatte diese Gelassenheit vor dem Spiegel geübt und in Gedanken dabei Sätze aufgesagt, von denen er glaubte, dass sie beschwichtigend klangen. Er hätte gerne älter ausgesehen. Nun, nicht unbedingt älter, vielleicht nur ein bisschen erfahrener. Die Leute wussten, dass er vor Kurzem noch als einfacher Sicherheitsbeamter - als Nachtwächter, genau genommen - in einer von Brian Smiths Firmen in Innertown gearbeitet hatte. Und bis heute hatte er in seinem neuen Beruf nicht viel gelernt, nur eines wusste er ganz genau - dass man nämlich einem jungen Polizisten kaum etwas zutraute.«Wer ist wann wohin gegangen?»Kaum waren die Worte gesagt, ärgerte er sich über sich selbst. Er hatte gerade gegen eine seiner elementarsten Regeln verstoßen. Immer nur eine Frage stellen. Langsam vorgehen. Ruhe verbreiten. Jedermann beschwichtigen und stets nur eine Person reden lassen.
Tom Brook schaute die Jungen an und schüttelte den Kopf.«Nun», sagte er,«ich weiß, das klingt verrückt. So lange ist er schließlich noch nicht da draußen.»Er wandte sich einem der Jungen zu, der hemmungslos zu weinen begonnen hatte.«Schon gut, Kieran», sagte er.«Jetzt ist ja die Polizei hier. Wir finden ihn …»
«Wen finden wir, Tom?»In Gedanken war Morrison schon wieder bei seiner Tasse Tee und den Keksen daheim in der Polizeidienststelle. Vielleicht würde er eine Weile bei Alice bleiben und sich still zu ihr an den Küchentisch setzen, wie damals in jenen Tagen, als es für ihn noch keine Last gewesen war, mit Alice zusammen zu sein. Er spürte genau, dass diese Geschichte hier belanglos war. Auch wenn er neu in seinem Job sein mochte, besaß er doch die Instinkte eines echten Polizisten. Bei dem Vorfall hier handelte es sich jedenfalls bloß um einen Dummejungenstreich oder um irgendein Missverständnis. Deshalb wollte er unter keinen Umständen den Rest der Nacht damit verbringen, im vergifteten Wald umherzuirren und nach einem Ausreißer Ausschau zu halten, der gerade mal anderthalb Stunden verschwunden war.
«Mark Wilkinson», sagte Tom Brook. Er schien sich seiner Sache schon nicht mehr ganz so sicher zu sein. Offenbar war Morrisons angeborener Skeptizismus doch ansteckend.«Sie behaupten, er sei in den Wald gelaufen und nicht zurückgekommen.»
Morrison nahm die Jungen genauer in Augenschein. Seltsam: Sie hatten offenbar wirklich Angst, auch wenn der größere der beiden einen ebenso verschreckten wie verlegenen Eindruck machte. Der Junge, den Brook mit Kieran angeredet hatte, der kleinere also, der ein bisschen untersetzt aussah und ein niedliches, fast mädchenhaftes Gesicht hatte, wirkte völlig verzweifelt, beinahe hysterisch, und er sah von Morrison zu Tom Brook, als wären sie daran schuld, dass sich sein Freund in Luft aufgelöst hatte.«Also», sagte Morrison,«nun erzähl uns mal genau, was eigentlich passiert ist. Und zwar von Anfang an.»
Trotz ihrer unterschiedlichen Gemütsverfassung stimmten die Geschichten der beiden Jungen lückenlos überein. Anscheinend hatten sie draußen im Wald gespielt, und da es sich bei dem Spiel um ein altes Halloween Ritual handelte, um eines, das vermutlich bis in heidnische Zeit zurückreichte, regte sich in Morrison rasch wieder die Überzeugung, er habe es mit einem Schuljungenstreich zu tun, mit einem ein wenig aus dem Ruder gelaufenen dummen Schelmenstück. Der größere Junge, William, war vermutlich von Anfang an eingeweiht gewesen, nur musste dann irgendetwas passiert sein, was nicht im Drehbuch stand, weshalb er nun zwischen Sorge und Skepsis schwankte - außerdem war ihm das Ganze peinlich, denn das Spiel war eigentlich für Mädchen, eines, von dem Morrison nur durch jenen Hätten Sie’s gewusst Artikel erfahren hatte, der ihm letzte Woche in der Zeitung aufgefallen war. Vielleicht hatte Mark oder einer der anderen beiden Jungen denselben Artikel darüber gelesen, wie Mädchen früher eine Garnrolle in die Hand genommen und eine Schnur daran festgebunden hatten. Dann waren sie in den Wald gegangen und hatten die Rolle nach Aufsagen der entsprechenden Zauberformel so weit wie möglich ins Dunkel geworfen, ohne dabei das andere Ende der Schnur loszulassen. Die Rolle flog in den Wald, landete irgendwo und war im Idealfall noch mit der Schnur verbunden, während die Mädchen sie festhielten und auf ein Zeichen warteten - eine Bewegung, ein Zittern, ein heftiges Rucken, das sie hinaus ins Dunkle rief. In dem Artikel hieß es, wenn diese Heidenmädchen der Garnrolle folgten, glaubten sie, ihren künftigen Liebsten in Geistergestalt anzutreffen und so vielleicht zu erfahren, wen sie einmal heiraten würden, wenn die rechte Zeit dafür gekommen war. Mark hatte vorgeschlagen, dieses Spiel, um es realistischer wirken zu lassen, draußen im vergifteten Wald zu spielen; offenbar hatte er sogar geglaubt, der Zauber könne tatsächlich wirken, und am anderen Ende werde wirklich jemand im Dunkeln auf sie warten.
«Was habt ihr denn geglaubt, wen ihr treffen würdet?», fragte Morrison den älteren Jungen.«Für Frauen seid ihr doch wohl noch ein bisschen jung, wie?»
William wirkte noch verlegener als zuvor.«Wir waren ja nicht auf Frauen aus», sagte er mit unüberhörbarer Abscheu.
Morrison lächelte ihm aufmunternd zu.«Aber wen habt ihr dann erwartet?», fragte er. William schaute auf seine Füße, weil er nicht dümmer dreinblicken wollte, als er sich bereits fühlte. Morrison wandte sich an Kieran, der sich allmählich wieder beruhigte.«Und du?», fragte er.«Mit wem hast du da draußen im Wald gerechnet, mein Junge?»
Kieran warf William einen Blick zu, doch der schüttelte bloß den Kopf, ohne vom Boden aufzusehen.«Den Teufel», sagte er nach einem Moment.«Es war Marks Idee. Er sagte, diese Sache mit den Mädchen und den Männern und so, das sei völliger Quark, eigentlich ginge es bei dem Zauber darum, den Teufel heraufzubeschwören.»Jetzt, da er zu weinen aufgehört hatte, wirkte Kieran wütend. Oder vielmehr empört - und Morrison spürte, dass er zu jenen Jungen gehörte, die sich über eine Welt ärgerten, die ihnen ihre Probleme gelegentlich nicht ersparte.
«Den Teufel?», fragte er im besten Tonfall eines skeptischen Polizisten.
Kieran starrte ihn an.«Klar doch», erwiderte er aufgebracht.
Morrison wandte sich an Tom Brook. Er wollte ein paar beruhigende Worte sagen, wollte ihnen versichern, dass es sich entweder um einen verkorksten Streich oder um eines dieser kleinen Rätsel handelte, über das man später bestimmt einmal lachen würde, aber ehe er etwas sagen konnte, begann Brook zu reden. Der Mann sah zugleich traurig und erleichtert aus.
«Niemand macht sich auf die Suche nach dem Teufel, mein Sohn», sagte er. Beide Jungen schauten zu ihm auf. Er war ein Erwachsener, also hörten sie ihm zu.«Hat man euch das noch nicht gesagt?», fragte er, wandte sich zu Morrison um und verzog das Gesicht zu einem traurigen, aber auch verschwörerischen Lächeln.«Niemand muss in den Wald gehen, um den Teufel zu suchen», fuhr er fort.«Der Teufel findet einen auch so, nicht wahr, Wachtmeister?»
Folgendes war passiert: Während einer Mutprobe, bei der es darum ging, dem Teufel selbst in die Augen zu schauen, hatte Mark Wilkinson seine Rolle ins dunkle Reich des vergifteten Waldes geworfen und war, als nichts geschah, der Schnur allein in die Schattenwelt gefolgt. Ehe er verschwand, hatte er den anderen Jungen gesagt, wenn er nicht gleich zurückkäme, sollten sie nicht auf ihn warten. Dann war er mit einem Lachen aus dem Lichtkreis ihrer Taschenlampen getreten und unter den Bäumen verschwunden. William und Kieran hatten lange auf seine Rückkehr gewartet, waren aber zu verängstigt gewesen, in die Nacht zu gehen, um ihn zu suchen. Stattdessen gerieten sie irgendwann in Panik, rannten davon und ließen nur ihre Taschenlampe zurück. Morrison hörte sich die Geschichte geduldig an und beschloss, es wäre das Beste - das einzig Sinnvolle -, diese Jungen ins Bett zu schicken und dann in den vergifteten Wald zu gehen, um selbst nachzusehen. Zuerst aber würde er bei den Wilkinsons vorbeischauen und fragen, ob Mark nicht vielleicht schon im Bett lag und über den Streich lachte, den er seinen Freunden gespielt hatte, während er sich selbst zur gelungenen Flucht vor dem Teufel beglückwünschte. An dieser Geschichte war nichts dran, sie war bloß ein Kinderspiel, und es verblüffte Morrison, dass die Jungen deshalb so aufgebracht wirkten. Allerdings war der vergiftete Wald nachts eine ziemlich unheimliche Gegend, selbst wenn man nicht allein war und eine Taschenlampe bei sich trug.«Also schön. Wir werden Folgendes machen», sagte er.«Ich gehe in den Wald und sehe mich einmal um. Vielleicht kann ich ja wenigstens eure Taschenlampe wiederfinden. Mark ist wahrscheinlich längst zu Hause und schaut fern. Und ihr beide lauft jetzt auch besser heim, aber macht euch keine Sorgen.»Dann wandte er sich an Tom.«Vielleicht kann euch ja Mister Brook nach Hause bringen.»
Brook nickte.«Ist nicht weit», sagte er.«Und ich habe sowieso nichts Besseres vor.»
Im selben Augenblick fiel Morrison ein, was für ein besonderes Datum diese Nacht für Tom Brook war. Jedermann kannte die Geschichte, die Tom für den Rest seiner Tage stumm mit sich herumtragen würde. Letztes Halloween war Toms Frau Anna an einer riesigen, sich unerklärlich rasch ausbreitenden Hirnwucherung gestorben, die sie zuvor in den Wahnsinn getrieben hatte. Gegen Ende war sie nur noch ein erbärmliches, verzweifeltes Geschöpf gewesen, das im eigenen Bett gelegen und geglaubt hatte, lebendig begraben zu sein. Ehe sie ihren Geist aufgab, hatte sie tagelang verzweifelt an jener imaginären Kiste gekratzt, in die sie sich eingeschlossen wähnte. Als Morrison einmal bei ihr vorbeischaute, um zu fragen, ob er irgendwie helfen könne, musste er an die Geschichte von Thomas von Kempen denken,jenem Heiligen, den man tatsächlich lebendig begraben hatte, was allerdings erst Jahre später bekannt geworden war, als man Thomas nämlich
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel«Glister»bei Jonathan Cape, London.
Der Abdruck der Zitate aus Herman Melville, Moby Dick, in der Übersetzung von Matthias Jendis erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlags, München.
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Unterstützung der Arbeit am vorliegenden Text.
Verlagsgruppe Random House FSC DEU-0100
1. Auflage
Copyright © 2008 by John Burnside Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
eISBN : 978-3-641-03419-1
www.knaus-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de