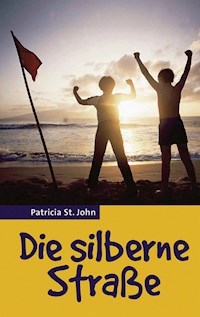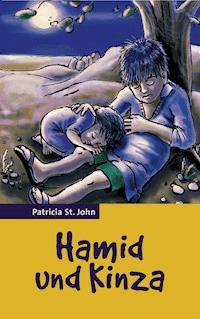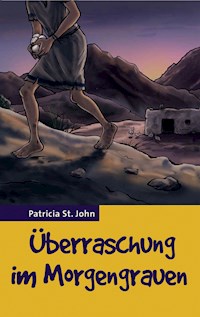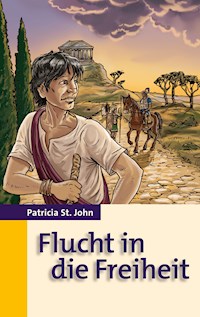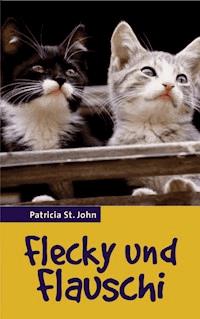Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Philo hält es zu Hause fast nicht mehr aus. Wie ein Fluch lastet Illyrika, die von unheimlichen Anfällen geplagte Schwester, auf der ganzen Familie. Als Philos Vater vom Fischen nicht mehr zurückkommt, zerbrechen auch die letzten Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Dann hört er, was die Leute von einem Propheten im Nachbarland erzählen. Stimmt es, dass er Kranke heilen, Hungernde speisen und von einem Fluch Beladene befreien kann? Kann er wirklich das Leben eines jeden von Grund auf erneuern? Die Frage lässt Philo nicht mehr los ... Zu diesem Buch gibt es Quizfragen in Antolin. Antolin ist ein Online-Portal zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10. Die Schüler lesen ein Buch und können dann unter antolin.de Quizfragen zum Buchinhalt beantworten. Richtige Antworten werden mit Lesepunkten belohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia St. John
Die Spur führt nach Jerusalem
Originaltitel: »The Victor.«
erschienen bei: Scripture Union (Bibellesebund), London
© 1983 by Patricia St. John
Deutsch von Renate Mauerhofer
© 1985 der deutschsprachigen Ausgabe
© 2018 der eBook-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://shop.bibellesebund.de/
Cover: Georg Design, Münster
ISBN 978-3-95568-323-8
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr eBooks des Bibellesebundes finden Sie auf
www.ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
1. Kapitel
Es ist schwer zu sagen, wann diese Geschichte eigentlich begann. Wie die Blumen werden auch wir mit der Sehnsucht geboren, dem Licht zuzustreben. Ich spürte diese Sehnsucht wohl zum ersten Mal an einem strahlenden Sommermorgen, als ich nördlich von Tyrus im Sand am Meer lag und mich Hassgefühle gegen meine Schwester Illyrika erfüllten. Dann hasste ich mich selbst, weil ich sie hasste, denn schließlich war es ja nicht ihre Schuld, dass sie krank oder, wie die Leute einander zuflüsterten, von einem Dämon besessen war.
Ich hasste sie nicht wegen der rasenden Tobsuchtsanfälle, die sie von Zeit zu Zeit plötzlich überkamen. Dann knirschte sie mit den Zähnen, riss sich das Haar aus und warf sich auf den Boden oder ins Feuer – je nachdem, wo sie gerade stand. Das geschah seit Jahren immer wieder gelegentlich und ich hatte mich daran gewöhnt. Außerdem hatte sie Zeiten, in denen sie manchmal fast normal war, obwohl sie immer ein wenig merkwürdig und abwesend wirkte. Sie saß dann mit gefalteten Händen da und starrte Löcher in die Luft. Dabei hatte sie einen unkindlichen, alten Gesichtsausdruck und wenn sie sprach, schien ihre Stimme von weit, weit her zu kommen. Aber sie sagte nur ganz selten etwas.
Ich hasste sie, weil sich meine Mutter nur um sie drehte. Sonst zählte niemand, dachte ich verbittert und grub meine bloßen Zehen in den Sand ein. Ich war der einzige Sohn, aber wenn der Fischfang nicht reichlich und somit das Essen spärlich war, mussten ich und meine jüngere Schwester Ione hungern, damit Illyrika genug zu essen hatte. Manchmal glaubte ich, dass meine Mutter Angst vor ihr hatte. Doch dann wieder hatte ich den Eindruck, dass sie vor lauter Liebe zu ihr kaum einen anderen Menschen wahrnahm. Ich seufzte, spuckte aus und wünschte mir, alt genug zu sein, um mit meinem Vater nachts auf Fischfang gehen zu dürfen. Aber er wollte mich erst mitnehmen, wenn ich zwölf wäre. Es fehlten noch zwei volle Monate, bis ich dieses Mannesalter erreicht hatte.
Es war sehr still am Strand. Die Sonne war über dem schnee bedeckten Gipfel des Hermon aufgegangen und wärmte meinen Rücken, aber der Dunstschleier lag immer noch über Land und Meer, sodass man nicht sagen konnte, wo die See aufhörte und wo der Himmel begann. Nicht die kleinste Welle brach sich im Sand. Das glatte Wasser leuchtete safrangelb und verschmolz mit dem hellen Dunst. Jeden Augenblick würde nun ein dunkler Fleck auftauchen, der beim Näherkommen immer größer würde.
Es war schon spät, was gewöhnlich auf einen guten Fang hinwies. Angestrengt blickte ich aufs Meer hinaus und entdeckte das Boot. Bald konnte ich auch das Netz entdecken, das auf und ab schlingerte, wie das Spiegelbild der Wellen. Ich rannte bis ans Wasser und winkte und mein starker, stiller Vater stand am Bug und winkte zurück. Obwohl wir uns, solange ich den ken konnte, fast jeden Morgen auf diese Weise begrüßten, war es immer wieder ein besonderer Augenblick für mich, denn ich liebte meinen Vater und nicht alle Fischer, die nachts hinausfuhren, kehrten am Morgen wieder zurück.
Ich holte die Körbe und war rechtzeitig zurück, um den Kiel auf dem Sand auflaufen zu hören. Da spürte ich auch schon die breite Hand meines Vaters auf der Schulter, als er aus dem Boot sprang. Die Männer waren gut gelaunt, das Boot war vollgeladen und das Netz schwer. Als eingespieltes Team nahmen wir schweigend unsere Stellungen am Seil ein. Ich, ein kleiner Statist, rannte ans Ende, denn obwohl ich ein kräftiger Junge war, hätte ich nicht mit den starken braunen Armen und der ganzen Energie der Fischer mithalten können. Jeder Muskel war angespannt, als sie sich gleichzeitig zurücklehnten, sich für den Bruchteil einer Sekunde entspannten, tief Luft holten und erneut die Muskeln anspannten, bis das Netz auf dem Strand lag. Wir stürzten uns alle gleichzeitig darauf, um die Fische zu sortieren.
Ich ging gern mit den Fischen um. Einige davon warfen wir wieder ins Wasser zurück. Aber heute waren die meisten genießbar. Die Männer legten sie, tropfend und silbrig glänzend, in die Körbe, hievten diese auf ihre Schultern und gingen damit zum Markt. Ich rannte zuerst noch einmal zurück und sprang ins Meer, denn obgleich die Schatten immer noch lang waren, brannte die Sonne bereits heiß herab und die Erfrischung tat mir gut nach der harten Arbeit. Dann nahm ich meinen etwas kleineren Korb und holte meinen Vater bald ein. Die Fisch verkäufer erwarteten uns schon im Schatten der Zelte und das Feilschen und Handeln begann. Ich war stolz auf meinen Vater, denn es gelang keinem, seine Preise wesentlich herunterzuhandeln, und unser Boot war heute morgen das erste. Als der Preis festgelegt war, wurde der Fisch gewogen und zu großen, glänzenden Haufen auf die Steinfliesen geschüttet. Dann wandte sich mein Vater mir zu.
»Bring den Rest in deinem Korb nach Hause«, sagte er, »und bitte Mutter, den Fisch zuzubereiten! Ich werde bald nachkommen.«
Wie die Fischer lediglich mit einem Lendentuch bekleidet, ging ich die Straße hinauf, die zu unserem Haus führte. Aller Kummer war vergessen. Ich war sehr hungrig und heute hatten wir genug zu essen. Meine Mutter würde mit meiner kleinen Schwester zusammen den Fisch ausnehmen und das Feuer entfachen. Bald darauf würden herrliche Düfte das Haus erfüllen: brutzelndes Öl, gebratener Fisch, würzige Kräuter und frisches Brot. Dann würde mein Vater kommen und wir würden uns um die volle Schüssel versammeln. Welch gemütliche Runde wäre das ohne die unheimliche Gegenwart meiner älteren Schwester! Gewöhnlich nahm sie ihr Essen etwas abseits ein. Ihr Teller war angefüllt mit dem Besten, was es gab. Manchmal setzte sie sich auch in unsere Familienrunde. Dann verstummten wir meistens, als hätten wir einen Fremden in unserer Mitte. Meine Mutter hörte auf zu essen und starrte sie mit jenem erschrockenen, sehnsuchts- und liebevollen Gesichtsausdruck an. Ich stopfte mir den Rest des Essens in den Mund und machte, dass ich hinaus ins Freie kam.
Der Tag würde heiß werden. Einer von Vaters Gehilfen stand in seiner Haustür und rief mich zu sich. Ich trat durch den weinumrankten Eingang und er gab mir Buttermilch zu trinken, während wir plauderten. Ich besuchte gern die anderen Fischerjungen, aber ich schämte mich gleichzeitig, denn ich konnte sie nie zu mir einladen. Ich wusste ja nie, wann meine Schwester wieder einen Anfall hatte. Tagsüber verließ Illyrika das Haus äußerst selten, aber jeder kannte sie und redete hinter vorgehaltener Hand über sie. Und wir bekamen ganz selten Besuch.
Die Buttermilch stillte vorübergehend meinen Hunger und ich blieb noch ein wenig da. Mein Vater würde nicht so schnell nach Hause kommen. Er hatte auf dem Marktplatz Geschäftliches zu besprechen. Außerdem saß er gern mit den anderen Fischern zusammen und plauderte über die Gezeiten, das Wett er und den Fang. Manchmal fragte ich mich, ob es ihm ebenso schwerfiel wie mir, die Freiheit des Morgenhimmels und die Weite des Meeres zurückzulassen, um unter dem schwarzen Schatten, der über unserem Haus lag, zu leben. Aber er war ein guter Ehemann und pflichtbewusster Vater und wenn er meine Gedanken teilte, so hatte er sie nie geäußert.
Ich verließ meinen Freund und eilte die Straße hinauf, denn jetzt war ich wirklich spät dran. Als ich um die Ecke bog, war ich aber doch überrascht, dass meine Mutter mitten auf der Straße stand und nach mir Ausschau hielt. Als sie mich entdeckte, lief sie mir entgegen. Sie war so vergnügt, wie ich sie seit langem nicht mehr gesehen hatte.
»Beeil dich, Junge!«, rief sie ungeduldig. »Gib mir den Fisch, wasch dich und zieh die Tunika an! Dein Onkel Adoram aus Galiläa ist hier, er wartet auf sein Frühstück.«
Ich rannte ihr voraus, denn das war tatsächlich eine gute Nach richt. Ich hatte meinen Onkel aus Galiläa sehr gern und wir hatt en ihn schon länger nicht mehr gesehen. Er war der ältere Bruder meiner Mutter, der sich in ein Mädchen aus Kapernaum verliebt hatte. Da die Familie seiner Braut strikt dagegen war, dass die Tochter Israel verließ, hatte er sein Fischerboot zum See Genezareth gebracht und übte seither seinen Beruf in Galiläa aus. Um seinen Schwiegervater vollends zu versöhnen, war er sogar zum Judentum übergetreten. Doch hatte er die Verbindung zu meiner Mutter nicht abgebrochen und von Zeit zu Zeit besuchte er uns.
Onkel Adoram war ein großer, schwarzbärtiger Mann mit der breiten Statur und den starken Muskeln eines Fischers. Er ruhte sich nach der langen Wanderung auf einer Matte aus und neckte meine kleine Schwester, die vergnügt kicherte. Er sprach auch höflich mit meiner älteren Schwester, aber er machte keine Späße mit ihr. Auch sah er sie kaum an, denn keiner wollte ihrem wilden, starren Blick begegnen. Wenn ich mit ihr sprach, sah ich immer in die entgegengesetzte Richtung.
Sauber und bekleidet platzte ich in das Zimmer und begrüßte fröhlich meinen Onkel. Ich glaube, er hatte mich besonders gern und jetzt redete er mit mir von Mann zu Mann.
»Na, warst du mit dem Boot draußen?«, fragte er zwanglos.
»Nein, ich darf erst mitfahren, wenn ich zwölf bin. Aber das dauert nicht mehr lange. Ich helfe jeden Morgen beim Einholen des Netzes und beim Fischeverlesen.«
»Freust du dich schon darauf, mitfahren zu dürfen?«
Ich nickte.
Er lächelte. »Es liegt uns im Blut, Junge, schon seit Generationen. Wenn meine Zeit gekommen ist und ich von der Erde wegmuss, will ich in einem Sturm untergehen. Die Stürme auf dem See Genezareth haben etwas herrlich Gewaltiges an sich. Sie kommen ganz plötzlich aus dem Faltengebirge her untergebraust, wenn man sie am wenigsten erwartet, und peitschen das Wasser auf, dass man meint, das letzte Stündlein habe geschlagen. Aber ich wollte es um nichts in der Welt eintauschen, das kannst du mir glauben!« Dieses Thema schien ihn an etwas zu erinnern, denn er hielt inne und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was in die gefahren ist!«, fuhr er gedankenvoll fort. »Vier meiner Freunde haben kürzlich ihre Boote im Stich gelassen, um sich in ein aussichtsloses Abenteuer zu stürzen. – Sieh mal, da kommt dein Vater! Und der Fisch duftet auch schon köstlich!«
Er sprang auf und küsste seinen Schwager herzlich. Meine Mutter eilte herein und servierte. Sie hatte sich selbst übertroffen: Der Fisch brutzelte noch, das warme Brot duftete köstlich, das Obst war kunstvoll in einer Schale angerichtet und mehrere Weinflaschen standen als Getränk bereit. Meine kleine Schwester Ione brachte die Wasserschüssel herein und wusch unsere Füße. Sie war erhitzt und außer Atem, weil sie zwischen dem Ofen und dem Krämer hin- und hergelaufen war. Meine Mutter legte das Beste von allem auf einen Teller, den sie meiner älteren Schwester brachte, die etwas abseits saß, und die Mahlzeit begann in fröhlicher Stimmung.
Zuerst drehte sich die Unterhaltung um die Fischerei: die unterschiedlichen Vorzüge der Küsten- und Binnenfischerei, die Preise und Steuern unter Herodes in Galiläa. Dann tauschten wir Familiennachrichten aus und aßen, bis wir alle satt waren. Schließlich entstand eine Gesprächspause. Ich wollte, dass sich mein Onkel weiter mit mir unterhielt, deshalb knüpfte ich da an, wo wir stehen geblieben waren.
»Onkel Adoram«, fragte ich, »wieso haben deine vier Freunde ihre Boote im Stich gelassen und sich in ein aussichtsloses Abenteuer gestürzt?«
»Tja«, meinte mein Onkel nachdenklich, »das fragt sich jeder bei uns. Es ist eine lange Geschichte. In Galiläa passieren merkwürdige Dinge und keiner weiß, was er davon halten soll – ich am wenigsten. Aber es gehört schon was dazu, Boot und Netz einfach zurückzulassen und ohne Geld loszuziehen! Sie müssen ein ganzes Stück überzeugter sein, als ich es bin!«
»Wer, Onkel? Und wohin sind sie denn gezogen?«
Jeder war nun neugierig geworden. Mein Onkel seufzte, als fiele es ihm schwer, unsere Fragen zu beantworten. Sein Gesicht war ernst und er runzelte die Stirn, während er sprach.
»Ich nahm die jüdische Religion an, um meiner Frau einen Gefallen zu tun, aber ich interessiere mich kein bisschen dafür. Immer wieder steht ein Prophet, Quacksalber oder Wundertäter unter ihnen auf, aber ich bin bis jetzt auf keinen von ihnen reingefallen. Als das Gerücht kursierte, dass wieder mal einer von dieser Sorte in Kana Wasser in Wein verwandelt haben soll, machte ich mich mit den anderen darüber lustig. Aber als dann der einzige Sohn meines Herrn schwer erkrankte, war es nicht mehr zum Lachen. Er ist ein guter Mann, ein Hauptmann und in der ganzen Stadt angesehen, und ich verkaufe ihm meine Fische privat. Er und seine Frau haben jahrelang auf dieses Kind gewartet. Es war ihr ganzer Sonnenschein.«
»Und was passierte dann?«
Mein Onkel nippte an seinem Wein, als wüsste er nicht, wie er fortfahren solle.
»Also, das Kind erkrankte an einem Fieber. Jeder Arzt im ganzen Gebiet wurde herbeigerufen, aber einer nach dem an deren ging kopfschüttelnd wieder weg. Eines Morgens brachte ich meine Fische wie gewöhnlich in die Küche, wo ich meistens einen Schluck trinke und mit den Dienern einen Schwatz halte. Manchmal unterhalte ich mich auch mit dem Herrn selbst, wenn ich ihm auf dem Gelände begegne. Aber an diesem Morgen war es seltsam still im Haus und die Mägde und Diener weinten, denn sie alle liebten das Kind. ›Die Hand des Todes liegt auf ihm‹, flüsterte eine Magd. ›Seine Haut brennt wie Feuer. Er liegt in den Armen seiner Mutter und erkennt keinen mehr.‹ Als ich dann am Tor stand, sah ich, wie mein Herr die Straße hinuntergaloppierte, als wolle er in die Schlacht ziehen. Der Staub, den die Pferdehufe aufwirbelten, hüllte ihn ganz ein.
›Wohin reitet er denn?‹, fragte ich.
›Nach Kana‹, sagte ein Diener. ›In Kana soll angeblich ein Wundertäter sein, ein Nazarener!‹ Er sagte das verächtlich, aber alle blieben ernst und ich ging kopfschüttelnd davon.«
Mein Onkel zögerte wieder. Er schien sich beinahe zu fürchten, mehr zu erzählen. Aller Augen hingen gespannt an ihm. Weil ich Illyrika gegenübersaß, bemerkte ich als Einziger, dass sie sich erhob und dicht hinter den anderen niederhockte. Ich erschauerte, als ich sie flüchtig anblickte, und sah schnell weg. Ihre Augen waren geweitet und schwarz und die nackte Furcht stand in ihnen geschrieben.
»Erzähl weiter!«, flüsterte meine Mutter.
»Ich ging erst drei Tage später wieder hinauf zur Villa. Auf dem Marktplatz hatte ich schon gehört, dass das Kind noch lebte. Als ich oben ankam, stand mein Herr im Garten und sein Sohn lief hinter einem kleinen Hund her. Seine Wangen glühten rosig vor Gesundheit. Ich war kühn genug, um stehen zu bleiben und meinem Herrn zu sagen, wie ich mich darüber freute.«
»Erzählte er dir, was passiert war?«
»Ja, er war viel zu glücklich, um es für sich zu behalten. Er musste es sogar seinem Fischer erzählen!«, lachte mein Onkel. »Der Prophet war in Kana angekommen, das kaum zwanzig Kilometer westlich liegt. Es war nicht schwer, ihn zu finden, denn jeder folgte ihm und wartete gespannt darauf, was er als Nächstes tun würde. Der Herr erzählte mir, wie er demütig auf die staubige Straße vor ihm niedergefallen sei. Flehentlich hätte er ihn gebeten, mit ihm nach Kapernaum zu kommen, bevor das Kind stürbe. Es sei gerade ein Uhr gewesen.
Der Prophet hätte nur gesagt: ›Geh nach Hause, dein Kind lebt!‹«
»Und er glaubte ihm?«, fragte meine Mutter erstaunt.
»Er glaubte ihm. Warum oder wieso, konnte er nicht erklären. Er wusste nur, dass das Wort wahr war und dieser Mann göttliche Kraft besaß. Er ritt heim und sang vor Freude vor sich hin. Bei Sonnenuntergang traf er ein. Als er in Sichtweite des Hauses kam, rannten ihm die Diener freudig winkend entgegen. Das Kind lebte; um ein Uhr war etwas geschehen. Das Fieber war gesunken.
Seine Frau ergänzte die Einzelheiten. Sie hatte das Kind in den Armen gehalten und seine trockenen Lippen benetzt, als die brennende Glut plötzlich aus seinem Körper entwich und sein rasender Herzschlag sich verlangsamte. ›Das ist der Tod!‹, dachte sie bei sich und begann zu weinen. Aber der Junge öffnete die Augen und sah sie an. Sie glänzten nicht mehr vor Qual und Fieber, sondern strahlten gesund und fröhlich. Sie küsste ihn auf die Lippen, die jetzt feucht und kühl waren. Er setzte sich auf und lächelte. ›Ich möchte mit dem Hündchen spielen, Mama‹, sagte er, stand auf und rannte in den Garten hinaus. Sie folgte ihm und sah auf die Sonnenuhr. Es war ein Uhr, genau die Zeit, als der Prophet sprach.«
Eine kurze Stille entstand, dann fragte mein Vater: »Wie heißt denn dieser Prophet?«
»Wie er heißt? Oh, sie nennen ihn Jesus.«
2. Kapitel
Entsetzt sprangen wir alle auf. Selbst ich, der ich doch an Illyrikas Krankheit gewöhnt war, hatte niemals zuvor einen so ra senden, verzweifelten Aufschrei gehört wie jetzt. Mein Vater umklammerte sie mit seinen starken Armen, denn diese Anfälle gaben ihr übermenschliche Kräfte. Meine Mutter schob Ione hin ter die Getreidetonne. Ich schnappte mir ein paar Früchte und rannte aus dem Haus. Ich lief bis zur Straßenecke, dann drehte ich mich um und sah, dass mein Onkel mir mit großen Schritten folgte. Ich wartete auf ihn und stellte fest, dass er zitterte – mein großer und starker Onkel.
»Passiert ihr das öfter?«, fragte er und ließ sich schwer auf die Hafenmauer nieder, als hätte er zu weiche Knie, um zu stehen.
»Ja, hin und wieder. Man braucht sich deswegen keine Sorgen zu machen. Sie kommt darüber hinweg – bis zum nächsten Mal.«
»Deine arme Mutter!«
»Ach, Mutter geht’s nicht schlecht. Sie wird herumsitzen und sie stundenlang pflegen. Sie hat sonst nichts zu tun.«
Ich konnte die Bitterkeit in meiner Stimme nicht verbergen und mein Onkel sah mich scharf an. »Was soll das heißen, Junge?«, fragte er. »Sie muss sich um euch alle kümmern und den ganzen Haushalt besorgen, ist dir das klar?«
Ich zuckte die Achseln.
»Sie wird jetzt tagelang kaum merken, dass wir auch noch da sind. Ione erledigt fast die ganze Arbeit allein, dabei ist sie erst neun.« Ich hielt inne, dann brach es aus mir hervor. »Es ist schrecklich zu Hause, Onkel! Keiner zählt außer Illyrika. Niemand kommt uns besuchen, weil alle Angst vor ihr haben. Ich wünschte, ich könnte allem den Rücken kehren und woanders aufwachsen!«
Er legte seine breite Hand auf meine Knie. »Ich werde jetzt nach Sarepta gehen und Anat und Etbaal besuchen. Kannst du mich dorthin begleiten?«
Ich schüttelte bedauernd den Kopf. Ich musste am Strand arbeiten, das Netz säubern und reparieren, das Boot reinigen und die Körbe auswaschen. Mein Vater hätte mich streng bestraft, wenn ich meine Pflichten vernachlässigt hätte.
»Nun gut«, sagte mein Onkel. »Ich werde heute Abend zu rückkehren. Ich möchte mich gern mit deiner Mutter noch etwas unterhalten, bevor ich morgen früh aufbreche. Also, dann mach dich an die Arbeit, Junge!«
Ich beobachtete, wie er mit langen Schritten auf die Bucht zuging, die zum Damm führte. Ich wünschte, ich hätte mit ihm gehen können, denn meine Cousins und Cousinen vom Bauern hof waren eine fröhliche Schar. Über ihrem Haus hing kein dunkler Schatten. Ich seufzte und ging zum Strand hinunter.
Ich blieb den ganzen Tag über am Strand, denn ich hatte am Morgen gut gegessen. Ich arbeitete und spielte mit den anderen Fischerjungen und schwamm ins blaue Mittelmeer hinaus, als die Sonne heiß über uns stand. Erst als sich die Sonne dem Meer zuneigte, machte ich mich auf den Nachhauseweg. Wie erwartet schien meine Mutter keine Notiz von mir zu nehmen. Sie saß gedanken versunken über meine Schwester gebeugt da, die anscheinend bewusstlos auf ihrer Matte lag. Ich holte eine Schale Butt er milch, ein Stück Brot und Ziegenkäse und legte mich dann in der äußersten Ecke des Raumes nieder. Mein Vater war schon fortgegangen zur Arbeit und Ione schlief. Im Zimmer war es fast stockdunkel, als Onkel Adoram den Türriegel hob und eintrat. Meine Mutter lehnte sich vor und füllte die Öllampe auf, sodass die Flamme wieder größer wurde und ihr Schein durch das ganze Zimmer flackerte.
»Ione!«, rief sie. »Steh auf und bereite deinem Onkel das Abendessen!«
Ione erhob sich wankend und schlaftrunken. Zuerst lief sie direkt gegen die Wand, dann stolperte sie zum Essplatz und sah verwirrt um sich. Mein Onkel hatte Mitleid mit ihr und half ihr. Ich wurde wütend auf meine Mutter. Warum musste die arme, kleine Ione geweckt werden, während Mutter untätig dasaß und meine große Schwester hätschelte? Ich hasste Illyrika.
Eine Weile lag ich da und beobachtete die Gruppe und ihre Schattenbilder an der Wand. Das Gesicht meiner Schwester war weiß und wie tot, das meiner Mutter verquollen vom Weinen.
Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wusste, dass es mich auch noch gab.
»Nun, Schwester, wie geht es dem Mädchen?«
»Sie hat sich jetzt beruhigt.« Die Stimme meiner Mutter war tonlos.
»Ich wusste, dass sie seltsam und kränklich ist, aber du hast mir nie von diesen Anfällen erzählt. Wie lange macht ihr das denn schon mit?
»Seit sie ein kleines Mädchen war – ungefähr zehn Jahre. Bruder, es ist alles meine Schuld.«
»Wieso? Alle Krankheit kommt doch von Gott – oder den Göttern – je nachdem, woran du glaubst.«
»Nicht diese Krankheit. Illyrika wurde mit einem verdrehten Fuß geboren und das bekümmerte mich. Ich dachte: ›Wer wird jemals einen Brautpreis für ein lahmes Mädchen zahlen?‹ So brachte ich sie zur Beschwörerin, einer bösen Frau, die Verbin dung zu dunklen Mächten hat. Sie murmelte viele Wörter vor sich hin, sah in eine Glaskugel, schrie laut auf und legte dem Mädchen die Hände auf. Sie verlangte eine große Summe und Tag für Tag musste ich meinen Mann belügen, um das Geld aufzubringen. Ich verkaufte fast all meinen Hochzeitsschmuck, aber er weiß es immer noch nicht.
Ihr Fuß heilte mit der Zeit, sie war nicht mehr lahm. Aber die Kraft der Beschwörerin ist eine böse Kraft und sie bemächtigte sich Illyrikas. Jetzt weiß ich, warum es dem Volk der Juden von ihrem Gott auf Todesstrafe verboten ist, etwas mit Zauberern oder Wahrsagern zu tun zu haben: Ihre Macht ist eine böse Kraft. Wenn du sie berührst, berührt sie dich. Willst du sie besitzen, besitzt sie dich. Seit diesem Tag leben wir in Angst und im Schatten des Bösen. Nichts und niemand kann uns davon befreien.«
»Kannst du nicht zur Geisterbeschwörerin zurückgehen, damit sie das Mädchen von dem Bann losspricht?«
Meine Mutter schüttelte den Kopf. »Kann das Böse Böses vertreiben? Nein, mein Bruder, ich habe nichts unversucht gelassen. Auch Ärzte und Apotheker können nichts ausrichten. Ich habe Illyrika so sehr geliebt, wie sicherlich kein an deres Kind je geliebt wurde, denn Liebe ist eine starke Kraft, aber die Macht des Bösen ist stärker als jede menschliche Kraft und wächst stetig an. Manchmal denke ich, dass sie uns alle umschlingen und in die Dunkelheit und den Wahnsinn hinabreißen wird … Ach, Adoram, ich habe solche Angst!«
Sie weinte jetzt, über die stille Gestalt gebeugt. Plötzlich sah sie auf.
»Bruder, erwähne diesen Propheten nie mehr. Sein Name scheint zu ihrer Unruhe beizutragen. Sie hat ihn heute mehrmals gemurmelt. ›Bist du gekommen, um uns zu zerstören?‹, flüsterte sie immer wieder mit schreckgeweiteten Augen. Zweifellos steht auch er in Verbindung mit bösen Mächten. Dieser klei ne Junge wird nun von ihnen besessen sein, wie meine Tochter von ihnen in Besitz genommen wurde. Lass dich nicht mit ihm ein!«
Mein Onkel schüttelte langsam den Kopf. »Im Garten meines Herrn war nichts Finsteres oder Böses zu spüren«, sagte er schließlich. »Nur eine große Freude und Heil und Licht.« Plötzlich erhob er sich scheinbar verlegen.
»Es war heute drückend heiß auf der Straße nach Sarepta«, sagte er. »Ich lege mich jetzt aufs Ohr, Schwester. Am besten lege ich mich dorthin, wo dein Mann tagsüber schläft, beim Fischgerät. Gute Nacht!«
Meine Mutter legte sich neben Illyrika. In ein paar Minuten schnarchte mein Onkel und jeder schien zu schlafen. Nur ich lag wach und fürchtete mich. Wenn die bösen Mächte stärker als alle Macht der Erde waren, dann waren wir alle verloren! Die Mächte würden stärker und der Schatten dunkler werden und wir waren ihnen hilflos ausgeliefert! Ich wollte weglaufen – zu den Cousins am Weg nach Sarepta oder zu meinem Onkel nach Kapernaum. Aber vielleicht würden sie darauf bestehen, mich zurückzuschicken, denn ich war fast ein Mann und hatte genug Arbeit zu tun. Mein Vater wartete nur darauf, dass ich mein zwölftes Lebensjahr vollendete.
Ich dachte an meinen stillen, geduldigen Vater, der immer nach Hause kam. Ich fragte mich wiederholt, was er von alldem hielt. In all den gemeinsamen Jahren hatten wir nie darüber gesprochen und heute hatte ich zum ersten Mal meine Mutter davon reden hören. Vielleicht würden mein Vater und ich eines Tages darüber sprechen, wenn ich erwachsen wäre. Ich gähnte ausgiebig. Kein Kummer kann einen Jungen, der vor Morgengrauen aufgestanden ist, lange vom Schlaf abhalten. Ich zog die Decke über mich und schlief tief und fest.
Mein Onkel verließ uns am nächsten Morgen nach einem weiteren herzhaften Familienfrühstück. Ich überquerte mit ihm den Damm, der aufs Festland führte, und begleitete ihn ein Stück die Küstenstraße nach Süden hinunter. Ich hätte liebend gern die Grenze nach Israel mit ihm überschritten, aber nach ein paar Kilometern legte er mir seine Hand auf die Schulter.
»Jetzt kehrst du am besten um«, sagte er. »Sei gut zu deiner Mutter und Schwester Ione, lerne unseren Beruf und übernimm eines Tages das Boot. Fischer leben nicht immer lange. Also Lebewohl, mein Sohn. Ich komme bald wieder und schaue, wie es euch geht.«
Ich küsste seine Hand und er drehte sich um und ließ mich zwischen dem Strandhafer und den Sanddünen stehen, bedrückt und enttäuscht. Er hatte mich nicht nach Kapernaum eingeladen.
Dennoch nahm ich seine Worte zu Herzen und ging nach Hause, sobald meine Arbeit erledigt war, ohne wie üblich bis zum Abendessen am Strand herumzubummeln. Es war später Nachmittag, als ich unsere Straße erreichte. Die Sonne stand im Westen und tauchte die kleine Stadt in klares, goldenes Licht. Ione kam gerade mit dem Wasserkrug auf dem Kopf vom Brunnen zurück und wir gingen zusammen nach Hause. Ione arbeitete so hart wie eine erwachsene Frau, aber sie tat es ohne Murren. Obwohl sie mit dem Bösen unter einem Dach lebte, hatte es bis jetzt keinen Schatten auf ihr freundliches, fröhliches Gemüt geworfen. Sie liebte das Leben und es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass sie schlecht behandelt wurde. Wenn es je ein Kind des Lichts gegeben hatte, dann war sie es. Sie wurde vom Guten angezogen wie die Motten vom Licht.
»Wie geht es Illyrika?«, fragte ich.
»Besser«, antwortete Ione fröhlich. »Heute hat sie sich aufgesetzt und etwas Fleisch gegessen, das Mama für sie gekocht hat. Sie ist still und scheint alles vergessen zu haben. – Philo, wir dürfen diesen Propheten Jesus nie mehr vor ihr erwähnen. Sie hat wohl Angst, dass er kommt und sie tötet. Aber weißt du, mir hat diese Geschichte von dem kleinen Jungen gefallen und ich hab den ganzen Tag darüber nachgedacht. Wenn er diesen kleinen Jungen geheilt hat, warum sollte er dann nicht auch Illyrika heilen und die blinde Astarte unten am Hafen?«
Ich wollte schon die Worte meiner Mutter wiederholen, dass Böses nicht von Bösem ausgetrieben werden kann. Aber dann fiel mir ein, dass das ja nicht für meine Ohren bestimmt war, deshalb sagte ich nur: »Er ist ein Jude, Ione, und wir sind Griechen oder Phönizier. Er würde nie über die Grenze zu uns kommen! Du weißt, dass sie uns da unten als Hunde bezeichnen. Sogar Onkels Frau Ester hat uns nie besucht. Außerdem ist ein Prophet ein religiöser Mann und unsere Religionen haben nichts Gemeinsames. Hast du diese Geschichte denn wirklich geglaubt?«
»Natürlich, warum sollte unser Onkel uns belügen? Du denn nicht?«
»Sie klang nicht sehr glaubwürdig. Der kleine Junge ist vielleicht zufällig in diesem Moment gesund geworden.«
Ich warf ihr einen Blick zu. Sie lächelte mich mit strahlenden Augen an. Ich erkannte, dass ich ihren Glauben keineswegs erschüttert hatte. An der Haustür legte sie einen Finger auf ihre Lippen.
»Sprich nicht mehr von ihm«, flüsterte sie. »Nur wenn wir allein sind.« Wir betraten das Haus und aßen unseren Linsen brei mit zerquetschten Feigen. Ich dachte ärgerlich an das Fleisch, das für Illyrika gebraten worden war. Der köstliche Duft der Soße hing noch in der Luft, aber mein Vater aß seine Lin sen recht zufrieden und ging bei Sonnenuntergang fort. Als er die Tür erreichte, wandte er sich um. Er sah mich schweigend von Kopf bis Fuß an, als wolle er meine Körpergröße und die Stärke meiner Muskeln messen.
»Bei Vollmond«, verkündete er schließlich, »kannst du mit mir hinausfahren. Das ist die beste Zeit zum Lernen, wenn es warm und die See ruhig ist. Ist das Meer erst einmal sturmgepeitscht und ist hoher Seegang, habe ich keine Zeit mehr, dich anzulernen. Deshalb fängst du am besten jetzt an.«
Ich war begeistert. Jetzt war ich ein Mann. Ich konnte am Tag schlafen und nachts hinausfahren. Der dunkle Schatten würde nicht länger auf mir lasten. Ich wandte mich eifrig zu meiner Mutter um, aber diese großartige Neuigkeit schien sie nicht zu interessieren, denn sie beugte sich über Illyrika, die im Schlaf wie ein verlorener Geist stöhnte. Nur Ione, die gerade die Schlafmatten ausrollte, drehte sich um und lächelte mich an – aber unter Tränen. Da wusste ich, dass auch sie sich vor dem Bösen fürchtete, das in unserem Haus herrschte, und mich als ihren Beschützer betrachtete. Als sie fertig war, setzte ich mich neben sie und legte den Arm um ihre Schultern. So saßen wir still beisammen, während der Himmel, den wir durch das Fenster beobachten konnten, sich hellrot färbte und die Geräusche der kleinen Stadt, die Schritte auf den Pflastersteinen, das Lachen der Kinder und das Hundegebell allmählich zu völliger Stille abebbten, bis nichts mehr zu hören war außer Illyrikas Stöhnen.
3. Kapitel
Die erste Nacht auf dem Meer werde ich nie vergessen. Ich folgte meinem Vater die Straße hinunter und blieb verzückt am Strand stehen. Die Sonne war gerade untergegangen, aber der Himmel über dem Horizont war entflammt und die Farben Gelb, Violett und Purpur spiegelten sich im dunklen Wasser wider. Ich liebte alles Schöne und hätte in stummem Staunen stehen bleiben und zusehen können, wie die Wellen Feuer fingen. Mein Vater jedoch, für den dieses großartige Schauspiel nichts Neues war, hatte es eilig.
»Wach auf, Junge!«, herrschte er mich an. »Komm zum Boot runter. Es wird Zeit, dass wir losfahren.«
Oh, wie der Kiel auf dem Kies knirschte und das Boot schlingerte, als es auf dem Wasser lag! Wie die kleinen Wellen an die Bootsseiten klatschten und das Wasser vor uns dunkler wurde, während die Farbenpracht am Himmel allmählich verblasste. Ich war nie zuvor so glücklich gewesen, denn irgendwie spürte ich, dass ich meine Kindheit für immer hinter mir ließ. Mir wurde ein Ruder zugeteilt und ich wusste, dass ich stark, frei und ein Mann war. Während wir in die unendliche Weite und Tiefe des Meeres vordrangen, spielte der Wind in meinem Haar. Bald fand das Wunder der Nacht statt: Der Mond ging über den Bergen auf und das dunkle Wasser wurde in gesprenkeltes Silber verwandelt. Die kleine Stadt vor uns wurde vom Mond erleuchtet und die Wassertropfen glänzten am Netz wie Kristall.
Selbst in den ruhigen, ereignislosen Stunden vor Tagesanbruch, als mir vor Müdigkeit schwindlig war und meine Augen lider so schwer wurden, dass ich sie kaum offen halten konnte, ließ mich mein Vater nicht schlafen. Er hielt mich mit dem Ruder und Takelwerk beschäftigt und ich arbeitete wie im Schlaf. Ich sah, wie der Himmel hinter dem Morgenstern verblasste und die grauen Umrisse der Berge auftauchten. Irgendwann ruderten wir dann zur Küste zurück und zogen ein schweres Netz hin ter uns her. Die ganze Welt, Meer und Land, bestand aus kaltem, nebligem Grau. Mein Kopf fiel vornüber. Ich dachte, ich sei der Junge am Strand, der das Boot erwartete, aber ein schmerzhafter Rippenstoß meines Vaters ließ mich aufschrecken. Ich merkte, dass ich der Junge im Boot war, der auf den Strand wartete. Schließlich erreichten wir die Küste. Das Meer glühte in den gedämpften Farben des Morgens, die Sonne erwärmte unsere Gesichter, vertrieb den Nebel und die erste, unendlich lange Nacht war vorbei. Da erbarmte sich mein Vater über mich, hob mich mit seinen kräftigen Armen hoch und warf mich wie einen jungen Hund auf den Sandstrand.
»Geh heim, iss und schlaf!«, sagte er freundlich. »Wir kommen heute ohne dich zurecht.«