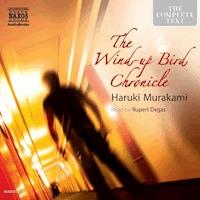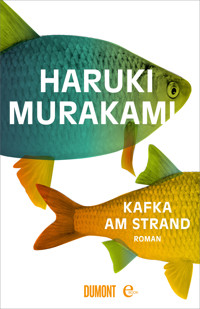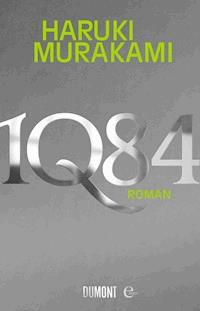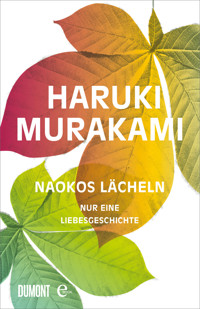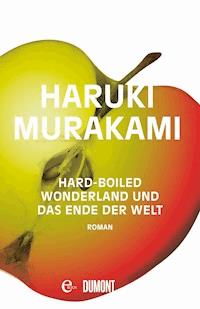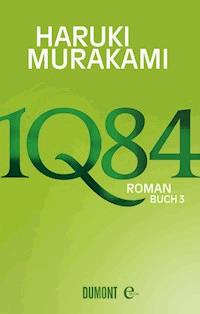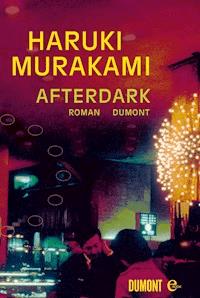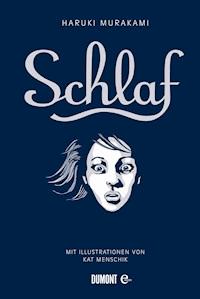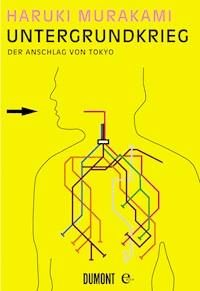14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine geheimnisvolle Bibliothek in einer ummauerten Stadt am Ende der Welt, die nur betreten kann, wer seinen eigenen Schatten zurücklässt: Hier lebt das wahre Ich des Mädchens, in das sich der namenlose Erzähler mit siebzehn Jahren unsterblich verliebt. Er macht sich auf die Suche nach ihr, gelangt in die geheimnisvolle Stadt, doch das Mädchen erkennt ihn nicht mehr. Der Erzähler gerät unter rätselhaften Umständen zurück in die Welt jenseits der Mauer. Er zieht nach Tokio, arbeitet im Buchhandel, hat wechselnde Freundinnen. Seine Eltern drängen ihn, endlich zu heiraten. Aber er kann das Mädchen nicht vergessen. Schließlich kündigt er und nimmt eine Stelle in einer alten Bücherei in der Präfektur Fukushima an. Hier trifft er auf Herrn Koyasu, der wie er den Verlust einer großen Liebe zu verwinden hat, und den mysteriösen Yellow-Submarine-Jungen. Die Erinnerung an die ummauerte Stadt kehrt mit aller Macht zurück, die Realität gerät knirschend ins Wanken – und der Erzähler muss sich fragen, was ihn an diese Welt bindet. ›Die Stadt und ihre ungewisse Mauer‹ ist eine Liebesgeschichte, die Geschichte einer wundersamen Reise und zugleich eine Geschichte vom Werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eine ummauerte Stadt, die nur betreten kann, wer seinen eigenen Schatten zurücklässt: Hier lebt das wahre Ich des Mädchens, in das sich der namenlose Erzähler mit siebzehn Jahren unsterblich verliebt. Er macht sich auf die Suche, gelangt in die Stadt und ihre geheimnisvolle Bibliothek, doch das Mädchen erkennt ihn nicht mehr.
Der Ich-Erzähler gerät unter rätselhaften Umständen zurück in die Welt jenseits der Mauer. Er zieht nach Tokio, arbeitet im Buchhandel, hat wechselnde Freundinnen. Seine Eltern drängen ihn, endlich zu heiraten. Aber er kann das Mädchen nicht vergessen. Schließlich kündigt er und nimmt eine Stelle in einer alten Bibliothek in der Präfektur Fukushima an. Hier trifft er auf den mysteriösen Yellow-Submarine-Jungen und Herrn Koyasu, der wie er den Verlust einer großen Liebe zu verwinden hat. Die Erinnerung an die ummauerte Stadt kehrt mit aller Macht zurück, die Realität gerät knirschend ins Wanken – und der Ich-Erzähler muss sich fragen, was ihn an diese Welt bindet.
Der neue große Roman von Haruki Murakami: ein melancholischer, zärtlicher und philosophischer Roman über eine verlorene Liebe, die Suche nach dem Selbst und die Möglichkeit, Mauern zu überwinden.
© Noriko Hayashi
Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung bei DuMont. Zuletzt erschienen die Romane ›Die Ermordung des Commendatore‹ in zwei Bänden (2018), ›Die Chroniken des Aufziehvogels‹ (2020) in einer Neuübersetzung, der Erzählband ›Erste Person Singular‹ (2021), ›Murakami T‹ (2021) und ›Honigkuchen‹ (2023).
Ursula Gräfe, geboren 1956, hat in Frankfurt am Main Japanologie und Anglistik studiert. Aus dem Japanischen übersetzte sie u. a. Yukio Mishima, Hiromi Kawakami und Sayaka Murata. Für DuMont überträgt sie die Werke Haruki Murakamis ins Deutsche. 2019 erhielt sie den japanischen ›Noma Award for the Translation of Japanese Literature‹.
HARUKI MURAKAMI
DIE STADT UND IHRE UNGEWISSE MAUER
Roman
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
Die japanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ›Machi to sono futashikana kabe‹ bei Shinchosha Publishing Co., Ltd, Tokio.
MACHI TO SONO FUTASHIKANA KABE (The City and Its Uncertain Walls)
Copyright © 2023 Harukimurakami Archival Labyrinth
Originally published by Shinchosha Publishing Co., Ltd.
E-Book 2024
© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Übersetzung: Ursula Gräfe
Lektorat: Stephan Kleiner
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © olga_hmelevska/iStockphoto
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1000-1
www.dumont-buchverlag.de
Wo Alph, der heil’ge Fluss, durchströmt
Höhlen, die kein Mensch durchmisst,
Hinab ins sonnenlose Meer.
Samuel Taylor Coleridge,
»Kubla Khan«
TEIL I
1
Du hast mir von der Stadt erzählt.
An jenem Sommerabend wanderten wir, den süßen Duft von Gräsern atmend, flussaufwärts. Mehrmals stiegen wir die Kaskaden kleiner Wasserfälle hinauf und blieben hin und wieder stehen, um die schlanken silbrigen Fischlein in den Tümpeln zu beobachten. Wir gingen schon eine Zeit lang barfuß. Das klare kühle Wasser umspülte unsere Knöchel, und unsere Füße sanken tief ein in den feinen Flusssand – wie in weiche Wolken in einem Traum. Ich war siebzehn, du ein Jahr jünger.
Deine flachen roten Sandalen hattest du in deine gelbe Plastikschultertasche gepackt und watetest nun ein Stück vor mir von Sandbank zu Sandbank. Kleine Blätter sprenkelten deine nassen Waden wie hübsche grüne Satzzeichen. Ich trug meine abgetragenen weißen Turnschuhe in den Händen.
Anscheinend müde vom Gehen setzt du dich ins Gras und blickst, ohne etwas zu sagen, in den Himmel. Zwei kleine Vögel durchschneiden ihn mit schrillem Gezwitscher. Es ist still, und die blauen Vorboten der Dämmerung hüllen uns immer mehr ein. Als ich neben dir sitze, überkommt mich das wundersame Gefühl, Tausende unsichtbarer Fäden würden deinen Körper an meine Seele binden. Jeder Wimpernschlag von dir, selbst das leiseste Zucken deiner Lippen lässt mein Herz erbeben.
Zu der Zeit haben weder du noch ich einen Namen. Du bist sechzehn, ich siebzehn, die sommerliche Dämmerung, die lebhaften Fantasien im Gras am Flussufer – mehr gibt es nicht. Nach und nach beginnen über uns Sterne zu funkeln, aber auch sie sind namenlos. Nebeneinander sitzen wir im Gras am Ufer einer namenlosen Welt.
»Die Stadt ist von einer hohen Mauer umgeben«, holst du die Worte aus der Tiefe der Stille herauf wie verborgene Perlen vom Meeresgrund. »Die Stadt ist nicht groß, aber so klein, dass man sie einfach überblicken kann, ist sie auch nicht.«
Es ist das zweite Mal, dass du die Stadt erwähnst. Und auch, dass sie von einer hohen Mauer umgeben ist.
Die Stadt liege an einem schönen Fluss und habe drei steinerne Brücken (Ostbrücke, Westbrücke und Alte Brücke), erzählst du weiter, und es gebe dort eine Bibliothek, Wachtürme, eine verlassene Gießerei und einfache Gemeinschaftsunterkünfte. Schulter an Schulter sitzen wir im schwindenden Licht des Sommerabends und blicken auf die Stadt. Mal blinzelnd aus der Ferne von einem Hügel, dann wieder mit großen Augen aus so unmittelbarer Nähe, dass ich sie fast mit Händen greifen kann.
»Mein wahres Ich lebt in der Stadt mit der hohen Mauer«, sagst du.
»Heißt das, das, was ich jetzt sehe, bist in Wirklichkeit gar nicht du?«, frage ich natürlich.
»Nein, was du siehst, ist nur eine Art Stellvertreterin. Ein wandernder Schatten.«
Ein wandernder Schatten? Ich überlege und beschließe, mir meine Meinung erst später zu bilden.
»Und was macht dein wahres Ich in der Stadt?«
»Ich arbeite in der Bibliothek«, antwortest du leise. »Von ungefähr fünf Uhr nachmittags bis ungefähr zehn Uhr abends.«
»Ungefähr?«
»Alle Zeiten sind dort ungefähr. Auf dem Marktplatz in der Mitte der Stadt steht ein Uhrturm, aber die Uhr hat keine Zeiger.«
Ich stelle mir eine Uhr ohne Zeiger vor. »Kann jeder in die Bibliothek gehen?«
»Nein. Niemand kann sie einfach betreten. Dazu braucht man eine besondere Fähigkeit. Aber du könntest hinein. Du besitzt diese Fähigkeit.«
»Und was ist das für eine Fähigkeit?«
Du lächelst, aber du antwortest nicht.
»Aber wenn ich in die Stadt käme, könnte ich deinem wahren Ich begegnen, oder?«
»Wenn du sie finden würdest. Und wenn …«
Du verstummst und wirst ein wenig rot. Aber ich höre deine unausgesprochenen Worte.
Wenn du mein wahres Ich wirklich, wirklich suchen würdest … Das sind die Worte, die du damals nicht laut ausgesprochen hast.
Behutsam lege ich meinen Arm um dich. Du trägst ein hellgrünes, ärmelloses Kleid. Deine Wange ruht an meiner Schulter. Aber es ist nicht dein wahres Ich, das ich an diesem Sommerabend im Arm halte. Es ist dein Schatten, der deinen Platz einnimmt.
Dein wahres Ich lebt in der von der hohen Mauer umgebenen Stadt, wo es den schönen von Weiden gesäumten Fluss, Hügel und friedliche Weidetiere mit nur einem Horn gibt. Die Menschen leben in alten Gemeinschaftshäusern und führen ein einfaches Leben, aber es fehlt ihnen an nichts. Die Tiere ernähren sich von den Blättern und Samen der Bäume, die dort wachsen, aber in den langen Wintern, wenn der Schnee alles unter sich begräbt, verlieren viele von ihnen ihr Leben.
Wie sehr sehnte ich mich danach, in diese Stadt zu gelangen, um dort deinem wahren Ich zu begegnen.
»Die Stadt ist von einer hohen Mauer umgeben, und es ist schwierig, hineinzugelangen«, sagst du. »Und noch schwieriger, wieder herauszukommen.«
»Wie müsste ich es denn anstellen?«
»Du brauchst es eigentlich nur zu wollen. Aber es ist nicht einfach, etwas von ganzem Herzen zu wollen. Es kann eine Weile dauern. In der Zwischenzeit musst du vielleicht auf vieles verzichten. Auch auf Dinge, die dir wichtig sind. Aber gib nicht auf. Denn ganz gleich, wie lange du brauchst, die Stadt wird nie verschwinden.«
Ich stelle mir vor, wie es wäre, in dieser Stadt deinem wahren Ich zu begegnen. Ich male mir alles aus – die ausgedehnten Apfelhaine vor der Stadt, den Fluss, die drei steinernen Brücken und die Rufe der unsichtbaren Nachtvögel. Und die kleine alte Bibliothek, in der dein wahres Ich arbeitet.
»Dort ist immer ein Platz für dich bereit«, sagst du.
»Ein Platz für mich?«
»Ja. Es gibt nur eine freie Stelle in der Stadt. Du füllst sie aus.«
Was für eine Stelle könnte das sein?
»Du wirst ›Traumleser‹«, sagst du mit gedämpfter Stimme, als würdest du mir ein bedeutsames Geheimnis anvertrauen.
Unwillkürlich muss ich lachen. »Ich kann mich ja nicht einmal richtig an meine eigenen Träume erinnern. Für so jemanden könnte es ziemlich schwierig werden, Träume zu lesen, meinst du nicht?«
»Es sind nicht seine eigenen Träume, die der Traumleser liest. Er muss die alten Träume aus dem Archiv der Bibliothek lesen. Doch das kann nicht jeder.«
»Aber ich kann es?«
Du nickst. »Ja, du kannst es. Du besitzt die Fähigkeit dazu. Und mein Ich dort wird dir bei deiner Arbeit helfen. Ich werde jeden Abend bei dir sein.«
»Als Traumleser lese ich also jeden Abend die alten Träume im Archiv der Bibliothek in der Stadt. Und du bist immer bei mir. Also dein wahres Ich«, fasse ich noch einmal zusammen.
Ich spüre, wie deine nackte Schulter unter meinem Arm zittert. Doch plötzlich erstarrst du.
»Aber eins muss ich dir noch sagen. Mein Ich in der Stadt wird sich nicht an dich erinnern, wenn wir uns begegnen.«
Warum nicht?
»Du weißt nicht, warum?«
Doch, ich weiß es. Denn die Schulter, um die ich meinen Arm gelegt habe, ist lediglich die deines Schattens. Dein wahres Ich lebt in der Stadt. In jener geheimnisvollen fernen Stadt hinter der hohen Mauer.
Deine Schulter fühlt sich glatt und warm an. Wie könnte sie nicht deinem wahren Ich gehören?
2
In der wirklichen Welt leben wir an zwei verschiedenen Orten. Sie liegen nicht weit voneinander entfernt, aber auch nicht so nah, dass wir uns spontan treffen könnten. Um zu dir zu kommen, muss ich zweimal umsteigen und brauche anderthalb Stunden. Aber unsere jeweiligen Wohnorte sind nicht von hohen Mauern umgeben. Wir können also kommen und gehen, wie wir wollen.
Ich wohne in einem ruhigen Vorort, du in der belebten Innenstadt, wo es viel lauter ist. In diesem Sommer bin ich in der zwölften Klasse, du in der elften. Ich besuche eine öffentliche Schule in der Nachbarschaft, du eine private Mädchenschule. Meist treffen wir uns ein- oder zweimal im Monat, abwechselnd bei dir oder bei mir. Wenn ich dich besuche, gehen wir in einen nahe gelegenen Park oder in den öffentlichen Botanischen Garten. Der Botanische Garten kostet Eintritt, aber neben dem Gewächshaus gibt es ein kaum besuchtes Café, das einer unserer Lieblingsorte ist. Dort bestellen wir Kaffee und Apfeltarte (ein kleiner Luxus) und schwelgen in der Zweisamkeit unserer Gespräche. Kommst du zu mir in die Vorstadt, gehen wir meist am Fluss oder am Meer spazieren. Bei dir in der Innenstadt gibt es natürlich keinen Fluss und auch kein Meer, weshalb du, wann immer wir uns bei mir treffen, zuerst den Fluss oder das Meer sehen willst. Offenbar fühlst du dich zu der großen Menge an natürlichem Wasser hingezogen, die es dort gibt.
»Ich weiß nicht, wieso, aber der Anblick von Wasser beruhigt mich«, sagst du. »Ich liebe das Rauschen.«
Wir haben uns irgendwann im letzten Herbst kennengelernt und sind seit acht Monaten zusammen. Bei unseren Begegnungen umarmen wir uns möglichst unbemerkt und küssen uns zärtlich. Weiter gehen wir nicht. Einer der Gründe dafür ist, dass wir nicht genügend Zeit haben. Und dann ist da noch der praktische Umstand, dass uns der geeignete Ort für eine intime Beziehung fehlt. Doch der Hauptgrund besteht vermutlich darin, dass wir völlig in unseren Gesprächen aufgehen. Weder du noch ich sind bisher einem Menschen begegnet, mit dem wir so frei und natürlich unsere Gefühle und Gedanken austauschen können. Für mich grenzt es an ein Wunder, jemandem wie dir begegnet zu sein. Deshalb reden wir bei unseren ein- oder zweimal im Monat stattfindenden Treffen so viel, dass wir die Zeit darüber vergessen. Wir können noch so lange über welches Thema auch immer sprechen, wir kommen nie zum Ende, und wenn wir uns schließlich an der Fahrkartensperre verabschieden, scheint immer viel Wichtiges ungesagt.
Natürlich ist es nicht so, dass ich kein körperliches Verlangen verspüre. Ausgeschlossen, dass ein Siebzehnjähriger keine sexuelle Erregung empfindet, wenn er den Arm um ein sechzehnjähriges Mädchen mit sich rundenden Brüsten legt. Aber ich spüre intuitiv, dass dafür später noch Zeit ist. Was ich jetzt brauche, sind unsere Treffen, wenn auch nur zweimal im Monat, und unsere langen Spaziergänge, auf denen wir über alles reden können. Unsere geheimsten Gedanken austauschen und uns von Mal zu Mal besser kennenlernen, uns im Schatten eines Baumes umarmen und küssen – ohne noch mehr in diese wunderbare Zeit hineinzupressen. Das könnte etwas Wichtiges zerstören, und wir könnten vielleicht nicht wieder zu dem zurückkehren, was wir einmal hatten. Das Körperliche können wir uns für später aufheben. Glaube ich. Zumindest sagt mir das meine Intuition.
Doch worüber redeten wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir die Köpfe zusammensteckten? Ich weiß es nicht mehr. Wir redeten so viel, dass es mir unmöglich ist, die einzelnen Themen zu benennen. Aber nachdem du mir von der eigentümlichen Stadt mit der hohen Mauer erzählt hattest, machte sie den größten Teil unserer Gespräche aus.
Im Wesentlichen schildertest du mir, wie die Stadt angelegt war, und ich stellte praktische Fragen dazu, die du so beantwortetest, dass ihre konkreten Einzelheiten zunehmend Gestalt annahmen. Die Stadt war von Anfang an deine Schöpfung. Oder etwas, das schon lange in dir war. Aber ich glaube, auch ich trug nach Kräften dazu bei, sie sichtbar und mit Worten beschreibbar zu machen. Du erzähltest, und ich schrieb es nieder. Ebenso wie die getreuen Jünger der antiken Philosophen und religiösen Lehrer im Hintergrund alles akribisch aufzeichneten. Als eifriger Jünger hatte ich mir sogar ein kleines, einzig diesem Zweck vorbehaltenes Notizheft angelegt, um alles aufzuschreiben. In diesem Sommer gingen wir ganz und gar in dieser unserer gemeinsamen Arbeit auf.
3
Im Herbst überzieht ein dichtes goldglänzendes Fell die Körper der Tiere, sodass sie der bevorstehenden kalten Jahreszeit trotzen können. Das aus ihrer Stirn wachsende Horn ist spitz und weiß. Sie spülen ihre Hufe im kalten Flusswasser, recken die Hälse nach den roten Beeren an den Bäumen und rupfen die Blätter des Besenginsters ab.
Es war eine schöne Jahreszeit.
Ich stehe auf einem der Wachtürme entlang der Mauer und warte auf das abendliche Hornsignal. Kurz vor Sonnenuntergang ertönt es einmal lang und dreimal kurz. So will es die Vorschrift. Sein weicher Klang gleitet in der langsam einsetzenden Dämmerung durch die Straßen aus Kopfsteinpflaster. Unverändert wiederholt sich dies seit Hunderten von Jahren (oder womöglich länger), breitet sich der Klang aus, dringt bis tief in die Risse der Steinhäuser und Statuen ein, die den Marktplatz säumen.
Sobald das Horn erklingt, heben die Tiere einer uralten Erinnerung folgend die Köpfe. Manche hören auf, ihre Blätter zu kauen, andere mit den Hufen auf das Pflaster zu stampfen, und wieder andere erwachen aus einem Schläfchen in der Abendsonne. Und alle wenden ihre Köpfe in dieselbe Richtung.
Jäh sind sie wie zu Statuen erstarrt. Einzig ihr weiches goldenes Haar weht leicht im Wind. Doch wohin schauen sie? Sie verharren reglos, den Blick nach oben ins Leere gerichtet.
Kaum, dass der letzte Ton verklungen ist, stützen sie sich auf die Vorderläufe und erheben sich, stehen aufrecht, um sich dann nahezu gleichzeitig in Bewegung zu setzen. Mit einem Mal ist der Bann gebrochen, und eine Zeit lang beherrscht ihr Hufgetrappel die verwinkelten Straßen. In einer Reihe ziehen sie über das Kopfsteinpflaster. Keines der Tiere setzt sich an die Spitze, offenbar spielt es keine Rolle, welches den Zug anführt. Mit gesenkten Blicken und schwingenden Flanken trotten sie durch die Stille hinunter zum Fluss. Und dennoch scheint eine unauflösliche Verbindung zwischen ihnen zu bestehen.
Nachdem ich sie mehrmals beobachtet habe, stelle ich fest, dass ihre Wegstrecke und ihre Geschwindigkeit streng reglementiert sind. Sich aneinanderdrängend, überqueren sie die leicht gewölbte Alte Brücke und erreichen den Marktplatz mit dem spitzen Turm (dessen Uhr, wie du sagst, ihre Zeiger verloren hat). Dort schließen sie sich einer kleinen Schar an, die auf der grünen Wiese am Ufer geweidet hat. Gemeinsam ziehen sie weiter flussaufwärts, vorbei am Fabrikgelände, entlang des ausgetrockneten Kanals, der nach Norden führt, und gesellen sich dort zu einer Herde, die im Wald nach Beeren gesucht hat. Nun wenden sie sich nach Westen und durchqueren den überdachten Gang zur Gießerei, wo eine lange Treppe zum Nordhügel hinaufführt.
Die Mauer, die die Stadt umgibt, besitzt nur ein Tor, das zu öffnen und zu schließen Aufgabe des Torwächters ist. Es wirkt schwer und massiv und ist mit sich kreuzenden Eisenbeschlägen verstärkt. Dennoch vermag er es mit Leichtigkeit zu bewegen. Niemand außer ihm darf das Tor auch nur berühren.
Der Torwächter ist ein großer, kräftiger, seiner Arbeit pflichtgetreu ergebener Mann. Sein spitz zulaufender Schädel ist sauber und glatt rasiert, ebenso sein Gesicht. Allmorgendlich erhitzt er Wasser in einem großen Topf, um sich mit einem scharfen Messer gewissenhaft zu rasieren. Er ist von unbestimmtem Alter. Zu seinen Aufgaben gehört es, morgens und abends das Horn zu blasen, um die Tiere zusammenzutreiben. Dazu besteigt er einen ungefähr zwei Meter hohen Ausguck vor der Wächterhütte und stößt in das Horn. Wie schafft es dieser grobschlächtige, fast vulgäre Mann, einen so weichen, strahlenden Ton hervorzubringen? Wann immer ich in der Dämmerung das Horn höre, wundere ich mich darüber.
Sobald sämtliche Tiere außerhalb der Mauer sind, drückt er das schwere Tor wieder zu und legt geräuschvoll den großen Riegel vor. Es klingt trocken und kalt.
Vor dem Nordtor ist ein Platz für die Tiere, an dem sie schlafen, sich paaren und ihre Jungen zur Welt bringen. Es gibt dort auch einen Wald, viel Gestrüpp und einen Bach. Auch dieses Gebiet ist von einer Mauer umgeben. Sie ist niedrig, eigentlich nur ein Mäuerchen, kaum über einen Meter hoch, aber aus irgendeinem Grund können die Tiere sie nicht überwinden. Oder sie wollen es nicht.
Die große Mauer zu beiden Seiten des Tors hat sechs Wachtürme, die, wer will, über eine alte hölzerne Wendeltreppe besteigen kann. Von den Wachtürmen hat man einen freien Blick auf den Lebensraum der Einhörner. Doch in der Regel steigt niemand hinauf. Die Stadtbewohner scheinen sich nicht für sie zu interessieren.
Nur in der ersten Frühlingswoche klettern Leute auf die Wachtürme, um von dort die ungestümen Kämpfe der Tiere zu beobachten. In dieser Zeit sind sie unvorstellbar wild, ganz anders als sonst. Die Bullen fressen nicht mehr und liefern sich tödliche Kämpfe um die Kühe. Unter lautem Röhren versuchen sie ihrem Rivalen ihr spitzes Horn in die Kehle oder den Bauch zu stoßen.
Während der Paarungszeit dürfen die Tiere eine Woche lang nicht in die Stadt. Der Wächter hält das Tor geschlossen, um die Einwohner vor der Gefahr zu schützen (deshalb entfällt auch das morgendliche und abendliche Blasen des Horns). Bei den Kämpfen werden nicht wenige Tiere schwer verletzt, und manche lassen sogar ihr Leben. Die blutgetränkte Erde bringt eine neue Ordnung und neues Leben hervor. So wie die Weiden im Vorfrühling nahezu gleichzeitig ihr frisches Grün austreiben.
Die Tiere leben nach ihrem eigenen Rhythmus und einem für uns unverständlichen System. Alles ist ein sich ständig wiederholender Kreislauf, in dem sie durch ihr Blutvergießen ihre Ordnung erneuern. Sobald die wilde Woche vorüber ist und der sanfte Aprilregen das vergossene Blut fortgewaschen hat, kehren die Tiere zu ihrem ruhigen und friedlichen Dasein zurück.
Allerdings habe ich diese Szenen nie mit eigenen Augen gesehen. Du hast mir nur davon erzählt.
Wenn die Tiere im Herbst auf ihren Weideplätzen lagern und ruhig warten, bis das Horn verklingt, glänzt ihr goldenes Fell in der Abendsonne. Ihre Zahl dürfte in die Tausende gehen.
Wieder neigt sich ein Tag in der Stadt dem Ende zu. Die Tage verstreichen, die Jahreszeiten wechseln. Aber letztendlich sind sie flüchtig in ihrer Vergänglichkeit. Die wahre Zeit der Stadt liegt andernorts.
4
Wir besuchen einander nie zu Hause. Auch unsere Eltern und Freunde stellen wir einander nicht vor. Kurz gesagt, wir wollen von niemandem – in welcher Welt auch immer – gestört werden. Unsere Zweisamkeit stellt uns vollauf zufrieden, und wir empfinden keinerlei Bedürfnis, ihr irgendetwas hinzuzufügen. Auch körperlich ist kein Platz für mehr. Denn wie gesagt, haben wir uns so unendlich viel zu sagen, und unsere gemeinsame Zeit ist begrenzt.
Du erzählst nur selten von deiner Familie. Alles, was ich über dich weiß, sind Bruchstücke. Dein Vater war früher Beamter, aber als du elf Jahre alt warst, wurde ihm wegen eines Missgeschicks gekündigt, und er unterrichtete inzwischen in einer Yobiko, einer Vorbereitungsschule. Um welche Art »Missgeschick« es sich gehandelt hatte, weiß ich nicht, aber offenbar etwas, worüber du nicht sprechen willst. Deine leibliche Mutter starb an Krebs, als du drei Jahre alt warst, weshalb du so gut wie keine Erinnerung an sie hast. Du weißt nicht einmal mehr, wie sie aussah. Als du fünf warst, hat dein Vater wieder geheiratet, und im Jahr darauf wurde deine kleine Schwester geboren. Einmal sagtest du, du fühltest dich deiner Mutter »vielleicht näher« als deinem Vater, obwohl sie ja deine Stiefmutter sei. Es klang wie eine beiläufige klein gedruckte Fußnote am Ende einer Buchseite. Über deine sechs Jahre jüngere Schwester erfuhr ich nicht mehr, als dass sie »allergisch gegen Katzenhaare« war und ihr deshalb keine Katze halten konntet.
In deiner Kindheit war deine Großmutter mütterlicherseits der einzige Mensch, zu dem du eine natürliche, liebevolle Bindung hattest, sodass du bei jeder Gelegenheit allein mit dem Zug zu ihr in den Nachbarbezirk fuhrst. In den Schulferien durftest du auch manchmal mehrere Tage bei ihr übernachten. Deine Großmutter liebte dich bedingungslos und kaufte dir von ihrer mageren Rente sogar kleine Geschenke. Doch nach jedem Besuch bei ihr fiel dir die gekränkte Miene deiner Stiefmutter auf, und obwohl sie nichts sagte, fuhrst du immer seltener zu deiner Großmutter, bis diese vor einigen Jahren plötzlich an einem Herzleiden verstarb.
Du berichtetest mir so bruchstückhaft von diesen Ereignissen, als würdest du ein paar Fetzen Papier aus der Tasche eines alten Mantels kramen.
Und noch etwas kommt mir in den Sinn, wenn ich an damals denke. Wenn du von deiner Familie sprachst, starrtest du aus irgendeinem Grund ständig auf deine Handflächen. Als müsstest du die Geschichte daraus ablesen (oder etwas in der Art), um ihr richtig folgen zu können.
Über meine Familie gab es nicht viel zu erzählen. Meine Eltern waren konservative, ganz normale Leute. Mein Vater arbeitete in einem Pharmaunternehmen, meine Mutter war Hausfrau. Sie verhielten sich wie durchschnittliche Eltern und redeten auch so. Wir hatten eine alte schwarze Katze. Auch über meine Schulzeit gab es nicht viel zu sagen. Meine Leistungen waren nicht allzu schlecht, aber auch nicht so herausragend, dass es aufgefallen wäre. Mein Lieblingsplatz in der Schule war die Bibliothek, in der ich mir überaus gern die Zeit mit Lesen und Träumen vertrieb. Den größten Teil der Bücher, die mich damals interessierten, las ich in der Schulbibliothek.
Ich erinnere mich noch gut an unsere erste Begegnung. Sie fand bei der Preisverleihung für einen Aufsatzwettbewerb der Oberschulen statt. Eingeladen waren die Preisträger bis zum fünften Platz. Wir hatten den dritten und den vierten Platz belegt und saßen nebeneinander. Es war Herbst, und ich war damals in der zehnten Klasse und du in der neunten. Weil die Preisverleihung eine langweilige Angelegenheit war, flüsterten wir zwischendurch kurz miteinander. Du trugst deine Schuluniform mit dem marineblauen Blazer und dem dazu passenden Faltenrock, eine weiße Bluse mit Schleife, weiße Söckchen und schwarze Halbschuhe. Die Söckchen waren schneeweiß und die Schuhe so fleckenlos blank, als hätten sieben freundliche Zwerge sie noch vor dem Morgengrauen gründlich poliert.
Nicht dass ich besonders gut im Schreiben von Aufsätzen gewesen wäre. Ich hatte schon als Kind sehr gern gelesen und nahm, wann immer ich Zeit hatte, ein Buch zur Hand. Allerdings traute ich mir selbst kein Talent zum Schreiben zu. Doch nachdem unsere Klasse dazu aufgefordert worden war, einen Japanisch-Aufsatz für den Wettbewerb zu verfassen, wurde meiner als bester ausgewählt und an die Jury geschickt. Unerwartet schaffte ich es in die Endrunde und gewann einen der Hauptpreise. Um ehrlich zu sein, war mir unverständlich, was an meinem Aufsatz besonders sein sollte. Auch nach mehrmaligem Lesen fand ich ihn ziemlich mittelmäßig und nicht gerade genial. Aber da die Jury ihn für preiswürdig befunden hatte, musste er wohl etwas zu bieten haben. Meine Klassenlehrerin freute sich sehr über den Preis. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass eine Lehrkraft sich derart beifällig über eine von mir erbrachte Leistung äußerte. Also beschloss ich, nicht weiter zu zweifeln und den Preis dankbar anzunehmen.
Der Aufsatzwettbewerb fand jeden Herbst in unserem Bezirksverband statt, und jedes Jahr wurde ein anderes Thema vorgegeben. Da mir leider kein einziger »Freund« einfiel, über den ich fünf Seiten lang schreiben wollte, schrieb ich über unsere alte Katze. Ich schilderte meine Beziehung zu ihr, unseren gemeinsamen Alltag und unsere – sich in ihren natürlichen Grenzen bewegenden – Gefühle füreinander. Über die Katze gab es eine Menge zu erzählen, denn sie war sehr intelligent und hatte eindeutig Charakter. Vielleicht saßen auch einige Katzenliebhaber in der Jury. Die meisten Menschen mit einer Vorliebe für Katzen hegen eine natürliche Zuneigung und Sympathie für andere Katzenliebhaber.
Du hast über deine Großmutter mütterlicherseits geschrieben. Über die Herzensbindung zwischen einer einsamen alten Frau und einem einsamen kleinen Mädchen. Über die lauteren und unverfälschten Werte, die daraus erwuchsen. Ein bezaubernder, anrührender Aufsatz. Um ein Vielfaches besser als meiner. Es ist mir unbegreiflich, dass mein Aufsatz den dritten Platz belegt und deiner nur den vierten. Was ich dir auch ganz offen sage. Du lächelst und erklärst, du fändest meinen Aufsatz ganz im Gegenteil viel besser als deinen. Und das sei wirklich nicht gelogen, fügst du hinzu.
»Eure Katze ist toll.«
»Sie ist sehr klug«, sage ich.
Du lächelst.
»Habt ihr auch eine Katze?«, frage ich.
Du schüttelst den Kopf. »Meine Schwester ist allergisch gegen Katzenhaare.«
Dies ist die erste rein persönliche Information über dich, die ich erhalte. Ihre Schwester ist allergisch gegen Katzenhaare.
Du bist ein sehr schönes junges Mädchen. Zumindest in meinen Augen. Klein und zierlich mit einem eher runden Gesicht und hübschen schlanken Fingern. Du trägst dein Haar kurz, auch der schwarze Pony über deiner Stirn ist kurz geschnitten. Exakt wie ein feiner Schattenriss. Du hast eine kleine gerade Nase und sehr große Augen. Nach landläufiger Meinung besteht vielleicht ein gewisses Ungleichgewicht zwischen der Größe der Nase und der der Augen, aber gerade dieses Ungleichgewicht ist es, das mich anzieht. Deine blassrosa Lippen sind klein und schmal und immer fest geschlossen, als würden sich bedeutende Geheimnisse dahinter verbergen.
Die fünf Gewinner betreten der Reihe nach die Bühne, und man überreicht jedem von uns ehrerbietig eine Urkunde und eine Gedenkmedaille. Ein großes Mädchen, die Gewinnerin des Hauptpreises, hält eine kurze Ansprache. Die Nebenpreise bestehen jeweils in einem Füllfederhalter (der Hersteller war Sponsor des Wettbewerbs, und der Füller blieb über viele Jahre lang mein Lieblingsschreibgerät). Kurz vor Ende der sich in die Länge ziehenden und ermüdenden Preisverleihung reiße ich ein Blatt aus meinem Notizbuch, schreibe mit Kugelschreiber meinen Namen und meine Adresse darauf und stecke es dir heimlich zu.
»Würdest du mir irgendwann einen Brief schreiben? Also nur, wenn du Lust hast«, flüstere ich dir heiser zu.
Normalerweise bin ich nicht so verwegen, sondern von Natur aus ein eher schüchterner Charakter (und feige). Aber der Gedanke, mich jetzt von dir zu verabschieden und dich vielleicht nie wiederzusehen, fühlt sich so völlig falsch und ungerecht an. Also nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und greife zu dieser tollkühnen Maßnahme.
Leicht erstaunt nimmst du den Zettel entgegen, faltest ihn ordentlich zusammen und schiebst ihn in die Brusttasche deines Blazers. Oberhalb der Wölbung deiner Brust. Du streichst dir die Haare aus der Stirn und errötest ein wenig.
»Ich würde gern mehr von dem lesen, was du schreibst«, sage ich wie einer, der sich in der Tür geirrt hat und nun eine lahme Ausrede hervorbringt.
»Ich möchte auch unbedingt einen Brief von dir lesen«, sagst du und nickst ein paarmal ermutigend.
Eine Woche später bekomme ich einen Brief von dir. Er ist hinreißend. Ich lese ihn mindestens zwanzig Mal. Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und schreibe dir mit meinem frisch gewonnenen neuen Füllfederhalter zurück. So beginnt unsere Brieffreundschaft und damit unsere persönliche Beziehung.
Waren wir ein Liebespaar? Konnte man das so nennen? Ich weiß es nicht. Doch zumindest waren wir, du und ich, fast ein Jahr lang unzertrennlich. Und irgendwann schufen wir uns eine besondere geheime Welt, nur für uns beide – die wundersame Stadt, umgeben von der hohen Mauer.
5
An meinem dritten Abend in der Stadt stieß ich die Tür des Gebäudes auf. Es hatte keine besonderen Merkmale, war alt und aus Stein. Wenn man ein Stück die Uferstraße entlang nach Osten ging, lag es hinter dem Marktplatz gegenüber der Alten Brücke. Der Eingang war nicht gekennzeichnet, sodass das Gebäude für einen Fremden nicht als Bibliothek erkennbar war. Nur ein beschlagenes, kaum noch lesbares Messingschild mit der Nummer 16 war nachlässig dort angebracht.
Die schwere Holztür öffnete sich laut knarrend nach innen und gab den Blick auf einen schwach beleuchteten quadratischen Raum frei. Er hatte eine hohe Decke, eine Hängelampe beleuchtete ihn spärlich, und es roch nach getrocknetem Schweiß. Niemand war zu sehen. Alles wirkte so körnig und verschwommen, als könnte es mir nichts, dir nichts von der Düsternis verschluckt werden. Die abgenutzten Zedernholzdielen knarrten hier und da, wenn ich darauftrat. Es gab zwei hohe längliche Fenster und kein einziges Möbelstück.
Die schlichte Holztür auf der gegenüberliegenden Seite hatte ein kleines Milchglasfenster, auf dem ebenfalls in altmodischer Schrift die Zahl 16 stand. Hinter dem Milchglas schimmerte ein schwaches Licht. Ich klopfte zweimal leicht an die Tür und wartete, aber es kam keine Antwort. Auch Schritte waren nicht zu hören. Nachdem ich einen Moment lang den Atem angehalten hatte, drehte ich den abgegriffenen Messingknauf und stieß sachte die Tür auf. Sie quietschte warnend, wie um zu sagen: »Achtung, da kommt jemand.«
Hinter ihr befand sich ein etwa zwanzig Quadratmeter großer Raum, dessen Decke nicht so hoch war wie die im Vorraum. Auch hier war niemand. Es gab kein Fenster. Die Wände waren verputzt, aber kein Bild, kein Foto, kein Poster, kein Kalender und schon gar keine Uhr zierte sie. Da waren nur die kahlen Wände, eine grobe Holzbank, zwei kleine Stühle, ein Tisch und ein hölzerner Garderobenständer, an dem allerdings kein Mantel hing. In der Mitte des Raumes stand ein altmodischer rostiger Holzofen, in dem ein rotes Feuer loderte und auf dem ein großer schwarzer Kessel dampfte. Am anderen Ende gab es eine Art Büchertheke mit einem aufgeschlagenen Register. Offenbar hatte die Bibliothekarin mittendrin etwas Dringendes zu erledigen gehabt. Vermutlich würde sie gleich zurückkommen. Die dunkle Tür hinter der Theke, die anscheinend in ein Archiv führte, war ein Hinweis, dass es sich um eine Bibliothek handelte. Obwohl kein Buch zu sehen war, vermittelten die Räumlichkeiten eindeutig diesen Eindruck. Ob groß oder klein, alt oder neu, sämtliche Bibliotheken der Welt haben diese ganz besondere Atmosphäre.
Ich zog meinen dicken Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe, setzte mich auf die harte Holzbank und wartete, mir die Hände am Ofen wärmend, darauf, dass jemand kam. Um mich herum herrschte vollkommene Stille wie auf dem Grund eines tiefen Gewässers. Versuchsweise räusperte ich mich, aber es klang nicht wie ein Räuspern.
Nach etwa einer Viertelstunde (glaube ich, aber da ich keine Uhr habe, kann ich es nicht genau sagen) geht die Tür zum Archiv auf, und du erscheinst. Als du mich auf der Bank sitzen siehst, hältst du einen Moment inne, und deine Augen weiten sich. Dann holst du langsam Luft. »Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich wusste nicht, dass jemand da ist.«
Mir fehlen die richtigen Worte, also nicke ich nur ein paarmal stumm. Deine Stimme klingt nicht wie deine. Zumindest nicht so, wie ich sie im Gedächtnis habe. Oder vielleicht hören die Geräusche und Stimmen sich hier auch anders an als woanders.
Plötzlich klappert der Deckel des Kessels, und ich zucke zusammen wie ein aufgescheuchtes Tier.
»Was kann ich für dich tun?«, fragst du.
»Ich suche alte Träume.«
»Alte Träume, ja.« Die schmalen Lippen zusammengepresst, siehst du mich an. Natürlich erinnerst du dich nicht an mich. »Wie du weißt«, fährst du fort, »haben nur Traumleser Zugang zu den alten Träumen.«
Schweigend nehme ich meine dunkelgrüne Brille ab und sehe dich mit geöffneten Lidern an. Meine Augen sind unverkennbar die eines Traumlesers. Damit kann ich nicht ins grelle Tageslicht hinaus.
»Ich verstehe. Du hast die Fähigkeit«, sagst du und senkst leicht den Blick. Vielleicht beunruhigt dich der Zustand meiner Augen. Aber das ist nicht zu ändern. Um die Stadt zu betreten, musste ich meine Augen dieser Behandlung unterziehen.
»Fängst du heute an zu arbeiten?«, fragst du.
Ich nicke. »Ich weiß noch nicht, ob ich gut lesen kann, aber ich muss mich allmählich daran gewöhnen.«
Noch immer ist kein Laut zu hören. Der Kessel ist wieder verstummt. Ohne auf mich zu achten, fährst du rasch mit deiner Arbeit am Register fort, mit der du gerade beschäftigt bist. Ich beobachte dich von der Bank aus. Äußerlich hast du dich nicht im Geringsten verändert. Du siehst noch genauso aus wie an jenem Sommerabend. Ich denke an die leuchtend roten Sandalen, die du trugst. Und auch an die Grashüpfer, die aus der nahen Wiese sprangen.
»Haben wir uns nicht schon einmal irgendwo gesehen?« Ich kann die Frage nicht zurückhalten, auch wenn ich weiß, dass sie sinnlos ist.
Den Bleistift in der linken Hand, blickst du von deinem Register auf und musterst mich kurz. (Stimmt, du bist ja Linkshänderin, hier wie andernorts.) Du schüttelst den Kopf.
»Nein, ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind«, antwortest du höflich. Vielleicht weil du noch sechzehn bist, ich jedoch nicht mehr siebzehn. Für dich bin ich inzwischen ein wesentlich älterer Mann. Bei all meinem Wissen um die Unaufhaltsamkeit der Zeit versetzt es mir einen Stich.
Nachdem du deine Arbeit am Register beendet hast, klappst du es zu, stellst es in das Regal hinter dir und kochst mir einen Kräutertee. Dazu nimmst du den Kessel vom Ofen und brühst mit heißem Wasser zerstoßene Kräuter zu einem tiefgrünen Aufguss auf. Du schüttest ihn in eine große Keramiktasse und stellst sie vor mich hin. Es ist ein besonderes Getränk für Traumleser, und es gehört zu deinen Aufgaben, es zuzubereiten.
Ich lasse mir beim Trinken Zeit. Der Kräutertee hat eine eigentümlich ausgeprägte Bitterkeit und ist nicht leicht zu genießen. Aber seine Nährstoffe haben eine heilende Wirkung auf meine verletzten, gereizten Augen. Das Getränk dient diesem besonderen Zweck. Unsicher beobachtest du von der anderen Seite des Tisches, ob mir der von dir zubereitete Kräutertee schmeckt. Ich nicke dir kurz zu, um dir zu verstehen zu geben, dass alles in Ordnung ist. Ein erleichtertes Lächeln huscht über deine Lippen. Es hat mir gefehlt, dieses Lächeln. Ich habe es so lange entbehrt.
Es ist still und warm im Raum. Auch ohne Uhr verstreicht lautlos die Zeit. Wie eine schlanke Katze, die auf leisen Pfoten an einem Zaun entlanghuscht.
6
Wir schrieben uns nicht häufig, nur etwa alle zwei Wochen. Dafür war jeder Brief für sich genommen ziemlich lang. Und insgesamt gesehen, waren deine um einiges länger als meine, glaube ich. Natürlich hatte die Länge der Briefe keine besondere Bedeutung für unseren Austausch.
Ich habe alle deine Briefe aufbewahrt, allerdings nie einen von meinen kopiert, sodass ich mich nicht mehr an ihren konkreten Inhalt erinnere. Er kann nicht weltbewegend gewesen sein. Meist berichtete ich dir von meinem Alltag und den kleinen Ereignissen um mich herum. Ich schrieb über die Bücher, die ich las, die Musik, die ich hörte, und die Filme, die ich mir ansah. Wahrscheinlich auch über die Schule. Ich war Mitglied im Schwimmclub (dem ich, wiewohl kein begeisterter Schwimmer, beigetreten war, weil es sich einfach nicht vermeiden ließ), also schrieb ich vermutlich auch über das Training. Dir konnte ich ohne Hemmungen schreiben, was ich wollte. So freimütig alles erzählen, was ich dachte und fühlte, dass es an ein Wunder grenzte. Zum ersten Mal in meinem Leben flossen mir die Worte so leicht aus der Feder. Wie gesagt, hatte ich bis dahin geglaubt, nicht schreiben zu können. Ganz gewiss hattest du diese Fähigkeit in mir geweckt. Besonders gefalle dir, sagtest du, der Humor in meinen Briefen, denn das war es wohl, woran es dir in deinem Dasein am meisten mangelte.
»So wie man Vitaminmangel haben kann?«, fragte ich.
»Ja, genau«, sagtest du und nicktest zustimmend.
Ich war hingerissen von dir und dachte unablässig an dich. Im Wachen und gewiss auch in meinen Träumen. Aber in meinen Briefen mäßigte ich mich, so gut ich konnte, um meine Verliebtheit nicht allzu offen zutage treten zu lassen. Ich hatte mir vorgenommen, vor allem über alltägliche, konkrete Dinge zu schreiben. Ich wollte mich damals an das Greifbare halten und es, wo möglich, mit ein wenig Humor würzen. Denn aus irgendeinem Grund fürchtete ich, in eine Sackgasse zu geraten, sollte ich dir von Liebe oder Verliebtheit, also den inneren Regungen meines Herzens, schreiben.
Im Gegensatz zu mir schriebst du statt über konkrete Ereignisse immer über Dinge, die dich im Innersten bewegten. Wovon du geträumt hattest oder auch kurze Geschichten. Einige deiner Träume hinterließen einen tiefen Eindruck bei mir. Häufig waren sie lang, und alle Einzelheiten waren dir noch lebhaft im Gedächtnis. Wie von etwas, das tatsächlich passiert war. Es war beinahe unglaublich für mich.
Ich selbst träumte so gut wie nie, und wenn doch, dann konnte ich mich kaum je an den Inhalt meiner Träume erinnern. Sobald ich morgens aufwachte, zerbarsten sie in tausend Stücke und lösten sich in nichts auf. Auch wenn ich ausnahmsweise einmal so lebhaft träumte, dass ich nachts aufwachte (was höchst selten vorkam), schlief ich sofort wieder ein und erinnerte mich am nächsten Morgen an nichts.
Als ich dir das sagte, erzähltest du mir von dem Notizheft und dem Bleistift, die immer am Kopfende deines Bettes lagen. »Sobald ich aufwache, schreibe ich auf, was ich geträumt habe. Auch wenn ich etwas anderes zu tun habe oder in Eile bin. Besonders wenn ich mitten in der Nacht aus einem lebhaften Traum aufwache, notiere ich mir seinen Inhalt so ausführlich wie möglich, egal, wie müde ich bin. Weil das meist wichtige Träume sind, aus denen ich viele bedeutsame Dinge lernen kann.«
»Was denn für bedeutsame Dinge?«, fragte ich.
»Dinge über mich, die ich nicht wusste«, erwidertest du.
Für dich standen Träume beinahe auf einer Stufe mit Ereignissen in der Wirklichkeit und waren keineswegs etwas, das man vergessen konnte oder das einfach verschwand. Für dich waren deine Träume eine kostbare innere Quelle, aus der du reichlich schöpfen konntest.
»Das ist eine Frage der Übung. Wenn du dir Mühe gibst, schaffst du es bestimmt, dich an die Einzelheiten zu erinnern. Versuch es doch mal. Es würde mich wirklich interessieren, was du träumst.«
Also gut, sagte ich, ich würde es versuchen.
Doch ungeachtet aller Bemühungen (die allerdings nicht so weit gingen, dass ich mir Notizheft und Bleistift ans Kopfende legte) konnte ich einfach kein Interesse für meine Träume aufbringen. Sie waren so verworren und widersprüchlich, dass sie sich meinem Verständnis entzogen. Was darin geschah, war wenig greifbar, und die Szenerie ergab kaum einen Sinn. Mitunter war der Inhalt zu verstörend, um mit jemandem darüber zu sprechen. Viel lieber hörte ich dir zu, wenn du von deinen langen und bunten Träumen erzähltest.
Mitunter kam auch ich in ihnen vor, was mich besonders freute, da ich so – in welcher Form auch immer – Teil deiner Vorstellungswelt war. Und auch dir schienen meine Auftritte in deinen Träumen zu gefallen, auch wenn ich in ihrer Dramaturgie meist nur eine bedeutungslose Nebenrolle spielte.
Ob du vielleicht mitunter zweideutige Träume hattest, über die mit mir zu sprechen dir schwerfiel? So wie ich sie oft hatte (wobei ich manchmal unfreiwillig meine Unterwäsche befleckte)? Jedes Mal, wenn du mir einen Traum erzähltest, fragte ich mich, ob du mir wohl alles sagtest, was du geträumt hattest.
Es hatte den Anschein, dass du mir vieles ehrlich erzähltest. Aber wer weiß schon, was wahr ist und was nicht? Es gibt wohl keinen Menschen, der keine Geheimnisse hat. Wir Menschen brauchen Geheimnisse, um auf dieser Welt zu überleben.
Ist es nicht so?
7
»Wenn es etwas Vollkommenes auf der Welt gibt, dann ist es diese Mauer. Niemand kann sie überwinden oder zerstören«, verkündete der Torwächter.
Auf den ersten Blick wirkte sie nur wie eine alte Backsteinmauer, die beim nächsten Sturm oder Erdbeben leicht zum Einsturz kommen konnte. Wie konnte er so ein Gemäuer als »vollkommen« bezeichnen? Als ich eine Bemerkung dahingehend machte, verzog der Wächter das Gesicht wie einer, der haltlose Beschimpfungen seiner Familie über sich ergehen lassen muss. Er zerrte mich am Ellbogen an die Mauer.
»Schau genau hin, aus der Nähe. Da ist nicht eine Fuge zwischen den Ziegeln. Außerdem ist jeder von ihnen ein bisschen anders. Die einzelnen Ziegel fügen sich so perfekt ineinander, dass nicht einmal ein Haar dazwischenpasst.«
Er hatte recht.
»Hier, kratz mal mit dem Messer daran.« Der Torwächter holte ein Klappmesser aus der Jackentasche, ließ es aufschnappen und gab es mir. Auf den ersten Blick wirkte das Messer abgenutzt, aber seine Klinge war sorgfältig geschärft.
»Ich wette, du kriegst nicht den kleinsten Kratzer hin.«
Er hatte wieder recht.
Die Klinge erzeugte nur ein trockenes Scharren, ohne dass eine Schramme sichtbar wurde.
»Siehst du? Stürme, Erdbeben, Kanonen, nichts kann die Mauer zerstören. Du kannst sie nicht mal ankratzen. Niemand hat das je geschafft, und niemand wird es je schaffen.«
Er legte die Handflächen an die Mauer und sah mich stolz mit eingezogenem Kinn an, als würde er für ein Erinnerungsfoto posieren.
Nichts auf der Welt ist vollkommen, dachte ich. Alles, was eine Form hat, hat unweigerlich eine Schwachstelle oder einen blinden Fleck. Aber ich sprach den Gedanken nicht aus.
»Wer hat die Mauer gebaut?«, fragte ich.
»Niemand«, sagte der Wächter voll unerschütterlicher Überzeugung. »Sie ist seit Anbeginn hier.«
Bis zum Ende der ersten Woche hatte ich einige der von dir ausgewählten alten Träume in die Hand genommen und versucht, sie zu lesen. Aber ich konnte keinen Sinn darin finden. Alles, was ich vernahm, war undeutliches Gemurmel, und sehen konnte ich auch nur verschwommene, bruchstückhafte Bilder. Es war, als würde mir eine Audio- oder Videokassette aus wahllos zusammengeschnittenen Fragmenten rückwärts vorgespielt.
Im Archiv der Bibliothek reihen sich statt Büchern unzählige alte Träume aneinander. Offenbar hat sie so lange niemand berührt, dass sie alle von einer weißen Staubschicht überzogen sind. Die alten Träume haben die Form von Eiern, doch jedes hat eine andere Größe und Farbe. Als wären sie von verschiedenen Tierarten gelegt worden. Allerdings sind sie nicht exakt eiförmig. Als ich sie in die Hand nehme und genau betrachte, erkenne ich, dass die untere Hälfte dicker und schwerer ist als die obere. Diese Unregelmäßigkeit verleiht ihnen einen festen Stand, sodass sie auch ohne Stützen nicht aus den Regalen fallen.
Ihre Oberfläche ist hart und glatt wie polierter Marmor. Allerdings sind sie weniger schwer. Ich weiß nicht, aus welchem Material sie bestehen oder wie stabil sie sind. Ob sie zerbrechen, wenn sie zu Boden fallen? Auf jeden Fall muss ich sehr vorsichtig damit umgehen. Wie mit den Eiern seltener Tiere.
In der Bibliothek steht kein einziges Buch – nicht eines. Gewiss sind die Regale früher voller Bücher gewesen, und die Einwohner der Stadt sind hierhergekommen, um Wissen und Unterhaltung zu finden. Wie in eine normale Stadtbücherei. Ein Hauch dieser Atmosphäre liegt noch in der Luft. Doch offenbar hat man irgendwann alle Bücher aus den Regalen entfernt und stattdessen die alten Träume darin aufgereiht.
Es scheint keine anderen Traumleser in der Stadt zu geben. Im Moment bin ich wohl der einzige. Ob es vor mir schon andere Traumleser gegeben hat? Mag sein. Angesichts der genau ausgearbeiteten und zu befolgenden Regeln und Verfahren für das Traumlesen ist das vermutlich der Fall.
Deine Aufgabe in der Bibliothek ist es, die dort befindlichen alten Träume zu schützen und angemessen zu verwalten. Du hast die zu lesenden Träume auszuwählen und im Register zu vermerken, dass sie gelesen wurden. Außerdem obliegt es dir, die Tür zur Bibliothek vor dem Abend zu öffnen, die Lampen anzuzünden und in der kalten Jahreszeit den Ofen zu heizen. Daher musst du dafür sorgen, dass der Vorrat an Rapsöl und Brennholz nicht ausgeht. Für den Traumleser – also für mich – bereitest du den dunkelgrünen Kräutertee zu, der den Schmerz in meinen Augen lindert und mich beruhigt.
Behutsam wischst du mit einem großen hellen Tuch den weißen Staub von dem alten Traum und legst ihn mir auf den Schreibtisch. Ich setze meine grüne Brille auf und umschließe ihn mit beiden Händen. Nach etwa fünf Minuten erwacht der alte Traum allmählich aus seinem tiefen Schlaf, und seine Oberfläche beginnt schwach zu leuchten. Eine angenehme, natürliche Wärme überträgt sich auf meine Handflächen. Und der Traum spult sich ab. Erst bedächtig, dann mit zunehmendem Eifer, als würde ich die Fäden eines Kokons abwickeln. Die Träume wollen sich mitteilen. Sie müssen geduldig im Regal darauf gewartet haben, aus ihrer Schale zu schlüpfen und sich zu entfalten.
Aber ihre Stimmchen sind zu fein, als dass man sie deutlich hören könnte. Und die Bilder, die sie projizieren, haben nicht genügend Substanz, sie verblassen sogleich, fallen in sich zusammen und verschwinden. Oder vielleicht liegt es gar nicht an ihnen, sondern eher daran, dass meine neuen Augen noch nicht richtig funktionieren. Oder dass meine Fähigkeit als Traumleser nicht ausreicht.
Irgendwann ist es Zeit, die Bibliothek zu schließen. Es gibt nirgends eine Uhr, aber du weißt natürlich, wann es so weit ist.
»Wie geht es? Kommst du gut voran?«
»Es wird langsam besser«, antworte ich. »Aber nach einem Traum bin ich schon todmüde. Vielleicht mache ich etwas falsch?«
»Keine Sorge.« Du bewegst den Schieber und schließt die Lüftung des Ofens. Nachdem du die Lampen gelöscht hast, setzt du dich mir gegenüber an den Tisch und blickst mir ins Gesicht. (Es macht mich nervös, wenn du mich so direkt ansiehst.) »Du brauchst dich nicht zu beeilen. Wir haben hier Zeit im Überfluss.«
Beim Schließen der Bibliothek folgst du stets gewissenhaft dem vorgeschriebenen Ablauf. Mit ernster Miene, ohne Eile und mit sicherer Gelassenheit. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte scheint immer die gleiche zu sein. Während ich dir zusehe, frage ich mich, ob es notwendig ist, die Bibliothek derart gründlich zu sichern. Wer würde in einer ruhigen, friedlichen Stadt wie dieser nachts hier einbrechen, um alte Träume zu stehlen oder zu beschädigen?
»Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich nach Hause bringe?«, wage ich mich vor, als wir am dritten Abend das Gebäude verlassen.
Du wendest dich mir zu und schaust mich mit großen Augen an. In ihrer Schwärze spiegelt sich ein Stern, der hell am Himmel steht. Du scheinst den Sinn meiner Frage nicht zu verstehen. Warum muss er mich nach Hause bringen?
»Ich bin neu in der Stadt und habe außer dir niemanden, mit dem ich reden kann«, erkläre ich. »Wenn möglich, würde ich gern einen Spaziergang machen und mich dabei unterhalten. Außerdem möchte ich dich besser kennenlernen.«
Du überlegst und errötest ein wenig.
»Aber deine Unterkunft liegt in der entgegengesetzten Richtung.«
»Das macht nichts. Ich gehe gern spazieren.«
»Aber was willst du denn über mich wissen?«, fragst du.
»Zum Beispiel, wo du wohnst. Und wer noch dort wohnt. Und wie es kommt, dass du in der Bibliothek arbeitest.«
Du schweigst einen Moment lang.
»Ich wohne nicht weit von hier«, sagst du dann. Mehr nicht. Aber es ist eine Tatsache.
Du trägst eine Art Armeemantel aus grobem blauem Stoff, einen schwarzen Pullover mit Rundhalsausschnitt, der an einigen Stellen ausgefranst ist, und einen etwas zu großen grauen Rock. Alles sieht aus wie die abgelegte Kleidung von jemand anderem. Doch selbst in dieser ärmlichen Aufmachung bist du schön. Während ich neben dir die nächtliche Straße entlanggehe, schnürt es mir das Herz ab, sodass ich kaum Luft bekomme. Du raubst mir den Atem. Wie an jenem Sommerabend, als ich siebzehn war.
»Du sagst, du seist neu in der Stadt. Woher kommst du?«
»Aus einer Stadt weit im Osten«, gebe ich vage zur Antwort. »Einer großen Stadt, die sehr, sehr weit weg ist.«
»Ich kenne keine andere Stadt als diese. Denn ich bin hier geboren und war noch nie außerhalb der Mauer.«
Deine Stimme klingt weich und zärtlich. Alle Worte, die aus deinem Mund kommen, stehen unter dem unermüdlichen Schutz der soliden, acht Meter hohen Mauer.
»Warum bist du eigens von so weit her in unsere Stadt gekommen? Ich begegne zum ersten Mal einem Menschen, der von woanders kommt.«
»Tja, warum?«, gebe ich unverbindlich zurück.
Ich bin den ganzen Weg hierhergekommen, um dich zu sehen, kann ich ja nicht sagen. Dazu ist es zu früh. Vorher muss ich noch viel mehr über die Stadt herausfinden.
Im spärlichen Licht der wenigen Straßenlaternen folgen wir der Uferstraße nach Osten. Wie früher gehen wir Schulter an Schulter. Leise dringt das Rauschen des Flusses an mein Ohr. Aus dem Wäldchen am anderen Ufer ertönt der Schrei eines Nachtvogels.
Du möchtest mehr über die »ferne Stadt im Osten« erfahren, in der ich gelebt habe. Dein Interesse bringt dich mir ein bisschen näher.
»Was ist denn das für eine Stadt?«
Ja, was war das eigentlich für eine Stadt, in der ich noch bis vor nicht allzu langer Zeit gelebt hatte? Unzählige Worte kamen und gingen, überquellend von all der Bedeutung, die in ihnen steckte.
Aber wie viel würdest du verstehen, wenn ich sie dir erklärte? Du bist in dieser stillen wortkargen Stadt geboren und aufgewachsen, die so einfach, friedlich und vollkommen ist. In ihr gibt es keine Elektrizität, kein Gas, bloß eine Turmuhr ohne Zeiger und eine Bibliothek ohne ein einziges Buch darin. Die Worte, die die Menschen sprechen, haben nur eine Bedeutung – ihre ursprüngliche –, und alle Dinge bleiben an ihrem jeweiligen Platz oder in einem Umkreis, in dem man sie sehen kann.
»Wie leben die Menschen in der Stadt, in der du früher gewohnt hast?«
Ich weiß nicht, wie ich dir diese Frage beantworten soll. Ja, wie hatten wir dort eigentlich gelebt?
»Aber ist das Leben in deiner Stadt nicht ganz anders als hier bei uns?«, fragst du. »Worin unterscheidet es sich am meisten? In der Größe der Stadt, in ihrer Organisation oder in der Lebensweise der Menschen?«
Ich sauge die Abendluft tief ein, während ich nach den richtigen Worten suche. Wie drücke ich es am besten aus? »Die Menschen dort leben alle mit ihren Schatten zusammen.«
8
Ja, alle Menschen dort lebten mit ihren Schatten zusammen. Ich und auch du, jeder besaß einen eigenen Schatten.
Ich kann mich noch gut an unsere Schatten erinnern, weiß noch, wie du damals im Frühsommer auf der menschenleeren Straße auf meinen Schatten tratst und ich auf deinen. Schattentreten war ein Spiel, das ich aus meiner Kindheit kannte. Aus welchem Anlass wir damit anfingen, weiß ich nicht, aber damals zeichneten unsere Schatten sich so schwarz, scharf und lebendig auf der frühsommerlichen Straße ab, dass ein Tritt darauf beinahe wehtat. Natürlich war es nur ein harmloses Spiel, aber wir gaben uns redlich Mühe, auf den Schatten des anderen zu treten. Als wäre es ein Akt von großer Tragweite.
Als wir danach allein auf der Böschung saßen, küssten wir uns zum ersten Mal. Nicht dass einer von uns den Anfang gemacht hätte oder wir den Kuss vorher geplant hätten. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern es ergab sich ganz natürlich. Unsere Lippen mussten sich an dieser Stelle treffen, und wir folgten nur dem Strom unserer Herzen. Du hieltest deine Lider geschlossen, während unsere Zungenspitzen sich leicht und zögernd berührten. Ich weiß noch, dass wir danach länger nicht sprachen. Wir fürchteten wohl, das köstliche Gefühl auf unseren Lippen könnte durch ein falsches Wort verloren gehen. Also schwiegen wir. Irgendwann später wollten wir gleichzeitig etwas sagen, sodass wir einander ins Wort fielen. Wir lachten, und unsere Lippen trafen sich erneut.
Ich habe ein Taschentuch von dir. Es ist sehr schlicht, aus einem weißen, gazeartigen Stoff, nur am Rand ist eine kleine gestickte Orchideenblüte. Du hast es mir bei irgendeiner Gelegenheit geliehen. Eigentlich hätte ich es waschen und dir zurückgeben sollen, aber das tat ich nicht. Ich behielt es absichtlich (obwohl ich es dir natürlich zurückgegeben und so getan hätte, als hätte ich es nur vergessen, sobald du mich dazu aufgefordert hättest). Häufig nahm ich es hervor, um das Gefühl, den Stoff in den Händen zu halten, ausgiebig auszukosten. Es war wie eine direkte Verbindung zu dir. Mit geschlossenen Augen rief ich mir ins Gedächtnis, wie ich meine Arme um dich gelegt und dich geküsst hatte. Auch nachdem du irgendwohin verschwunden warst, änderte sich das nicht.
Ich erinnere mich noch gut an einen Traum (oder besser gesagt den Teil eines Traumes), den du mir in einem deiner Briefe geschildert hast. Es war ein langer achtseitiger Brief auf waagerecht liniertem Briefpapier, geschrieben mit dem Füllfederhalter, den du bei dem Aufsatzwettbewerb gewonnen hattest, wie üblich in türkisblauer Tinte. Wie einer unausgesprochenen Vereinbarung folgend, schrieben wir immer mit diesen Füllfederhaltern. Für uns waren die nicht einmal besonders teuren Füller ein wertvolles Andenken, ein Schatz, der uns verband.
Die Tinte, die ich verwendete, war schwarz. Tiefschwarz wie dein Haar. True Black.
»Ich schreibe dir, was ich letzte Nacht geträumt habe. In meinem Traum kamst du auch kurz vor«, begann dein Brief.
Ich schreibe dir, was ich letzte Nacht geträumt habe.
In meinem Traum kamst du auch kurz vor. Tut mir leid, dass du keine besonders wichtige Rolle darin gespielt hast, aber so sind Träume eben, da kann man nichts machen. Denn ich erschaffe sie nicht selbst, sondern bekomme sie – sieh da – spontan von jemand anderem und habe (vermutlich) nicht die Freiheit, ihren Inhalt nach meinem Gutdünken zu ändern. Außerdem sind in allen Theaterstücken oder Filmen die Nebenfiguren immer sehr wichtig. Der Eindruck eines Stücks oder eines Films kann je nachdem, welche Nebenfiguren auftreten, sehr unterschiedlich sein. Also hab Geduld, auch wenn du nicht die Hauptrolle spielst, und arbeite auf eine Art Oscar für den besten Nebendarsteller hin.
Jedenfalls hatte ich, als ich aufwachte, Herzklopfen [das Wort hattest du dick mit Bleistift unterstrichen]. Wieder in der Wirklichkeit angekommen, hatte ich nämlich das Gefühl, du stündest direkt neben mir. Interessanter wäre es gewesen, wenn du wirklich da gestanden hättest … Haha, nur ein Scherz.
Wie immer habe ich den Traum sofort detailliert (schreibt man das so?) mit meinem kleinen Bleistift in das Notizheft an meinem Bett eingetragen. Das tue ich immer als Erstes, wenn ich aufwache. Egal ob morgens oder mitten in der Nacht, ob ich schlafwandle oder in Eile bin, ich halte meine Träume, so genau es mein Gedächtnis hergibt, in dem Notizheft fest. Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt (ein paarmal habe ich es versucht, aber nie länger als eine Woche durchgehalten), aber meine Träume schreibe ich immer auf, ohne es einmal zu versäumen. Dass ich kein Tagebuch führe, aber grundsätzlich meine Träume aufschreibe, klingt vielleicht, als würde ich den Ereignissen in ihnen größere Bedeutung beimessen als meinem wirklichen Alltag.
Eigentlich empfinde ich das aber gar nicht so. Selbstverständlich unterscheidet sich das, was sich im Traum abspielt, völlig von dem, was in meinem Alltag passiert. Es ist, als würde man eine U-Bahn mit einem Luftballon vergleichen. Und ich sitze, wie alle anderen auch, unweigerlich in meinem Alltag fest und friste gefangen auf der Erdoberfläche mein armseliges Dasein. Niemand kann der Schwerkraft entkommen, ganz gleich, wie reich oder mächtig er ist.
Aber wenn ich mich unter meiner Bettdecke verkrieche und schlafe, ist die »Traumwelt«, die mir dann erscheint, ganz real und mitunter (aus irgendeinem Grund mag ich das Wort »mitunter«) realer als mein Alltag. Außerdem sind die Ereignisse, die sich dort entfalten, so gut wie unvorhersehbar und spektakulär. Und folglich kann ich mitunter nicht mehr unterscheiden, was was ist. Und ich frage mich, ob ich etwas wirklich erlebt oder nur geträumt habe. Geht dir das nicht auch manchmal so? Dass du nicht mehr klar zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kannst? Wahrscheinlich habe ich eine weit stärkere Neigung dazu als die Menschen in meiner Umgebung (so stark, dass die Nadel eines Messgeräts über den Anschlag hinausschnellen würde). Vielleicht ist das angeboren.
Ich habe es erst bemerkt, als ich in die Grundschule kam. Wenn ich mit meinen Schulfreundinnen über meine Träume sprechen wollte, zeigte kaum jemand ein Interesse daran. Keine von ihnen nahm ihre Träume so ernst wie ich, geschweige denn, dass sie darüber reden wollten. Außerdem war das, was die anderen träumten – falls sie es mir erzählten –, meistens nicht so bunt, beklemmend und unmittelbar. Warum, weiß ich nicht. Also gab ich es auf, mit meinen Schulfreundinnen über meine Träume zu sprechen. Auch mit meinen Eltern rede ich nicht darüber (allerdings rede ich, ehrlich gesagt, wenn es sich vermeiden lässt, überhaupt nicht mit ihnen). Stattdessen liegen Notizheft und Bleistift am Kopfende von meinem Bett. Im Laufe der Jahre ist das Heft zu meinem besten Freund und unentbehrlich für mich geworden. Wahrscheinlich ist das unerheblich, aber ich finde, seine Träume kann man am besten mit einem kurzen Bleistift aufschreiben. Er braucht nicht länger als acht Zentimeter lang zu sein. Am besten, man spitzt abends schon ein paar davon mit dem Messer an. Neue, noch lange Bleistifte sind nicht geeignet! Warum? Warum ich meine Träume nur mit einem kurzen Bleistift notiere? Schon komisch, wenn ich darüber nachdenke. Es ist ein bisschen wie mit dem Tagebuch von Anne Frank. Das Notizheft ist mein einziger Freund. Natürlich lebe ich nicht umzingelt von Nazisoldaten in einem winzigen Versteck. Immerhin tragen die Leute um mich herum keine Armbinden mit Hakenkreuzen.
Jedenfalls gab es dann diesen Aufsatzwettbewerb, und bei der Preisverleihung habe ich dich kennengelernt. Das war mit das Schönste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Nicht der Wettbewerb natürlich, sondern dich kennenzulernen! Und du hast dich für meine Träume interessiert und mir aufmerksam zugehört. Das war das Allerschönste. Es war fast das erste Mal in meinem Leben, dass ich darüber reden konnte, so viel ich wollte, und jemand mir aufmerksam zuhörte. Echt!
Verwende ich eigentlich das Wort »fast« zu häufig? Fast kommt es mir so vor. Manchmal verwende ich unentwegt – ich kann mir das Kanji für »unentwegt« einfach nicht merken – das gleiche Wort. Ich muss aufpassen, noch einmal gründlich durchlesen, was ich geschrieben habe, und an meinen Sätzen feilen (wieder kann ich das Kanji nicht schreiben), aber wenn ich noch mal lese, was ich geschrieben habe, nervt es mich so, dass ich es am liebsten zerreißen und wegschmeißen möchte. Echt!
Ach so, ich wollte ja von meinem Traum erzählen. Den muss ich dir wirklich erzählen. Immer wenn ich anfange zu schreiben, schweife ich sofort ab und finde nur schwer zu meinem eigentlichen Thema zurück. Eine meiner Schwächen. Was ist übrigens der Unterschied zwischen »Schwäche« und »Makel«? Ist in meinem Fall »Schwäche« richtig? Aber egal, es ist ja fast [mit Bleistift unterstrichen] das Gleiche. Aber zurück zum Thema. Also, mein Traum von letzter Nacht.
In diesem Traum bin ich anfangs nackt. Splitternackt. Kennst du den Ausdruck »splitterfasernackt«? Ich fand ihn immer etwas übertrieben, aber dann habe ich genau hingesehen und bemerkt, dass ich tatsächlich keine einzige Faser am Leib hatte. Vielleicht ein paar Fusseln am Rücken, wo ich es nicht sehen konnte, aber das ist ja egal. Und ich sitze in einer länglichen Badewanne. In so einer klassischen weißen im westlichen Stil. Vielleicht eine mit so niedlichen Tatzen. Aber es ist kein Wasser darin. Ich liege also nackt in einer leeren Badewanne.
Aber als ich mich genauer anschaue, merke ich, dass es nicht mein Körper ist. Die Brüste sind zu groß. Eigentlich wünsche ich mir schon länger größere Brüste, aber als ich nun tatsächlich welche habe, fühlt es sich unnatürlich und unangenehm an. Irgendwie seltsam. Als wäre ich gar nicht ich. Vor allem sind sie schwer, und ich kann nicht sehen, was unterhalb davon ist. Auch die Brustwarzen kommen mir zu groß vor. Ich glaube, wenn ich so große Brüste hätte, würde mich ihr Gewackel beim Laufen oder so stören. Wahrscheinlich war es besser, als ich die kleineren hatte, denke ich.
Dann fällt mir auf, dass mein Bauch sich wölbt. Aber nicht, weil ich dick bin. Mein übriger Körper ist schlank. Nur mein Bauch ist angeschwollen wie ein Ballon. Mir wird bewusst, dass ich schwanger bin. In meinem Bauch ist ein Baby. Der Wölbung nach zu urteilen bin ich ungefähr im siebten Monat oder so.
Was glaubst du, war mein erster Gedanke?
Ich überlegte, was ich anziehen sollte. Meine Brüste waren so groß und mein Bauch so dick, dass ich nicht wusste, was ich anziehen sollte. Schließlich war ich nackt und musste mich bedecken. Diese Vorstellung beunruhigte mich sehr. Ich konnte doch nicht nackt durch die Stadt laufen.